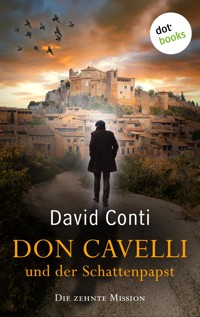1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Don Cavelli
- Sprache: Deutsch
Wem ist im Vatikan noch zu trauen? Der fesselnde Kriminalroman »Don Cavelli und die Stille Stadt« von Erfolgsautor David Conti als eBook bei dotbooks. Auf dem Petersplatz werden die Proteste von Erzkonservativen immer lauter: Die Kirche muss endlich zur alten Ordnung zurückkehren! Gleichzeitig betritt der älteste Ritterorden der Welt erneut das Spielfeld der Macht – was plant der Großmeister der Malteser, und worauf bereitet sich in einer Villa am Comer See der Enkel des Diktators Mussolini vor? Geschichtsprofessor und Vatikanbewohner Don Cavelli ahnt wie so viele andere noch nichts von der dunklen Verbindung dieser Ereignisse – einzig die Journalistin Vera Ciola ist überzeugt, dass sich auf der Insel Malta eine Verschwörung zusammenbraut, die die Gesetze der Welt neu ordnen soll. Niemand außer Cavelli kann ihr bei den brisanten Nachforschungen helfen … doch immer mehr beschleicht ihn die eiskalte Angst, dass manche Türen besser verschlossen geblieben wären! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der actiongeladene Vatikan-Thriller »Don Cavelli und die Stille Stadt« von David Conti ist der siebte Band der Bestsellerreihe um seinen außergewöhnlichen Ermittler, in der alle Krimis unabhängig voneinander gelesen werden können. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Auf dem Petersplatz werden die Proteste von Erzkonservativen immer lauter: Die Kirche muss endlich zur alten Ordnung zurückkehren! Gleichzeitig betritt der älteste Ritterorden der Welt erneut das Spielfeld der Macht – was plant der Großmeister der Malteser, und worauf bereitet sich in einer Villa am Comer See der Enkel des Diktators Mussolini vor? Geschichtsprofessor und Vatikanbewohner Don Cavelli ahnt wie so viele andere noch nichts von der dunklen Verbindung dieser Ereignisse – einzig die Journalistin Vera Ciola ist überzeugt, dass sich auf der Insel Malta eine Verschwörung zusammenbraut, die die Gesetze der Welt neu ordnen soll. Niemand außer Cavelli kann ihr bei den brisanten Nachforschungen helfen … doch immer mehr beschleicht ihn die eiskalte Angst, dass manche Türen besser verschlossen geblieben wären!
Über den Autor:
David Conti wurde 1964 in Rom geboren und verbrachte dort – unterbrochen von einem mehrjährigen Aufenthalt in München – seine Kindheit und Jugend. Nach einem Studium der Theologie, Geschichte und Germanistik in Perugia, Yale und Tübingen, war er mehrere Jahrzehnte lang in verantwortlicher Position bei einer internationalen Institution in Rom tätig. Seit seinem beruflichen Ausscheiden aus dieser, verbringt er seine Zeit mit Reisen und dem Schreiben der »Don Cavelli«-Reihe. Er lebt abwechselnd in Castel Gandolfo, Zürich und Santa Barbara.
In der »Don Cavelli«-Reihe erschienen bei dotbooks bisher:
»Don Cavelli und der tote Kardinal – Die erste Mission«
»Don Cavelli und der letzte Papst – Die zweite Mission«
»Don Cavelli und die Hand Gottes – Die dritte Mission«
»Don Cavelli und das Sizilianische Gebet – Die vierte Mission«
»Don Cavelli und der Apostel des Teufels – Die fünfte Mission«
»Don Cavelli und die Wege des Herrn – Die sechste Mission«
»Don Cavelli und die Stille Stadt – Die siebte Mission«
Alle Romane sind sowohl als eBook- als auch Printausgaben erhältlich. Weitere Bände sind in Vorbereitung.
***
Originalausgabe November 2022
Copyright © der Originalausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-528-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Don Cavelli 7« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Conti
Don Cavelli und die Stille Stadt
Die siebte Mission
dotbooks.
»Ich glaube an den hohen Duce,
Schöpfer der Schwarzhemden –
und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Beschützer.
Unser Erlöser wurde empfangen
von einer guten Lehrerin
und einem fleißigen Schmied...«
Aus einem italienischen Schulgebet der dreißiger Jahre
Prolog
Es war am Freitag, dem 18. Mai 1565, als jene Ereignisse ihren Ausgang nahmen, die Malta zur berühmtesten Insel des Mittelmeers machen sollten. Mit Entsetzen sahen die Wachen der beiden maltesischen Forts St. Elmo und St. Angelo, wie sich der Horizont verdunkelte, als die größte Seestreitmacht, welche die Welt je gesehen hatte, auf die Küste Maltas zuhielt. Es waren mindestens vierzigtausend Mann auf zweihundert Schiffen, die der Herrscher in Istanbul, Sultan Süleyman der Prächtige, entsandt hatte. Süleymans Bemühungen, ein Weltreich aufzubauen, waren 1529 vor Wien gescheitert, doch ihm gehörten bereits große Teile Ungarns und Persiens, der arabischen Halbinsel, Nordafrikas, die gesamte Balkanhalbinsel und Mesopotamien. Nun hatte er entschieden, den wichtigsten Brückenkopf für die Eroberung Südeuropas einzunehmen: Malta.
Man würde leichtes Spiel haben, so hatte man in Konstantinopel angenommen, denn den vierzigtausend osmanischen Soldaten standen lediglich siebenhundertfünfzig Ordensritter des Johanniterordens, sechshundert spanische Soldaten und achttausend maltesische Kämpfer gegenüber. Doch man hatte nicht mit dem unerschütterlichen Heldenmut der Ordensritter gerechnet.
Angeführt wurden sie von dem bereits siebzigjährigen Ordensgroßmeister Jean de la Valette-Parisot – nach ihm wurde später Maltas Hauptstadt Valletta benannt – einem Mann von unbeugsamer Charakterstärke. 1541 war er bei einer Seeschlacht von den Mohammedanern gefangen genommen worden und ein Jahr lang Galeerensklave gewesen. Er hatte nur durch pure Willenskraft überlebt. Danach hatte er sich bis zum Flottenkommandeur hochgearbeitet. 1557 wurde er zum Großmeister des Johanniterordens ernannt. Da er mit einem Angriff der Osmanen rechnete, hatte er unverzüglich damit begonnen, Malta zur Festung ausbauen zu lassen. Eine Vorgehensweise, die sich nun als äußerst weise und vorausschauend herausstellen sollte.
Der Krieg erwies sich als ein Inferno von Danteschen Ausmaßen. Wochenlang feuerten die osmanischen Truppen täglich sechstausend bis siebentausend Kanonenkugeln gegen das Fort St. Elmo. Zusätzlich versuchten Mineure, wie auch schon vor Wien, die Mauer durch Unterhöhlung zum Einsturz zu bringen. Von den hundertfünfzig Ordensrittern in St. Elmo überlebten nur neun. Der osmanische Kommandant ließ sie kreuzigen. La Valette ließ im Gegenzug die Köpfe türkischer Gefangener in Kanonen laden und auf die Feinde abfeuern. Immer wieder warf er sich selbst an vorderster Front in die Schlacht, um die Moral aufrecht zu erhalten. Für die Ritter galten zwei Regeln: Wer noch gehen kann, gilt als unverletzt und Der Tod ist jeder anderen Handlung vorzuziehen. Manche Ritter, die sich kaum noch aufrecht halten konnten, ließen sich auf Stühlen zur Schlacht tragen.
Anfang September traf ein Heer von achttausend Mann aus Sizilien zu ihrer Unterstützung ein. Die Osmanen, von der Hitze Maltas, der Ruhr und riesigen Verlusten geschwächt und – zweitausend Kilometer von ihrer Heimat entfernt – am Ende ihrer Vorräte, überschätzten die Heeresstärke der Sizilianer und zogen ab. Vierundzwanzigtausend ihrer Leute waren gefallen.
Auf maltesischer Seite waren in den vier Monaten der Belagerung zehntausend Menschen umgekommen, darunter 250 Ordensritter. Städte und Burgen waren völlig zerstört.
Dennoch war es die größte Niederlage Süleymans des Prächtigen. Er war von den »Söhnen Satans« besiegt worden. In unbändigem Zorn befahl er, eine neue Expedition für das nächstes Jahr vorzubereiten. »Ich werde sie selbst gegen diese verfluchte Insel führen. Und ich schwöre bei den Gebeinen meiner Väter – möge Allah ihre Gräber erleuchten – dass ich keinen von ihnen verschonen werde.« Doch so weit kam es nicht mehr. Ein Jahr später war Süleyman tot.
Die Osmanen versuchten nie wieder, Europa auf dem Seeweg zu erobern. Von Papst Pius IV. erhielt der Johanniterorden – der sich später Malteserorden nannte – den Ehrentitel »Schild der Christenheit« und noch zweihundert Jahre danach schrieb der Philosoph und Dichter Voltaire: »Nichts ist so berühmt wie die Belagerung Maltas.«
Die winzige Insel Malta hatte unter Führung der katholischen Malteserritter geradezu Übermenschliches geleistet. Sie hatten das größte Reich Europas besiegt und damit das Abendland gerettet.
Es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein ...
Erstes Buch
I
Er hatte sich noch immer nicht daran gewöhnt und er würde es auch niemals tun. Wann immer er, im Fond seines Rolls Royce Phantom VI sitzend, den bewussten Straßenabschnitt zwischen Musso und Dongo – unweit von seiner Villa am Comer See – passierte, lief Amilcare ein kalter Schauder über den Rücken und er bekreuzigte sich. Am 27. April 1945 war sein Großvater hier an einer Straßensperre von kommunistischen Partisanen angehalten und gefangengenommen worden. Am Tag darauf hatte man ihn erschossen. Doch davon hatte Amilcare erst im Jahre 2000 erfahren. Sein Vater war ein überaus verschlossener Mann gewesen, der niemals über seine Eltern redete, und seine Mutter respektierte diese Entscheidung und schwieg ebenfalls. Als Amilcare fragte, warum er diesen seltsamen Vornamen habe, erklärte man ihm, dass er nach dem Komponisten Amilcare Ponchielli benannt sei, dem Komponisten der Oper La Gioconda, und er hatte keinen Anlass gesehen, etwas anderes zu glauben. Mehr noch, es hatte ihn inspiriert. Er wollte ebenfalls Komponist werden. Von klein auf lernte er, Klavier und Violine zu spielen. Später besuchte er das Musikkonservatorium Giuseppe Verdi in Mailand, wo er mit Auszeichnung abschloss. Er schien eine glänzende Karriere als Musiker vor sich zu haben. Anfang 1999 war sein Vater für alle völlig überraschend einem schweren Herzinfarkt erlegen, aber es hatte noch bis zum ersten Januar 2000 gedauert, bis seine Mutter, wohl animiert durch dieses magische Datum, das als Beginn eines neuen Jahrtausends einen Abschluss für alles Vergangene zu sein schien, mit der Wahrheit herausrückte. Er war keineswegs nach Ponchielli benannt, sondern nach seinem Großvater: Benito Amilcare Andrea Mussolini, dem Duce, Freund und Vorbild Hitlers und elf Jahre lang Diktator Italiens. Amilcare verstand nicht, warum ihm seine Eltern die Wahrheit über seine Abstammung all die Jahre vorenthalten hatten. Lag es daran, dass sein Vater nicht aus der Ehe Mussolinis mit Rachele Guidi stammte, sondern aus der Liebschaft mit der Favoritin seiner vierhundert Geliebten, Clara Petacci, die am Ende zusammen mit ihm in den Tod gegangen war? Oder lag es an Mussolinis Taten? Amilcare hatte damals über ihn nur gewusst, was er in der Schule gelernt hatte, und das war nichts Gutes. Er hatte sich allerdings auch nie besonders für diese historische Figur interessiert, die ihm genauso weit entfernt schien wie Dschingis Khan oder Abraham Lincoln. Wenn er überhaupt sowas wie ein Gefühl ihm gegenüber gehabt hätte, wäre es Verachtung gewesen. Der Mann hatte Italien in eine faschistische Diktatur und in den Zweiten Weltkrieg geführt. Unzählige Tote gingen auf sein Konto. Doch nun begann sich Amilcare mehr für diesen Mann, der sein Großvater war, zu interessieren. War das, was man ihm beigebracht hatte, wirklich schon alles gewesen? Er begann, jedes Buch und jede Dokumentation über ihn zu studieren, und tatsächlich: Es gab auch eine andere Seite. Mussolini hatte höchst erfolgreich die Mafia bekämpft und in die Bedeutungslosigkeit getrieben. Er hatte den Achtstundentag eingeführt, die Korruption der Behörden beendet, tausendsiebenhundert Ferienlager für Kinder errichten lassen, siebzig Millionen für Familienzuschüsse ausgegeben und vieles mehr. Je mehr Amilcare über seinen Großvater erfuhr, desto stolzer wurde er auf ihn. Es war ihm eine Ehre, sich zu ihm zu bekennen. Auch den Nachnamen seines Großvaters nahm er schließlich wieder an. Es war die beste Entscheidung seines Lebens gewesen. Zwar wandten sich fast alle seine bisherigen Freunde von ihm ab, aber dafür öffneten sich plötzlich manche Türen, die den meisten verschlossen waren. Er gewann viele neue Freunde. Einflussreiche Freunde, die ihn mit einer Sicht auf die Welt bekannt machten, die so ganz anders war als alles, was man in den Zeitungen las. Dies waren seine wahren Freunde, das spürte er in seinem Blut.
II
Don Cavellis Blick glitt über die etwa sechzig Studenten, die sich an diesem Morgen im Hörsaal IV der Sapienza, Roms ältester Universität, eingefunden hatten. Es war sein einunddreißigstes Semester als Professor für die Geschichte des Papsttums. Wer sich für dieses Thema interessierte, tat gut daran, sich bei Cavelli einzuschreiben. Nicht nur, weil für dieses Fachgebiet auf der ganzen Welt nur dieser eine Lehrstuhl existierte, sondern auch, weil es niemanden gab, der mehr dazu prädestiniert gewesen wäre, es zu unterrichten. Die Cavellis lebten seit 1513 im Vatikan. Die genauen Umstände ließen sich nach einem halben Jahrtausend nicht mehr rekonstruieren, bekannt war nur, dass ein gewisser Capitano Umberto Cavelli seiner Heiligkeit Julius II. kurz vor dessen Tod einen Gefallen getan hatte. Einen Gefallen von so monumentaler Bedeutung, dass der dankbare Papst verfügt hatte, die Familie Cavelli Liberatus ab ullis calamitatibus, also frei von allen Nöten zu stellen, und dies bis zum Jüngsten Tag, was wortwörtlich gemeint war. Dies beinhaltete nicht nur eine märchenhafte Summe Goldes, die im Laufe von über fünfhundert Jahren zu einem so großen Vermögen angewachsen war, dass kein Cavelli jemals wieder Geldsorgen haben würde, sondern auch das Wohnrecht im Vatikan sowie eine Reihe weiterer Privilegien. Die Cavellis waren die einzigen Vatikanbewohner, die dort keinerlei Funktion ausübten, ein Umstand, der manchen Klerikalen ein Dorn im Auge war. Aus diesem Grund war es eine jahrhundertelange Tradition, dass der jeweils älteste Sohn der Familie einen Vornamen erhielt, der sich als Don abkürzen ließ, was schlecht informierten Personen suggerierte, dass es sich bei ihm um einen Priester handelte. Cavellis eigentlicher – von ihm selbst gehasster – Vorname lautete daher Donato. Sein Vater hatte Spiridon geheißen.
Seit über zwanzig Jahren schrieb Cavelli nun an einer vollständigen Geschichte des Papsttums. Natürlich existierten bereits zahlreiche Werke zu diesem Thema, auch gute, aber keiner ihrer Autoren hatte im Vatikan gelebt und unbeschränkten Zugang zum Päpstlichen Geheimarchiv gehabt, und zwar selbst zu den Teilen, die – bis siebzig Jahre nach dem Tod eines Papstes – komplett gesperrt waren, was alle Päpste vom 1958 verstorbenen Pius XII. bis heute betraf. Das verschaffte Cavelli einen Einblick, der einmalig war. Und natürlich war es diese besondere Position und die Existenz einiger schlecht recherchierter, uralter, aber im Internet leider immer noch präsenter Zeitungsartikel über den »geheimnisvollen Vatikanbewohner«, die – da machte er sich gar keine Illusionen – auch in diesem Semester einen Großteil seiner Studenten veranlasst hatte, sich in seinen Kurs einzuschreiben. Die Studentenzahlen in seinen Seminaren waren in den letzten zwanzig Jahren kontinuierlich zurückgegangen, obwohl Cavelli in letzter Zeit wieder ein zunehmendes Interesse wahrzunehmen glaubte und für die Zukunft mit einer Fortsetzung dieses Trends rechnete. Das Pendel der Geschichte wanderte eben unaufhaltsam hin und her. Alles war in Auflösung begriffen und alte Gewissheiten galten immer weniger, es war nur menschlich, dass immer mehr Menschen nach etwas suchten, an das sie glauben konnten.
Natürlich gab es in jedem seiner Seminare neben vielen Studenten, denen es an elementarster Allgemeinbildung fehlte – Cavelli erzählte auf Partys immer gern von dem jungen Mann, der auf Cavellis Frage nach Martin Luthers berühmtestem Ausspruch mit »I have a dream« geantwortet hatte – auch jedes Mal mindestens einen, der glaubte, sich durch Fundamentalopposition hervortun zu müssen. Nach Cavellis Erfahrung gab es zwei Möglichkeiten, wie das ausgehen konnte. Entweder schmissen diese Studenten das Seminar spätestens nach der dritten Stunde oder sie ließen sich von der auch heute noch vorhandenen Relevanz des Themas überzeugen. »Wir begegnen den christlichen Ursprüngen auch in unserem heutigen Leben auf Schritt und Tritt«, hatte Cavelli soeben ausgeführt. »Sie bilden das Fundament von fast allem. Sie sind so selbstverständlich, dass wir sie meist gar nicht mehr bemerken. Dabei ist es nicht überall so offensichtlich wie bei unserer Zeitrechnung, die sich auch nach über zweitausend Jahren immer noch auf die Geburt Christi bezieht, wobei diese Zahl historisch nicht ganz korrekt ist und nach heutigem Wissensstand um einige Jahre differiert. Schon etwas weniger bekannt ist, dass der von Julius Caesar eingeführte Julianische Kalender im Jahre 1582 von Papst Gregor XIII. abgeschafft und durch den Gregorianischen Kalender ersetzt wurde, durch den das Schaltjahr eingeführt wurde. Dies war nötig geworden, da sich eine kleine Ungenauigkeit im Julianischen Kalender im Laufe der Jahrhunderte mittlerweile zu einer Abweichung von zehn Tagen aufaddiert hatte. Der Papst verfügte, dass auf den vierten Oktober 1582 unmittelbar der fünfzehnte Oktober folgte. Danach stimmte der Kalender wieder. Zumindest für die Katholiken. Die Protestanten machten ihrem Namen alle Ehre und weigerten sich hundertfünfzig Jahre lang, bei etwas mitzumachen, das aus dem Vatikan stammte. Dieser Kalender gilt bis heute. Die astronomischen Beobachtungen dazu wurden im Vatikan, im sogenannten Turm der Winde, durchgeführt, der noch existiert und baulich zu den Vatikanischen Museen gehört. Aber wie gesagt, das ist ein eher offensichtliches Beispiel, aber haben Sie sich schon einmal gefragt, woher unsere Weltkarten ihre Anordnung haben? Alaska links oben und Neuseeland rechts unten? Da die Erde ja eine Kugel ist, ist diese Anordnung nur eine von vielen Möglichkeiten. Genauso gut könnte auch Afrika links oben sein und die anderen Kontinente entsprechend verschoben. Aber es gab damals einen sehr guten Grund für diese Aufteilung. Bei dieser Art der Darstellung liegt nämlich im Mittelpunkt der Weltkarte der Ort, den man im Christentum damals als den wichtigsten überhaupt erachtete: Jerusalem.«
»Das sind alles uralte Traditionen«, meldete sich ein Student mit asymmetrischer Frisur zu Wort, »aber werden die im Computerzeitalter nicht zunehmend bedeutungslos?«
»Mag sein« antwortete Cavelli, »dennoch ist es wichtig zu wissen, auf welchen Fundamenten man aufbaut, und um auf Ihr Beispiel einzugehen: Schon im Mittelalter gab es ein Gerät mit dem Namen Computum, das zur Berechnung diente. Zur Berechnung der bereits geleisteten Gebete. Die meisten kennen es unter dem Namen Rosenkranz.«
Der Student verzog geringschätzig die Mundwinkel. »Bei allem Respekt, der Rosenkranz ist ein sehr primitives Werkzeug, der moderne Computer, besonders in Verbindung mit dem Internet, ist einfach grandios.«
»Stimmt, aber wissen Sie auch, was das Wort grandios bedeutet?« Der Student schüttelte misstrauisch den Kopf.
»Es ist spanisch«, fuhr Cavelli fort. »Gran Dios heißt nichts anderes als Großer Gott.«
III
Der Mann, der eine Aluminiumprothese trug, wo sich eigentlich sein linker Unterschenkel hätte befinden müssen, lag auf dem dicken Perserteppich, der den Marmorboden seines riesigen Arbeitszimmers bedeckte, und wand sich in unkontrollierten Zuckungen. Es war einer von den schwächeren epileptischen Anfällen, einer von jenen, bei dem er alles bei vollem Bewusstsein erlebte. Er hatte auch schon andere erlebt. Aber es völlig klar miterleben zu müssen war schlimmer. Die Hilflosigkeit. Die schreckliche Angst. Er musste jederzeit damit rechnen, dass es passierte, und er hatte einen Großteil seines Lebens daraufhin ausgerichtet. Am meisten Angst hatte er davor, beim Stürzen mit dem Kopf auf einen harten Gegenstand aufzuschlagen und so zu Tode zu kommen. Seine Dienstwohnung und sein Arbeitszimmer waren so verändert worden, dass es keine scharfen oder spitzen Kanten mehr gab. Wann immer es ging, vermied er es zu stehen und setzte sich. Es waren unendlich viele Maßnahmen, aber oft nützten sie nichts. Die Anfälle kamen fast immer im falschen Moment, fast immer gerade dann, wenn er sie am wenigsten gebrauchen konnte. Was hatte es nur mit dieser Krankheit auf sich, dass sie so viele der ganz Großen dieser Welt befallen hatte? Von Alexander dem Großen über Hannibal, Julius Caesar, Leonardo da Vinci, Moliere, Napoleon, die Liste war endlos. Es war die Heimsuchung der politischen Visionäre und Anführer, der begnadeten Künstler und Wissenschaftler. Papst Rodrigo Borgia hatte es sogar verstanden, daraus Kapital zu schlagen, indem er behauptete, während seiner Krampfanfälle Visionen von Gott zu empfangen. Wer wollte ihm das Gegenteil beweisen?
Doch der Mann mit der Aluminiumprothese empfand einfach nur panische Angst. Darum hatte er sich abgesichert. Doppelt. Zum einen trug er, außer beim Baden, ständig eine dieser modernen Uhren, die den Herzschlag und andere Vitalfunktionen überwachten. Wenn er stürzte, ging fast sofort ein Signal an seinen Diener und weitere Angestellte. Mit Grauen hatte er eines Tages von den Umständen gelesen, unter denen der sowjetische Diktator Josef Stalin ums Leben gekommen war. Stalin hatte in seinen Privatgemächern einen Schlaganfall erlitten und bis zum Mittag des folgenden Tages auf dem Boden gelegen, da keiner seiner zahlreichen Bediensteten es gewagt hatte, die Tür eigenmächtig zu öffnen. Stalins Terror, der jeden Sowjetbürger fürchten lassen musste, schon für ein falsches Wort hingerichtet zu werden, hatte sich schließlich gegen ihn selbst gewendet. Die Furcht, die er verbreitet hatte, war sein eigener Untergang gewesen. Das würde dem Mann mit der Prothese nicht passieren. Auf seinem Territorium hatte er die gleiche Position inne wie einst Stalin. Er war das Oberhaupt, gegen sein Wort gab es keine Einspruchsmöglichkeiten, jeder hatte ihm zu gehorchen. Aber anders als Stalin behandelte er seine Untergebenen mit Güte und Nachsicht. Niemand fürchtete ihn, im Gegenteil, man liebte und respektierte ihn. Und das würde sich auch niemals ändern. Sein Amt war auf Lebenszeit verliehen. Bei seinem Eintritt in diese Institution – sehr viel weiter unten auf der Karriereleiter – hatte er drei Dinge schwören müssen. Keuschheit, Armut und Gehorsam. Die Keuschheit war für ihn nie ein Problem gewesen. Was die Armut anging, hatte er sein ganzes Vermögen der Institution gespendet; allerdings benötigte er auch kein Geld mehr. Finanziell hatte er ausgesorgt. Bis an sein Lebensende würde er in Palästen leben, zu Galadiners eingeladen und von einer vielköpfigen Dienerschaft umsorgt werden. Das stand ihm zu. Luxuriöse historische Ferienresidenzen auf Zypern und am Trasimenischen See standen jederzeit für ihn bereit. Blieb nur der Gehorsam. Aber auch damit hatte er kein Problem. Es war leicht, gehorsam zu sein, wenn es niemanden mehr gab, dem man gehorsam sein konnte. Mit Ausnahme vielleicht einer Person. Ihr musste er gehorchen, wenn es Meinungsverschiedenheiten gab. Bislang hatte er – wie auch seine Vorgänger – solche zu vermeiden gewusst. Doch diese Zeit war nun vorbei. Sein ganzes Leben war ein einziger Kampf gewesen. Die schrecklichen Jahre als Schüler in einem englischen Internat, seine Militärzeit, während der er bei einem Manöverunfall den linken Unterschenkel verloren hatte und seitdem mit der Aluminiumprothese leben musste, und auch seine aufopferungsvolle Arbeit für die Schwerkranken in Lourdes hatte an ihm gezehrt. Doch selbst jetzt, während er sich so unwürdig auf dem Marmorfußboden wand, hilflos wie ein Kleinkind, war ihm vollkommen bewusst, dass er unmittelbar vor dem größten Kampf seines Lebens stand.
IV
Unter normalen Umständen hätte Kardinal Balistreri an diesem Morgen die Demonstranten auf dem Petersplatz keines Blickes gewürdigt. Aber die Umstände waren eben nicht normal. Zum Glück. Fast überall auf der Welt wuchs die Zahl der Katholiken unaufhaltsam. Allein in Amerika waren es im letzten Jahr fast sieben Millionen gewesen. In Afrika über dreiunddreißig Millionen und in Asien sogar über vierzig Millionen. Nur in Europa gingen die Zahlen zurück, im vergangenen Jahr fast um dreihunderttausend. Und die Europäer, die geblieben waren, äußerten zunehmend Unmut. Es war nicht die Mehrheit, da war Balistreri sicher, nur eine Minderheit, aber die war dafür umso lauter und wusste sich, im Gegensatz zur schweigenden Mehrheit, Gehör zu verschaffen. Auch mit Demonstrationen. Doch diese Demonstranten hier gehörten nicht zu jener Gruppe.
Wie viele Menschen mochten es wohl sein? Kardinal Balistreri blieb unter den Kolonaden von Bernini stehen und ließ den Blick prüfend über die Demonstrationsteilnehmer wandern. Er zählte eine Gruppe von fünfzig ab und versuchte abzuschätzen, wie oft diese Gruppe in die Gesamtteilnehmerzahl passte. Er kam zu dem Schluss, dass es etwa fünftausend Demonstranten sein mussten.
Der Platz war über fünfunddreißigtausend Quadratmeter groß. Mehr als drei Fußballfelder. Aber er wirkte viel kleiner, wahrscheinlich weil es nirgendwo um ihn herum normal dimensionierte Gebäude gab. Das führte dazu, dass man die Menschenmenge eines voll besetzten Petersplatzes auf einige Tausend schätzte, obwohl über hunderttausend Menschen auf ihm Platz fanden, eine ganze Großstadt. Fünftausend Menschen wirkten auf der riesigen Fläche geradezu verloren. Allerdings hatten sie sich so platziert, dass sie fast die ganze Breite des Platzes einnahmen, und außerdem wussten sie, was ihnen an Zahl fehlte, durch infernalischen Lärm wettzumachen. Es war natürlich nur eine Demonstration, sie würde im Vatikan nicht das Geringste verändern. Aber wie hatte noch der von Johannes Paul II. heiliggesprochene Gründer des Opus Dei, Josemaría Escrivá, gesagt: Die Schlachten werden an den Rändern gewonnen. Kardinal Balistreri sah es genauso. Steter Tropfen höhlte den Stein. Wenn die vielen stummen Unzufriedenen, die unter dem modernistischen Kurs der Kirche litten, endlich ihre Stimme erheben würden, konnte der Vatikan diese Unzufriedenheit nicht länger ignorieren. Balistreri versuchte zu verstehen, was sie riefen, und las einige der hochgehaltenen Transparente. Dann setzte er seinen Weg durch die Kolonaden fort und bewegte sich auf das Bronzeportal zu, dem Haupteingang des Apostolischen Palastes. Sein Gesicht war so ernst wie immer, aber innerlich frohlockte er. Diese Demonstranten taten ihm gut. Es waren eben nicht die üblichen linken Spinner, die für das Recht auf Abtreibung, Aufhebung des Zölibats oder Frauen als Priester und Ähnliches, was sich nicht mit der Jahrtausende alten Tradition der Katholischen Kirche vereinbaren ließ, demonstrierten – ganz im Gegenteil: Sie demonstrierten für die Rückkehr zur Tridentinischen Messe, der alten, originalen Messform, die auf Latein gehalten wurde und bei welcher der Priester mit dem Rücken zu den Gläubigen stand. Während des Zweiten Vatikanischen Konzils war diese Form fast vollständig abgeschafft worden und Priester, die sie heute noch vollziehen wollten, brauchten eine besondere Genehmigung des Papstes. Wie viele konservative Katholiken war auch Kardinal Balistreri ein Befürworter der Tridentinischen Messe. Der Priester war doch bei der Messe in gewisser Weise der Wortführer der Gläubigen gegenüber Gott. Es war also nur natürlich, dass er – mit der Gemeinde im Rücken – sich Gott, symbolisiert durch das Kreuz, zuwandte. Die Hinwendung zu den Gläubigen war in Wirklichkeit das Abwegige. Und was sprach gegen die lateinische Sprache? Gerade heute in Zeiten der Globalisierung wäre es doch eine wunderbare Sache, wenn es in der Kirche wieder eine universale Sprache gäbe, die, wenn im Kommunionsunterricht vermittelt, es jedem gestattete, auf der ganzen Welt an Gottesdiensten teilzunehmen.
Ja, Balistreri war der Ansicht, dass auf dem Konzil viel Unheil angerichtet worden war, das bis zum heutigen Tag fortdauerte, aber offen ausgesprochen hätte er das nur vor wenigen anderen Klerikern, von denen er wusste, dass sie seine Meinungen teilten, denn in der Kirche von heute waren diese Ansichten unpopulär, ja fast schon ketzerisch. Doch diese jungen Menschen auf dem Petersplatz machten ihm Hoffnung. Waren die Jungen nicht schon immer die Zukunft gewesen? Balistreri war neunundsechzig Jahre alt, er hatte sich längst damit abgefunden, dass die Kirche, die er liebte und der er sein Leben geweiht hatte, langsam, aber sicher den Bach runterging. Wie viele Beichtstühle waren inzwischen schon zu Besenkammern umfunktioniert worden? Und täglich wurden es mehr. Hier und da konnte man den Niedergang vielleicht ein wenig verlangsamen, aber das war auch schon alles. Aber an diesem herrlichen Morgen überkam Balistreri zum ersten Mal seit langem für einige Augenblicke ein Gefühl, dass vielleicht doch eine realistische Chance bestand, dass er noch bessere Zeiten würde erleben dürfen. Mit so viel Energie wie seit Jahren nicht stieg er die zwanzig Stufen zum Bronzeportal hinauf, nickte dem salutierenden Schweizer Gardisten knapp zu und verschwand im Apostolischen Palast.
V
Der Helikopter vom Typ Bell 429 zog in nur dreißig Metern Höhe eine elegante Schleife über den regenverhangenen Comer See, so dass man die berühmten Villen wie Balbianello, d’Este, Carlotta und all die anderen aus nächster Nähe bestaunen konnte. Normalerweise würde der Pilot an einer bestimmten Stelle seinen Arm ausgestreckt und gerufen haben »Dort wohnt George Clooney«, aber heute unterließ er es. Sein Fluggast hatte mit ziemlicher Sicherheit noch nie etwas von George Clooney gehört. Aus flugtechnischer Sicht war das ganze Manöver überflüssig – und von den Anwohnern ganz und gar nicht gern gesehen – aber der Pilot war von seinem Auftraggeber instruiert worden, es dennoch auszuführen, denn es war überaus eindrucksvoll. Die Schönheit der Landschaft und die Pracht der historischen Villen, die schon zahlreichen Hollywoodfilmen Glanz verliehen hatten, waren einfach überwältigend. Ein Mensch, der hier, an einem der schönsten (und teuersten) Orte der Welt wohnte, musste überaus wichtig sein. Und überaus kultiviert. Beides waren Attribute, die auf Amilcare Mussolini zutrafen, aber er legte auch Wert darauf, dass dies jeder andere ebenfalls mitbekam.
Mit beinah feierlicher Langsamkeit sank der Helikopter auf der großen und akkurat getrimmten Rasenfläche hinter der unbezahlbaren Villa nieder und setzte sanft auf. Üblicherweise ließ Amilcare wichtige Besucher dort von seiner Privatsekretärin Giulietta di Bono empfangen, einer unnahbaren Dame von atemberaubender Schönheit, die ihn als ihr Arbeitgeber (und heimlicher Liebhaber? – Er hoffte zumindest, dass seine Besucher diese nicht der Wahrheit entsprechende Möglichkeit in Betracht zogen; und die meisten taten es) weiter aufwertete. Er hätte nie gewagt, ihr ein entsprechendes Arrangement vorzuschlagen. Er besaß gegenüber Frauen nicht die Respektlosigkeit, die sein Großvater an den Tag gelegt hatte und von der Aussprüche wie »Frauen sind nur für zwei Dinge gut: Zum Kinderkriegen und zum Verprügeltwerden« kündeten. Für Amilcare hatten Frauen etwas Heiliges und Unerreichbares. Er betete sie lieber heimlich aus der Ferne an. Und bei diesem besonderen Gast wäre das Hervorrufen solcher Gedanken ohnehin nicht nur nicht hilfreich, sondern eher schädlich gewesen, deshalb stand nun Amilcares grauhaariger Butler Ernesto mit einem besonders großen Regenschirm bereit, um den wichtigen Besucher so würdevoll wie nur irgend möglich in Empfang zu nehmen. Gebückt, um der Enthauptung durch die wirbelnden Rotorblätter zu entgehen, lief er zu dem Hubschrauber und öffnete die hintere Tür. Worte der Begrüßung wurden gebrüllt, dann geleitete er den Mann über den Rasen zur Villa. Ihm fiel auf, dass der Mann leicht hinkte. Nachdem er die Tür geschlossen und den Schirm in einem antiken Messingständer abgestellt hatte, führte er ihn in den Salon. Schon im Vorraum hörte der Besucher die Musik. Chopins Prélude Nr.4 in E-Dur, Opus 28, ein wunderbar trauriges Stück, das der Mann mit der Aluminiumprothese sehr liebte. Der Diener klopfte an der Tür und das Klavierspiel verstummte. Das Stück hatte den beabsichtigten Zweck bereits erfüllt.
Der Mann mit der Prothese hatte diesem Treffen mit Unbehagen entgegengesehen. Sicher, Amilcare Mussolini konnte nichts für seinen Großvater, aber dennoch ... Schon der Name bewirkte, dass sich sein Magengeschwür meldete. Sicher, er benötigte Unterstützung, aber er war nicht gewillt, sich in dubiose Unappetitlichkeiten verwickeln zu lassen. Andererseits war ihm von mehreren Seiten – es handelte sich um Personen, die über jeden Zweifel erhaben waren – versichert worden, dass Amilcare Mussolini nicht »so einer« sei, sondern ein hochgebildeter Feingeist, der sich auch politisch engagiere. Das Chopin-Prélude ließ seine letzten Zweifel schwinden. Sein Gastgeber war kein nationalistischer Primitivling, sondern ein Mann von Welt. Dennoch würde er die Verbindung zu diesem Mann niemals anderen offenbaren. Seinen Gegnern nicht, und noch viel weniger seinen Unterstützern. Es konnte zu leicht Missverständnisse geben. Ihm trat der kalte Schweiß auf die Stirn, wenn er sich ausmalte, wie ein Mann wie Kardinal Balistreri, den er für den Abend zu einem Gespräch zu sich gebeten hatte, darauf reagieren würde. Dessen Vater hatte zu den Ärzten gehört, die nach der Besetzung Roms durch Hitler zahlreichen Juden das Leben gerettet hatten, indem sie bei diesen die erfundene, angeblich hochansteckende und tödliche Krankheit »Syndrom K« »diagnostiziert« und sie unter Quarantäne gestellt hatten. Balistreri würde ganz sicher jegliche Unterstützung verweigern, sollte er erfahren, dass Mussolinis Enkel zu den wichtigsten Unterstützern dieses Unternehmens gehörte. Und nicht nur er.
Der Diener öffnete die schwere Tür zum Salon und der Herr des Hauses kam ihm mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen entgegen.
VI
Amilcare wusste, dass er sich auf dünnem Eis bewegte. Das folgende Gespräch verlangte seine volle Konzentration. Sein Besucher war eines der ranghöchsten Mitglieder der Katholischen Kirche und das Verhältnis von Amilcares Großvater zur Kirche war höchst problematisch gewesen: Papst Pius XI. hatte seinen Großvater verachtet und in aller Deutlichkeit postuliert: »Rom gehört mir!«, was einen Alleinherrschaftsanspruch darstellte. Der faschistischen Regierung – und auch jeder anderen möglichen Regierung – erkannte er lediglich das Recht zu, sich um die Straßenreinigung zu kümmern. Dennoch verhandelte er mit Mussolini, weil er in dem faschistischen Diktator ein Bollwerk gegen den Kommunismus sah. Mussolini seinerseits hatte die Kirche gehasst und sah sich selbst über dem Papst. Berühmt war jene Begebenheit, als Mussolini in jungen Jahren – er war zu dieser Zeit noch Sozialist und lieferte sich fast täglich öffentlich hitzige Streitgespräche mit Priestern – in einer Wirtschaft auf einen Tisch gestiegen war, seine Taschenuhr hervorgeholt und gerufen hatte, dass Gott ihn in den nächsten fünf Minuten niederstrecken solle, falls es ihn wirklich gäbe. Als dies nicht geschah, veröffentlichte er seinen ersten Zeitungsartikel. Er trug den Titel: »Gott existiert nicht.« Auch Mussolinis Roman »Die Geliebte des Kardinals« trug nicht zur Verbesserung seines Verhältnisses zum Vatikan bei. Er forderte die Enteignung der Kirche und ließ Priester und Angehörige katholischer Organisationen verprügeln. Manche kamen dabei zu Tode. Später, als er erkannte, dass die Kirche in Italien mehr Anhänger als Gegner hatte, änderte er seinen Standpunkt um hundertachtzig Grad. Von nun an unterstützte er den Vatikan. Nach seiner Machtergreifung ließ er in Italien Religion als Pflichtfach einführen und in allen öffentlichen Stellen Kruzifixe aufhängen, er erhöhte das Gehalt der Priester, erkannte viele katholische Feiertage als offiziell an und verhandelte in einhundertfünfzig geheimen Sitzungen die seit 1870 offene sogenannte »Römische Frage«, also das rechtliche Verhältnis des Vatikan zum italienischen Staat, ein Verhältnis, das neunundfünfzig Jahre in einem Kalten Krieg bestanden hatte und bei dem die Päpste dieser Zeit sich als »Gefangene im Vatikan« betrachteten und ihn nie verließen. In den sogenannten (bis heute gültigen) Lateranverträgen wurden 1929 alle offenen Fragen geklärt und für alle Zeit festgeschrieben. Die Katholische Kirche konnte zufrieden sein und hatte allen Grund zur Dankbarkeit. Unter anderem erhielt sie umfangreiche Entschädigungszahlungen, der Papst war nicht länger ein Gefangener im Vatikan, und die volle Souveränität des Kirchenstaates wurde garantiert. Pius XI. sprach von Mussolini öffentlich als dem Mann, »den die Vorsehung uns gegenübergestellt hat«. Doch Mussolini hatte insgeheim ganz andere Beweggründe, er sah sein Ziel, die weltliche Macht des Vatikan zu begraben, als erreicht an.
Amilcare war von den Ansichten seines Großvaters nicht weit entfernt. Nur, dass er die Katholische Kirche noch weit mehr verachtete, als dieser es je getan hatte. Für ihn waren es alle Heuchler, die Wasser predigten und Wein tranken. Und das betraf nicht nur die Paläste, in denen die Bischöfe und Kardinäle residierten. Was ihn noch weit mehr anwiderte, war das Körperliche. Die Katholische Kirche verurteilte die Homosexualität (mit diesem Punkt war Amilcare absolut einverstanden), hielt sich aber selbst in keiner Weise daran. Früher hatte er gedacht, dass es im Vatikan auch einige Homosexuelle gab, inzwischen wusste er, dass es die Mehrheit war. Selbst drei der fünf letzten Päpste hatten dazu gehört, wie man von Personen erfahren konnte, die es wissen mussten. Im Grunde hätte man all das viel früher ahnen können, dachte er. Man musste sich nur einmal die Flagge des Vatikan genauer ansehen. Zwei gekreuzte Schlüssel. Natürlich gab es eine offizielle Erklärung dafür, welche besagte, dass der Stellvertreter Christi damit Erde und Himmel aufschließe, aber war es nicht eine Jahrtausende alte Tradition, in Kunstwerken und Symbolen vor aller Augen geheime Bedeutungen zu verbergen? Amilcare hatte die geheime Bedeutung der Vatikanischen Flagge entdeckt: Normalerweise war das Gegenstück zu einem Schlüssel ein Schloss. Zwei Gegenstände, die in ihrer Symbolik leicht dem Mann und der Frau zugeordnet werden konnten. Doch auf dieser Flagge gab es kein Schloss, sondern lediglich zwei gekreuzte Schlüssel. Seit Amilcare dies aufgegangen war, konnte er kaum mehr glauben, dass dieser nur allzu deutliche Hinweis nicht jedem auf den ersten Blick auffiel. Doch das würde er seinem heutigen Gast natürlich nicht auf die Nase binden. Amilcare hatte gelernt, seine Emotionen zu verbergen. Er verabscheute die Kirche und ihre Repräsentanten, aber sie und er hatten gemeinsame Feinde. Zumindest der Teil der Kirche, den sein Gast vertrat. Hatte nicht Napoleon gesagt: »Was mich angeht, so sehe ich in der Religion nicht die Mysterien der Fleischwerdung, sondern einzig das Mysterium der sozialen Ordnung.« Hatte nicht Voltaire, an den Abenden, an denen er mit seinen Freunden atheistische Diskussionen führte, vorher die Diener aus dem Haus geschickt? Hatte nicht sein Großvater Benito Mussolini gesagt, dass die Faschisten ein undisziplinierter Haufen seien, während die Katholiken das Gehorchen gewohnt wären? Amilcare dachte genauso. Die Welt – zumindest die westliche – war auf einem moralischen Tiefpunkt angelangt. Dekadent, sittenlos und in einem Prozess der lustvollen Selbstzerstörung gefangen. Genau so war das Römische Weltreich untergegangen. Doch dieses Mal durfte es nicht so weit kommen. Dreizehn Jahre lang hatten Amilcare und seine einflussreichen Freunde geschuftet, um eine Wende herbeizuführen. Und nun war sie zum Greifen nah.