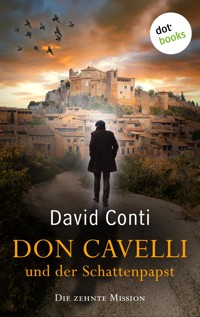2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Heiliger oder Teufel? Ungewollt wird der Geschichtsprofessor Don Cavelli von seinem ehrgeizigen neuen Kollegen an der Sapienza-Universität in einen Wettstreit verwickelt: Professor Constantini will nachweisen, dass es sich bei dem berühmten Pater Rosario um einen perfiden Betrüger handelt – seine Stigmata und sein heiliges Wirken in Assisi seien völliger Humbug. Cavelli, der lebenslanges Wohnrecht im Vatikan besitzt und sich dort auskennt wie kein anderer, will seinem atheistischen Kollegen nicht zustimmen. Doch als beide nach Assisi reisen und Constantini von seinen Nachforschungen nicht zurückkehrt, ist Cavelli in Alarmbereitschaft. Wer ist die rätselhafte Frau, die ihm wie ein Schatten durch die mittelalterlichen Gassen folgt? Und wer verwandelt Assisi nachts in ein Flammeninferno? Der elfte Band der Bestsellerreihe um den Vatikandetektiv wider Willen – alle Krimis sind unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ungewollt wird der Geschichtsprofessor Don Cavelli von seinem ehrgeizigen neuen Kollegen an der Sapienza-Universität in einen Wettstreit verwickelt: Professor Constantini will nachweisen, dass es sich bei dem berühmten Pater Rosario um einen perfiden Betrüger handelt – seine Stigmata und sein heiliges Wirken in Assisi seien völliger Humbug. Cavelli, der lebenslanges Wohnrecht im Vatikan besitzt und sich dort auskennt wie kein anderer, will seinem atheistischen Kollegen nicht zustimmen. Doch als beide nach Assisi reisen und Constantini von seinen Nachforschungen nicht zurückkehrt, ist Cavelli in Alarmbereitschaft. Wer ist die rätselhafte Frau, die ihm wie ein Schatten durch die mittelalterlichen Gassen folgt? Und wer verwandelt Assisi nachts in ein Flammeninferno?
Über den Autor:
David Conti wurde 1964 in Rom geboren und verbrachte dort – unterbrochen von einem mehrjährigen Aufenthalt in München – seine Kindheit und Jugend. Nach einem Studium der Theologie, Geschichte und Germanistik in Perugia, Yale und Tübingen, war er mehrere Jahrzehnte lang in verantwortlicher Position bei einer internationalen Institution in Rom tätig. Seit seinem beruflichen Ausscheiden aus dieser, verbringt er seine Zeit mit Reisen und dem Schreiben der »Don Cavelli«-Reihe. Er lebt abwechselnd in Castel Gandolfo, Zürich und Santa Barbara.
In der »Don Cavelli«-Reihe erscheinen bei dotbooks:
»Don Cavelli und der tote Kardinal – Die erste Mission«
»Don Cavelli und der letzte Papst – Die zweite Mission«
»Don Cavelli und die Hand Gottes – Die dritte Mission«
»Don Cavelli und das Sizilianische Gebet – Die vierte Mission«
»Don Cavelli und der Apostel des Teufels – Die fünfte Mission«
»Don Cavelli und die Wege des Herrn – Die sechste Mission«
»Don Cavelli und die Stille Stadt – Die siebte Mission«
»Don Cavelli und die Töchter Marias – Die achte Mission«
»Don Cavelli und der Atem Gottes – Die neunte Mission«»Don Cavelli und der Schattenpapst – Die zehnte Mission«
Alle Romane sind sowohl als eBook- als auch Printausgaben erhältlich. Die ersten acht Bände sind außerdem als Hörbücher bei Saga Egmont erschienen.
***
Originalausgabe Oktober 2024
Copyright © der Originalausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98952-197-1
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Conti
Don Cavelli und der Mann aus Assisi
Die elfte Mission
dotbooks.
»Euch geschehe nach eurem Glauben.«
Jesus (Matthäus 9,29)
Prolog
Dreiundvierzig Jahre zuvor
Es war kurz vor fünf am Morgen. Auch heute würde es wieder ein heißer Tag werden, doch noch war die Luft kalt und feucht und das gesamte Kloster lag unter einer Glocke von Nebel.
So schnell, wie die Würde des Ortes und die seines Amtes es gerade noch zuließen – vielleicht doch ein wenig schneller – lief der junge Mönch durch den Kreuzgang. Sein Atem ging hastig und er zitterte. Nicht vor Kälte, wie sonst oft am frühen Morgen, sondern vor Aufregung.
Am Ende des Gangs bog er nach links ab, zog eine Tür auf und eilte eine schmale Treppe empor. In wenigen Augenblicken würde die erste Heilige Messe des Tages beginnen und diese durfte unter keinen Umständen unterbrochen werden. Er musste es unbedingt vorher schaffen, den Pater Superior zu finden, und ihm über das unglaubliche Ereignis Bericht erstatten.
Im Refektorium und in seiner Zelle hatte er ihn schon gesucht, jedoch nicht angetroffen. Es war neun Minuten vor fünf, als er vor dem Uffizium des Pater Superiors innehielt und sich mit dem Ärmel seiner Kutte den Schweiß aus dem Gesicht wischte, dann klopfte er an die schwere uralte Tür.
»Avanti!«, antwortete man von innen. Es klang mehr wie eine Drohung als wie eine Aufforderung. Verständlicherweise. Dies war nicht die Zeit für irgendwelche Anliegen. Bebend vor Aufregung trat der Mönch ein. Ein strenger Blick schien ihn förmlich zu durchbohren.
»Nun?«
»Es geht um Pater Rosario ...«
Mit einer unwirschen Kopfbewegung befahl ihm der Pater Superior weiterzusprechen.
Sich mehrfach verhaspelnd berichtete der junge Mann atemlos, was sich ereignet hatte, während sich der Ausdruck auf der Miene seines Vorgesetzten von Ungeduld über Verärgerung bis zu Entsetzen verwandelte.
Ohne den Mönch einer Antwort zu würdigen, ließ der Pater Superior ihn stehen und eilte aus der Kammer in Richtung des Krankenzimmers, wobei er versuchte, den wild in seinem Kopf durcheinanderwirbelnden Gedanken Einhalt zu gebieten. Was war hiervon nur zu halten? Es war bei Gott nicht das erste Mal, dass der gesundheitliche Zustand von Pater Rosario ihm Anlass zur Sorge bereitete. Obwohl dieser erst zweiundzwanzig Jahre alt war, stand es um seine Gesundheit mehr als schlecht. Unerklärliche Schwächeanfälle und Fieberattacken mit abnorm hohen Temperaturen wechselten mit Phasen, in denen er keinerlei Nahrung, ja nicht einmal den kleinsten Schluck Wasser zu sich nehmen konnte, ohne sich augenblicklich zu erbrechen. Und das war nur das Körperliche. Nicht selten hatte Pater Rosario Visionen oder verfiel in stundenlange Ekstasen, währenddessen er mit verstorbenen Heiligen in direktem Kontakt zu stehen schien. In etlichen Nächten waren schweres Poltern und Schmerzensschreie aus seiner Zelle zu hören und am Morgen war dann sein Leib von Blutergüssen übersät, die ihm, wie er einem Klosterbruder anvertraut hatte, von leibhaftigen Dämonen beigebracht worden seien. Dieser junge Mann hatte ganz offenbar nicht nur eine fragile körperliche Konstitution, sondern war auch im höchsten Maße geistig überspannt. Jeden anderen hätte der Pater Superior längst als ungeeignet fortgeschickt, doch Pater Rosario war eben auch ein Musterbeispiel für einen Mönch. Demütig und gehorsam und was von noch größerer Bedeutung war – er ging vollständig in seinem Glauben auf und betete mehr als jeder andere. So jemanden konnte man nicht zurück in die Welt schicken, zumal alles darauf hindeutete, dass er ohnehin nicht mehr lange zu leben hätte.
Doch nun schien etwas eingetreten zu sein, das – sollte es tatsächlich wahr sein – alles änderte. Langsam – mit einer Andächtigkeit, die ihn im selben Moment bereits ärgerte – betrat er das Krankenzimmer und schloss die Tür. Der Arzt erwartete ihn bereits. Mit einer besorgten Miene, die ungewöhnlich für ihn war, trat er auf ihn zu und klärte ihn im Flüsterton über die Situation auf. Der Pater Superior wusste, dass die Frage ein Affront gegenüber dem seit über dreißig Jahren bewährten Mediziner war, doch er musste sie trotzdem stellen: »Sind Sie sicher, Dottore?«
Der Arzt nickte mit ernsten Augen. »Es kann kein Zweifel bestehen.«
Der Pater Superior spürte eine leichte Übelkeit in sich aufsteigen. Bis zu diesem Augenblick hatte er nur den Bericht des jungen Mönchs gehabt und etwas in ihm hatte geglaubt – hatte glauben wollen – dass dieser etwas falsch verstanden hatte, doch nun war es offiziell. Dennoch musste er es einfach mit eigenen Augen sehen. Beklommen trat er an die Pritsche, auf der Pater Rosario lag. Er wirkte elend und schien sich zu schämen. Wenig feinfühlig streifte der Arzt Rosarios Kutte hoch und wies auf eine etwa sieben Zentimeter lang Wunde, die sich rechts unter den Rippen befand. An derselben Stelle hatte der römische Legionär Longinus Jesus nach dessen Tod am Kreuz mit einer Lanze gestochen, um sicherzugehen, dass er nicht mehr lebte.
Dann zeigte der Arzt ihm die Wunden, die sich an dessen Füßen und auf seinen Händen zeigten, ganz so, als seien dicke Nägel hindurchgetrieben worden. Der Pater Superior schnappte nach Luft. Es war also tatsächlich wahr: Pater Rosario trug die Stigmata Jesu Christi.
Einige Momente konnte der Pater Superior nur hilflos auf die Wunden starren, dann bekreuzigte er sich hastig. Es war das erste Mal, dass er einen stigmatisierten Menschen mit eigenen Augen sah. Bislang hatte es weltweit etwa dreißig bis vierzig solcher Fälle gegeben. In aller Regel junge katholische Frauen, wobei der Abt – auch wenn er es öffentlich niemals zugegeben hätte – es insgeheim für recht wahrscheinlich hielt, dass diese sich die Wunden in religiösem Wahn selbst beigebracht hatten. Die heilige Katharina von Siena war die einzige Frau, bei der es als gesichert galt, dass sie echt gewesen waren. Der erste Mensch überhaupt und darüber hinaus der einzige Mann in der Geschichte, den Gott mit Stigmata gezeichnet hatte, war Giovanni di Pietro di Bernadone gewesen, besser bekannt als derjenige Heilige, den man nach seinem Ordensnamen und dem Namen des kleinen Städtchens, in dem sich das Kloster des Pater Superiors befand, nannte: der Schutzpatron Italiens – Franz von Assisi.
Nun war es am selben Ort zum zweiten Male geschehen.
Erstes Buch
I
Erster Tag
Der etwa fünfzigjährige Mann in dem leicht speckigen grauen Anzug hatte soeben eine einzelne Briefmarke erstanden und betrachtete das Wechselgeld in seiner Hand mit deutlichem Missvergnügen. Dann verließ er die Vatikanische Post am Petersplatz. Don Cavelli, der ebenfalls gerade Briefmarken gekauft hatte, sah ihm amüsiert hinterher. Er war sicher, dass der Mann schon morgen wiederkommen würde – und nicht nur er. Es gab viele wie ihn. Er gehörte zu den zahllosen Privatpersonen, die versuchten, auf eBay mit vatikanischen Münzen ein bisschen Geld nebenher zu verdienen. Obwohl der Vatikan nicht Mitglied der EU war, durfte er aufgrund eines bilateralen Abkommens mit Italien dennoch pro Jahr 2,3 Millionen Euro in Münzen prägen. Dies geschah im Palast der Münze, einem kleinen burgähnlichen Gebäude inmitten der Vatikanischen Gärten. Da diese Geldstücke die seltensten unter den Euromünzen waren, wurden sie bereits am Tage ihrer Ausgabe von Sammlern zu einem Vielfachen ihres nominellen Wertes gehandelt – eine ziemlich interessante Einnahmequelle für den Vatikan und der Grund dafür, dass diese Münzen nie in den normalen Geldumlauf kamen. Im Jahre 2010 war jedoch von Seiten der EU festgelegt worden, dass der Vatikan zumindest einundfünfzig Prozent der geprägten Münzen regulär auszugeben hatte, so dass seitdem unter anderem an allen Vatikanischen Stellen, an denen die Öffentlichkeit einkaufen konnte, dem Vatikanischen Buchladen, der Vatikanischen Post, den Vatikanischen Museen und an weiteren Stellen, pro Prägung immerhin zwei Millionen Fünfzigcentstücke als Wechselgeld ausgeben wurden. Die billigste Chance auf solche Münzen hatte man beim Kauf einer Briefmarke. Es war wie ein Gratislos kaufen, denn man erhielt ja auf jeden Fall die Briefmarke für sein Geld. Jeder, der wusste, wann wieder einmal eine neue Serie in den Umlauf kam, und ein bisschen Glück hatte, konnte sich so leicht ein wenig dazuverdienen, denn die Münzen ließen sich für das Zehn- bis Zwanzigfache weiterverkaufen. Eine augenblickliche Wertsteigerung, bei der keine noch so gute Aktie mithalten konnte.
Gelegentlich landete so ein Fünfzigcentstück auch bei Cavelli.
Wenn dies der Fall war, steckte er es in die kleine Extratasche in seiner Jackettasche und verschenkte es in seinem Seminar; immer dann, wenn lediglich ein einziger Student eine besonders schwierige Frage beantworten konnte. Ein kleiner Motivationsanreiz, der bisher noch immer sehr gut angekommen war.
Don Cavelli – das Don war im Gegensatz zu dem, was manche dachten, kein kirchlicher Titel, sondern lediglich die Abkürzung seines fürchterlichen Vornamens Donato – hatte eine Professur zur Geschichte des Papsttums an der Sapienza, der ältesten Universität Roms, inne. Auf eigenen Wunsch erhielt er dafür lediglich ein symbolisches Jahresgehalt von einem Euro, denn er verspürte kein Verlangen, in Italien eine Steuererklärung abgeben zu müssen, und er konnte es sich leisten, denn auf das Geld war er nicht angewiesen. Sein Vorfahr, Capitano Umberto Cavelli, hatte im Jahr 1513 Papst Julius II. einen so ungeheuer wertvollen Dienst erwiesen, dass dieser bestimmt hatte, man möge Umberto Cavelli und all seine Nachkommen bis zum Jüngsten Tage »liberatus ab ullis calamitatibus« – also frei von allen Nöten – stellen. Diese Anordnung hatte nicht nur eine märchenhafte Menge Goldes, sondern auch Wohnrecht im Vatikan und zahlreiche Privilegien beinhaltet. Das Gold hatte sich im Laufe von einem halben Jahrtausend durch Zins und Zinseszins zu einem riesigen Vermögen vermehrt – mehr als genug, damit auch sämtliche Cavellis der nächsten fünfhundert Jahre in Luxus leben konnten.
Manchmal fragte sich Cavelli, was um alles in der Welt es für ein Dienst gewesen war, den Umberto dem Papst erwiesen hatte. Bislang hatte noch kein Historiker eine einschlägige Quelle finden können, doch es bestand kein Zweifel, dass es sich bei dieser offensichtlichen Geheimaktion um etwas ganz Entscheidendes gehandelt haben musste, bei dem es wohl nicht ohne Tote abgegangen war. Gelegentlich befiel Cavelli der Verdacht, dass er, wie auch schon sein Vater Spiridon, überhaupt nur deshalb Historiker geworden war, weil ihn tief im Innern das Geheimnis um die Tat seines Ahnen umtrieb. Schließlich beruhte ein Großteil seiner eigenen Existenz darauf. Sein verstorbener Vater hatte vor einigen Jahrzehnten begonnen, eine Geschichte des Papsttums zu schreiben, und Cavelli hatte diese Arbeit fortgesetzt, wobei ihm eines seiner Privilegien – der unbeschränkte Zutritt zur Vatikanischen Geheimbibliothek, inklusive der Einsicht in alles, was für den Rest der Öffentlichkeit noch Jahrzehnte gesperrt sein würde – einen großen Vorteil verschaffte. Zurzeit arbeitete er an Band 15. Es war jedoch weniger dieses Wissen als vielmehr seine Privilegien, vor allem sein Wohnrecht im Vatikan, was dafür sorgte, dass seine Seminare immer voll waren. Ein großer Teil seiner Studenten – Cavelli nannte sie privat »die Dan-Brown-Fraktion« − hielten ihn für eine geheimnisumwitterte Figur, die in alle dunklen Geheimnisse des Vatikan eingeweiht war, und sie brannten darauf, einen kleinen Blick hinter den Schleier dieser Mysterien zu werfen. Und dann waren da noch die Studentinnen, die sein Foto im Seminarverzeichnis gesehen hatten. Sie hatten zwar noch nie etwas von dem verstorbenen französischen Filmstar Gérard Philipe gehört, mit dem ihn öfter ältere französische Touristen verwechselten, aber sie fanden ihn auch ohne das »voll schnuckelig«.
Cavelli verließ die Vatikanische Post, durchquerte die Kolonnaden von Bernini und betrat den Petersplatz. Dies war der gefährlichste Ort des Vatikanstaates, der, gemessen an seiner Einwohnerzahl von etwas über achthundert, der kriminellste Staat der Welt war. Dies kam allerdings einzig und allein durch die Anzahl der Taschendiebe auf dem Petersplatz zustande. Doch Cavelli fühlte sich hier völlig entspannt, er hatte durch jahrzehntelange Erfahrung einen Blick für die Taschendiebe und das war nicht der einzige Grund. Auch wenn der Vatikan jegliches Aufsehen vermied, ging er doch überaus effektiv auf dem Gebiet der Sicherheit vor. Viele der Diebe wurden auf frischer Tat erwischt, nicht wenige von ihnen durch die Polizisten in Priesterkleidung, die sich seit den Anschlägen vom 11. September dort befanden.
Doch das war noch gar nichts gegen das, was bei einem Papstbegräbnis oder der Inthronisation eines neuen Papstes aufgeboten wurde. Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit waren dann auf, um und über dem Petersplatz fünfzehntausend Securityleute, einschließlich eintausend Scharfschützen, F16-Abfangjäger und AWACS-Aufklärungsflugzeuge der NATO im Einsatz und ein italienisches Kriegsschiff.
Ja, man konnte sich hier ziemlich sicher fühlen.
An den Tagen, an denen Cavelli unterrichtete, verzichtete er auf seine tägliche Joggingtour zum und durch den Villa-Borghese-Park und ging in flottem Tempo zur knapp acht Kilometer entfernten Universität. Heute allerdings würde er kein Seminar halten, denn es stand eine Sonderveranstaltung auf dem Plan. Eine, zu der er nicht die geringste Lust verspürte, aber man hatte ihn nachdrücklich überzeugt, dass es sein musste. Etwa ein- bis zweimal pro Jahr bat der Rektor der Sapienza Cavelli in sein Büro und jammerte ihm die Ohren voll, wie viele böse Briefe und Anfeindungen er bekäme, weil die Sapienza Cavellis Seminar »Die Geschichte des Papsttums« anbot. Die christliche Religion war (anders als in Afrika und Asien) in der westlichen Welt dramatisch auf dem Rückmarsch und die Zahlen derjenigen Leute, die jedes Jahr aus der Kirche austraten, waren gigantisch. Mehrere theologische Seminare waren bereits eingestellt worden, und Cavellis Seminar verdankte seinen Fortbestand in erster Linie nur noch seinem Renommee als einzigem privaten Vatikanbewohner und dem Umstand, dass er keine Kosten verursachte. Vor drei Wochen war es wieder einmal so weit gewesen und Cavelli hatte sich ein weiteres Lamento dieser Art anhören müssen. Dann hatte er erfahren, dass die Sapienza ab dem kommenden Semester einen neuen Professor beauftragen würde, ein weiteres Seminar anzubieten. Der Titel klang zunächst unverfänglich: Säkulare Studien. Doch die Presse hatte für die neue Lehrkraft sofort eine griffige Bezeichnung geprägt, die auch viel zutreffender war: Professor für Atheismus.
Cavelli bog auf die Via della Conciliazione ein und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es war wieder einer dieser glutheißen Tage. Er trat an einen der zweitausendfünfhundert überall in Rom verteilten Nasoni heran, die großen Nasen, wie die Römer ihre hydranten-ähnlichen Trinkbrunnen mit den entfernt an eine Nase erinnernden Wasserhähnen liebevoll nannten. Eine segensreiche Einrichtung, aus der klarstes Quellwasser aus den Bergen sprudelte. Es existierten zwei Methoden, daraus zu trinken. Die erste war beliebt bei Hunden und Touristen: Man bewegte seinen Mund unter den Wasserhahn und schlürfte unter Verrenkungen das nach unten fließende Wasser. Als jemand, der sein ganzes Leben in Rom verbracht hatte, kannte Cavelli die andere – die eigentliche – Methode. Er hielt den Hahn unten mit dem Zeigefinger zu und sofort schoss ein anmutiger Strahl aus dem von Touristen nicht beachteten Loch auf dem Wasserhahn nach oben, der bequem zu trinken war. Cavelli nahm mehrere erfrischende Schlucke, dann ging er weiter.
Heute würde der Atheistik-Professor mit großem Brimborium der Öffentlichkeit präsentiert werden und Cavelli war verdonnert worden, mit dem Vorstand der Universität und einigen der bekannteren Professoren auf dem Podium in der Aula zu sitzen. Er hasste solche Veranstaltungen, aber er hatte schlecht nein sagen können. Schließlich war er, der geheimnisvolle Mann aus dem Vatikan, damals ebenso bei einer Veranstaltung wie dieser eingeführt worden. Erneut wischte er sich den Schweiß ab und fluchte vor sich hin, es war einfach zu heiß heute und ihm missfiel der Gedanke daran, einen halben Tag sinnlos verschwenden zu müssen.
II
Endlich würde Giovannas Mutter ihn sehen und die Aussicht darauf ließ ihr Herz wie wild schlagen.
Wie ein Lauffeuer hatte sich unter den Gläubigen in Assisi das Gerücht verbreitet, dass Pater Rosario heute Morgen eine Heilige Messe halten würde, und zwar in der Basilika San Chiara. Solche Informationen waren ungemein kostbar, denn in den Terminplänen, welche die Kirche ausgab, standen zwar alle Orte und Zeiten, in denen Gottesdienste stattfanden, ordentlich aufgelistet, doch welcher Priester sie halten würde, stand dort leider nicht. Einerseits war dies verständlich, denn erstens waren solche Angaben grundsätzlich nicht üblich (allerdings war es in der Regel doch möglich, es herauszufinden, wenn man auf die Internetseite der jeweiligen Gemeinde ging) und zweitens – und das war hier in Assisi zweifellos der Hauptgrund – wollte man nicht, dass alle Gläubigen zu Pater Rosario liefen, während die Messen der übrigen Priester leer blieben. Eine durchaus berechtigte Befürchtung, denn Pater Rosario war, daran konnte kein Zweifel bestehen, ein wahrer Heiliger.
Giovannas Mutter wusste alles über ihn, was es zu wissen gab. Schon in jungen Jahren hatte er die Stigmata des Herrn erhalten, offensichtlicher konnte Gott nicht sagen, dass er diesen Priester für ganz besondere Aufgaben auserwählt hatte. So sehr die Kirchenführung in Assisi, mächtige Männer im Vatikan und auch die Bürger von Assisi versuchten, es geheim zu halten, es sprach sich dennoch überall in Italien herum: Pater Rosario hatte die Macht, Kranke zu heilen. Auch und gerade solche, die als unheilbar galten. Von überall pilgerte man nach Assisi, um sich von ihm helfen zu lassen. Viele blieben auch dauerhaft hier, wurden seine geistlichen Kinder und versuchten alles, um ein gottgefälliges Leben nach seiner Anleitung zu führen. Was konnte ein sicherer Weg ins Paradies sein? Für viele war er die Wiedergeburt des Franz von Assisi und fast so bedeutend wie Jesus. Oder – wenn sie ganz ehrlich waren – sogar bedeutender als Jesus, denn Pater Rosario existierte im Hier und Jetzt und war mitten unter ihnen.
Dann waren jene zwanzig Jahre gekommen, die man hier in Assisi als das schwarze Zeitalter bezeichnete. Die Zeit, in der Rom Pater Rosario verbot, nach außen zu wirken. Er war quasi ein Gefangener im Kloster gewesen und durfte fast niemanden sehen. Mit der bewunderungswürdigen Demut eines Heiligen hatte er es klaglos hingenommen.
Doch vor einem guten Jahr hatte es in der Glaubenskongregation des Vatikan einen Personalwechsel gegeben und das unversöhnliche Misstrauen gegen den Pater war einem vorsichtigen Wohlwollen gewichen. Natürlich hatte niemand in Rom bestätigen wollen, dass Pater Rosario echte Wunder vollbrachte, aber zumindest waren alle schikanösen Beschränkungen, die man ihm zwei Jahrzehnte lang auferlegt hatte, über Nacht aufgehoben worden. Zum Leidwesen der Bürger von Assisi, die ihren Heiligen für sich allein haben wollten, hatte sich die Kunde blitzschnell im globalen Dorf verbreitet und in dem ursprünglich so beschaulichen historischen Ort ging es nun zu wie am Broadway in New York.
Giovannas Mutter hatte Schwierigkeiten gehabt, hier ein Hotelzimmer zu ergattern und war schließlich gezwungen gewesen, bei einer uralten Dame mit unzähligen Katzen eine Dachkammer zu mieten, die dunkel und feucht war, doch das spielte für Giovannas Mutter keine Rolle. Ihre elfjährige Tochter litt seit achtzehn Monaten an einer Krankheit, die alle Ärzte vor ein Rätsel stellte. Sie hatte sie zu allen möglichen Spezialisten gebracht, und Giovanna hatte sich allen möglichen Tests unterziehen lassen müssen, doch niemand hatte eine Diagnose stellen können. In der Zwischenzeit war Giovanna immer dünner und schwächer geworden und die Ärzte gaben ihr nur noch zwischen drei und sechs Monaten zu leben.
In ihrer Verzweiflung hatte Giovannas Mutter schon mit ihr nach Lourdes fahren wollen, doch die knapp siebentausend Heilungen waren angesichts der riesigen Menschenmassen, die dort seit über hundert Jahren hinpilgerten, wenig ermutigend. Giovannas Mutter glaubte zwar durchaus, dass die Heilige Jungfrau Maria dort zuweilen Wunder wirkte, doch die Kriterien, nach denen sie das tat, blieben undurchschaubar. Dann hatte sie von Pater Rosario gehört, der zwar längst nicht bereit war, jeden zu heilen, doch wenn er es tat, funktionierte es auch. Augenblicklich hatte sie gewusst, dass sie Pater Rosario um Hilfe anflehen musste und dass er sie erhören würde.
Nun erblickte sie in der Ferne den Glockenturm der Basilika San Chiara und bekreuzigte sich. Diese Kirche war etwas ganz Besonderes. In ihr hing das berühmte Kreuz, von dem aus Jesus zu Franz von Assisi gesprochen hatte, und hier war er auch im Jahr 1228 heiliggesprochen worden. Als sie jedoch den Kirchplatz erreichte, sank ihr Herz. Sie kam zu spät. Die Kirche war offenbar bereits bis zum letzten Stehplatz gefüllt und vor dem Eingang befanden sich hunderte Menschen, die ebenfalls nicht früh genug gekommen waren. Ihre angeborene Schüchternheit überwindend, versuchte sie, sich einen Weg durch die Menschenmenge zu bahnen; sie hatte keinen richtigen Plan, aber wenn es ihr gelang, ein paar Worte an Pater Rosario zu richten, wenn er die Kirche verließ, würde er sie vielleicht anhören. Doch erst jetzt wurde ihr richtig klar, dass ihre Verzweiflung hier nichts Besonderes war. Fast jeder in dieser Menge war aus dem gleichen Grund hier und hielt sein persönliches Anliegen für das einzige von Bedeutung. Schließlich hatte sie sich bis zu einem Platz in der zweiten Reihe vorgekämpft, doch weiter ging es nicht für sie, die Plätze in der ersten Reihe wurden erbittert verteidigt.
Beinahe zweieinhalb Stunden geschah nichts. Es war bekannt, dass die Heiligen Messen, die von Pater Rosario zelebriert wurden, weitaus länger dauerten als bei anderen Priestern. Die allgemein übliche Zeit lag bei fünfundvierzig bis sechzig Minuten, bei Pater Rosario war das Doppelte bis Vierfache an der Tagesordnung, aber er hatte auch schon Messen gelesen, die sieben Stunden gedauert hatten. Allerdings beschwerte sich niemand (zumindest keiner der Gläubigen – bei Pater Rosarios Vorgesetzten sah es anders aus), im Gegenteil, vielen konnten seine Messen gar nicht lang genug sein und sie wünschten, dass sie niemals enden würden.
Schließlich öffneten sich die Türen der Kirche und die Menge strömte nach draußen und dann endlich trat auch Pater Rosario ins Freie. Er war Ende sechzig, sah jedoch älter aus. Er war korpulent, hatte einen grauen Vollbart und wirkte schwach und leidend. An seinen Händen erblickte sie die allseits bekannten Handschuhe ohne Finger, die er stets trug, um seine Stigmata zu verbergen. Er hielt den Blick gesenkt, sein Gesicht war schmerzverzerrt und er stützte sich mit der rechten Hand auf einen Stock und mit der linken auf den Arm eines hochgewachsenen, hageren Mannes um die dreißig, bei dem es sich wohl um Delano Garavaglia handelte, über den Giovannas Mutter gehört hatte, dass er so eine Art freiwilliger und unbezahlter Privatsekretär Pater Rosarios war. Seine unverzichtbare rechte Hand. Es hieß, dass man sich mit ihm gutstellen musste und dass es in seiner Macht stand, ein Treffen mit dem heiligen Pater sowohl zu ermöglichen als auch zu verhindern.
Augenblicklich wurde der Pater von den Menschen der ersten Reihen umringt und bedrängt. Alle riefen durcheinander und einige griffen nach ihm, um auf sich aufmerksam zu machen. Andere versuchten, ihm die stigmatisierten Hände zu küssen. Garavaglia bemühte sich, sie so gut es ging abzuwehren, doch das war nur bedingt möglich, es waren einfach zu viele. Pater Rosario machte unwirsche Bewegungen mit seinem Stock und schimpfte wie ein Rohrspatz auf diejenigen, die ihn bedrängten. Fragen beantworte er nicht und er ließ sich auch auf kein Gespräch ein, allerdings nahm Garavaglia im Vorbeigehen von den Leuten eine ganze Reihe von Briefen und Zetteln entgegen, vermutlich hauptsächlich Bittgesuche, und stopfte sie in seine Jackentaschen. Mühsam bahnten sie sich den Weg zu einem alten Fiat. Garavaglia half dem Pater auf den Beifahrersitz, setzte sich ans Steuer und brauste los. Gleich darauf waren sie verschwunden.
Giovannas Mutter verspürte keine Enttäuschung, dass sie nicht mit Pater Rosario hatte sprechen können. Allein ihn aus so großer Nähe gesehen zu haben, war ein Sonnenstrahl der Hoffnung gewesen. Alles würde gut werden, da war sie jetzt ganz sicher.
III
Dafür, dass der Mann sein linkes Bein etwas nachzog, war er ziemlich schnell unterwegs. Es ging zwar nicht um einen Krankenbesuch, sondern nur um die Ausstellung eines Totenscheins, aber irgendetwas in Dottore Olivelli hatte sich schon immer geweigert, den Tod eines Patienten endgültig anzuerkennen, solange er ihn nicht selbst diagnostiziert hatte. Schließlich hatte es auf diesem Gebiet ja schon die krassesten Fehlurteile gegeben, auch wenn er zugeben musste, dass er selbst noch nie erlebt hatte, dass ein vermeintlich Toter doch noch am Leben war.
Dottore Olivelli war jetzt Mitte sechzig und müde, aber er brachte es nicht fertig, in Rente zu gehen. Für viele ältere Bewohner von Assisi war er der Arzt und sie weigerten sich, zu den jüngeren Ärzten und Ärztinnen zu gehen, die nicht von hier stammten und die sie nicht kannten und denen sie nicht vertrauten.
Olivelli hatte vorgehabt, so lange weiter zu praktizieren, bis auch der letzte seiner alten Stammpatienten verstorben war und man ihn nicht mehr brauchte. Sein Arbeitspensum wäre so nach und nach immer kleiner geworden, doch er hatte sich gründlich verrechnet. Schuld war Pater Rosario sowie eine radikale Kehrtwende innerhalb der vatikanischen Kurie.
Olivelli konnte sich noch gut an eine Zeit vor über zwanzig Jahren erinnern, eine Zeit, die viele Ältere als die Goldenen Jahre von Assisi bezeichneten. Es waren die Jahre, als immer mehr Leute erkannten, dass Pater Rosario nichts weniger als ein Heiliger war. Er war von Gott mit den Stigmata Jesu Christi ausgezeichnet worden, sprach mit der seligen Jungfrau Maria und machte unheilbar Kranke wieder gesund. Eine ganze Zeit lang war das gutgegangen, doch dann nahmen einige mächtige Kirchenfürsten in Rom Anstoß an diesen Vorgängen. Über die Gründe konnte man nur spekulieren. Sei es, dass sie nicht wollten, dass ein unbedeutender Pater aus der Provinz für viele Gläubige wichtiger war als Jesus, sei es, dass sie ihn für einen Betrüger hielten, sei es aus einem anderen Grund, jedenfalls hatten sie die Macht, drakonische Maßnahmen zu erlassen. Pater Rosario wurde regelrecht kaltgestellt. Fortan durfte er weder die Beichte abnehmen (die viele Gläubige missbräuchlich dazu benutzten, ihn um die Heilung für Kranke zu bitten), noch durfte er öffentlich die Heilige Messe halten oder irgendwelche Ämter übernehmen. Er durfte keine Gläubigen segnen, keine Briefe beantworten und nicht seine Stigmata zeigen. Jeglicher Kontakt mit der Außenwelt war ihm verboten, er hatte sich nicht einmal mehr am kleinen Fenster seiner Zelle zeigen dürfen, ja, man hatte sogar versteckte Mikrophone im Beichtstuhl gefunden, mit denen man – natürlich vergeblich – nachzuweisen versucht hatte, dass er dort Unzucht mit Frauen trieb. Die wiederholten leidenschaftlichen Proteste der gesamten Gemeinde von Assisi, einschließlich ihres Bürgermeisters, waren in Rom auf taube Ohren gestoßen. Stattdessen hatte man einen Arzt von der Gemelliklinik geschickt, der – ohne Pater Rosario je untersucht zu haben – amtlich »feststellte«, dass es sich bei Pater Rosario um eine hochgradig hysterisch-paranoide Persönlichkeit handelte, die sich die Stigmata heimlich selbst beibrachte. Pater Rosario hatte sich gegen diese Vorwürfe nie verteidigt und sämtliche Schikanen gehorsam hingenommen. Ja, er hatte sogar ein Dokument aus Rom unterzeichnet, in dem er bestätigte, dass es an seiner Behandlung nichts zu beanstanden gäbe und er mit allem zufrieden sei. Doch vor einigen Monaten hatte sich der Wind in Rom gedreht. Olivelli wusste nicht, was genau vorgefallen war, doch urplötzlich waren alle Beschränkungen aufgehoben worden. Seitdem war Assisi zu einem Wallfahrtsort geworden. Menschen kamen aus allen Regionen Italiens und dem Rest der Welt herbeigeströmt, um sich von dem wundertätigen Pater helfen zu lassen oder ihn zumindest einmal aus der Nähe zu sehen. Es sprengte jede Vorstellungskraft. Allein zweitausend Beichten nahm Rosario pro Monat ab. Assisi, Heimat des Heiligen Franz und ebenso aufgrund seiner historischen Bauten ein Juwel, hatte auch zuvor schon viele Menschen, hauptsächlich Touristen, angelockt, doch nun platzte es aus allen Nähten und natürlich brachte der Ansturm der vielen Menschen es auch mit sich, dass Dottore Olivelli dreimal so viel zu tun hatte wie zuvor.
Endlich erreichte er das kleine Hotel in der Via San Gregorio. Die Wirtin, die er schon sein ganzes Leben lang kannte, erwartete ihn schon vor der Tür. Die im Hoteliersjargon sogenannte Kalte Abreise, also dass ein Hotelgast über Nacht verstarb, meistens durch Herzinfarkt, kam immer mal wieder vor, aber in der Regel nahm das Hotelpersonal so etwas relativ gelassen hin. Das gehörte nun mal zum Hotel-Alltag und es gab wesentlich unangenehmere Hotelgäste. Anders sah es bei Selbstmord aus. Jemand, der sich im Zimmer erhängt oder in der Badewanne die Pulsadern aufgeschnitten hatte, zu finden, das verdauten viele nicht so leicht. Auch hier schien einer dieser schweren Fälle vorzuliegen, denn die Wirtin wirkte angeschlagen und fuhr sich ständig nervös mit der Hand durch ihre weißen Haare, doch es war zu früh, irgendwelche Schlüsse zu ziehen, vielleicht hatte sie auch ganz andere Sorgen. Beinahe wortlos führte sie ihn hinein und zur Treppe nach oben. Der Geruch von gebratenen Kalbsschnitzeln drang aus der Küche und Olivelli verspürte Appetit. Als ihn der Anruf erreicht hatte, war er gerade im Begriff gewesen, sich an den Frühstückstisch zu setzen.