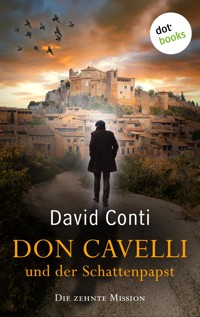Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Don Cavelli
- Sprache: Deutsch
Wenn niemandem mehr zu trauen ist … Der fesselnde Vatikanthriller »Don Cavelli und die Töchter Marias« von Erfolgsautor David Conti als eBook bei dotbooks. Ein tödliches Lügengeflecht scheint den Vatikan unterwandert zu haben … Gerade wurde einer seiner ältesten Freunde brutal ermordet – und jetzt steht er selbst unter Verdacht: Geschichtsprofessor Don Cavelli fühlt sich in einem Albtraum gefangen. Er lebt im Vatikan, er ist »einer von ihnen« – und doch wird er über Nacht zum Staatsfeind Nr. 1 erklärt. Ihm bleibt nichts anderes als die Flucht. Doch wer hat den Tatort so inszeniert, dass alle Hinweise auf Cavelli deuten? Mehr und mehr beschleicht ihn das Gefühl, dass er nur eine von vielen Schachfiguren ist, die dazu benutzt werden sollen, um das uralte Gefüge des Kirchenstaats zu erschüttern. Hat der unbekannte Gegner es etwa auch auf die Wohltätigkeitsorganisation der »Töchter Marias« abgesehen, die gerade erst eine ihrer Schwestern nach Italien entsandt haben? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der sensationsgeladene Vatikan-Krimi »Don Cavelli und die Töchter Marias« von David Conti ist der achte Band seiner Bestsellerreihe um den Vatikandetektiv wider Willen. Alle Bände können unabhängig voneinander gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein tödliches Lügengeflecht scheint den Vatikan unterwandert zu haben … Gerade wurde einer seiner ältesten Freunde brutal ermordet – und jetzt steht er selbst unter Verdacht: Geschichtsprofessor Don Cavelli fühlt sich in einem Albtraum gefangen. Er lebt im Vatikan, er ist »einer von ihnen« – und doch wird er über Nacht zum Staatsfeind Nr. 1 erklärt. Ihm bleibt nichts anderes als die Flucht. Doch wer hat den Tatort so inszeniert, dass alle Hinweise auf Cavelli deuten? Mehr und mehr beschleicht ihn das Gefühl, dass er nur eine von vielen Schachfiguren ist, die dazu benutzt werden sollen, um das uralte Gefüge des Kirchenstaats zu erschüttern. Hat der unbekannte Gegner es etwa auch auf die Wohltätigkeitsorganisation der »Töchter Marias« abgesehen, die gerade erst eine ihrer Schwestern nach Italien entsandt haben?
Über den Autor:
David Conti wurde 1964 in Rom geboren und verbrachte dort – unterbrochen von einem mehrjährigen Aufenthalt in München – seine Kindheit und Jugend. Nach einem Studium der Theologie, Geschichte und Germanistik in Perugia, Yale und Tübingen, war er mehrere Jahrzehnte lang in verantwortlicher Position bei einer internationalen Institution in Rom tätig. Seit seinem beruflichen Ausscheiden aus dieser, verbringt er seine Zeit mit Reisen und dem Schreiben der »Don Cavelli«-Reihe. Er lebt abwechselnd in Castel Gandolfo, Zürich und Santa Barbara.
In der »Don Cavelli«-Reihe erschienen bei dotbooks bisher:
»Don Cavelli und der tote Kardinal – Die erste Mission«
»Don Cavelli und der letzte Papst – Die zweite Mission«
»Don Cavelli und die Hand Gottes – Die dritte Mission«
»Don Cavelli und das Sizilianische Gebet – Die vierte Mission«
»Don Cavelli und der Apostel des Teufels – Die fünfte Mission«
»Don Cavelli und die Wege des Herrn – Die sechste Mission«
»Don Cavelli und die Stille Stadt – Die siebte Mission«
»Don Cavelli und die Töchter Marias – Die achte Mission«
Alle Romane sind sowohl als eBook- als auch Printausgaben erhältlich. Weitere Bände sowie Hörbuchausgaben sind in Vorbereitung.
***
Originalausgabe April 2023
Copyright © der Originalausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-507-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: info@dotbooks.de. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Don Cavelli 8«an: lesetipp@dotbooks.de (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Conti
Don Cavelli und die Töchter Marias
Die achte Mission
dotbooks.
»Jungfrau, ruhmreiche Königin des Himmels, Mutter der Sünder, Hilfe der Waisen, Rat der Witwen, Beschützerin der verlassenen und Armen, ich armseliger, untreuester Sünder übergebe dir diese Stadt Siena und ihr ganzes Land. Zum Zeichen dafür lege ich hier die Schlüssel der Tore von Siena auf den Altar.«
Bounoagida Lucari – Anführer des Volkes von Siena, 1260 n. Chr.
Prolog
Nachdem das Konklave sieben lange Wochen angedauert hatte, wurde schließlich, am achtzehnten November 1523, Giulio de’ Medici zum Papst gewählt. Nicht weil man ihn für den besten Kandidaten hielt – davon konnte nun wirklich keine Rede sein – sondern weil er seine gigantischen Besitztümer an die wahlberechtigten Kardinäle verteilt hatte. Eine natürlich streng verbotene, aber dafür sehr erfolgreiche Vorgehensweise.
Er nannte sich Clemens VII. Clementia bedeutet »Milde« und die Wahl dieses Namens sollte zweifellos eine beruhigende Wirkung auf seine Umwelt ausüben. Dies war auch bitter nötig, denn niemals zuvor, noch je danach, hatte ein Pontifikat unter einem solch schlechten Stern gestanden.
Weder war der Papst in der Lage gewesen, zu verhindern, dass immer mehr katholische Gemeinden in Europa zu der neuen Glaubensrichtung, dem Protestantismus, übertraten, auch seine strikte Weigerung, den Bitten von Englands König Heinrich VIII. nachzukommen, dessen ohne einen männlichen Thronnachfolger gebliebene Ehe mit Katharina von Aragon zu scheiden, auf dass er Anne Boleyn heiraten könne, hatte katastrophale Folgen: Heinrich, der zuvor einer der treuesten Anhänger von Clemens’ Vorgänger Hadrian VI. gewesen und von diesem sogar mit dem Ehrentitel »Verteidiger des Glaubens« ausgezeichnet worden war, erklärte die Loslösung Englands von Rom und die Gründung der Church of England, dessen Oberhaupt bis heute der regierende britische Monarch ist.
Doch die ungeschickte Politik des Papstes interessierte den einfachen Römer nur wenig, denn sie betraf ihn nicht. Dies sollte sich am sechsten Mai 1527 ändern, dem Tag, als die dritte Katastrophe des Pontifikats Clemens VII. in Gestalt des schrecklichsten Infernos, welches Rom je erlebt hatte, über die Stadt hereinbrach: das berüchtigte Sacco di Roma.
Ein Heer von vierundzwanzigtausend Männern, bestehend aus deutschen Landsknechten und spanischen Söldnern, die ihren Offizieren nicht mehr gehorchten, alles Abtrünnige der Armee Kaiser Karls V., fiel über die Stadt her und wütete dort in barbarischster Weise.
Die dem persönlichen Schutz des Papstes dienende Schweizer Garde, die einundzwanzig Jahre zuvor von Papst Julius II. gegründet worden war, machte ihrem Ruf von untadeliger Treue und Zuverlässigkeit alle Ehre. Um den Heiligen Vater zu schützen, traten hundertsiebenundvierzig der hundertneunundachtzig Gardisten den feindlichen Söldnern auf dem Petersplatz entgegen. Sie wurden bis auf den letzten Mann niedergemetzelt. Clemens selbst flüchtete sich mit den zweiundvierzig verbleibenden Schweizern über den Passetto in die Engelsburg, wo er im Juni kapitulierte.
Der entfesselte Mob legte Brände, raubte, mordete, vergewaltigte und folterte noch bis hinein in den Februar 1528, Seuchen brachen aus, es war die Hölle auf Erden. Dann setzte Kaiser Karl V. der Anarchie ein Ende, indem er neue Anführer einsetzte und ausstehenden Sold bezahlte.
Rom lag in Trümmern, unzählige Menschen waren tot und neun Zehntel aller Kunstschätze geraubt.
Bis auf den heutigen Tag ehrt die Schweizer Garde die Treue der einhundertsiebenundvierzig Gefallenen, indem sie die neuen Rekruten stets am sechsten Mai vereidigt, dem Datum der Schlacht auf dem Petersplatz.
Erstes Buch
I
Es war der letzte Tag vor den Semesterferien und die Hitze in dem Auditorium mit den ansteigenden Sitzreihen war typisch für Rom um diese Jahreszeit. Obwohl alle Fenster weit offenstanden, war die Temperatur in dem Hörsaal kaum zu ertragen. Professor Don Cavelli fragte sich nicht zum ersten Mal, warum sich eine so ehrwürdige Universität wie die Sapienza keine Klimaanlagen leisten konnte, und beneidete die früheren Päpste, die den glühenden Sommern in Rom immer in die kühlen Albaner Berge nach Castel Gandolfo entflohen waren.
Es war eine dieser Stunden, in denen er nicht zum ersten Mal bedauerte, dass seine Studenten nicht mit den Studenten vergleichbar waren, die er als Gastprofessor einmal pro Woche an der Gregoriana unterrichtete, der Päpstlichen Universität in Rom, die von Ignatius von Loyola gegründet worden war und allgemein als Bischofsschmiede galt. Die Studenten dort waren wirklich interessiert an Cavellis Fachgebiet »Die Geschichte des Papsttums« und sie brachten bereits umfangreiches Vorwissen mit. Die meisten – zum Glück nicht alle – von Cavellis Studenten an der Sapienza hingegen waren nur hier, weil sie ihr gesamtes Wissen über den Vatikan von Dan Brown bezogen und im Internet Artikel über Cavelli gelesen hatten, der, wie auch schon seine Vorfahren, Wohnrecht und zahlreiche Privilegien im Vatikan genoss, seit Capitano Umberto Cavelli im Jahr 1513 für Papst Julius II. etwas von außerordentlicher Bedeutung getan hatte. Was das gewesen war, darüber rätselten Historiker, nicht zuletzt auch Cavelli selbst, immer noch. Wahrscheinlich würde es niemals aufgeklärt werden, doch man durfte davon ausgehen, dass dabei nicht wenig Blut vergossen worden war.
Viele von Cavellis Studenten erwarteten sich hier unterhaltsame Insider-Einblicke hinter die geheimnisumwitterten vatikanischen Mauern und einige Studentinnen saßen in seinem Seminar, weil sie sein Bild im Seminarverzeichnis gesehen hatten. Sie hatten zwar noch nie etwas von dem französischen Filmstar der fünfziger und sechziger Jahre, Gérard Philipe, gehört, auf dessen Ähnlichkeit zu ihm ältere Menschen ihn immer wieder ansprachen, aber sie fanden ihn einfach süß.
Das alles erlebte er an der Gregoriana natürlich nicht, aber dort ging es ihm oft wiederum zu ernsthaft und zu religiös zu.
An der Sapienza hingegen kam ihm das Klima, das hier gegenüber der Katholischen Kirche herrschte, jedes Jahr feindlicher vor. Er hatte nichts dagegen, dass seine Studenten kritisch waren, was ihn störte, war das Halbwissen (oft eher ein Zehntelwissen), das dafür umso engagierter vorgetragen wurde. Jeder wusste von der Inquisition und glaubte die unwahre Legende, dass der Papst Galileo Galilei eingekerkert hatte, aber von der anderen Seite der Medaille hatten sie noch nie etwas gehört. Cavelli hatte versucht ihnen einen kleinen Einblick zu geben, indem er von der Verfolgung von Menschen mit katholischem Glauben (der als Hochverrat galt) im England des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts sprach, vom Ku-Klux-Klan, der keineswegs nur Farbige und Juden verfolgt hatte, sondern auch Katholiken zu seinen erklärten Todfeinden zählte, und schlug einen Bogen bis hin zur Gegenwart. »Das Christentum ist heute die meistverfolgte Religion der Welt«, erklärte er. »Tausende von Christen werden jedes Jahr in Ländern wie Nigeria oder Pakistan und vielen anderen wegen ihres Glaubens ins Gefängnis geworfen oder getötet. Allein in China werden jedes Jahr etwa dreitausend Kirchen geschlossen oder zerstört, weltweit pro Jahr sogar etwa 5000. Allein in Myanmar wurden letztes Jahr 200.000 Christen vertrieben, in Nicaragua gab es hundertneunzig Angriffe auf Kirchen und ...«
»Also wozu das alles?«, rief eine Studentin mit gepiercter Lippe von hinten.
Cavelli stockte. »Wozu was?«
»Wenn das alles so viel Probleme bringt, warum dann überhaupt gläubig sein? Besser man glaubt nichts, dann hat man auch keinen Ärger.«
Cavelli sah auf seine Armbanduhr. Die Stunde war fast zu Ende.
»Da stellen Sie natürlich eine große Frage. Der berühmte Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal hat sie in einer Weise beantwortet, die als Pascalsche Wette berühmt geworden ist. Danach gibt es vier Möglichkeiten: Erstens, es gibt keinen Gott und man glaubt auch nicht. Das ist kein Problem. Zweitens, es gibt keinen Gott und man glaubt trotzdem, das ist auch kein Problem, drittens, es gibt einen Gott und man glaubt, dann kommt man in den Himmel. Viertens, es gibt einen Gott und man glaubt nicht an ihn, dann kommt man in die Hölle. Folglich hat man nach Pascal auf keinen Fall einen Nachteil, wenn man an Gott glaubt, aber möglicherweise den größten nur denkbaren Nachteil, wenn man es nicht tut.«
Einige Studenten wirkten irritiert, andere lachten.
»Pascal hat’s voll erkannt«, rief ein anderer Student, von dem Cavelli noch nie einen ernsthaften Beitrag gehört hatte. »Beten funktioniert wirklich, wenn man was haben will. Man muss sich natürlich an den Richtigen wenden. Ich hab alle durchgecheckt: Jesus, Gott, Pater Pio, Jungfrau Maria, Josef und Johannes Paul II. und ich kann eindeutig sagen: Pater Pio liefert am besten.«
Cavelli sah erneut auf die Uhr. »Und mit diesem wertvollen Tipp entlasse ich Sie in die Semesterferien.«
II
Tochter Concepción hatte in der letzten Nacht kaum Schlaf bekommen. Stundenlang hatte sie mit offenen Augen dagelegen und auf den ausgeblichenen grauen Stoff des Zeltes geblickt, das sie sich mit drei weiteren Helferinnen teilte. Nach den Statuten der Organisation hätte ihr als Leiterin des Camps ein Zelt ganz für sich allein zugestanden, aber es wäre ihr falsch vorgekommen. Bolivien war das ärmste Land Südamerikas und das letzte Hochwasser hier im Departamento Chuquisaca hatte die Lage noch einmal verschärft. Concepción war hier, um zu helfen, und wenn sie durch den Verzicht auf ein eigenes Zelt dafür sorgen konnte, dass ein paar mehr Menschen in Not untergebracht werden konnten, dann musste sie keine Sekunde überlegen.
Bald würde es soweit sein, sie konnte es immer noch nicht wirklich fassen, dass sie tatsächlich Tochter Maria kennenlernen würde. Maria Concetta Crespo.
Die Frau, ohne die es all das hier nicht gäbe. Und nicht nur hier. Die Töchter Marias waren eine weltumspannende Organisation mit Hilfscamps in einundvierzig Ländern. Wie diese Frau das alles mit eigener Kraft aus dem Nichts aufgebaut hatte, grenzte an ein Wunder. Nein, es war ein Wunder. Ein paarmal hatte Concepción Tochter Maria im Fernsehen gesehen, da hatte sie immer klein und zerbrechlich und geradezu demütig gewirkt. Sie war niemand, der etwas forderte, und doch sammelte sie nicht nur zahllose Spenden von gläubigen Menschen aus aller Welt, sondern auch Millionenbeträge aus Kirche, Industrie und vielen Regierungen ein.
Es war ihre besondere Persönlichkeit, diese Frau war eine Heilige, jeder, der nicht völlig blind war, konnte das sehen.
Concepción hatte sich schon seit Jahren gewünscht, sie irgendwann einmal aus der Nähe zu sehen, aber sie hätte nicht zu hoffen gewagt, dass dies jemals geschehen würde. Siena, der internationale Hauptsitz der Töchter Marias, lag unendlich weit weg. Eine Reise dorthin war unerschwinglich und außerdem wurde sie hier gebraucht. Früher hatte Tochter Maria viele ihrer Camps noch selbst besucht, aber das geschah inzwischen kaum noch, was Concepción gut verstehen konnte; die Leitung einer immer größer werdenden internationalen Organisation war eine Herkulesaufgabe, die für so etwas längst keine Zeit mehr ließ.
Und nun würde es doch geschehen. Concepción würde sie nicht nur sehen, sie würde höchstpersönlich mit ihr sprechen. Bevor sie vor vier Monaten zur Campleiterin befördert worden war, hatte sie es gar nicht gewusst, aber bei den Töchtern Marias existierte eine Tradition, die an die Ad-limina-Besuche beim Heiligen Vater erinnerte. Alle fünf Jahre reiste jeder der etwa fünftausend Bischöfe weltweit nach Rom, um ad limina, also »an der Schwelle«, dem Papst Bericht über seine Diözese zu erstatten. Es hieß, dass so ein Besuch in der Regel nur fünfzehn Minuten dauerte, aber es war auch bekannt, dass sich Tochter Maria bis zu drei Stunden für ihre Helferinnen Zeit nahm.
Morgen würde eine Transportmaschine mit Hilfsgütern aus Italien in Sucre, der größten Stadt Chuquisacas, landen. Einer der Lastwagen, der diese Hilfsgüter von dort ins Lager transportierte, würde Concepción dann auf der Rückfahrt nach Sucre mitnehmen und sie würde im nun leeren Frachtraum des Transportflugzeugs zurück nach Rom fliegen. Von dort würde sie ein Wagen nach Siena bringen. Ihre fast elftausend Kilometer lange Reise würde die Töchter Marias praktisch nichts kosten.
Alles war bestens organisiert.
III
Oberst Durand zögerte und starrte auf das Telefon auf seinem Schreibtisch. Überschritt er hier seine Kompetenzen? Darüber konnte man durchaus geteilter Meinung sein. Die Schweizer Garde, der er die Ehre hatte, als Kommandant zu dienen, war keineswegs – wie man es ständig in Zeitungen und miserabel recherchierten Internetartikeln las – die kleinste Armee der Welt. Klein war sie mit hundertfünfunddreißig Mann zweifellos, aber eben keine Armee, sondern, wie der Name ganz klar sagte, eine Garde. Ihre Aufgabe bestand auch nicht im Schutz des Vatikan oder in der Aufrechterhaltung der Sicherheit dort, allenfalls indirekt. Alles, was die Garde tat, also auch das Bewachen der Zugänge zum Vatikan und vieler Eingänge im Inneren, diente nur einem einzigen Zweck: dem Schutz des Heiligen Vaters – und während der Sedisvakanz, also der Übergangszeit zwischen dem Tod eines Papstes und der Wahl seines Nachfolgers, dem Schutz des Kardinalkollegiums. Für den Schutz des Petersplatzes war die römische Polizei zuständig – bis zum Beginn der Stufen zum Petersdom – und für alles andere die der Allgemeinheit relativ unbekannte Vatikanische Polizei.
Durand war unschlüssig, wie er sich verhalten sollte. Hier ging es um etwas, das ihn normalerweise nichts anging. Es war Sache der Kurie und der Berater des Heiligen Vaters. Normalerweise. Andererseits hatte man ihn direkt angesprochen. Das war ungewöhnlich, nein, mehr als das, es war absolut unüblich. Und es hatte seinen Argwohn erregt. Nicht nur, dass es geschehen war, sondern vor allem, wie es geschehen war. Dies gab Anlass zu ernster Besorgnis. Noch ließ sich allerdings nichts definitiv sagen, er würde Nachforschungen anstellen müssen. Aber falls es sich tatsächlich so verhielt, wie er befürchtete, musste er handeln. Schließlich hatte er geschworen, den Papst zu beschützen, und nach Durands Interpretation bezog sich das nicht nur auf dessen körperliche Unversehrtheit, sondern auf alles, auch auf dessen Integrität.
Seine Gedanken wanderten erneut zu der Frau, die ihn in seinem Büro aufgesucht hatte. Sie war überaus freundlich gewesen, bescheiden und einfach; ganz so, wie man sie aus dem Fernsehen kannte, doch während sie sprach, hatte Durand urplötzlich so etwas wie eine Vision gehabt. Zum ersten Mal in seinem Leben, denn er war ein Mann nüchterner Vernunft. Umso mehr hatte ihn die Vision erschreckt. Vor Jahren hatte er mal in einem Artikel über den Schriftsteller Thomas Mann gelesen, dass dieser im Jahre 1895 während eines Urlaubes in Palestrina auf einer Bank einen Mann sitzen gesehen habe und im selben Moment mit absoluter Sicherheit wusste, dass es der Teufel war. Durand hatte das immer für eine typische Überspanntheit gehalten, wie sie bei Künstlern nun mal vorkommen, doch gestern hatte es ihn wie ein Blitzschlag getroffen. Genau wie Thomas Mann wusste er, dass er sich in diesem Augenblick in Gegenwart des Teufels befand.
IV
Siena.
Maria liebte diese Stadt. Nicht in erster Linie, weil Siena zu den attraktivsten Städten der Toskana und in großen Teilen zum UNESCO-Welterbe gehörte oder wegen der Piazza del Campo, die viele für den schönsten Platz der Welt hielten, ja nicht einmal wegen der aus schwarzem und weißem Marmor erbauten Kathedrale Metropolitana di Santa Maria Assunta, des Doms von Siena, der, wäre er tatsächlich so errichtet worden, wie es ursprünglich geplant war, selbst den Petersdom in den Schatten gestellt hätte, nein, Maria hatte andere Gründe.
Da war zum einen der Palio.
Der Palio di Siena war ein Pferderennen, das seit 1566 in jedem Juli und August auf dem Piazza del Campo veranstaltet wurde. Das Rennen, zu dem sich auf dem Platz jeweils sechzigtausend Zuschauer versammelten, war das wichtigste Ereignis für die Bewohner der Stadt. Wobei das Wort »wichtig« es nicht annähernd beschrieb. Siena war in siebzehn Bezirke aufgeteilt, die sogenannten Contradas. Man wurde in diese hineingeboren und gehörte ihnen an, bis man starb. Sie waren wichtiger als die eigene Familie. Die Contradas führten poetische Namen wie Käuzchen, Drachen oder Einhorn, doch das konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie seit Jahrhunderten in geradezu tödlicher Feindschaft zueinander standen. Jeder Palio dauerte vier Tage. Während dieser Zeit hatte ein gewählter Capitano die absolute Gewalt über seine Contrada.
Es begann mit der Auslosung der Pferde, wobei es ungerechterweise gute und schlechte gab. Welche Contrada welches Pferd erhielt, war Zufall. Dann betraten die Jockeys (die nie der Contrada angehörten, sondern von außerhalb engagiert wurden) zusammen mit ihrem Pferd die Kirche ihrer Contrada und wurden dort beide von einem Priester gesegnet. Gewettet wurde auf den Ausgang dieses Rennens nicht, es ging um nichts anderes als die Ehre.
Dies hielt die Contradas jedoch nicht davon ab, auch ehrlose Mittel einzusetzen, um das Rennen zu gewinnen. Das reichte von der Bestechung der Jockeys der verfeindeten Contradas über die Verwendung des Nerbos (eines Ochsenziemers) durch die Jockeys gegen die Konkurrenten während des Rennens (was erlaubt war) bis zum Herunterziehen der anderen Jockeys vom Pferd (was verboten war – aber dennoch gemacht wurde).
Bei dem mit äußerster Verbissenheit durchgeführten, nur etwa hundert Sekunden andauernden Rennen kam im Schnitt ein Pferd pro Jahr zu Tode. Jockeys, die in Verdacht standen, bestochen zu sein und absichtlich verloren zu haben, wurden von ihrer Contrada fast zu Tode geprügelt. Ein Sieg wurde wochenlang gefeiert. Eine Niederlage war ein Weltuntergang. Noch wichtiger als ein eigener Sieg war allerdings die Niederlage der Contradas, mit denen man besonders verfeindet war.
Für Außenstehende war diese extreme Form der Feindschaft unter den Bürgern von Siena, die sich nicht auf konkrete Taten, sondern einfach auf Tradition gründete, entweder lächerlich oder beängstigend, Maria hingegen waren diese Feindschaften überaus willkommen. Gigantische Mengen von Energie warteten nur darauf, von ihr zu ihrem Nutzen in die richtige Bahnen gelenkt zu werden, und im Laufe der Jahre war sie eine Meisterin darin geworden, auf dieser Klaviatur des Hasses ihr eigenes, höchst profitables Lied zu spielen.
Der andere Grund, warum sie Siena schätzte, war der Marienkult.
Im dreizehnten Jahrhundert hatte Siena sich im Krieg mit Parma und dreizehn Jahre später mit dem militärisch weit überlegenen Florenz befunden. Die Bürger von Siena gehörten zu den frommsten des Landes, ihre Mariengläubigkeit war beispiellos und so weihten sie in den Augenblicken größter Verzweiflung während dieser Kriege – und auch in späteren, zuletzt im Jahre 1944 – die Stadt in aufwendigen Zeremonien der Jungfrau Maria. Sie wurde zur Schutzherrin der Stadt ausgerufen und in das Wappen aufgenommen. Beides hatte bis zum heutigen Tag Bestand. Schwester Maria konnte sich keinen besseren Ort für ihre Organisation vorstellen.
Dreißig Jahre zuvor war Maria, die mit vollem Namen Maria Concetta Crespo hieß, in eine zutiefst gläubige Familie hineingeboren worden. Während ihre zwei Jahre ältere Schwester ebenso religiös wurde wie die Eltern und ihr ein Jahr älterer Bruder vehement dagegen rebellierte und ein militanter Atheist wurde, fand Maria ihren eigenen Weg, eine Kombination aus beidem. Während sie in ihrer frühen Kindheit noch unsäglich darunter gelitten hatte, dass ihre strenge Mutter jeden Abend von ihr verlangte, dem lieben Gott laut alle Sünden des Tages zu beichten, und im Zimmer blieb, während Maria dies tat, was nicht selten schwere Bestrafungen nach sich zog, hatte sie einige Jahre später den ganzen katholischen Schwindel durchschaut und konnte inzwischen diesen Humbug nur noch verachten.
Allerdings hatte sie auch erkannt, dass sie ihre Eltern um den Finger wickeln konnte, wenn sie sich als gottesfürchtige Christin ausgab. Und nicht nur ihre Eltern. Die Priester, die Lehrer, die Leiterinnen der katholischen Jugendgruppen, in denen sie Mitglied war, sie alle waren nicht nur strenggläubig, sondern, dadurch bedingt, auch ungeheuer leichtgläubig und sahen nur, was sie sehen wollten. Allerdings gab Maria ihnen auch keinen Anlass, etwas anderes zu sehen. Wenn sie Geld aus den Sammelbüchsen stahl, das sie mit ihren Freundinnen für Hilfsprojekte in Afrika sammelte, war sie die Letzte, die man verdächtigte. Es lag nicht nur an ihrer Verstellung; das junge Mädchen mit der zarten Figur, den blassen, filigranen Gesichtszügen und den riesigen blauen Augen wirkte so unschuldig und zerbrechlich, dass es fast in jedem augenblicklich den Beschützerinstinkt weckte.
Und Maria hatte gelernt, dies zu ihrem Vorteil auszunutzen. Mit fünfzehn war sie bereits Leiterin einer kleinen Gruppe, die normalerwiese von Mädchen geleitet wurde, die mindestens siebzehn waren. Maria hatte es verstanden, ihre Vorgängerin und die beiden als Nachfolgerin in Frage kommenden Mädchen mit Gerüchten aus dem Weg zu räumen.
Mit der Zeit wurde sie gewiefter, aber auch unvorsichtiger. Als sie ein Priester dabei erwischte, wie sie sich an der Kollekte vergriff, beschuldigte sie ihn, sie sexuell bedrängt zu haben. Seine Unschuldsbeteuerungen nützten ihm nichts, er wurde in eine weit entfernte Diözese in der Provinz strafversetzt.
Wenn sie von dem angeblichen Missbrauch erzählte, musste sie sich – abgesehen davon, dass das Geschilderte nie stattgefunden hatte – gar nicht verstellen. Ihr Ekel war echt. Schon der Gedanke, dass ihr ein anderer Mensch körperlich nahekommen könnte – aus welchem Grund auch immer – widerte sie an. Eine Eigenschaft, die sich noch verstärkte, als sie älter wurde. Dafür entdeckte sie eine exhibitionistische Seite an sich. Sie war klug genug, sie verborgen zu halten, denn sie hätte nicht zu dem Bild der unschuldigen Maria gepasst, das sie mehr und mehr von sich nach außen kultivierte, doch hatte sie dennoch einen Weg gefunden, diese Gelüste auszuleben. Es bereitete ihr ein perverses Vergnügen, sexuelle Sünden, die nie stattgefunden hatten, im Beichtstuhl ausführlich auszubreiten und kein – erfundenes – Detail auszulassen. Es dauerte nicht lange, bis sie herausgefunden hatte, welcher Priester wann in welcher Kirche in Rom Dienst hatte und welchen Priestern es Unbehagen bereitete, ihre Beichten anzuhören, denn nur dann genoss sie es. Es verschaffte ihr nicht nur Lust, sie liebte auch den Gedanken, dass sie es war, welche auf diese Weise die Priester missbrauchte. Außerdem half es ihr, ihren Hass und ihre Verachtung für alles, was katholisch war, zu verbergen. Und das musste sie, denn sie glaubte einen Weg entdeckt zu haben, wie sie die Naivität der Gläubigen zu ihrem eigenen Vorteil nutzen konnte.
V
Cavelli wusste, dass er höllisch aufpassen musste. Eine unbedachte Formulierung, eine kleine Geste, die Unsicherheit verriet, und es würde vorbei sein. Man würde ihn augenblicklich durchschauen und das durfte auf keinen Fall geschehen. Er blickte seinem Gegenüber so aufrichtig er konnte in die Augen und lächelte. »Es ist eine einmalige Gelegenheit. Eine besondere Ehre, die nur wenigen zuteilwird.«
Beatrice Kingsley kniff ein Auge zu und verzog skeptisch den schönen Mund, während sie ihn mit dem Blick des offenen Auges geradezu zu durchbohren schien. »Ich weiß nicht recht, Don.«
Wie Cavelli gehörte auch Beatrice zu den Professoren der Sapienza und unterrichtete in den Studiengängen Englisch und Italienische Literatur. Sie und ihr aus London stammender Ehemann Terry, der ebenfalls an der Sapienza lehrte, zählten zu den engsten Freunden von Cavelli.
Drei Tage zuvor hatte Cavelli für den morgigen Abend eine Einladung zum Abendessen erhalten, und zwar vor Oberst Durand, dem Chef der Schweizer Garde im Vatikan. Cavelli schätzte Durand. Er war der richtige Mann für diesen Posten. Kompetent, unermüdlich und korrekt. Cavelli hatte in der Vergangenheit das eine oder andere Mal mit ihm zu tun gehabt, man hatte sich gegenseitig geholfen und Durand hatte sich dabei immer als fair und verlässlich erwiesen und auch als jemand, der nicht blind an den Vorschriften klebte, wenn es um Wichtigeres ging. Allerdings wäre Cavelli nicht so weit gegangen, ihn als Freund zu bezeichnen, für ihn war Durand ein Bekannter, den er sehr respektierte. Durand jedoch schien es anders zu sehen, was an seiner speziellen Situation liegen mochte. Sein Schwiegervater hatte vor vier Monaten einen Schlaganfall erlitten und seitdem befand sich Durands Frau im schweizerischen Lauterbrunnen und führte ihren alten Eltern den Haushalt. Kaserniert im Vatikan und mit extremen Dienstzeiten, hatte Durand nur sehr wenige Freunde und in Cavelli, der ebenfalls im Vatikan lebte, ohne Kleriker zu sein, und der vor einigen Jahren seine Frau Elena durch einen Verkehrsunfall verloren hatte, schien er einen natürlichen Seelenverwandten zu erblicken. Schon des Öfteren hatte er Cavelli zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen. Das erste Mal hatte Cavelli die Einladung auch gerne angenommen, doch so sehr er auch Durand als wichtige Figur des Vatikanstaates schätzte, so langweilig und ermüdend fand er ihn als Privatperson. Die umständliche Art, in der es Durand verstand, uninteressante Geschichten zu erzählen, langweilte ihn tödlich. Bereits mehrfach hatte er sich seitdem mit fadenscheinigen Begründungen vor Einladungen von Durand gedrückt, aber er spürte, dass die nächste Ablehnung eine zu viel sein würde, falls er Durand nicht vor den Kopf stoßen wollte. Er würde hingehen müssen.
Aber bitte nicht allein. Beatrice Kingsley war nicht nur der klügste Mensch, den er kannte, sondern auch der Mittelpunkt jeder Gesellschaft. Nicht nur wegen ihrer äußeren Erscheinung, wegen der sie die älteren Kollegen als »Sophia Loren in schön« und die Studenten als »Miss Sapienza« bezeichneten, sondern auch wegen ihrer geistreich-witzigen Konversation. Cavelli setzte darauf, dass Beatrice für sie alle drei reden würde, was den morgigen Abend – kulinarisch gesprochen – von einem zähen Käsefondue in prickelnden Champagner verwandeln würde.
Doch im Moment sah es nicht danach aus, als ob dies auch tatsächlich geschehen würde.
»Besuche im Vatikan sind einfach nicht mein Ding, Don«, fuhr sie fort. »Du weißt ja, wenn es um Religion geht, sehe ich es genau wie Oscar Wilde: Religion ist, wenn ein Blinder in einem stockdunklen Raum eine schwarze Katze sucht – und sie findet.«
Cavelli lachte pflichtschuldigst über den alten Witz und schüttelte den Kopf. »Wenn es um einen Bischof oder Kardinal ginge, würde ich gar nicht wagen, dich zu fragen, aber dies ist der Chef der Schweizer Garde. Das ist etwas völlig anderes.«
»Also, ich weiß wirklich nicht, Don ...«
Beatrice ließ sich von Cavelli noch eine Weile bitten (sie liebte es, sich bitten zu lassen), dann sagte sie gnädig zu. Nicht aus übergroßer Lust, aber ihr Ehemann war noch weniger ein Freund von gesellschaftlichen Einladungen als Cavelli und überdies auf einem fünftägigen Seminar in Edinburgh. Außerdem war sie ewig nicht aus gewesen. Warum also nicht? Auch wenn sie aus Cavellis blumigen Umschreibungen schon klar herausgehört hatte, dass nicht allzu viel Spaß zu erwarten war. Vor allem aber wollte sie Cavelli nicht im Stich lassen.
Und dann war da auch noch ein kleines bisschen Neugier.
VI
»Ich möchte einen Wagen mieten.«
Die junge Angestellte am Schalter der Avis-Autovermietung von Siena zuckte zusammen, als sie Rajivs Gesicht erblickte. Krampfhaft versuchte sie, Normalität vorzutäuschen. »Sehr gerne. Für wie lange?«
»Vierundzwanzig Stunden müssten genügen«, antwortete Rajiv und lächelte sie an. Er war es gewohnt, dass die Menschen so reagierten, wenn sie ihn zum ersten Mal sahen. Viele dachten, dass die Entstellungen in seinem Gesicht und an seinen Händen Verbrennungen oder die Folgen einer schweren Hautkrankheit waren, und solange sie nicht explizit nachfragten, klärte Rajiv sie auch nicht auf.
Er war strenggläubiger Katholik, er wollte nicht lügen, aber wo stand geschrieben, dass man Fragen beantworten musste, die niemand gestellt hatte? Wenn man ihn direkt darauf ansprach, sagte er die Wahrheit, nämlich, dass er die Hansenkrankheit gehabt hatte, aber schon seit Jahren davon geheilt war. Doch auch das versetzte ihm jedes Mal einen kleinen Stich. Es handelte sich dabei zwar um die Wahrheit, aber ihm war sehr wohl bewusst, dass, abgesehen von Medizinern, niemand je von der Hansenkrankheit gehört hatte, zumindest nicht unter diesem Namen. Den anderen Namen, den veralteten, den, welchen alle kannten, nahm er nie in den Mund: Lepra.
VII
»Ich schwöre, treu und redlich und ehrenhaft zu dienen dem regierenden Papst und seinen rechtmäßigen Nachfolgern und mich mit ganzer Kraft für sie einzusetzen. Bereit, wenn es erheischt werden sollte, selbst mein Leben für sie hinzugeben. Ich übernehme dieselbe Verpflichtung gegenüber dem Heiligen Kollegium der Kardinäle während der Sedisvakanz des Apostolischen Stuhles.
Ich verspreche überdies dem Herrn Kommandanten und meinen Vorgesetzten Achtung, Treue und Gehorsam.
Ich schwöre, all das zu beobachten, was die Ehre meines Standes von mir verlangt.
Ich, Gardist Elias Monthey, schwöre, all das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wahr mir Gott und seine Heiligen helfen.«
Es war bereits einige Wochen her, seit Gardist Monthey während der feierlichen Zeremonie auf dem Damasushof drei Finger gehoben, die andere Hand auf die Fahne der Garde gelegt und seinen Treueeid auf den Heiligen Vater geschworen hatte, aber noch immer durchfuhr ihn ein Gefühl des Stolzes, wenn er an diesen glorreichen Moment dachte.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: