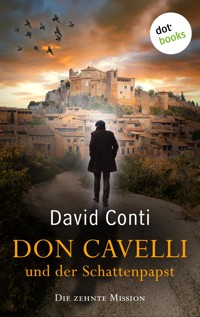Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Don Cavelli
- Sprache: Deutsch
Ein dunkler Verdacht – eine unglaubliche Verschwörung? Der Vatikan-Krimi »Don Cavelli und die Wege des Herrn« von David Conti als eBook bei dotbooks. Wie ein Erdbeben erschüttert diese Nachricht den Kirchenstaat: Ein Beamter der Vatikanbank soll diese seit vielen Jahren um Milliarden geprellt haben – ein Mann, der nun tot ist. Doch Geschichtsprofessor Don Cavelli, der im Vatikan exklusives Wohnrecht besitzt, kann nicht glauben, dass der stets integre Aldo Volpi ein Verbrechen von so gewaltigen Ausmaßen begangen hat – und auch Cecilia Volpi glaubt fest daran, dass ihr Ehemann nur als Sündenbock herhalten soll. Die Suche nach der Wahrheit führt Cavelli und die schöne Witwe bald nach Venedig und bis ins ferne Kuba. Dabei beschleicht Cavelli mehr und mehr das dunkle Gefühl, auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden … Aber verbirgt sich dahinter der Vatikan, fremde Geheimdienste – oder ein weitaus gefährlicherer Gegner, der sich noch in Schatten hüllt? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der actiongeladene Vatikan-Thriller »Don Cavelli und die Wege des Herrn« von David Conti ist der sechste Band der Bestsellerreihe, in der alle Bände unabhängig voneinander gelesen werden können. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wie ein Erdbeben erschüttert diese Nachricht den Kirchenstaat: Ein Beamter der Vatikanbank soll diese seit vielen Jahren um Milliarden geprellt haben – ein Mann, der nun tot ist. Doch Geschichtsprofessor Don Cavelli, der im Vatikan exklusives Wohnrecht besitzt, kann nicht glauben, dass der stets integre Aldo Volpi ein Verbrechen von so gewaltigen Ausmaßen begangen hat – und auch Cecilia Volpi glaubt fest daran, dass ihr Ehemann nur als Sündenbock herhalten soll. Die Suche nach der Wahrheit führt Cavelli und die schöne Witwe bald nach Venedig und bis ins ferne Kuba. Dabei beschleicht Cavelli mehr und mehr das dunkle Gefühl, auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden … Aber verbirgt sich dahinter der Vatikan, fremde Geheimdienste – oder ein weitaus gefährlicherer Gegner, der sich noch in Schatten hüllt?
Über den Autor:
David Conti wurde 1964 in Rom geboren und verbrachte dort – unterbrochen von einem mehrjährigen Aufenthalt in München – seine Kindheit und Jugend. Nach einem Studium der Theologie, Geschichte und Germanistik in Perugia, Yale und Tübingen, war er mehrere Jahrzehnte lang in verantwortlicher Position bei einer internationalen Institution in Rom tätig. Seit seinem beruflichen Ausscheiden aus dieser, verbringt er seine Zeit mit Reisen und dem Schreiben der »Don Cavelli«-Reihe. Er lebt abwechselnd in Castel Gandolfo, Zürich und Santa Barbara.
In der »Don Cavelli«-Reihe erschienen bei dotbooks bisher:
»Don Cavelli und der tote Kardinal – Die erste Mission«
»Don Cavelli und der letzte Papst – Die zweite Mission«
»Don Cavelli und die Hand Gottes – Die dritte Mission«
»Don Cavelli und das Sizilianische Gebet – Die vierte Mission«
»Don Cavelli und der Apostel des Teufels – Die fünfte Mission«
»Don Cavelli und die Wege des Herrn – Die sechste Mission«
Alle Romane sind sowohl als eBooks als auch als Printausgaben erhältlich. Weitere Bände sind in Vorbereitung.
***
Originalausgabe April 2022
Copyright © der Originalausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-588-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Don Cavelli 6« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Conti
Don Cavelli und die Wege des Herrn
Die sechste Mission
dotbooks.
»Ich begann die Revolution mit 82 Mann. Wenn ich es nochmal tun müsste, würde ich es mit 10 oder 15 absolut überzeugten Männern tun. Es ist egal, wie klein man ist, wenn man überzeugt ist und einen Plan hat.«
Fidel Castro
Prolog
Von der Stadt würde nicht viel übrigbleiben. Durch das Abschmelzen des Gletschers würde eine fünfhundert Meter hohe Tsunamiwelle entstehen. Diese, verbunden mit einem Erdbeben, das von Seismologen auf eine Stärke von 7,0 berechnet worden war, wäre das Ende. Irgendwann würde es passieren, so viel war sicher.
Barnabas Cole zog den Thermobecher aus der Getränkehalterung des schwarzen SUV und nahm einen Schluck Kaffee. Irgendwie klang diese Tsunami-Story unglaubwürdig. Tsunamis! Die gab es irgendwo am Ende der Welt, aber nicht in Amerika. Andererseits befand er sich hier zwar in Amerika, aber die Südwestküste Alaskas war gewissermaßen auch so etwas wie das Ende der Welt. Wie hatte die ehemalige Gouverneurin und frühere Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin gesagt: »Von hier aus kann man Russland sehen.« Eine Aussage, die in den Medien viel Spott ausgelöst hatte, aber sie stimmte. Trotzdem war die Vorstellung eines Tsunamis seltsam. Cole hoffte, dass diese Katastrophe nicht mehr zu seinen Lebzeiten eintreten würde. Auch wenn er, fünfzig Meilen weiter in der FBI-Außenstelle Anchorage, wahrscheinlich nicht viel davon mitkriegen würde. Aber es wäre wirklich schade um die kleine Stadt. Whittier, direkt am Prinz-William-Sound gelegen, mit seinem malerischen kleinen Boots-Hafen und von schneebedeckten Bergen umgeben, war geradezu eine Postkartenidylle.
Cole gähnte und schaltete das Licht ein, während sein Kollege Abegg seine Sonnenbrille absetzte. Sie fuhren jetzt in den Anton Anderson Memorial Tunnel. Er war mit seiner Drei-Meilen-Strecke der längste Bahn- und Straßentunnel Nordamerikas, führte direkt durch den Maynard Mountain und stellte die einzige Möglichkeit dar, Whittier auf dem Landweg zu erreichen. Letzteres schien die kleine Stadt für gewisse Leute attraktiv zu machen. Barnabas Cole spürte, wie sein Mund trocken wurde. Das FBI musste selbstverständlich in den gesamten Vereinigten Staaten präsent sein, aber die Außenstelle in Anchorage war nicht gerade New York oder Miami. Hier ging es verhältnismäßig ruhig zu. Ein Anruf aus Washington, wie heute Morgen, kam nur selten vor. Sehr selten. Der Mann, hinter dem sie nun her waren und der sich in Whittier aufhalten sollte, war offenbar ein europäischer Geschäftsmann, den das FBI bislang zwar mit keiner Straftat in Verbindung bringen konnte, dessen Flugreisen an bestimmte Orte, zu bestimmten Zeiten, in bestimmten Abständen aber einem Algorithmus im Zentralcomputer des FBI nicht gefallen hatten, und der hatte den Mann infolgedessen als »Person of Interest« eingestuft und eine routinemäßige Überprüfung angeordnet. Barnabas Cole fragte sich, wann die Künstliche Intelligenz endgültig die Herrschaft übernommen haben würde, während Special Agents wie er und Abegg gerade noch gut genug waren, sich die Schuhsohlen abzulatschen. Lange konnte es nicht mehr dauern, im Grunde war es schon jetzt so weit. Dem Computer war es egal, ob sie hier ihre Zeit verschwendeten, ihn interessierte nur die mathematische Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses. Die Realität sah allerdings oft anders aus.
Inzwischen hatten sie den Tunnel hinter sich gelassen, und kurz darauf lenkte Cole den SUV auf den Parkplatz hinter dem altmodischen Hafengebäude. Von hier war ihr eigentliches Ziel schon zu sehen: die Begich Towers, eines der ungewöhnlichsten Gebäude Amerikas. Anfang der fünfziger Jahre als eines der größten Gebäude Alaskas erbaut, war es für die Armee als »Stadt unter einem Dach« konzipiert worden. Seit den siebziger Jahren wurde das vierzehnstöckige Gebäude für zivile Zwecke genutzt, aber noch immer nach dem alten Konzept: Nicht nur die gesamte Stadtverwaltung und praktisch alle Geschäfte waren dort untergebracht, auch sämtliche zweihundertzwanzig Einwohner von Whittier lebten darin. Die Schule lag nicht im Gebäude, war aber über einen Tunnel zu erreichen. Außerhalb gab es nur noch einen weiteren Supermarkt, ein paar Cafés, ein Museum und den Bootshafen. Für Personen, die befürchteten, von den Behörden – oder schlimmeren Organisationen – verfolgt zu werden, war dies der ideale Unterschlupf. Wenn man es darauf anlegte, entging einem hier kein Neuankömmling.
Barnabas Cole wuchtete seine hundertfünf Kilo aus dem Wagen und machte sich mit Agent Abegg auf den Weg zu den Begich Towers. Die Luft schmeckte salzig, und ein eiskalter Wind pfiff ihnen um die Ohren. Abegg schlug den Kragen seiner Windjacke hoch. Cole amüsierte das immer noch. Abegg war nicht in Alaska aufgewachsen. Wenn es kalt war, fror er. Und da es immer kalt war, fror er immer, Cole hingegen genoss die Kälte, sie hielt ihn wach. Nach zehn Minuten Fußmarsch erreichten sie das Gebäude. Er zog sein Notizbuch aus der Jacke und versuchte, seine Notizen zu entziffern. Nach FBI-Informationen hielt sich der Gesuchte in Apartment 14-3 auf. Cole drückte im Lift auf »14«. Er registrierte, dass der Knopf gleich über der »12« war. Die vierzehnte Etage war also in Wirklichkeit die dreizehnte. Natürlich. Niemand wollte in einer dreizehnten Etage wohnen, daher die Manipulation bei den Knöpfen. Den wenigsten fiel das auf. In Passagierflugzeugen kam dasselbe Prinzip zum Tragen. Wer in Reihe 14 saß, befand sich in Wirklichkeit in Reihe 13. Die Welt wollte betrogen sein. Allerdings, vielleicht brachte es dem Gesuchten ja heute wirklich Pech, dass er das Apartment in der dreizehnten Etage genommen hatte.
Sie hatten die Tür erreicht, Abegg klingelte, und als sich nichts rührte, ein zweites Mal. Niemand öffnete. Abegg machte sich auf, um den Hausmeister zu holen, während Cole vor der Tür die Stellung hielt. Fünf Minuten später betraten sie die Wohnung. Es handelte sich offenbar um eine Unterkunft für Kurzzeitgäste. Sie war spartanisch eingerichtet. Nur das Allernötigste. Ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, Kühlschrank, Fernseher. Nicht mal ein Kleiderschrank. Ein typischer Mafiaunterschlupf, in dem man Personen, die von der Polizei gesucht wurden, so lange unterbringen konnte, bis man einen Weg gefunden hatte, sie außer Landes zu bringen. Cole und Abegg durchkämmten die Wohnung, sie war leer. Keine Kleidung, kein Gepäck, keine persönlichen Gegenstände. In der Spüle hatte jemand Papiere verbrannt. Im Kühlschrank stand eine angebrochene Tüte Milch, das Abfülldatum darauf war vom Tag zuvor. Also heute erst gekauft. Sie hatten den Mann offenbar nur um Stunden verpasst.
Während sie zum Wagen zurückgingen, fragte sich Cole, wohin der Mann wohl unterwegs sein mochte. Er tippte auf Russland und zwar auf dem Seeweg.
Mit der zweiten Vermutung lag er sogar richtig, doch der kleine Frachter, auf dem sich der Mann, der nur vier Minuten vor ihrem Eintreffen das Apartment verlassen hatte, nun befand, hatte eine sehr viel weitere Fahrt vor sich. In zwei Wochen würde er in Panama sein. Dann war der schwierigste Teil geschafft.
Erstes Buch
I
Sechs Wochen später
Don Cavelli saß an einen Baum gelehnt auf dem Rasen mit Blick auf die Rückseite der Casina Pio IV., einem seiner Lieblingsplätze in den Vatikanischen Gärten. Die Casina war Mitte des sechzehnten Jahrhunderts als Sommerresidenz des Papstes erbaut worden. Heute diente die reich verzierte Villa mit dem prächtigen Innenhof als Päpstliche Akademie der Wissenschaften. Ein Widerspruch in sich, wie manche fanden. Religion und Wissenschaft – wie passte das zusammen? Offenbar sehr gut. Dieser Ansicht war nicht nur die Kirche, die darin keinen Gegensatz sah, sondern auch Spitzenwissenschaftler wie der Nobelpreisträger Werner Heisenberg, der gesagt hatte: »Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, doch auf dem Grunde des Bechers wartet Gott.« Allerdings kamen die hochkarätigen Akademiemitglieder (durch die Bank Leute von Weltruf) nur sehr selten zusammen. Normalerweise stand das Bauwerk leer, und nachmittags, wenn Touristen keinen Zutritt zu den Gärten hatten, war es hier vollkommen ruhig. Die tempelartige Fassade mit den lebensgroßen Statuen, dem großen Wasserbassin und den zwei kleinen Wasserfällen links und rechts sowie der Duft von Oleander in der Luft übten eine beruhigende Wirkung auf Cavelli aus. Von allen vatikanischen Privilegien, die Cavelli, wie alle seine Vorfahren seit fünfhundert Jahren, genoss, zum Dank für eine unbekannte, aber höchstwahrscheinlich blutrünstige Tat, die sein Urahn Umberto Cavelli für Papst Julius II. ausgeführt hatte, war ihm die unbeschränkte Benutzung der Vatikanischen Gärten das kostbarste. Die Gärten waren ein Paradies, eine grüne Oase umgeben von hohen Mauern im Zentrum von Rom. Eine Welt für sich. Ganz besonders an einem so herrlichen Sommertag wie diesem.
Cavelli blickte auf seine Notizen. Zweimal in der Woche unterrichtete er als Geschichtsprofessor an der Sapienza, der ältesten Universität Roms, »Die Geschichte des Papsttums«.
In seiner nächsten Vorlesung würde es um die Kardinäle Richelieu und Mazarin gehen, die über Jahrzehnte die eigentlichen Herrscher Frankreichs gewesen waren. Cavelli wusste aus Erfahrung, dass alles, was nicht in Italien stattgefunden hatte, sich bei seinen Studenten nicht der vollen Aufmerksamkeit erfreute. Daher versuchte Cavelli solche Themen, noch mehr als sonst, unterhaltsam und überraschend zu gestalten. Soeben hatte er sich Notizen zu den letzten Wochen Richelieus gemacht. Der alte Kardinal war bereits vom Tode gezeichnet, konnte aber weder von der Macht noch vom Prunk lassen. Da er zu krank war, in einer Kutsche zu fahren, reiste er in einem fahrenden Haus, das von vierundzwanzig Männern gezogen wurde. Dabei nahm er auf nichts Rücksicht, was ihn hätte aufhalten können. Er ließ nicht nur eine Bresche in die Stadtmauer von Paris sprengen, sondern auch ganze Häuser niederreißen, die im Weg standen. Cavelli wusste, dass das vielen seiner Studenten gefallen würde. Zum einen, weil es wie eine Szene aus einem Kinofilm wirkte, und zum anderen, weil es ihre Klischeevorstellung von der Rücksichtslosigkeit der Katholischen Kirche bestätigte. Cavelli fragte sich, wie sie im Gegensatz dazu auf Kardinal Jules Mazarin reagieren würden, der immerhin ursprünglich Italiener war und eigentlich Giulio Mazarini hieß. Er hatte etwas geleistet, was in der Weltgeschichte einmalig dastand: Im Mantuanischen Erbfolgekrieg war die Piemontesische Stadt Casale von den Franzosen belagert worden. Das französische und das italienische Heer standen sich bereits gegenüber; die Schlacht stand unmittelbar bevor. Buchstäblich in letzter Sekunde war Mazarin, der gerade einmal sechsundzwanzigjährige Adjutant des päpstlichen Legaten, auf das Schlachtfeld geritten und hatte beide Seiten an den Verhandlungstisch gebracht, wo ein Friedensabkommen geschlossen wurde. Der Krieg war abgesagt.
Cavelli machte sich noch eine weitere Stunde lang Notizen zur historischen Bedeutung Mazarins. Zum Schluss überlegte er, ob er seinen Studenten auch noch von Mazarins etwas speziellem Humor erzählen sollte, der unter anderem darin gipfelte, seiner dreizehnjährigen Nichte Marie-Anne Mancini vorzugaukeln, sie sei schwanger, indem er heimlich ihre Kleider immer enger machen und ihr zum Schluss in der Nacht ein neugeborenes Kind ins Bett legen ließ. Cavelli entschied sich dagegen und sah auf seine Armbanduhr. Es war kurz nach sechzehn Uhr. Er erinnerte sich, dass er noch einige Bankgeschäfte zu erledigen hatte. Die Osterfeiertage standen vor der Tür, und wenn er die Angelegenheiten vorher noch regeln wollte, hatte es noch heute vor sechzehn Uhr dreißig zu sein. Er stand auf und machte sich auf den Weg. Während der Osterfeiertage war es in Rom und besonders um den Vatikan herum noch überlaufener als sonst. Als Anwohner blieb man besser zu Hause oder fuhr selbst in den Urlaub. Es war Hochsaison für die Taschendiebe auf dem Petersplatz, die dafür sorgten, dass der Vatikan statistisch gesehen das kriminellste Land der Welt war, zumindest gemessen an der Anzahl der Straftaten im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Und die Diebe, von denen allerdings kein einziger Bürger des Vatikan war, ließen sich ständig etwas Neues einfallen. Der neueste Trick bestand darin, zu zweit hinter telefonierenden Touristen herzugehen, und während der eine dem ahnungslosen Opfer von hinten das Smartphone aus der Hand nahm, versetzte ihm der andere einen kräftigen Stoß in den Rücken. Der Tourist stolperte ein paar Schritte vorwärts, und wenn er sich zwei Sekunden später umdrehte, war niemand mehr hinter ihm. Er konnte sich natürlich denken, dass irgendeine der Personen in der Nähe sein Handy hatte, aber es war bereits zu spät, etwas zu unternehmen.
Zu den zahlreichen Touristen kamen noch viele Gläubige, die am Karfreitags- oder Ostergottesdienst im Petersdom teilnehmen wollten. Karfreitags konnte man dort zuweilen amüsante Szenen erleben: Manche Gläubige, oft solche, die Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, nicht zur Beichte gegangen waren, hatten es sich, nach dem Motto »Wenn schon, denn schon« in den Kopf gesetzt, Karfreitag im Petersdom zur Beichte zu gehen, quasi als religiöser Höhepunkt der Reise. Viele von ihnen wussten nicht, dass Karfreitags der Papst selbst in einem der Beichtstühle saß. Cavelli hatte schon verschiedene Male Menschen fluchtartig den Beichtstuhl verlassen oder auch nach durchstandener Beichte totenbleich daraus hervorwanken sehen.
Weit hatte Cavelli nicht zu laufen. Die Bank, bei der sich ein Großteil seines Vermögens befand, besaß nur eine zentrale Geschäftsstelle und keine einzige Filiale, war aber dennoch eine der bekanntesten Banken der Welt: das IOR oder Istituto per le Opere di Religione, das Institut für religiöse Werke, bekannter als Vatikanbank, nur einen Steinwurf von dem Palazzo in den Vatikanischen Gärten entfernt, in dem Cavelli lebte.
Er betrat den hässlichen, halbrunden Turm Nikolaus V. aus dem fünfzehnten Jahrhundert, der direkt an die Rückseite des Apostolischen Palastes gebaut und für seinen Durchmesser viel zu niedrig war, und durchquerte den Eingangsbereich, der ganz und gar nichts Mittelalterliches an sich hatte, sondern in seiner ultramodernen Art eher an einen Science-Fiction-Film erinnerte. Dann betrat er die runde Schalterhalle, die sich, abgesehen von dem prächtigen Marmorboden sowie einem Kruzifix und einem Bild des Heiligen Vaters an der Wand, in nichts von einer x-beliebigen Bankfiliale mit einer Reihe von Schaltern unterschied, an denen überall Kunden warteten. Priester, Nonnen, verschiedene Angestellte des Vatikan und ein Erzbischof. Cavelli stellte sich an der kürzesten Schlange an und hielt Ausschau nach seinem Lieblingskassierer Aldo Volpi, dessen unkomplizierte Art und skurrilen Humor er schätzte – beides Eigenschaften, mit denen die meisten Mitarbeiter der Vatikanbank nicht gerade überreichlich gesegnet waren. Außerdem kannte sich Volpi nach all den Jahren mit Cavellis Belangen bestens aus, so dass lange Erklärungen bei ihm nicht nötig waren. Doch zu seinem Bedauern konnte Cavelli ihn nirgendwo erblicken. Normalerweise löste er dieses Problem, indem er die Person am Schalter bat, Volpi herbeizuholen, und für gewöhnlich wurde diesem Wunsch entsprochen, denn inzwischen hatte jeder verstanden, dass dies allen Beteiligten einige Zeit sparte. Heute jedoch war es anders. Die grauhaarige Kassiererin sah Cavelli erschrocken an: »Haben Sie es denn noch nicht gehört, Signor Cavelli?«
»Was gehört?«
Die Kassiererin beugte sich etwas über den Schalter, als verrate sie ein Geheimnis: »Signor Volpi ist tot.«
»Wie? Was ist denn ...?«
»Herzinfarkt. Seine Frau kam von der Arbeit nach Hause, da lag er im Wohnzimmer auf dem Teppich. Sie hat sofort den Notarzt gerufen und noch Wiederbelebungsversuche unternommen, sie ist ja Krankenschwester, wissen Sie, aber es war alles vergeblich. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Es ist furchtbar.«
»Mein herzlichstes Beileid« sagte Cavelli zur Kassiererin, was er selbst etwas seltsam fand, aber er meinte es ernst, und es war sonst niemand da, zu dem er es hätte sagen können. Während sie sich beeilte, Cavellis Bankformalitäten zu erledigen, plapperte sie die ganze Zeit weiter über die tragischen Umstände von Volpis Tod. »Er war doch erst Anfang fünfzig und hat nicht mal geraucht«, sagte sie schließlich. »Das ist so ungerecht. Er war ein so wunderbarer Kollege. Es trifft immer die nettesten.«
Cavelli nickte.
Weder er noch die Kassiererin wussten es zu diesem Zeitpunkt, aber dies war das letzte Mal, dass innerhalb der Mauern der Vatikanbank etwas Positives über Aldo Volpi gesagt worden war.
II
»Das Beste, was der Katholischen Kirche nach Jesus Christus widerfahren ist, war Bernardino Nogara.«
Diese Äußerung mochte den meisten Gläubigen wie Blasphemie erscheinen, zumal sie von Bernardino Nogara noch nie im Leben etwas gehört hatte, doch als der bekannte New Yorker Kardinal Francis. J. Spellman 1958 diesen Ausspruch tat, konnte er sicher sein, im Vatikan auf Zustimmung zu treffen, und daran hatte sich bis zum heutigen Tag nicht viel geändert.
Nogara war 1929 Chef der Administratio Patromonii Sedis Apostolicae (APSA), der neu gegründeten Vermögensverwaltung des Vatikan, geworden und hatte sich sogleich daran gemacht, die Ausgleichszahlungen, die der Vatikan im Zuge der mit Benito Mussolini geschlossenen Lateranverträge von Italien erhalten hatte, zu investieren. Mit großem Erfolg: Bis zu seinem Tod im Jahre 1958 hatte Nogara daraus ein Vermögen von über zwei Milliarden Dollar gemacht, was mehr als dem Tausendfachen der ursprünglichen Summe entsprach.
1968 allerdings führte die italienische Regierung für den Vatikan die 1942 abgeschaffte Dividendenbesteuerung wieder ein. Rückwirkend. Eine Katastrophe, die ein Finanzloch in – nach heutigem Kurs – Milliardenhöhe riss. Aus purer Not gestattete Papst Paul VI. dem IOR eine waghalsigere Finanzpolitik, woraufhin sich dieses an den bestens vernetzten Bankier Michele Sindona wandte, den das amerikanische Time Magazine als erfolgreichsten Italiener seit Mussolini bezeichnet hatte – was als Kompliment gemeint war.
Die katholische Kirche war von Anfang an äußerst geschäftstüchtig gewesen, und sie hatte auch gewusst, wie man das Vermögen zusammenhält. So wurde beispielsweise das Zölibat nicht, wie die allermeisten dachten, aus einem religiösen Grund eingeführt, sondern tatsächlich, um zu verhindern, dass Kirchenmänner legitime Kinder zeugten oder Witwen hinterließen, die Ansprüche auf das Erbe hätten erheben können. Auf diese Weise fiel der ganze Nachlass immer an die Kirche. Das war eine höchst effektive Maßnahme, wenn auch eine äußerst simple und in keiner Weise vergleichbar mit der Raffinesse, mit der Sindona zu Werke ging. Mit Hilfe der Mafia und höchsten Regierungsmitgliedern schuf Sindona ein undurchschaubares und hochprofitables Finanzgeflecht, das weltweiten Einfluss hatte. 1973 bezeichnete der neunundzwanzig Mal vor Gericht freigesprochene und siebenfache Ministerpräsident Giulio Andreotti, der beim IOR geheime Konten im Wert von mindestens sechzig Millionen Dollar unterhielt, Michele Sindona als den »Retter der Lira«. Zum ersten Mal publik wurden die undurchsichtigen Finanzmanöver beim Zusammenbruch der römischen Banco Ambrosiano. Ihr Direktor Roberto Calvi, der als »Bankier Gottes« berühmt-berüchtigt wurde, hatte das IOR in höchst dubiose Geschäfte verwickelt, angeblich ohne dessen Wissen. Als im Jahre 1982 die ganze Sache aufflog und er, um seinen eigenen Kopf zu retten, damit drohte, auszupacken, ließ ihn die Mafia töten. Man fand seine Leiche erhängt an der Blackfriars Bridge in London. Seine Sekretärin kam am selben Tag in Rom durch einen Sturz aus einem Bürofenster ums Leben. Michele Sindona wurde wegen Mordes – in einer anderen Sache – schuldig gesprochen und starb 1986 im Gefängnis an einem mit Zyanid vergifteten Kaffee. Eine Untersuchung durch den Vatikan sprach das IOR von jeder juristischen Schuld frei, räumte aber eine moralische Schuld ein und zahlte freiwillig zweihundertvierzig Millionen Dollar an von Calvi geprellte Gläubiger.
Versuche, das Ganze auf eine solide Basis zu stellen und zu beaufsichtigen, scheiterten einerseits an der Komplexität der Geschäfte, welche die damit beauftragen Kirchenherren oft überforderte, deren finanzielle Kompetenz wohl wenig über die von Papst Leo XIII. hinausging, der seinerzeit das gesamte Gold der Kirche in einer Kiste unter seinem Bett aufbewahrte. Noch immer gilt die unumstößliche Regel, dass allerhöchste Positionen im Zweifelsfall immer von einem Kleriker bekleidet werden müssen, selbst wenn ein Laie sich darin besser auskennt. Wenn dann Probleme auftauchen, heißt die Devise der Kurie: »Lieber gar nichts tun, als einen Fehler begehen«. Man wartet einfach ab, wobei man nach außen versichert, dass es ein aufmerksames und tätiges Warten sein wird.
Wenn die Probleme schließlich unübersehbar werden, übergibt man diese gerne an eine Kommission, die die nächsten zwanzig Jahre damit verbringt, die Sache zu untersuchen. Nichts ist eilig, man denkt in Jahrhunderten und Jahrtausenden.
Stellt sich schließlich wirklich heraus, dass ein eklatantes Fehlverhalten vorliegt, tut sich die katholische Kirche schwer, jemanden zu bestrafen. »Wir sind alle nur Menschen«, lautet ein Lieblingswort im Vatikan. Niemand soll sein Gesicht verlieren. Zwar gelten die vatikanischen Gesetze, aber im Zweifelsfall findet man eben eine kreative Ausnahmeregelung, die Kurie wählt immer den geräuschlosesten Weg. In der größten Not greift man auf das Motto Promoveatur ut admoveatur zurück: »Er wird befördert, damit man ihn loswird.« Natürlich schafft man so sehr oft gleich ein neues Problem.
Die große Wende kam erst mit dem Pontifikat von Benedikt XVI.: Es wurde begonnen, alles zu durchleuchten, hochrangige Mitarbeiter wie Angelo Caloia wurden entlassen. Das IOR hörte auf, eine Offshorebank zu sein, mit der EU wurde eine Vereinbarung getroffen, die festschrieb, dass die Vatikanbank künftig auch dem Gesetz gegen Geldwäsche unterliegen würde. Viel war seitdem unternommen und von Benedikts Nachfolger fortgeführt worden. Doch bis zur absoluten Makellosigkeit war es ein langer Weg, dessen Ende nicht in Sicht war.
III
Als die Sea-Princess nach sechzehn Stunden den Panamakanal endlich durchquert hatte, atmete Dante Anistasidis auf. Er hieß nicht wirklich so, aber so stand es in einem der hervorragend gefälschten Pässe, die er mit sich führte und die jeder noch so strengen Grenzkontrolle standhalten würden. Allerdings gab es ja inzwischen auch noch die Kameras an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen neuralgischen Punkten, die ihre Live-Bilder an automatische Gesichtserkennungssysteme weiterleiteten. Doch waren die nicht wirklich ein Problem, wenn man wusste, wie sich die Dinger austricksen ließen: Ein breites Grinsen veränderte die Abstände von Mund, Nase, Augen, Ohren und Augenbrauen so signifikant, dass das System ins Leere lief. Er wusste nicht mehr, auf wie vielen Flughäfen er sein – wie er es nannte – biometrisches Grinsen aufgesetzt hatte, aber anscheinend hatte es gewirkt. Nur in wenigen Augenblicken hatte er es vergessen, aber die waren anscheinend allen Kameras entgangen. Er hatte sich nie Sorgen gemacht. Bis gestern. Der Panamakanal war nur neunundvierzig Meter breit, er war das Nadelöhr seiner Reise gewesen, und es hatte ihn nervös gemacht, nach beiden Seiten nur ein paar Meter vom Land entfernt zu sein. Natürlich wussten die Strafverfolgungsbehörden nicht, dass er sich an Bord der Sea-Princess befand, aber es war dennoch ein scheußliches Gefühl gewesen. Doch das war nun vorbei. Dante Anistasidis stand am Bug des Schiffes und ließ sich die salzige Meeresbrise der Karibik ins Gesicht wehen. Sie fühlte sich wie Freiheit an. Er dachte an die Tage in Alaska. Er hatte jede einzelne Sekunde davon gehasst. Diese Kälte! Aber in zwei oder drei Wochen würde er die letzte Etappe seiner langen Reise erreicht haben, doch zuvor musste dort noch einiges für ihn vorbereitet werden. In der Zwischenzeit würde er vollständig von der Bildfläche verschwinden. Es war wie Magie. Er grinste bei dem Gedanken. In der Tat steckte der weltberühmte Illusionist David Copperfield dahinter. Und genauso, wie die allermeisten Menschen nicht wussten, wie Copperfield es anstellte, wenn er die Freiheitsstatue verschwinden ließ oder andere nicht weniger spektakuläre Illusionen vorführte, wussten sie nicht, dass er auch ein karibisches Urlaubsparadies kreiert hatte: Musha Cay and the Islands of Copperfield Bay bestand aus elf Inseln mit je einer Luxusvilla. Das Konzept war einzigartig; der Werbeslogan brachte es auf den Punkt: »Reservieren Sie Ihr eigenes privates Inselparadies. Die einzigen anderen Gäste sind die, die Sie selbst einladen.« Es war ein Privatresort für einen ganz besonderen Kundenkreis. Menschen, die sehr reich waren und die nicht von anderen gesehen werden wollten. Beides traf auf Dante Anistasidis zu.
IV
Sechs Wochen später
Don Cavelli saß in einem großen Büro im obersten Stockwerk des Governatorats inmitten der Vatikanischen Gärten und fragte sich, was man von ihm wollte. Er war schon unzählige Male im Governatorat, der Regierung des Vatikanstaates, gewesen, jedoch noch nie in diesem Büro. Auch den Mann, der hinter dem Schreibtisch saß, hatte er noch nie getroffen. Er gehörte somit nicht zur Kurie, sondern kam von außen. Dennoch saß er hier, was überaus seltsam oder doch zumindest reichlich ungewöhnlich war. Meist handelte es sich um etwas Unerfreuliches, wenn man Cavelli, wenn auch stets mit vollendeter Höflichkeit, ersuchte, hier zu erscheinen. Immer wieder gab es subalterne Angehörige der Kurie, die meinten, dem Vatikan oder gar dem Heiligen Vater einen guten Dienst zu erweisen, wenn sie versuchten, Cavellis vatikanische Privilegien zurechtzustutzen. Cavelli regte sich schon lange nicht mehr darüber auf. Sein Wohnrecht in einem Vatikanischen Palazzo, sein Recht, jederzeit praktisch überall Zutritt zu haben, und eine ganze Reihe anderer Dinge waren 1527 in einem hochoffiziellen Dokument von Papst Julius II. niedergelegt worden und galten offiziell bis zum »Jüngsten Tag«, was in diesem Fall keine Redewendung darstellte, sondern wörtlich gemeint war. Die Urkunde lag wohlverwahrt in einem Banksafe in Rom und war juristisch unanfechtbar. Aber vor allem, und das konnten manche Kurienmänner offenbar nicht begreifen, war es ein Mosaikstein in der Gesamtkonstruktion des Vatikan. Wenn man erst einmal anfing, Entscheidungen eines früheren Papstes in Frage zu stellen, wo würde das enden? Damit, dass man auch die Entscheidungen des gegenwärtigen Papstes in Frage stellen konnte? Bisher hatte das jeder amtierende Papst verstanden und respektiert. Die Cavelli-Dynastie konnte nicht aus dem Vatikan vertrieben werden und würde auch niemals freiwillig gehen.
Cavelli lehnte sich entspannt zurück und wartete gelassen ab, was der Mann mit der Goldrandbrille, der sich beim Händeschütteln als Dottore Diotallevi vorgestellt hatte, sagen würde. Sein Gesichtsausdruck war konzentriert, aber freundlich gewesen, wenn er auch von Cavellis Anblick sichtlich irritiert gewesen war. Männer mit einem blauen Auge sah man im Governatorat eher selten. Cavelli hatte es sich vor zwei Tagen bei seinem Training im Ringen zugezogen, zu dem er zweimal in der Woche bei einem kleinen Sportclub in Trastevere ging. Eine unkontrollierte Ellenbogenbewegung seines Trainingspartners war buchstäblich ins Auge gegangen. Cavelli dachte schon gar nicht mehr dran und wurde nur durch die seltsamen Blicke seiner Mitmenschen immer wieder daran erinnert.
Dottore Diotallevi räusperte sich dezent und rückte unnötigerweise eine Akte auf dem Schreibtisch zurecht, auf deren Deckel Cavelli über Kopf das Wort Riservatissima – Streng Vertraulich – entzifferte.
»Ich danke Ihnen, dass Sie es so schnell ermöglichen konnten, Signor Cavelli. Vielleicht haben Sie schon gehört, dass auf Wunsch des Heiligen Vaters umfangreiche interne Ermittlungen in Bezug auf das IOR eingeleitet wurden. Vieles, was dort abläuft, ist von außen nicht so durchschaubar, wie man es wünschen möchte. Wir sollen nun Licht ins Dunkel bringen, das Ganze transparent machen und da hilfreich eingreifen, wo es sich als notwendig erweist. Dabei soll vorerst nicht unterstellt werden, dass es zu kriminellen Handlungen gekommen ist, vieles kann auch Dilettantismus sein, doch das muss zunächst sorgfältig untersucht werden. Außerdem wird ab sofort ein neuer Verhaltenskodex verpflichtend, den nicht nur alle Angehörigen der Kurie und alle Mitarbeiter des IOR unterschreiben müssen, sondern auch alle Kontoinhaber, deren Kreis auch Sie angehören, Signor Cavelli. Es ist nur eine Formalität, Sie bestätigen lediglich, dass Sie nicht in Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Bestechung und die Ausbeutung Minderjähriger verstrickt sind.«
Cavelli nickte. »Kein Problem.«
Diotallevi schien erfreut, er klickte auf dem Bildschirm seines Computers etwas an, und im nächsten Moment erschien laut ratternd ein Dokument im Ausgangskorb des Druckers hinter ihm.
Diotallevi warf einen kurzen Blick darauf und wollte es bereits Cavelli herüberreichen, als er stutzte und noch einmal genauer hinsah. »Verzeihung, hier liegt ein Fehler vor, Ihre Kontonummer ist falsch wiedergegeben.« Er blickte irritiert auf den Bildschirm. »Es scheint ein Eingabefehler zu sein, ich entschuldige mich, sagen Sie mir eben Ihre richtige Kontonummer? Dann korrigiere ich das.«
»Gerne: 001-1-00004.«
»4?«
»4.«
»Aber das kann nicht ... Warum haben Sie so eine niedrige Kontonummer? Seit wann haben Sie denn dieses Konto?«
»Es ist unser Familienkonto. Mein Großvater hat es am 27. Juni 1942 eröffnet.«
»Aber das ist der Gründungstag des IOR.« Diotallevi war verwirrt.
»Richtig«, klärte Cavelli sein Gegenüber auf. »Konto Nr. 1 ist das offizielle Konto des Heiligen Vaters, Konto Nr. 2 sein Privatkonto, Nr. 3 das der Kurie und Nr. 4 das Cavelli-Konto. Die Cavellis leben seit fünfhundert Jahren im Vatikan, wir gehören sozusagen zur Familie.«
Diotallevi sah ihn entgeistert an und versuchte offensichtlich, diese Information zu verarbeiten. Cavelli wartete einfach ab, es passierte innerhalb des Vatikan nur ausgesprochen selten, dass jemand nicht wusste, wer er war, und nicht zumindest rudimentäre Kenntnisse über die Familienlegende der Cavellis besaß. Diotallevis Blick wanderte weiter über den Bildschirm, und dann weiteten sich seine Augen erneut voller Unglauben. Cavelli war sicher, den Grund zu kennen: Diotallevi hatte den Kontostand gesehen. Eine Summe, die eher zu einem Konzern als zu einer Privatperson gepasst hätte, doch im Grunde steckte nichts Geheimnisvolles dahinter. Die beträchtliche Summe Goldes, die Cavellis Urahn Umberto von Julius II. erhalten hatte, war im Laufe eines halben Jahrtausends durch Zins und Zinseszins einfach immer weitergewachsen. Cavelli nahm es nicht besonders wichtig; es war angenehm zu wissen, dass er niemals Geldsorgen haben würde, aber abgesehen von seinem Wagen und dem Wein, den er für gewöhnlich trank, verspürte er kein Bedürfnis, ein luxuriöses Leben zu führen.
Inzwischen hatte sich Dottore Diotallevi wieder gefangen. Allerdings schien ihm geradezu ins Gesicht geschrieben zu sein, dass er sich sofort nach Beendigung dieses Gesprächs über Cavelli informieren würde. Offenbar war ihm da etwas überaus Wichtiges bisher vollständig entgangen. Höflich reichte er das Papier über den Tisch, und Cavelli unterschrieb. Diotallevi legte das Blatt in eine Mappe und drückte auf einen Knopf der Sprechanlage auf seinem Schreibtisch. Er verzog verkrampft das Gesicht. »Eine weitere Formalität bitte noch, dann sind wir hier durch.« Die Tür zum Vorzimmer öffnete sich, und eine junge Sekretärin in einem grauen Rock trat mit einem Block in der Hand ein. Sie lächelte scheu in Cavellis Richtung, ohne ihm in die Augen zu sehen, und nahm an einem zweiten, sehr viel kleineren Schreibtisch an der Seitenwand Platz, auf dem ein ziemlich veralteter Computer stand. Im Gegensatz zu Dottore Diotallevi war Cavelli diese Frau bekannt, er hatte sie schon öfter im Governatorat gesehen, aber noch nie mit ihr gesprochen, auch ihren Namen wusste er nicht.