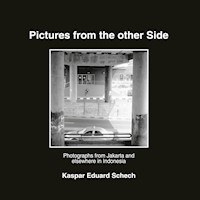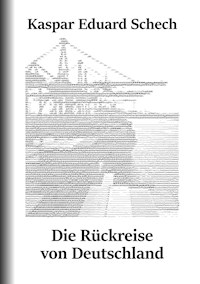Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Physik-Student Kaspar liebt klare Strukturen. Er denkt und handelt logisch, sein Alltag ist geregelt und sein Studium steht kurz vor dem Abschluss (Diplomthema: »Raum und Zeit«), eine Karriere zeichnet sich ab. Bis er Donatella trifft - oder sie auf ihn. Der begeisterte Amateurmusiker ist frustriert, weil er ein sichergeglaubtes Vorspielen verloren hat, als er abends die attraktive Frau vom Rummel trifft. Sie verleitet ihn mit ihr und ihrem Autoscooter-Fahrgeschäft von einer Stadt zur nächsten zu reisen, ein Leben, wie es nicht gegensätzlicher sein könnte. Er verfällt ihr und sein Leben gerät aus den Fugen. Kaspar endet schließlich als Pausenclown beim Zirkus, wo er durch ein Raubtier einen gewaltsam den Tod findet, der sich durch seltsame Ereignisse angekündigt hat. Kaspar kommt ins Jenseits, wo gerade das Computersystem modernisiert wird und erhält dort die Chance zur Wiedergeburt, da er das vorgesehene Ziel seiner Existenz mit der Liebesaffäre verfehlt hat. Als Frettchen, das zunächst als Ratte verkannt wird, begegnet er seiner geliebten aber inzwischen alternden Donatella wieder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Liebe ist keine Sünde, nur eine riesengroße Dummheit«
Der Inhalt
Wie alles begann
Donatella
Meine Welt über der Straße
Die anderen im Haus
Die Entscheidung
Ein Unfall?
Gibt es einen freien Willen?
Anfang im Kirmesbetrieb
Wieder dieser Hund
Nessie und ihr Freund
Herbst
Der Winter
Gedanken im Park
Der Anfang im Zirkus
Musik bei den Zirkustieren
Unruhe im Zirkuscamp
Tod im Zirkus
Im Jenseits
Department für Reinkarnation
Zurück im Diesseits
Alleine gelassen
Wie alles begann
I ch war gut vorbereitet gewesen und hatte trotzdem versagt, vorhin, am Nachmittag beim Vorspielen.
Der Musikverein der Stadt wollte eine kleine Gruppe für die Adventszeit zusammenzustellen, die bei Weihnachtsfeiern im Altenheim, in der Kirche und bei anderen Festen aufspielt. Die Geschäftsleute der Stadt hatten bereits im September Geld überwiesen. Sie wollten die Musik für Konsum und Kommerz nutzen. Markt, Eisbahn für die Kinder, Glühwein für die Eltern. Oder ein Auftritt im zugigen Eingang vor dem Kaufhaus: »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit …«, hereinspaziert, Sonderangebot. Frohe Menschen, motiviert von passendem Gedudel, Gefiedel und Posaunentönen, geben gerne Geld für Konsumgut aus.
Zu meinem Bedauern ging die Mucke an einen Buben aus Indien. Er musizierte auf einer verbeulten Trompete und hatte eine merkwürdig kurzatmige Phrasierung, die seinem Spiel eine synkopierte, jazzartige Melodieführung gab. Es klang nach Django Reinhardt, aber auch irgendwie nach Zirkus. Ich schätzte sein Alter auf vierzehn oder fünfzehn Jahre. Der Junge war mit seinem Vater zum Probespielen gekommen und konnte nicht einmal Noten lesen, was sofort auffiel, als man ihm kinderleichte Musikstücke auf den Notenständer legte. Beide, Vater und Junge, freuten sich über den Zuschlag. Ich wusste nicht, dass ich dieser Familie später noch einmal begegnen sollte.
Der Musiklehrer, der die Musikanten bewertete, versuchte, mir eine Brücke zu bauen:
»Wir brauchen auch noch ein paar Alleinunterhalter. Heimorgel, Gitarre oder Saxofon, egal was. Hauptsache, da kommt ein weihnachtliches Trällern bei rum, das die Leute bei Laune hält. Das wäre doch auch was für Sie, oder?« Da ich einen unentschlossenen Eindruck machte, sprach er weiter:
»Natürlich müssen Sie dabei richtig unterhalten, singen, tanzen, etwas Klamauk machen. Im Fundus haben wir noch Nikolausklamotten aus den letzten Jahren, die können Sie dazu gerne anziehen, ein paar Glöckchen – und schon kann es losgehen. Ich kann noch mal nachfragen, wenn Sie wollen ...?«
»Nein und nochmal nein!«
Er sah mich fragend an.
»Nein! So was mache ich nicht. Ich spiele klassische Klarinette und Saxofon, bin in Jazz und Bebop gut zu Hause, aber so was, nein, bitte nein, das mache ich einfach nicht.«
»Ich wollte Ihnen doch nur helfen.«
Nein, ich wollte keinen Clown und keinen Nikolaus machen.
Mein Studium war im letzten Semester. Ich besuchte nur noch ein einziges Pflichtseminar und schrieb an meiner Diplomarbeit in theoretischer Physik. Ich hatte wochenlang für diesen Tag geübt und trotzdem beim Vorspielen versagt. Auch das Geld hätte ich gut gebrauchen können. Aber nicht so, nicht als Kinderclown.
Jener Tag war nicht mein Freund. Das Vorspielen versemmelt, Regen, zu wenig Geld in der Tasche. Meine Freundin, Martha, hatte sich seit Wochen nicht gemeldet und war verschwunden. Wir hatten uns schon lange getrennt, aber ich vermisste sie. Zumindest an Tagen wie diesen, an denen mir nichts gelang.
Ein Donnerstagabend im Spätherbst, ein Tag, an dem es seit Nachmittag geregnet hatte und die Regentröpfchen – plitsch – konzentrische Kringel in die Pfützen am Straßenrand zeichneten, die sich gegenseitig überlagerten und am Rande der Wasserlache wieder zur Mitte hin reflektiert wurden. Ich bummelte grübelnd die nasse Straße entlang. Sollte ich besser gleich nach Hause gehen und zur Ablenkung an meiner Arbeit weiterschreiben oder den Heimweg für einen Kaffee unterbrechen? Oder ich könnte zu unserer Stammkneipe weitergehen, dort Kommilitonen treffen und dabei mit der charmanten Kellnerin, die immer Zeit hatte, schwatzen? Die Vorstellung von einer warmen Stube und Kaffeeduft war in Resonanz mit meiner Seelenlage. Ich zog vor, an diesem Tag alleine zu bleiben, um meine Gedanken zu ordnen und über den missglückten Tag nachzudenken. Also Kaffeehaus.
Seit dem Probespielen am Nachmittag war es dunkel geworden und die Geschäfte in der Innenstadt hatten inzwischen geschlossen. Die Menschen, die jetzt noch unterwegs waren, liefen mit hochgeschlagenen Krägen oder übergezogenen Kapuzen um die Pfützen herum ihren Zielen entgegen, einem Hauseingang oder zum Busbahnhof. Ältere Frauen trugen Eingekauftes nach Hause, junge Mädchen, nach ihrer Arbeit im Supermarkt, trotteten müde zum Parkplatz, da, wo sie morgens ihr kleines Auto abgestellt hatten, oder dahin, wo sie jemand abholen würde, ein Freund oder der große Bruder. Stille Geschäftigkeit verband alle; keine Eile, nur die Emsigkeit von Menschen, die das notwendige Handeln des Tages hinter sich gelassen hatten und sich jetzt auf Zeit mit ihren Freunden, der Familie oder auf das Bier in der Eckkneipe freuten. In der Ferne hörte ich ein Martinshorn, das aus der Vorstadt näher kam. Meist waren es Krankenwagen, die Menschen in die Stadtklinik brachten. Opfer von Autounfällen oder Frauen, deren Geburtswehen begonnen hatten.
Ich saß bei meinem Kaffee mit Sahnehäubchen und Zimt und ärgerte mich immer noch über das Probespielen, die verlorene Mucke, das Ansinnen, als Weihnachtsclown aufzutreten, weniger über das Geld, das ich auch gebraucht hätte.
Ohne Noten würde der Junge Schwierigkeiten haben, mit den anderen zu musizieren.
»Nicht meine Sorge«, dachte ich und empfand kein Mitgefühl, sondern nur Verwunderung darüber, wie der Bub ohne Noten in zwei Wochen neue Lieder lernen wollte. »So ist das Leben, er hat das bekommen, was er haben wollte. Soll er sehen, wie er damit zurechtkommt.«
Jetzt, im letzten Semester, besuchte ich nur noch ein einziges Pflichtseminar und schrieb an meiner Diplomarbeit, eine Ausarbeitung zum Thema Zeit und Raum. Ich hatte genug Zeit für etwas Musik. Ich könnte auch Nachhilfestunden in Mathematik geben oder in einer Kneipe kellnern, um etwas Geld zwischen die Finger zu bekommen. Der Abgabetermin meiner Diplomarbeit war im nächsten Sommer. Das war knapp, aber machbar. Ich hatte eine Aufgabenstellung gewählt, die der Beziehung zwischen Raum, Relativität und Zeit nachging, kein besonders spannendes oder neues Thema, denn Einstein hatte schon das meiste dazu gesagt. Es hatte den Nachteil, dass ich außer meinem Betreuer niemand für einen befriedigenden Gedankenaustausch fand. Andererseits benötigte ich keine Labordaten und keine Experimente und konnte den Großteil der Arbeit bequem zu Hause zusammenschreiben. Zur Einleitung suchte ich noch nach einem passenden Sinnspruch: »Sphärenmusik des Atoms« oder »Wer von der Quantentheorie nicht fassungslos ist, der hat sie nicht verstanden.« Egal, ich würde schon die richtige Einleitung zu meiner Welt finden.
Außer dem verpatzten Vorspielen und trotz Martha, die mich seit Wochen allein gelassen hatte, war mein Leben geordnet und unter Kontrolle. Ich brauchte die Welt da draußen nicht, meine Notizen, meine Bücher und Zeit reichten. Und ich hatte meine Musik. Ich brauchte niemand.
Die Zahl meiner Freunde, die ich ohne Verabredung und Anmeldung besuchen konnte, hatte sich im Jahr zuvor enorm vermindert. »Freundschaften müssen gepflegt werden«, sagte man. Bei Pflege dachte ich eher an Blumen oder Grabpflege, seltener an Freunde.
Martha ging mir an diesem Tag nicht aus dem Kopf. Sie hatte mich hundertmal eingeladen. Sie würde mir gerne ein bescheidenes Abendessen kochen, sagte sie, und da wäre eine Flasche Wein im Schrank ihrer Studentenbude. Es gab Momente, da erschien es mir, als wollte Martha sich für eine kleine Hilfe im Studium revanchieren, Erklärungen und ein Spickzettel, die ihr ein ganzes Semester gerettet hatten. Vielleicht war da auch mehr. Vor einigen Monaten, zu Beginn des neuen Semesters, war ich bei ihr. Sie servierte eine trockene Paella, der versprochene Wein blieb unauffindbar. Jener Abend im vergangenen Sommer endete mit einem langen Abschied (»Bleib’ doch noch ein wenig länger!«), und stand in meiner Erinnerung als ein warmes dîner à deux, das lange vierundsiebzig Minuten gedauert hatte. Wir hatten uns seither noch weiter voneinander entfernt.
Sie mit ihrem Gerede über Achtsamkeit und ich mit meinem Newton-physikalisch-planbaren-Leben, das mir an Tagen wie diesem trotz aller Klarheit doch manchmal aus der Hand glitt. Unsere Gedankenwelten passten nicht zusammen. Aus der Physik ist bekannt, dass die sogenannte schwache Wechselwirkung zugleich eine anziehende und eine abstoßende Kraft ist, daraus lassen sich keine stabilen Zustände hervorbringen.
Meine Gedanken pendelten zwischen Physik und Martha hin und her. An diesem Tag vermisste ich sie schmerzlich. Während ich von meinem Kaffee schlürfte, betrachtete ich Martha mit einer anderen Einstellung. Kerzen in ihrer Bude kamen in meine Erinnerung, Figuren aus dem Asia-Laden, Teddybären, bunte Kissen, Tee und Räucherstäbchen in ihrer Dachkammer. Eine warme, angenehme Vorstellung an so einem kalten Herbstregentag. Ich brauchte jemand, der mir zuhörte, um mein Versagen beim Vorspielen zu bejammern. Eben einen Menschen wie Martha. Sie konnte zuhören und wenn sie mich unterbrach, dann stellte sie kluge Fragen. Heute brauchte ich kein Abendessen, sondern nur etwas Verständnis und eine Tasse Tee mit trockenen Plätzchen, um diesen Tag abzuschließen. Ein Tag, von dem ich viel erwartet, an dem ich aber nichts erreicht hatte.
Der Kaffee, ich hatte mir noch zwei weitere Tassen bestellt, hatte meine Stimmung so weit aufgemöbelt, dass ich beschloss, Martha noch einmal zu besuchen. Ich hatte mein Saxofon unter den nassen Mänteln an der Garderobe vergessen und musste nach ein paar Schritten auf der Straße noch einmal umkehren, um die Kiste mitzunehmen, die mir so viel bedeutete. Am Taxistand beim Busbahnhof warteten nur zwei Fahrer auf Gäste, auf eine Fuhre für den frühen Abend, an dem es regnete und wenig Arbeit für sie gab.
Der erste Teil der Fahrt im Taxi und das Warten vor den Ampeln der Innenstadt verlief schweigsam.
Eine kleine Plastiktafel auf dem Armaturenbrett verriet: »Es fährt sie Harry K.«
»Von wo kommen Sie, Herr Harry?«, fragte ich, nur um das Schweigen zu brechen.
Der Mann am Steuer freute sich, angesprochen zu werden, und erzählte redselig, er käme aus Griechenland, er sei ein legaler Migrant in der EU und er fahre gerne Taxi, vor allem in der Nacht, wenn der Verkehr ruhiger ist. Er liebe seine Arbeit und freue sich, Menschen vor hier nach da zu bringen. Er fände es bedauerlich, dass er bei der Arbeit seinen Hund oft nicht mitnehmen könne.
»Ich habe keine Familie, keinen Menschen, mit dem ich mich unterhalten kann«, sagte er, »Ich habe meinen Hund aus Griechenland mitgebracht. Wir reden oft und er versteht mich.«
Ich vermied es, nach seiner Familie zu fragen und das Gespräch weiter auf persönliche Einzelheiten zu lenken. Der Spritverbrauch seines Autos oder eine andere nebensächliche Konversation über das Wetter wäre von Anfang an ein besseres Thema für unsere Taxifahrt gewesen.
»Es regnet.«
»Ja, es regnet schon seit gestern. Nur heute Vormittag nicht.«
Eine belanglose Plauderei am Abend.
Die Fahrt in die Vorstadt führte an einem leeren Platz vorbei, auf dem an diesem Abend Lastwägen, Sattelschlepper und Kräne arbeiteten, dem Volksfestplatz. Die Schausteller waren wieder da und bauten, wie jeden Herbst, ihre Buden und Geschäfte auf.
Martha wohnte weit draußen in der Vorstadt, in einem Stadtteil, in dem die Straßen die Namen von Dichtern und Denkern trugen, Hegel, Kant, Fichte, Schiller und Schelling, Wittgenstein. Ich kannte die Adresse, wusste den Weg zu ihr. Anaximenes’ Name passte nicht genau in diesen Zusammenhang, aber Harry freute sich, als ich den Straßennamen aussprach. Martha wohnte in der Anaximenes-Straße.
Warum war keine Straße, keine Kreuzung und kein Platz nach einem Physiker oder Mathematiker benannt? Carl-Friedrich-Gauß-Platz oder eine Maxvon-Laue-Straße? In diesem Land ehrte man weder die Mathematiker noch die Physiker, keiner hatte einen Straßennamen abbekommen, man suchte sie vergeblich auf dem Stadtplan. Dahingegen bekam jeder halbwegs begabte Politiker, jeder, der eine brauchbare Idee gehabt oder eine einzige gute Rede gehalten hatte, seine Straße. Jeder, der ein Buch geschrieben oder ein paar Verse für ein Kinderlied gedichtet hatte, wurde so geehrt. Waren die Dichter und Denker systemrelevanter als die Naturwissenschaftler? Zumindest mussten die Denker tot sein, um gewürdigt zu werden. Damit sollte vermieden werden, einem Denker zu huldigen, der am Ende seine Meinung geändert und doch anders gedacht hatte. Geisteswissenschaftler haben eine Meinung, Mathematiker haben nachprüfbare Lösungen, man müsste also nicht auf deren Ableben warten.
Die besser gestellten Menschen in der Vorstadt besaßen Autos. Aus diesem Grund war der Stadtteil, der auf einem Hügel lag, am Abend nicht mit dem Bus zu erreichen. Die Bewohner des ordentlich gepflegten Dichter-und-Denker-Viertels besaßen große, hübsch anzusehende Häuser mit Doppelgaragen, darum herum großflächige Gärten mit kurzrasierten Rasenflächen. Dort standen fachgerecht geschnittene Obstbäume und in einer windgeschützten Ecke fast jeder häuslichen Grünanlage waren Holzbänke um einen Platz zum Grillen gruppiert. Für Feste im Sommer mit Freunden. Versteckte Kameras spähten über die Jägerzäune, verborgen von Ranken mit reifen, roten Hagebutten oder herbstlich-buntem Weinlaub. Das Licht am Garteneingang leuchtete bei jeder Bewegung vor der Tür auf und erlosch nach genau fünfundvierzig Sekunden, weil vom Hersteller so konfiguriert.
Ich wollte nach Harrys Hund fragen, aber das Taxi war inzwischen vor dem Haus angekommen, in dem Martha unter dem Dach ihr Studentenzimmer hatte.
Der freundliche Taxifahrer fragte, ob er auf mich warten solle.
»Ich warte gerne. Sie brauchen für die Wartezeit nicht zu bezahlen. Ich kann Ihnen ja keinen Fahrpreis berechnen, wenn wir nicht fahren.« Das leuchtete mir ein. Ein netter Mensch, der Herr Harry.
Martha wohnte zur Miete bei reichen Leuten, Bekannte ihrer Eltern vom gemeinsamen Golfspielen. Der Zugang zu ihrer Dachwohnung hatte eine eigene Klingel. Ich brauchte nicht bei dem Notar oder Doktor – oder was der Glatzkopf in Erdgeschoss sonst beruflich treiben mochte – zur Gesichtskontrolle antreten. Das ersparte mir den Dialog: »Schön, dass sie Martha besuchen, sie waren ja vorgestern auch schon mal hier …«
»Nein, das war nicht ich, das war wohl ein anderer.«
Aber Martha war heute doch nicht zu Hause. Ich hatte viele Male geläutet und damit nur erreicht, dass der Glatzkopf, dem das Haus mit der Doppelgarage gehörte, mit seinen gestreiften Leggins zur Tür schlurfte.
»Nein, Martha ist gerade nicht daheim«, sagte der Kahlkopf. »Sie war vorhin noch mal ganz kurz oben in ihrer Bude und ist dann in großer Eile wieder weggerannt. Seltsam. So aufgeregt habe ich sie noch nie gesehen.«
»Es wird schon alles in Ordnung sein«, murmelte ich, nur um etwas zu sagen, »ich sehe sie ja sowieso morgen in der Uni.«
»Wollen Sie vielleicht eine Nachricht dalassen, eine Notiz, einen Zettel?«, fragte der Glatzkopf.
»Nein, danke, das ist nicht so wichtig.«
Es war jammerschade, dass ich Martha nicht angetroffen hatte. Vielleicht wäre es ein kuscheliger Abend geworden. Sie hätte mir zugehört, mich verstanden oder wenigstens Anteilnahme vorgespielt. Draußen Herbstregen, drinnen ein Abend bei Rauchtee und Kerzenschein.
Als ich vom Hauseingang zurückkam, saß Harry wartend neben seinem Taxi auf dem nassen Rinnstein und kraulte einen großen gelben Hund. Die beiden, der Fahrer und der Hund, kannten sich gut, das konnte man sehen. Das also war der treue Gefährte, von dem Harry während der Fahrt erzählt hatte. Bevor wir losfuhren, gab Harry dem Tier noch einen Happen zu fressen und verabschiedete ihn daraufhin mit einem freundlichen Klaps in den Nieselregen der Nacht. Der Regen schien den Hund nicht zu stören.
»Das ist aber ein lieber Hund. Haben Sie den selbst so erzogen? Wie heißt er denn?«
»Das ist Aikos. Die Leute fürchten sich vor ihm, weil es manchmal aussieht, als ob er in der Dunkelheit verschwände und unsichtbar würde. Aber er ist harmlos.
Wohin darf ich Sie jetzt bringen?«, fragte Harry.
»Ach, irgendwohin. Am besten zurück in die Stadtmitte.« Ich hatte keinen Plan für den Rest des Abends.
Donatella
D ie Fahrt führte uns wieder an dem Volksfestplatz vorbei, jetzt lag die Einfahrt auf der rechten Seite der Straße. Es war früh am Abend und ich entschied, die Fahrt zu unterbrechen, um mich auf dem Platz umzusehen. Ich hatte mir nichts anderes für den Rest des Tages vorgenommen und wollte noch nicht zurück in meine kalte Wohnung, wo ich doch nur wieder alleine vor dem Fenster gesessen und auf die leere Straße vor dem Haus gestarrt hätte. Das vergeigte Vorspielen plagte mich noch immer. Den Instrumentenkoffer ließ ich einstweilen im Auto, um nicht den Eindruck zu erwecken, ich sei ein arbeitssuchender Musiker. Was ich suchte, war ein warmes Abendessen, denn ich hatte seit dem Vorspielen am Nachmittag nichts gegessen und war inzwischen hungrig. Selbst wenn der Jahrmarkt noch nicht eröffnet war, bestand dennoch die Aussicht, hier ein Essen zu bekommen, eine Bratwurst oder – falls gar nichts anderes zu finden war – Popcorn oder gebrannte Mandeln. In meinen Gedanken bildete sich die klare Vorstellung einer heißen Currywurst heraus.
Ich verließ die Enge des Taxis und freute mich über meine langen, ungehinderten Schritte in dem frisch aufgestreuten Sand, der sich dort, wo die Lastwagen tiefe Reifenspuren zurückgelassen hatten, mit Schlamm mischte. Durch den Regen am Nachmittag hatten sich Pfützen mit Wasser gefüllt und spiegelten das ungleichmäßige Licht der Kräne und Zugmaschinen. Eine Seite des Platzes war finster. Kabel lagen in Dunkelheit auf dem Weg. Gegenüber, auf der anderen Seite der Eingangsgasse, war es hell, die Buden auf dieser Seite hatten Strom und die Arbeiter werkelten weiter daran, mehr Lampen, mehr buntes, flackerndes Neon aufzuhängen, mehr Licht.
»Na, Kleiner, biste gekommen, um uns hier zu helfen?«
Es sprach eine raue Frauenstimme von der dunklen Seite des Platzes zu mir.
Ich ging weiter. Ich wollte nicht angesprochen werden, nicht jetzt und nicht hier. Folglich bummelte ich weiter bis zum Ende des Platzes, dort, wo der Boden von der Nässe nicht tief aufgeweicht war. Nirgendwo gab es Essen. Die Buden, die Popcorn, Bratwurst und gebrannte Mandeln versprachen, waren noch dunkel. Ein Stand mit asiatischen Leckereien baute gerade auf, aber der Gaskocher war nicht angeschlossen, die Küche kalt. Ich wandte mich um und ging zurück zu meinem Taxi, das an der Einfahrt zum Gelände mit hell leuchtenden Scheinwerfern wartete.
»Na Kleiner, wo willste denn heut’ noch hin?«, fragte die Stimme von vorhin – und dann, in reinem Hochdeutsch, jetzt langsam und mit Nachdruck:
»Kannst du Strom?« Die Worte waren solcher Bestimmtheit gesprochen, als sagte sie: »Es werde Licht.«
In diesem Augenblick klang die Frauenstimme nicht mehr höhnisch, sondern wie eine dringende Bitte um Hilfe. Aus Neugier trat ich näher an den Stand heran, der in der Dunkelheit als Autoscooter erkennbar wurde. Scooter ohne Licht, ohne Strom; Planen verdeckten die kleinen Autos. Davor eine große Frau, in dunkler Kleidung und in Stiefeln, die mit einer Hand an dicken Kabeln herumzerrte und in der anderen Hand, kopfunter, ein totes Tier hielt, dem Aussehen nach eine Ratte.
Um nicht ganz unhöflich zu erscheinen, trat ich näher.
»Guten Abend!«
»Nee, dat is’ kein guter Abend, nä«, zeterte sie, »mein Helfer is’ mir abgehaun und hat mich mit dem ganzen Mist hier sitzenlassen.«
»Das tut mir leid«.
So kam unser Gespräch in Gang. Sie, mit dunkler, warmer Altstimme:
»Bis letzte Woche hatte ich noch zwei Handlanger. Die ham sich vom Acker gemacht. Dat Geld war denen nicht gut genug. Der eine war ein Illegaler aus Afrika, von wo genau, weiß ich auch nicht. Ich bin ja kein Erdkundelehrer!«
Sie hatte ihn nie nach seinem Herkunftsland gefragt. Es war ihr egal, denn die Männer erfüllten nur ihre Rolle als Helfer, Knechte, die ihren Weisungen folgten.
»Der Illegale konnte den Strom anschließen und war ein geschickter Allzweck-Techniker, das reichte. Der andere stammte aus dem Irak. Die haben beide nur abends gearbeitet, da ist die Gewerbeaufsicht nicht so scharf«.
Sie sah, wie ich das tote Tier in ihrer Hand betrachtete.
»Alle denken, dat is ’ne Ratte. Iset aber nich.«
Ihre Sprache glitt wieder in einen Ruhrpottdialekt ab.
»Sieht aber so aus«, hielt ich dagegen.
»Nee, dat is’n ganz liebet Tier, dat war en liebet Tier. Abgehaun iser mir und innen Stromkasten rinne. Un gez isser tot.«
Ihre Stimme stockte und sie schluckte.
»Hömma, dat is’n Frettchen, ich hat’ es dressiert und er war mein liebster Freund. Wir ham uns oft inner Nacht unterhalten. Un gez – tot!«
Es fiel mir schwer, die geeigneten Worte zu finden, die Frau im Dunklen mit ihrer toten Ratte oder was sie da am Schwanz festhielt, zu trösten.
Sie hieße übrigens Donatella, sagte sie, nachdem sie sich gefangen hatte, ihr Künstlername. Was ich denn abends hier wolle, die Eröffnung sei doch erst übermorgen.
»Ach, ich weiß nicht, was zu essen, vielleicht.«
Sie hätte noch Lasagne von gestern in der Mikrowelle, aber ohne Strom könne sie das nicht heißmachen. Wir lachten zusammen – ich hatte kein Essen, sie keinen Strom. In diesem Moment verband uns das Lachen über unsere gemeinsame Hilflosigkeit.
»Ich komm’ schon irgendwie zurecht, einer vom Kettenkarussell nebenan hilft mir bestimmt, mit dem Strom. Ich habe ja schon viel Schlimmeres erlebt und auch überstanden.«
Dann die überraschende Wendung:
»Hömma, kommste Samstach noch ma’ hier rum, ja?«, fragte die Donatella-Frau.
»Ja, dann bis morgen oder übermorgen, ok, gerne.« Meine eigenen Worte überraschten mich selbst, aber es war schon gesagt.
Was zum Teufel hatte mich an so einem Abend hierhergebracht, buchstäblich fehl am Platz? Was suchte ich hier und was morgen oder übermorgen?
»Ja, komm«, rief sie mir nach, »mach’ dat, ja«, als ich schon auf dem Weg zum Taxi war.
Ich hielt inne und sah zurück auf den dunklen Scooterkiosk und Donatella, halb im Schatten, halb im Licht von der Gegenseite, immer noch mit dem toten Felltier, kopfunter in ihrer Hand. Harrys Hund lief über den Platz, von der hellen auf die dunkle Seite, und verschwand in der Finsternis hinter Donatellas Aufbau. Es schien unwahrscheinlich, dass der Hund uns die ganze Strecke nachgelaufen sein sollte. Er war einfach da, aber lief jetzt nicht zu Harry hin.
»Ja, komm!«
Wie auf einem Karussell gingen mir Donatellas Worte durch den Kopf: »Komm!«. Auf der Heimfahrt hing ich meinen Gedanken nach, dachte an die flotte Frau in den dunklen Kleidern, mit den Stiefeln, dem Ruhrpottdialekt und der toten Ratte in der Hand. Sie war nicht von hier.
»Komm!«
War das eine Einladung oder hatte sie das nur so dahingesagt? Warum sollte ich auf den matschigen Platz und in die wilde Welt der Schausteller zurückkehren, in eine Welt, die so verschieden von meiner geordneten Lebenswelt war? Aber der Gedanke an einen weiteren Besuch ließ sich nicht einfach beiseiteschieben und drängte sich, trotz aller Absicht, an etwas anderes zu denken, immer wieder in den Vordergrund meines Bewusstseins. Noch mal hingehen oder nicht?
Logik gegen Gefühl, die Abwägung führte zu widersprüchlichen Denkergebnissen und zu keiner eindeutigen Lösung.
Wie weiter?
Meine Welt über der Straße
D as Haus aus der Gründerzeit, in dem ich wohnte und zu dem ich jetzt zurückfuhr, war vier oder fünf Etagen hoch, je nachdem, wie man zählte. Die Wohnung war zu teuer für mich, aber praktisch und wohnlich. Das Gebäude hatte Erker und Schnörkel um die Fenster und andere neoklassizistische Elemente. Vieles war bei der letzten Renovierung mit dem Vorschlaghammer vereinfacht worden. Im Gegenzug, so argumentierte die Hausverwaltung, bauten sie eine neue Heizung und bessere Fensterscheiben ein und erneuerten den Parkettboden.
Wie bei den meisten Häusern aus der Gründerzeit war im Inneren des Gebäudes ein Lichtschacht, eine finstere vertikale Aussparung, offen zum Himmel hin, in die der Regen fiel. Der Schacht verband die kleinen Fenster der Toiletten und der Küchen aller Wohnungen und war ursprünglich eingebaut worden, um mehr Licht und Luft in das Gebäude zu bringen. Beide Aufgaben erfüllte das Luftloch nur unzureichend. Die Geräusche und Gerüche aus fünf Etagen störten alle, was uns in gewisser Weise verband. Im oberen Bereich des Lichtschachtes, in dem meine Wohnung lag, versammelten sich die Ausdünstungen des gesamten Mietshauses zu strengem Gestank. Zum Ausgleich dieser Unzulänglichkeit schien an Sonnentagen helles Licht in mein Obergeschoss, was den Umstand mit dem Mief nicht immer aufwog.
Wie jetzt im Herbst fand ich es wohltuend, für eine Reihe von Tagen zu Hause zu bleiben, um Bücher meiner Diplomarbeit durchzuarbeiten und anschließend zur geistigen Lockerung für eine oder zwei Stunden alleine zu musizieren, wenn es nicht schon zu spät am Abend war und ich die anderen im Hause dadurch belästigen könnte.
Manchmal verdiente ich mit der Musik, mit meinem Saxofon, ein Nebeneinkommen. Mal war es Begleitmusik zu einer kurzen Zeremonie in der Kirche, mal bei einer Combo, die bei fremden Leuten zur Hochzeit aufspielen wollte, aber keine Saxofonstimme in ihrer Besetzung hatten. Musik war nicht mein Beruf, bedeute mir aber mehr als nur das wenige Bargeld für einen Gig. Musik war für mich eine andere Dimension im Leben, eine erfreuliche Zerstreuung der Gedanken.
Ein oder zweimal im Semester war es notwendig, zu auswärtigen Unis zu reisen, um dort ein wichtiges Referat anzuhören oder zusammen mit anderen Kommilitonen unseren Professor zu seinen Vorträgen zu begleiten, den Projektor zu bedienen oder ihn bei Debatten argumentativ zu unterstützen. Böse Stimmen nannten uns die Claqueure des Instituts. Nach den Vorträgen tranken wir miteinander Bier, diskutierten eine Zeitlang über die Unendlichkeit und übernachteten in schlichten Hotels, die meist im Umfeld des jeweiligen Bahnhofs zu finden waren, nie nahe am Campus, sondern in größeren Städten oft am Bahnhof und in fußläufiger Entfernung des Rotlichtbezirkes. Für mich war das Ende solcher Dienstreisen, die Heimkehr, das Erfreulichste an den Ausflügen. Ich fand keinen Gefallen daran, aus dem Koffer zu leben, nicht für einen einzigen Tag.