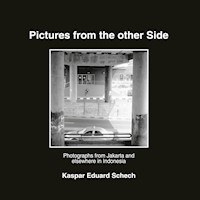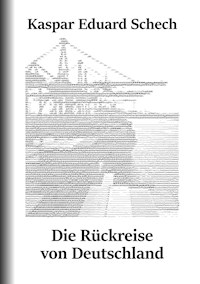Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zu Zeiten der aufkommenden Macht der Nazis und infolge einer unglücklichen Liebe entscheidet sich der Metzgergeselle Gustav aus Schlesien dazu, seine Heimat in Deutschland zu verlassen und den Weg nach Amerika anzutreten. Sein Lebensweg erstreckt sich von den 1920er bis in die 1980er Jahre, während derer er sich in Chicago eine erfolgreiche Existenz aufbaut, eine Familie gründet aber dennoch am Ende alles verliert. Der Leser taucht ein in eine Ära, die von weltweiten politischen und technologischen Umwälzungen geprägt ist. Dabei durchlebt der Protagonist nicht nur persönliche Höhen und Tiefen, sondern wird auch mit den Herausforderungen von Identität, Zugehörigkeit und Vorurteilen konfrontiert. Ein zentrales Thema des Romans ist daher das stetige Spannungsfeld zwischen dem "wir" und "den anderen" - eine facettenreiche Betrachtung, die durch die Augen eines Auswanderers zu unterschiedlichsten Konflikten führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Inhalt
Hinweise
Die Heimat
Die Polen
Die Juden
Die Familie
Die Jugend
Lehre als Metzger
Was ist Freiheit?
Besuch in Berlin
Gustavs Freundin
Auswandern?
Reisevorbereitungen
Abschied
Warten in Hamburg
Überfall
Die Überfahrt
New York
Brooklyn
Die Mafia
Abstecher nach Florida
Die Busreise
San Augustine
Mareks Eisdiele
Ein Abend und eine Nacht
Weiter nach Norden
Chicago
Nancy und ihr Diner
Arbeit als Metzger
Gustav und Nancy
Brief an die Eltern
Der Betrieb soll verkauft werden
Die »Teutonia«
Buchladen in Chicago
Einbürgerung
Der große Krieg
Krieg im Pazifik
Militär fordert Unterstützung
Trennung von Nancy
Kriegsende. Endlich Frieden!
Ein Brief aus Deutschland
Gustav übernimmt den Laden
Gustav trifft Carmen wieder
Hochzeitsreise nach Las Vegas
Heimreise durch die Wüste
Kinder: Kenneth und Connie
Angst vor den Kommunisten
Brief von der lange vergessenen Lissy
Die Fünfziger und Sechziger Jahre
Ermordung von J.F. Kennedy
Ken rückt zum Militär ein
Carmen erkrankt
Brief von Kenneth
Kenneth stirbt in Vietnam
Wie weiter?
Reise nach Deutschland
Heimreise
Neue Freiheit im Alter
Ein Ende ohne Ende
Hinweise
Dieser Roman enthält biografische Elemente, jedoch sind sämtliche Charaktere rein fiktiv. Sowohl die Orte als auch die Ereignisse, insbesondere die Namen der handelnden Personen, sind vollständig erdacht und ohne jeglichen Bezug zur Realität, sei es in der Vergangenheit oder in der Gegenwart. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen, Orten oder Ereignissen ist daher rein zufällig und keinesfalls beabsichtigt.
Aus praktischen Gründen wurde am Ende des Romans (Seite 285) ein Glossar hinzugefügt, das dem Leser oder der Leserin weniger vertraute Zusammenhänge kurz erläutert.
Die Heimat
Schlesien war ein reiches Land: Acker, Wald, Seen und Flüsse boten alles, was man zum Leben brauchte, und das in reichlicher Menge für alle, die bereit waren, wenigstens ein bisschen dafür zu arbeiten.
Je nach Geschichtszeitraum ergriffen verschiedene Mächte Besitz von dem wertvollen und fruchtbaren Land. Die Habsburger herrschten bis 1918 und so kam es, dass viel von der Kultur und Tradition Schlesiens eher an das Österreich-Ungarn-Reich als an das preußische Deutschland anschließt. Wien war gar nicht so weit entfernt. Man hatte sogar einmal versucht, die Donau mit der Oder durch einen Kanal zu verbinden. Das wären gerade einmal um die dreihundert Kanalkilometer gewesen, die dem K.-u.-k.-Reich den Zugang zur Ostsee verschafft und eine Pforte zum Handel mit dem Baltikum geöffnet hätte. Der Kanal war oft geplant worden, wurde aber nie fertig gebaut. So kam es also, dass an Gustavs Kreisstadt nun doch keine Wasserstraße vorbeiführte und keine Lastkähne aus Wien am Stadthafen festmachten und im Gegenzug von dort Kohle nach Wien verfrachteten. Sie hätte vielleicht die Geschichte Schlesiens in ganz andere Bahnen gelenkt.
Doch dieser Seitenarm der Geschichte fand nicht statt.
Aus dieser historischen Zeit stammte die Anordnung der Obrigkeit, dass Juden in Schlesien willkommen seien, sie mögen siedeln, ihren Geschäften nachgehen und als freie Menschen handeln und wandeln.
Das Land, inzwischen unter der Fuchtel der Preußen, entwickelte sich weiter prächtig zu einem Wirtschaftszentrum von europäischer Bedeutung, so wichtig wie später das jetzt viel bekanntere Ruhrgebiet. Es war ein reiches Land, das nur ein bisschen Frieden brauchte oder gebraucht hätte, um weiter zu wachsen, blühen und gedeihen.
Nach dem verlorenen Weltkrieg von 1914 bis 1918 kam es im Zuge der europäischen Neuordnung zur Neugründung Polens, das es vorher lange nicht auf der Landkarte gegeben hatte, und der Tschechoslowakei. Die Alliierten zogen neue Grenzen, die niemand wollte, veranstalteten ein Referendum, das niemand akzeptierte, und, 1921, eine Schlacht zwischen Freikorpsverbänden und polnischen Separatisten, die diese Grenzen schon wieder neu festlegte1.
Die Polen
Gustav, die Hauptfigur dieses Romans, war zu dieser Zeit ein kleiner Junge, der viel sah, aber noch wenig von der Welt verstand. Die neue Grenze, die es vor Monaten noch gar nicht gegeben hatte, lag nur ein paar Stunden im Pferdewagen entfernt von Gustavs Heimatdorf Schönowitz. Was ihm früher wie ein Land ohne Grenzen erschienen war, war jetzt gespalten. Es gab »die dort drüben«, die Polen, und hier die Schlesier, die glaubten, ihr Recht auf Land von achthundert Jahren Geschichte ableiten zu können.
Von »dort drüben«, von der anderen Seite der neuen Grenze, kamen die anderen, die Arbeiter, die Erntehelfer, die Stallknechte und die Hilfsarbeiter, die sich für fast jeden kargen Lohn auf ein paar Monate im Sommer verdingten, denn wer Hunger hat, kann nicht wählerisch sein, wie er sein Geld verdient. Einerseits patriotisch stolz auf die neugewonnene nationale Selbstständigkeit, andererseits sprachen die Arbeiter untereinander polnisch und wurden zu einer geschlossenen sozialen Gruppe, die von den Schlesiern verächtlich als »Polacken« bezeichnet wurde.
Die Juden
Eine dritte Gruppe waren die Juden. Sie besaßen kein Ackerland, wohl aber schmucke Häuser, in denen sie lebten, und Gärten. Sie siedelten in den Städten Oppeln, Neiße und weiter entfernt vom Handlungsort unserer Geschichte. Sie waren frei und, soweit die örtliche Menschenerinnerung reicht, immer willkommen, denn sie trugen mit ihrem Handel und ihren Geschäften zur Wirtschaft bei.
Vor Aschermittwoch verkaufte der Bäcker besondere Faschingskrapfen, die man besser auch in Berlin nicht finden konnte, ansonsten das ganze Jahr lang Beygl, die unglaublich beliebt waren. Ein jeder, der in die Kreisstadt kam, brachte eine Papiertüte voller Backwaren mit nach Hause. Nur am Sabbat waren die Juden nicht auf der Straße zu sehen. Die Synagoge, die sie besuchten, war neu, gebaut von reichlichen Spenden der Gemeinde, und stand stolz sichtbar im Weichbild der Stadt.
* * *
Der oberste Meinungsmacher im Dorf, der mit der lautesten Stimme und den vulgärsten Ausdrücken, war der alte Bloch, der den größten Hof ganz oben an der Dorfstraße hatte. Viele Tagwerke besten Ackerlandes, zu dem er jedes Jahr noch ein paar Morgen dazu pachtete. Er hatte nie genug. Auch nicht genug Kinder. Mit seiner zweiten Frau – die erste war bei einer Geburt verstorben – hatte er zwölf Kinder in die Welt gesetzt. Man wusste nicht genau, ob das eine oder andere Kind, das in der Neiße-Vorstadt auf seine Einschulung wartete, vielleicht auch den alten Bloch zum Vater hatte.
Seine Familie im Hof war ein kunterbunter Haufen. Einer seiner Söhne war nachts von der Polizei abgeholt worden und lange nicht mehr nach Hause gekommen. Ein anderer fuhr ein-, zweimal im Monat mit der Eisenbahn im besten Zugabteil nach Berlin, um allerlei Handelsware mitzubringen, die er am Markt in Oppeln oder manchmal Breslau recht erfolgreich losschlug. Er war bekannt, zu sagen, er sei beliebt, wäre eine Übertreibung. Als jemand, der genug Geld in der Tasche hatte, kannte er viele Mädchen, die er, solange sie ihm gelegen waren, mit allerlei Chinoiserie und Lingerie bei Laune hielt. Jene, an denen er kein Interesse mehr fand, merkten schnell, dass es aus war, und wenn nicht, dann scheute sich der junge Bloch, Kurt sein Name, nicht, mit Fäusten dem Verständnis nachzuhelfen.
Die Arbeiter hielten es nicht lange aus am Bloch’schen Hof. Sie zogen lieber, oft mitten in der Ernte, in die Zuckerfabrik oder in die Ziegelei, beides Arbeiten, die noch weniger einbrachten als der Hungerlohn vom Bloch, selbst wenn man bedenkt, dass sie beim Bloch freie Kost und Logis hatten.
Die Familie
Das Heimatdorf der Grzesinskis war reich, gute Böden erwirtschafteten in guten Jahren satte Erträge. Das Vieh stand gesund und kräftig im Stall, Gänse schnatterten auf der Wiese und zwei große Karpfenteiche befanden sich hinter dem Hof, dort, wo das Gelände zum Bach hin etwas abfiel. Zwei Dutzend Kühe, Ziegen, Schweine und sechs Pferde, von denen Papa Grzesinski sonntags zwei vor seinem Landauer anspannen ließ, um sich und seine Familie vom Stallknecht in die Kirche kutschieren zu lassen. Er wollte gesehen werden, respektiert und angesehen sein. Am Geld lag es nicht. Seine Frau und die Kinder trugen die neuesten Kleider, er selbst im Sommer den hellen dreiteiligen Anzug mit Panamahut, im Winter einen warmen Paletot, der innen und am Kragen mit edlem Biberpelz gefüttert war.
Er wäre so gern wie die anderen gewesen, ein Bauer mit einem großen wohlgeführten Hof. Aber jeder sah in ihm den Schweinehändler mit dem polnischen Namen, der jeden Mittwoch und Samstag am Markt mit den Bauern und Metzgern um jeden Pfennig feilschte. Er hatte den Hof »geheiratet«, seine Frau hatte die Landwirtschaft als reiche Mitgift in die Ehe gebracht. Sie hatte es ihn nie spüren lassen, ganz im Gegenteil, sie war ihm in allen Lebenslagen eine liebende und sorgende Partnerin. Aber die Nachbarn und Geschäftspartner ließen, wenn sie ihn verletzen wollten, durchblicken, dass sie in Gustavs Vater nur einen emporgekommenen Viehhändler sahen, jemand, der von woanders gekommen war und den harten schlesischen Dialekt nur angenommen hatte, um beim Handeln mit den Bauern besser zurechtzukommen.
Anders als der Bloch sorgte sich Gustavs Vater um seine Leute und erst recht um seine Kinder, sie sollten es im Leben besser haben als er. Er hatte nicht viel Bildung genossen, nur ein paar Jahre in der Dorfschule, aber als geschickter Händler, der er war – hart, aber fair, wie ihn seine Geschäftspartner sahen - besaß er genug Geld.
Die Aussichten für den ältesten Sohn Josef waren gut, er sollte in ein paar Jahren den Hof bekommen und diesen weiter ausbauen und modernisieren. Noch verrichteten Pferde die schwere Arbeit. Aber ein Viehhändler, der in Berlin die Grüne Messe besucht hatte, erzählte von der Zukunft: Die Arbeit werde dann von Maschinen verrichtet, keine Plackerei mehr bei der Ernte und beim Dreschen. Der Pferdeknecht sitze dann oben auf der Maschine, ziehe an Hebeln, und an einem einzigen Tag sei die Arbeit einer ganzen Woche in der Scheune aufgeschichtet und das Korn in Säcken fertig, um zum Lagerhaus gebracht zu werden. Der Händler erzählte auch von der neuen Politik in Berlin, endlich sei da Licht am Ende des Tunnels zu sehen, die Volksgemeinschaft werde sich bald erheben, Arbeit für alle, Schluss mit dem ewigen Gezänk im Reichstag. Bald sei alles in einer festen, starken Hand zusammengefasst.
Es war noch nicht abzusehen, dass Josef das schlechteste Los gezogen hatte, denn in wenigen Jahren sollte ein neuer Krieg alle Karten des Schicksals neu mischen.
Die älteste Tochter Trudel absolvierte die Hauswirtschaftsschule mit Bravour, was sie auf ein Leben als Hauswirtschafterin auf einem großen Gut weiter im Osten oder Pommern oder einem Schlösschen bei einem Adligen gut vorbereitete. Sie würde auch eine gute Partie für einen Arzt, Offizier oder einen erfolgreichen Geschäftsmann sein. Der Mann, der sie eines Tages heiraten sollte, würde ein gutes Leben haben.
Für die jüngeren Mädchen hatte der Vater achtenswerte Frauenberufe ausgesucht, Handelsschule und dann Stadtverwaltung, eine andere schickte der Vater zu einem Onkel nach Berlin, damit er sie dort in sein Textilgeschäft einführen konnte.
Blieben nur noch die zwei Jungen, die zwar nicht den Hof erben würden, aber, so dachte der Vater sich das aus, keinesfalls irgendwann der Notwendigkeit nachgeben müssten, sich eines Tages als einfache Arbeiter in einer Fabrik oder als Stallknechte bei einem fremden Herrn abplacken zu müssen. Ein Beruf, eine Ausbildung, sollte die Grundlage für ihre wirtschaftlich auskömmliche Zukunft sein. Ein akademischer Bildungsgang, vielleicht als Tierarzt oder in der Verwaltung beim Oberbergamt in Breslau, war noch jenseits des Denkhorizonts des Vaters. Zudem hatte keines der Kinder ein Gymnasium besucht. Aber essen und sich kleiden müssen Menschen immer, dachte der Vater, da sollte es doch zukunftssichere Berufe geben. Das mit dem Gymnasium sei »nichts Richtiges«, und wenn überhaupt, wenn der Junge das Zeug dazu habe, werde er so oder so seinen Weg im Leben gehen.
Mit dieser Weltsicht suchte er jede Woche nach dem Handeln und Feilschen am Schweinemarkt nach Lehrherren für seine Söhne, wobei er seine Beziehungen zu den anderen Händlern und Handwerkern in der Vorstadt einsetzte. Der Schneider Toczek brauchte Hilfe. Der zweitjüngste Sohn Albert war schnell dort untergebracht. Der Laden, der sonst modische Anzüge oder warme Wintermäntel mit Pelzfutter zusammennähte und bei dem auch Gustavs Vater schneidern ließ, hatte aus Berlin von einer neuen politischen Partei einen großen Auftrag für Uniformen bekommen. Diese braunen Kleider – der Vater verglich die Stofffarbe mit der Erde frisch ausgehobener Gräber – waren nicht das, was das Militär oder die Polizei trug, aber eindeutig Uniformen.
Ich greife der Geschichte vor, wenn ich schon jetzt preisgebe, dass Albert nicht lange beim Schneiderhandwerk blieb. Er mochte weder den aufbrausenden Charakter seines Lehrherren noch die Arbeit, bei der er, während der Meister den reichen Herren die Körpermaße abnahm, Zahlen aufschreiben oder Tee und flachgedrückte türkische Zigaretten andienen musste, und dafür gelegentlich von der Kundschaft eine Münze als Trinkgeld in die Hand gelegt bekam. Albert wollte weder einem jüdischen Lehrherrn noch anderen Menschen dienen, aber wenn es schon sein musste, dann wollte er seine ganze Kraft einer großen Sache unterordnen. Das Motto »Freiheit und Brot«, das jetzt in Berlin immer häufiger und dann immer lauter zu hören war, fand auch in der Vorstadt Widerhall. Aber, so Alberts Einschätzung, noch war die Zeit der Freiheit nicht gekommen, noch gab es zu viele »Rote« in Berlin, Verräter, die den letzten Krieg sabotiert und den Sieg weggegeben hatten.
* * *
Die Jugend
Es war nicht einfach, für den jüngsten Sohn Gustav, dessen Leben wir in dieser Geschichte nachzeichnen, eine Lehrstelle zu finden. Das lag nicht an Gustav. Der ging schwerer Arbeit nicht aus dem Weg, was man ihm ansah und was er jedes Jahr in der Ernte bewies. Er hatte ein gutes Zeugnis aus der Schule mitgebracht. Der Lehrer hatte vorgeschlagen, ihn aufs Gymnasium zu schicken.
»Der Junge hat das Zeug dazu, er ist schlau und wissbegierig«, sagte er und schrieb in das Abgangszeugnis: »Er wird seinen Weg gehen.« Der Provinzlehrer ahnte noch nicht, wie lang dieser Weg sein würde.
Das Wichtigste war seine nette, freundliche Art, ein charmanter Bursche, auf den die Mädchen nach der Schule warteten, um ein Stück des Heimweges gemeinsam mit ihm zu gehen und sich seiner Gesellschaft zu erfreuen. Sie wurden gern mit dem jungen Mann gesehen, er war höflich und unterhaltsam.
Der Vorstellungsbesuch beim Kronenwirt, bei dem Gustavs Vater sonntags nach der Kirche seinen Schweinebraten mit böhmischen Klößen genoss, verlief ernüchternd. Der Wirt gab sich abweisend:
»Ich brauche keinen Lehrbuben. Ich habe eine Köchin aus Polen, zwei tüchtige Commis und eine flotte Saaltochter. Die ist beliebt und serviert flink. Wir kommen gut zurecht. Danke der Nachfrage.« Er gab ihm noch den Rat mit:
»Probier es doch mal beim Konditor oder beim Metzger. Das sind auch gute und ehrliche Berufe.«
So nahm der Vater seinen Sohn gleich in der nächsten Woche wieder mit in die Vorstadt, um ihn bei einem anderen möglichen Lehrherren zu präsentieren. Aber auch der Bäcker, der unbestritten die besten Beygl und die beliebteste Mohnbabe im Schtetl buk, winkte ab:
»Wir brauchen keinen Lehrling. Die Zukunft ist zu unsicher. Wer weiß, was morgen sein wird?«
Und doch, es schien ihm schwerzufallen, die beiden abzuweisen, und aus Verschämtheit gab er ihnen eine wohlgefüllte Papiertüte mit frischen warmen Backwaren mit auf den Weg. Für den jungen Gustav war das der Duft, an den er sich sein Leben lang erinnern würde, das Aroma der Heimat, die Reizempfindung aus einer Welt, in der sich immer alles zum Guten wendete.
Der Konditor, der sich selbst lieber als Zuckerbäcker bezeichnete, hatte den Laden, den er erfolgreich betrieb, von seinem Vater geerbt, der damals aus Wien gekommen war. Das Sich-Bekanntmachen beim Konditor brachte eine unerwartete Wendung, als Gustav und sein fürsorgender Vater den halb leeren Laden betraten.
»Was kann ich für euch tun?«, fragte der Meister der Süßigkeiten. »Wollt ihr die Kühlvitrine kaufen oder das Rührwerk für den Teig? Schokolade, Zucker, echte Vanille, das ist alles schon weg. Ich habe da noch eine nagelneue Eismaschine aus Italien. Die war erst einmal in Betrieb. Ich wollte Speiseeis bekannt machen, denn hier gibt es die beste Sahne, die beste Milch im ganzen Reich, aber die Leute wollen kein Milcheis. Ist das nicht schade?« Er liebte seinen süßen Beruf.
Gustav und sein Vater standen einer unerwarteten Situation gegenüber. Der Zuckerbäcker war dabei, das Inventar seines Ladens und der Backstube zu verkaufen.
»Um Himmels Willen, was haben Sie denn vor?«
»Ich gehe nach Amerika. Das Inventar hier, die Maschinen, die ich verkaufe, das wird mein Startkapital in Amerika. Dort ist alles besser, dort kann ich machen, was ich will und dort kann ich in meinem eigenen Laden schalten und walten, wie es mir passt, und ich brauche mich nicht an all das dumme Zeug zu halten, das mir die Innung und das Ordnungsamt vorschreiben wollen. Freiheit.«
Er machte eine Pause, um die Wirkung seiner Worte abzuwarten.
»Noch was. Ich muss dann auch nicht mehr an jedem Ultimo mit einem braunen Umschlag ins Rathaus, damit die nicht wieder eine Kontrolle vorbeischicken und alles kaputt machen. Ich hab’ einfach genug, wisst ihr? Ich will weg. In Amerika ist alles besser.«
»Und woher wollen Sie das alles so genau wissen?«
»Der Sohn vom alten Bloch, der Kurt, der hat einen langen Brief geschrieben an seinen Vater. Der hat mir den gezeigt und ihn lesen lassen.«
»Und?«
»Dem Kerl, der nicht mal ein anständiges Handwerk gelernt hat, geht es gut. Er schreibt, er habe mehr Geld, als er bräuchte. Er importiert Bleistifte, Bürozeug und andere Sachen, sagt er. Unter seinen Brief hat er ganz keck einen Reim gekritzelt: >Ist der Handel noch so klein, bringt er mehr als Arbeit ein.<, schrieb er.«
Gustavs Vater überlegte für einen Moment, ob vielleicht doch das eine oder andere Teil der Einrichtung auf dem Hof nützlich sein könnte. Nein, einen großen Kühlschrank hatte er als erster im Dorf im letzten Jahr gekauft. Die Kühlvitrine sah nützlich aus, war aber viel zu groß für die heimische Speisekammer. Die meisten Vorräte brauchten sowieso keine Kühlung. Geräucherter Schinken, Speck und Wurst hingen trocken hinter Fliegendraht unter dem Dach, so wie es schon immer gebräuchlich war, gesalzene Butter in der kühlen Speisekammer.
Sie verabschiedeten sich:
»Ja, dann wünsche ich Ihnen Erfolg mit dem neuen Leben in der Neuen Welt. Schreiben Sie uns doch mal, wie Sie dort ankommen und was es Neues von dort gibt.«
Es war noch Zeit an diesem Mittwoch und so ging Gustav mit seinem Vater einige Straßen weiter, wo Fleischer Graba seinen Laden hatte. Graba war ein guter Kunde des Viehhändlers und die beiden Männer wurden sich auch an diesem Tag schnell einig:
»Ja, der junge Gustav kann bei mir anfangen. Lehrgeld brauchst du nicht zu löhnen, dafür kennen wir uns schon zu lange und zu gut.«
»Wann soll es denn losgehen?«
»Ja, meinetwegen im Herbst, Oktober. Dann ist hier die meiste Arbeit und da können wir jede Hand gebrauchen.«
»Also gut, nach der Ernte im Oktober.«
Gustav war einerseits froh, in die Lehre zu kommen, andererseits hatte er eine tiefe Abscheu gegen das blutige Schlachterhandwerk, aber er wollte seinen Vater, der mit gutem Willen und väterlicher Liebe die Lehrstelle aufgetrieben hatte, nicht enttäuschen. So fügte er sich in seine Fleischerzukunft in der Hoffnung, es werde vielleicht nicht so schlimm werden. Immerhin bestand das Berufsbild aus zwei Teilen, dem Schlachter, der die Tiere tötete und zerteilte, und dem Wurstmacher, der dann aus dem rohen Fleisch allerlei genussfertige Delikatessen fabrizierte.
Die Folgen dieser halbherzigen Entscheidung sollten Gustav fast sein ganzes Leben lang verfolgen: Er hasste den Inhalt seines Schaffens, das Töten, das Blut und den Geruch, der mit dieser Arbeit verbunden war. Und doch versorgte ihn eben diese Arbeit ein Leben lang mit einem mehr als ausreichenden Einkommen.
Lehre als Metzger
Der Oktober kam und Gustav stellte sich an einem Montag frühmorgens vor die Hintertür von Grabas Metzgerei. Der alte Graba war noch nicht da, aber sein Altgeselle Heinrich öffnete die Tür und wies den Jungen ein.
»Du fängst hier immer um fünf Uhr an, klar? So will das der Alte. Der sagt dir dann, wann du heim kannst. Verstanden?«
Der Geselle nahm den Jungen mit in eine Kammer:
»Hier sind Arbeitskleider. Du brauchst eine Hose, ein Hemd, eine Schürze, ich zeig dir nachher genau, wie das aussehen muss. Nimm dir Sachen für zwei oder drei Tage mit. Waschen musst du das selbst zu Hause.«
Der Altgeselle hinkte sichtlich, als er Gustav voranging, um ihm den Weg durch die Schlachterei zu zeigen, den großen Wurstkessel, Schüsseln und Wannen und den Flaschenzug, mit dem die toten Tiere zum Ausweiden und Häuten aufgehängt wurden.
»Hast du schon mal getötet?«, fragte Heinrich.
»Wie meinst du?«
»Ja, hast du schon mal getötet? Jagd? Ein Tier im Stall oder auf der Wiese? Oder einen Menschen?«
»Nein, mein Gott, ich bin doch kein Mörder!«
»Im Krieg darfst du töten, du sollst es sogar. Wenn du viele umbringst, dann bekommst du einen Orden und einen höheren Dienstgrad.« Heinrich bohrte weiter: »Hast du nie ein Huhn geschlachtet, einer Gans den Hals umgedreht?«
»Nein, nie, das haben bei uns immer andere gemacht, meist mein großer Bruder.«
Heinrich weiter:
»Es ist nichts Großes im Tod. Es ist meist nur das jämmerliche Ende eines Individuums, das nur leben wollte, nur leben, nichts weiter. Das Schlimme ist, wenn sie dir in ihrem letzten Moment in die Augen sehen. Menschen oder Tiere, das ist fast gleich. Als ob sie dich fragen wollten: >Warum machst du das?<«
»Im Krieg ist das nicht anders als hier im Schlachthaus.«
»Da ist immer jemand, der dir sagen wird, dass es in Ordnung ist, zu töten – und immer werden dir Zweifel bleiben, Mitleid und die Voraussicht auf dein eigenes Ende ...«
»Es ist nichts Großes im Tod.«
Er sprach ohne Übergang, ohne Pause weiter: »So, Gustav, nun lass uns noch die zwei Schweine im Hof zum Verwursten zurechtmachen. Leider leben sie noch.«
Heinrich erwies sich mit der Zeit als ruppiger, aber im Herzen gutmütiger alter Mann, der sich so verhielt, als müsse er der Welt noch etwas zurückgeben, bevor er sich aus dieser verabschiedete. Er sprach nie von einer Familie oder von Kindern und die Umstände ließen Gustav vermuten, dass der alte Mann für sich allein lebte.
Er half Gustav über die schwierige Arbeit, Tiere töten zu müssen. Gustav sollte es ein, zweimal machen, um es zu lernen, aber die tägliche Schlachterei wollte Heinrich ihm, soweit es ging, abnehmen.
»Ich mag das auch nicht, aber ich habe im Krieg Schlimmeres erlebt.«
Gustav war unendlich erleichtert.
»Der Meister soll es halt nicht erfahren. Aber der kommt sowieso immer erst nach elf, wenn Fleisch und Wurst schon in der Kesselsuppe schwimmen und die Würste zum Räuchern auf der Stange aufgereiht sind.«
»Klar, ich pass’ da auf.«
»Der alte Graba ist ohnehin schon vor Mittag besoffen. Er ist nicht mehr gesund. Er hat es an der Leber, seit seine Frau gestorben ist.« Der nächste Satz kam überraschend:
»Er findet die Schlachterei auch widerlich. Er wäre lieber Schmied oder Automechaniker geworden. Vielleicht säuft er ja deswegen und kommt erst spät in den Laden, dass er das ganze Elend mit den Schlachttieren nicht hören und sehen muss.«
»Ja, und?«
»Wenn du alles richtig anstellst und seiner Tochter schön den Hof machst, dann kannst du vielleicht eines Tages den ganzen Laden übernehmen. Das wär’ doch was, oder?«
»Nein. Ich hab’ schon eine Freundin, ein liebes, braves Mädchen, wir werden heiraten, wenn ich mit der Lehre fertig bin und sobald ich eine feste Anstellung habe, so haben wir es besprochen. Sie bekommt einen schönen Hof mit als Mitgift.« Gustav ahnte nicht, dass auch sein Vater den Hof von seiner Frau als Mitgift bekommen hatte und damit zwar reich, aber nie recht glücklich geworden war. Seine Eltern redeten nie darüber.
Das Gespräch von Altgeselle und Lehrjunge wurde unterbrochen. Es klopfte an der Hintertür. Der Amtstierarzt.
»Guten Morgen zusammen. Alles in Ordnung. So wie immer?«
»Ja.«
Das Ritual des Besuchs zwischen Tierarzt und Schlachter war schon so oft gespielt worden, sie brauchten nur noch wenige Worte.
Der Veterinär baute sein Mikroskop auf, nahm selbst die Proben, ein Stück vom Herz, von der Milz, den Nieren, und verrichtete schweigend seine Arbeit. Es schien, als beachtete er seine Präparate kaum, und kam zu dem Schluss:
»Nein, keine Trichinen, sonst ist auch alles in Ordnung, gesunde Tiere.«
Zum Abschluss stempelte er die Hälften der Kadaver, nahm sein Geld entgegen und packte einen Kranz geräucherter Wurst, die er bei jeder Untersuchung als Dreingabe erhielt, in seine Tasche. Fertig. Wie an jedem Tag.
»Der is’ auch a Jüd ...«, ließ Heinrich den Jungen wissen. In seiner Stimme klang keine Wertung, eher die Sorge um den Veterinär, mit dem sie immer vertrauensvoll zusammengearbeitet hatten. Vielleicht war er auch froh, dass er Grabas Laden nicht wegen des gelegentlichen Schächtens eines Rindes für seine Kehilloh [jüdische Gemeinde] in Neustadt verpetzte.
* * *
Man könnte fast sagen, dass Gustav und der alte Heinrich Freunde geworden wären. In gewisser Weise brauchten sie sich gegenseitig. Gustav bekam tatkräftige Hilfe beim Betäuben und Töten der Tiere, Heinrich hatte einen Freund, der ihm zuhörte und bei dem er seine kleinen Lebensweisheiten an den Mann bringen konnte. Und der bei der schweren Arbeit des Zerlegens mit anpackte. An Tagen, wenn viel zu tun war, wie vor den großen Feiertagen, kamen noch Helfer dazu, ungelernte Tagelöhner, die mit Geld und etwas Fleischwaren entlohnt wurden.
Nach einiger Zeit fand Gustav den geeigneten Moment, Heinrich nach seinem Bein zu befragen:
»Was ist mit deinem Bein?«
»Da ist nichts mehr, da ist jetzt ein Holzbein, das tut nicht mehr weh, nur der Stumpf.«
»Wie ist das passiert? Ein Unfall?«
Heinrich ließ sich unendlich lange Zeit, bis er die Frage beantwortete; und doch schien es, als befreie es ihn von etwas, das lange auf seiner Seele gelastet hatte, wenn er darüber redete.
»Das ist aus dem Krieg. Es war an der Somme, nur ein Granatsplitter. Eigentlich eine kleine Wunde an der Wade, aber die haben zu lange gewartet, bis sie mich ins Lazarett gebracht haben, da hatte der Gasbrand schon angefangen. Dem Feldscher fiel nichts Besseres ein, als das Bein zu amputieren. Ich war nicht narkotisiert, nur Chloroform, sonst hatten die nichts mehr. Ich konnte mich nicht wehren, denn ich war von den Dämpfen ganz meschugge. Ich wäre damals lieber gestorben, als weiter als Krüppel auf einem Bein rumzuhumpeln. Ich weiß immer noch nicht, ob ich mich inzwischen daran gewöhnt habe oder nicht.«
Beide schwiegen lange. Der eine vertieft in seine Erinnerung, der andere mit der Vorstellung des Unvorstellbaren.
»Ich weiß noch vieles aus dieser Zeit«, fuhr Heinrich fort. »Da war dieser bayerische oder österreichische Fähnrich, ein Meldeläufer, der zu viel Giftgas von den Tommys abbekommen hatte. Der röchelte tagelang, dann kotzte er weißen Schaum auf sein Bettzeug. Ich dachte, der überlebt nicht.«
»Und, ist er gestorben?«
»Ganz im Gegenteil. Ich habe in der Zeitung gelesen, wie der Bayer in München jetzt große Reden schwingt. Er hatte beschlossen, Politiker zu werden, sagte er damals. Wir haben ihn alle ausgelacht. Auch in Berlin kommt er jetzt groß raus. Die Leute mögen sein Gerede. Dabei ist er nur ein ganz kleines Licht, ein Windbeutel, ein Niemand, aber die Leute hören ihm zu und, was noch schlimmer ist, sie glauben den Quatsch, den er erzählt.«
»Und du, was hast du vor dem Krieg gemacht?«
»Ich habe in Freiburg ein gutes Abitur gemacht und war eigentlich drauf und dran, dort Medizin zu studieren, aber dann kam die Einberufung, die letzte Welle. Der General Falkenhayn wollte die Franzmänner weißbluten, so wie die Juden ihre Schlachttiere Schächten. Ach ja, das ist auch noch etwas, was du vor der Gesellenprüfung lernen musst.«
»Was?«
»Das Schächten2. Das ist verboten, aber das machen wir manchmal für die Juden aus der Vorstadt. Dann kommt der Rebbe, spricht Gebete und wir erledigen unsere Arbeit. Immerhin, wenn die Tiere sterben, dann spricht man Gebete, ihr Tod hat einen Sinn, wenigstens in irgendeiner transzendenten Weise. Beim Soldaten kommt eine Kugel – plopp – und aus ist’s. Absolut sinnlos. Wenn noch Zeit ist, reißt ihm noch jemand die Erkennungsmarke ab. Kein Gebet, nur Chlorkalk im Massengrab.«
»Und dann? Wie hast du nach dem Krieg weitergemacht?«
»Ich hatte Glück. Nach dem Heereslazarett wurde ich in Görlitz entlassen.«
»Weit weg von der Badenser Heimat ...?«
»Ja, weit weg von Freiburg. Aber besser gesund in der Fremde als krank in der Heimat, oder?«
»Ja, und weiter?«
»Da hat mich der alte Graba auf der Straße aufgelesen, hat mich gefragt, ob ich Arbeit suche. >Ja klar<, hab’ ich gesagt, Arbeit, Essen, Logis, alles. Seltsam, er hat mich nie gefragt, was ich gelernt hab’ oder ob ich mit einem Bein solche Arbeit machen kann. Er hat nur gesagt: >Na, dann komm mit, ich brauch’ jemanden, der mir im Laden hilft.<«
»Ja dann, ganz einfach weiter, kein Studium, sondern ein Kriegskrüppel, der bei einem Provinzmetzger aushilft. Immerhin hat der alte Graba mir die Gesellenprüfung geschenkt und ich hab’ jetzt ein Auskommen. Manchmal klaue ich eine Wurst oder ein Stück Speck für mein Abendessen. Der Alte weiß das, aber er sagt nie was.«
Gustav verstand jetzt, warum der Altgeselle ihm half, das zu tun, was er eigentlich nicht tun konnte, die Tiere im Hof zu betäuben und dann abzustechen.
»Wir müssen noch die Abfälle aufräumen«, erinnerte Gustav.
»Ja, jede Nacht kommt da einer, der das Zeug abholt. Es ist wichtig, dass es täglich wegkommt und nicht im ganzen Laden und bis vorne auf die Straße stinkt. Angeblich macht er Dünger, Blutmehl aus dem Abfall. Oder Seife. Keiner kennt sich damit aus und niemand will es genau wissen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Du musst die Abfallecke jeden Tag sauber mit heißem Wasser ausspritzen. Wenn der Boden zu glitschig ist, dann streust du ein paar Schippen Bleichkalk drüber.«
»Weißt du, welches Bild mir jeden Tag bis heute immer noch nachgeht?« Gustav unterbrach:
»Wollen wir nicht erst aufräumen, vielleicht nachher ein Bier und eine Slivovka in der Schwemme hinten im Hof beim Kronenwirt trinken? Ich geb’ einen aus zu meinem Einstand.«
Heinrich blieb beim vorgelegten Thema:
»Ich sehe immer noch, wie der Feldscher im Lazarett meinen Beinstummel auf den Haufen mit den Gliedmaßen der anderen Krüppel geworfen hat. Unterarme, Füße, ganze Beine, am Femur abgetrennt, Blut, kaum Bandagen, das Leiden einer ganzen Kompanie lag da auf dem Handwagen.«
Gustav schwieg, hörte aber weiter zu.
»Dieses Bild kommt mir immer wieder vor Augen, jeden Abend, wenn wir hier aufräumen. Nur der Geruch ist hier anders. Hier riecht es nach Blut, dort, damals roch es nach Karbol. Alles. Sogar das Essen.«
Der Altgeselle blieb stumm und unbewegt in seinen Erinnerungen, schien aber dennoch erleichtert, wieder einmal darüber reden zu können. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben.
Gustav, der neue Lehrling, verabschiedete sich nach der Arbeit mit einer Geste, auf die Heinrich flüchtig und mit einem kurzen Wink reagierte.
»Geh’!«
»Bis morgen. Ein neuer Tag. Licht. Sonne. Und mehr tote Tiere.«
Was ist Freiheit?
In der beginnenden Dämmerung trottete Gustav nach Hause, am Bach entlang, über das schmale Brett am Wehr und dann weiter mitten auf der Dorfstraße, an deren oberen Ende die Bahnstation lag und wo seine Familie auf halber Strecke, gegenüber der Dorfschmiede, den Hof betrieb. Alles war in Ruhe, die Kühe gemolken, die Pferde versorgt, die Schweine in ihren Ställen, die Gänse schlafend im Garten, ihre Köpfe unter den Flügeln vergraben. Stille.
Gustav versuchte, sich eine Zukunft vorzustellen. Ihre bunten Farben, Ansichten von grünen Weiden, reifen gelben Weizenfeldern, die auf die Ernte warteten, und dem blauen Himmel darüber, verblichen bei jedem Schritt und jedem Versuch, die Einzelheiten des Bildes genauer zu betrachten.
»Was ist das mit der Freiheit, von der sie alle daherreden?«
Er dachte an die zwei Rinder, die im letzten Herbst aus dem Stall ausgebrochen, in den Wald geflüchtet und lange nicht einzufangen waren. Eines hatte sich dabei an den Klauen verletzt und hinkte. Sie hatten die Wärme des Stalls und sicheres Futter eingetauscht gegen nichts anderes als die Vorstellung, jetzt selbst in Freiheit den Lauf ihres Lebens bestimmen zu können. Freiheit?
Besuch in Berlin
Wie sich Väter um ihre Kinder sorgen, schweigend, innerlich, kümmerte sich Vater Grzesinski besonders um Albert, der seine Schneiderlehre abgebrochen und sich ohne Abschied von der Familie nach Berlin abgesetzt hatte. Gustav hatte über die Feiertage ein paar Tage frei und so bereitete es Vater Grzesinski keine Mühe, Gustav zu einem Besuch in Berlin anzuhalten. Sorgend gab er ihm mit, er möge doch bitte nach seinem Bruder sehen, wie es ihm ginge und wie er mit dem Leben in der Großstadt zurechtkäme. Um seinem Vorschlag mehr Gewicht zu geben, steckte er ihm ein reichlich bemessenes Taschengeld für die Reise zu.
Gustav hatte seinen Ausflug nach Berlin mit einer Postkarte angekündigt, hoffend, seinen Bruder schon am Bahnhof zu treffen. Die Fahrt mit der Eisenbahn schien kurz und verlief angenehm. Albert wartete am Ende des Bahnsteigs im Schlesischen Bahnhof in Friedrichshain und winkte schon aus der Entfernung. Er freute sich sichtlich über den Besuch aus der Heimat und wohl auch auf die Fleisch- und Räucherwaren, die er richtigerweise im Gepäck seines Bruders vermutete.
»Komm, du kannst die paar Tage bei mir schlafen. Ich wohne zusammen mit Kameraden, wir teilen uns die Bude, das ist billiger so. Die anderen werden uns nicht stören. Wir sind sowieso jeden Tag unterwegs. Du wirst in Berlin deine Freude haben! Hier ist was los! Hier passiert die Zukunft!«
Die beiden jungen Männer, die Geschwister Gustav und Albert, beide aus dem gleichen Dorf und mit der gleichen Erziehung, betrachteten den Glanz und die Schatten in der Großstadt Berlin völlig unterschiedlich:
Albert fühlte überall Unsicherheit, Auflösung und Hoffnungslosigkeit, eine Welt, in der die Arbeitslosen hungerten und Horden verwahrloster Kinder, die sich in dunklen Hinterhöfen langweilten, Zeitungen verkauften, ja, und manchmal doch wie Kinder spielten.
Er hatte sich der SA angeschlossen und dort Freunde gefunden. Er nannte sie Kameraden und verbrachte viel Zeit mit ihnen: Sport, Exerzieren, abendliche Zusammenkünfte, manchmal beim Bier, nicht selten bei Umzügen mit Fackeln. Es schien, er hätte dort seine emotionale Heimat gefunden und genug Ablenkung, um nicht im Hinblick auf die Ausweglosigkeit dieser Welt (also Berlin) vom Nachdenken aufgefressen zu werden. Tagsüber ging Albert keiner richtigen Arbeit nach, sondern klapperte mit einer Liste, die er bekommen hatte, kleine Läden ab und kassierte im Auftrag seiner Kameraden Schutzgeld von den Geschäftsleuten. Eine Mark hier, Groschen da und bis zum Ende eines jeden Tages trugen Albert und seine Gesinnungsgenossen beachtliche Summen zusammen. Das Geld nahm der Kommandant an sich, bezahlte davon die Miete für die Unterkunft der Männer und manchmal etwas zum Essen und hin und wieder mal eine Pulle Schnaps. Der nicht kleine Rest ging an die Buchhalter der SA.
Gustav war von den Eindrücken der Großstadt ebenso überwältigt wie sein Bruder, sah sie aber aus einem anderen Blickwinkel. Er erkannte in allem Chancen und Hoffnung und sammelte eine Unmenge an Eindrücken von gut gewürzten Speisen, bislang ungehörter Musik, von imposanten Bildern in Ausstellungen, wie er sie noch nie gesehen hatte. Noch eindrücklicher waren für ihn die Leseräume in zwei alten Bibliotheken. Berlin, die große schrankenlose Stadt machte ihm keine Angst und er fühlte sich von ihr angezogen. Für den Metzgergesellen aus der Provinz gab es in Berlin viel zu entdecken, vieles von dem er vorher nicht wusste, dass es ihm gefehlt hatte.
Besonders faszinierte ihn die ungewohnte Musik, die aus einem fernen Land kam, wilde Rhythmen, denen er zusammen mit Albert vor einem Tanzschuppen und, an einem anderen Abend, vor einem Kabarett lauschte. Dem Plakat vor der Tür ließ sich entnehmen, dass dort Weintraub’s Syncopators (ausgerechnet aus Breslau) die Stimmung anheizten. Die Brüder hatten nicht genug Geld für den Eintritt, richtig angezogen waren sie auch nicht, sie fielen auf zwischen den Berlinern wie eben Dörfler in einer Großstadt. Albert, dem die Musik gar nicht gefiel, nannte das, was sie hörten, entartete Negermusik und drängte zum Weitergehen, bis ein Schutzmann auf Streife die Situation endgültig beendete:
»Bitte, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen!«
Gemeinsam besuchen sie das Sechstagerennen3, ein kleines geschlossenes Soziotop der Vertreter der neureichen Halbwelt und ein wichtiges soziales Ereignis für ein aufstrebendes radsportkundiges Proletariat dazu, entwickelten sich nicht nur in Berlin und Paris zu einem gesellschaftlichen Ereignis, zumal die erste Austragung in der deutschen Hauptstadt einmal von Kronprinz Wilhelm besucht worden war. Oben in den Logen des Sportpalastes vergnügte sich die feine Gesellschaft. Die Männer standesgemäß in Frack gekleidet, die Damenwelt in tief ausgeschnittenem Abendkleid und beide gemeinsam üppig mit Champagner ausgestattet. Unten auf den billigen Plätzen, dem sogenannten Heuboden, traf sich die Arbeiterschaft und tobte sich dort bierselig aus.
Albert begeistert:
»Der brutale, nackte Kampf von Mann gegen Mann.«
Gustav:
»Da schinden sich arme Menschen, die im Leben sonst nichts haben, für ein paar Mark, riskieren dabei ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben, aber das große Geld machen die Herren im Frack dort oben in den Logen, die Sekt saufen und Schinkenbrötchen fressen.«
Abends fand der Kampf der »Roten« mit den zunehmend erstarkenden »Braunen«, den Nazis, im Freien statt. Nächtliche Fackelumzüge, der stampfende Rhythmus der Militärstiefel hallte über das Pflaster der Straßen und immer wieder gab es Schlägereien mit den angeblich so gefährlichen »Roten«, den Kommunisten, oder mit wem auch immer, dessen Gesicht den »Braunen« nicht gefiel. Bruder Albert war begeistert von dem nächtlichen Treiben, von der Macht seiner Kameraden, Gustav fand das nächtliche Geschehen auf den Straßen verstörend und die offene Gewalt abstoßend.
* * *
Später, zu Hause im Dorf, las er mit Befremden die begeisterten Briefe, die sein Bruder Albert aus Berlin schickte: Er habe jetzt eine Uniform bekommen und exerziere mit seinen Kameraden, wie er sie nannte, jetzt nachts im Fackelschein. In einem seiner Briefe schickte er ein gedrucktes Blatt mit einem Liedtext der »Braunen«: »Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen ...«, darauf handschriftlich am Rand: »Lern’ das mal auswendig, das wird in der Zukunft in unserem Vaterland noch öfter gesungen werden.«
Einer der Briefe vom Bruder in Berlin schloss: »Hier bin ich frei und unter Freunden. Das ist kein Vergleich mit der Fron unter dem tapferen Schneiderlein«, wie er seinen ehemaligen Lehrherren in der Vorstadt gern abschätzig bezeichnete.
Erst jetzt, lange nach der Reise in die Großstadt, dachte Gustav zum ersten Mal im Leben genauer über seine Zukunft nach, weil er ahnte, dass alles, was er kannte, bald anders sein könnte. Ihn überkam die vage Ahnung kommender Veränderungen, so wie das Singen der Bahngleise das Näherkommen eines Zuges ankündigt, lange bevor der Dampf der schwarzen Lokomotive zu sehen ist.
* * *
Die Stadtbücherei in der Kreisstadt war eine reichhaltig sprudelnde Quelle von Bildern und Geschichten aus der Welt, die bislang jenseits Gustavs Denkhorizontes gelegen hatte, aber jetzt in Bildern und Büchern immer deutlicher sichtbar wurde. Er las von Eroberungen, fernen Ländern und Kolonien, von Kaiser-Wilhelmsland4 und den vielen kleinen Inseln im tiefblauen Stillen Ozean. Dort erntete man das ganze Jahr lang süße Früchte, befasste sich mit erfolgreichen Geschäften oder lebte inmitten der edlen Wilden sorglos in den Tag hinein. Stundenlang hatte er die Bilder von Palmen, Blumen und Karten der Südsee betrachtet, traumhafte Länder, die, wie er in einem anderen Buch gelesen hatte, Deutschland weggenommen worden waren, angeblich, weil die Deutschen es nicht geschafft hatten, die Eingeborenen zu zivilisieren. Jetzt versuchten andere Länder, die Savages zu disziplinieren.
Gustav fragte sich, ob der Zuckerbäcker, der in Amerika ein neues Leben beginnen wollte, es inzwischen dort geschafft hatte. Er versuchte, sich diese unbekannten Welten vorzustellen. Dazu hatte er viele Einzelheiten in einem Atlas in der Bücherei in Oppeln nachgelesen, Textpassagen abgeschrieben, Zeitungsartikel ausgeschnitten und in sein Amerika-Album eingeklebt. Amerika, so verhießen seine gesammelten Zettel, Exzerpte und Bilder, sei ein Land, in dem alles möglich sei und die Gebäude bis zu den Wolken reichten. Er lieh sich jede Woche die erlaubten drei Bücher aus und las alles, was mit Reisen, Schiffen und fremden Ländern zu tun hatte.
Freiheit war dabei das Wort, das in vielen Texten vorkam und in Gustavs Empfinden eine ganz bestimmte Saite traf und in resonante Schwingung versetzte. Aber was genau war diese Freiheit?
Manche Bücher, nach denen Gustav in der städtischen Leihbücherei fragte, blieben ihm verwehrt:
»Das ist nicht freigegeben.«
»Warum?«