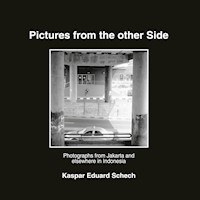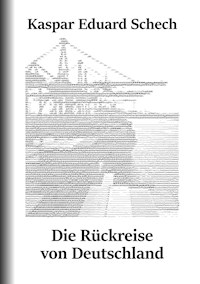5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Kaspar Eduard Schech, aufgewachsen in der fränkischen Provinz, ist ein Draußen-Mensch, einer, der Luft und Freiheit braucht und das in seinem Beruf als Geologe auf der Suche nach Erdöl- und Gasvorkommen auch findet. Sein Lebensweg führt ihn nach Südostasien, in den Regenwald, auf hohe Bergmassive, in quirlige Metropolen. Es ist ein Leben zwischen bürgerlicher Idylle und Abenteuer, 5-Sterne-Hotel und Armut nach dem Absturz. Doch Schech gibt nicht auf. Unterhaltsam und spannend nimmt uns der Autor mit in seine Vergangenheit und ermöglicht dem Leser eine Zeitreise inklusive amüsanter technischer Details, Weltgeschichte und reichlich Musik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
»Bedenke gut, was du dir wünscht, es könnte wahr werden!« (aus Aesops Fabeln)
Warum?
Es hat damit angefangen, dass ich meinen Kindern etwas von meiner Zeit erzählen wollte, mein inzwischen erwachsener Sohn hatte nach alten Bildern gefragt. Ich merkte schnell, dass alleine die Aneinanderreihung von Fotos aus dem Schuhkarton der Erinnerungen keine Geschichte erzählte. Ja, man könnte Textunterschriften einfügen, aber es war meine Absicht, etwas zu hinterlassen, das erzählt und unterhaltsam ist und von mir und meinem Weg durch mein Leben erzählt und alles mit der Zeitgeschichte in Verbindung bringt.
Dieser Text ist die erweiterte und öffentliche Version meines Bilderbuches, das ich für meine Kinder zusammengestellt habe – ohne die Bilder. Ich habe daher Namen und Einzelheiten von anderen Menschen aus dem Text herausgehalten, so dass alles von jedem gelesen werden kann und niemand kompromittiert wird. In gleicher Weise schreibe ich wenig von oder über meine Familie, Frau, Kinder. Nicht, weil es nicht wichtig gewesen wäre, nicht, weil es keinen Einfluss auf mein Leben gehabt hätte, nein, sondern weil es Privates und Persönliches darstellt, das hier nicht breitgetreten werden braucht.
An verschiedenen Stellen erwähne ich Musiktitel, die zu der Zeit gehören. Der interessierte Leser wird die Songs leicht finden oder ohnehin kennen.
Eingerückte Textstellen liefern Hintergrundmaterial zum geschichtlichen Verständnis und sind aus dem Internet zusammengeklaubt. Die Abfolge meiner Erzählungen ist nicht streng chronologisch, sondern folgt eher dem Sinnzusammenhang jedes Erzählstranges.
Eingerückte Textstellen liefern Hintergrundmaterial zum geschichtlichen Verständnis und sind aus dem Internet zusammengeklaubt.
Die Abfolge meiner Erzählungen ist nicht streng chronologisch, sondern folgt eher dem Sinnzusammenhang jedes Erzählstranges.
Der Inhalt
Warum?
Schulzeit und Abitur
Provinzstadt
Zu Hause
Grundschule und Gymnasium
Die 60er Jahre – Aufbruchstimmung
US-Kaserne, Kalter Krieg
Urlaub und die Berge
Musik
Gymnasium, Oberstufe, Abitur
Musik, Radio, Jazz
Fotografie
Aufbruch, die frühen 70er Jahre
Das erste Auto
Die Abende
Auf großer Fahrt
Oberstufe und Abitur
Ego-Trip
Studium und Beruf
Studieren — aber was?
Die ersten Semester
Geologie?
Kastenpraktikum
Praktika, Arbeit
Dorf und Stadt
Der erste Job
Die Zeit in Indonesien
Jakarta
Tarakan
Karriere?
Mit Familie in Jakarta
Das andere Jakarta
The Club
Alleine in Jakarta
Arbeitssuche, Zeit ganz unten
Die Wohnung im Stadtteil Cikini
Zurück in Deutschland –
flash-back
Essen
Doch noch eine Bohrung in Indonesien
Essen, zum allerletzten Mal
Nisah in Deutschland
Die 90er Jahre
Fina
Saigon
Wenig Arbeit für Geologen
Genug vom wilden Leben
Heiraten?
Goldbergbau
Krise und Wende
Reformasi
Urlaub und Essen in Europa
Eigenes Haus und eigene Firma
Die Firma
Gold kochen
Berlin
revisited
, 2003
Die späteren Jahre
Die Molukken
Das Finale
Arbeit für die Mafia
Wissenschaft
Katzen, Musik, Garten
Alle Jahre wieder
Noch ein paar Jahre?
Memories und Marmelade
Glück gehabt
Schulzeit und Abitur
Geboren im Jahr 1955, der Zeit von Rock’n Roll und die Zeit der Babyboomer. Das heißt, solche wie mich gibt es – noch – viele. Ich hatte liebe Eltern, einen großen Bruder und wuchs in einer Kleinstadt auf: Bad Kissingen, knapp 10,000 Einwohner, dazu eine US-Garnison. Eine Kur-Stadt, also Sanatorien, Krankenhäuser, aber auch friedvolle Parks und jede Menge ältere oder kranke Menschen, die die Trottoirs der Stadt im Langsamgang benutzten.
Provinzstadt
Kissingen war – dereinst, damals, irgendwie, trotzdem – meine Heimatstadt. Deswegen nehme ich mir die Freiheit, die Stadt in diesem Zusammenhang als Kissingen und nicht Bad Kissingen anzusprechen, denn Bad Kissingen ist die Stadt der Kurgäste (wir nannten sie respektlos Gastis), für die vier Wochen Kuraufenthalt schön und unterhaltsam sein mögen. Für uns war es eine Kleinstadt, klein, zu eng und provinziell, eingeschränkt. Die Stadt beherbergte eine amerikanische Garnison und die Soldaten, exotische Erscheinungen in ihren grünen Uniformen und in ihren offenen Jeeps sitzend, vermittelten uns einen Eindruck, wie es außerhalb der Provinzstadt, draußen in der weiten Welt, zugehen mochte. Viel Interaktion fand nicht statt: Wir sahen die GIs, wie sie ihre Einkäufe aus dem PX-Laden, zu dem wir keinen Zugang hatten, in dünnen, braunen Papiertüten nach Hause trugen, auch im Regen. Warum? Hatten sie keine Einkaufstaschen?
Jedes Mal, wenn ich in späteren Jahren nach Kissingen zurückkam, vermittelte die Stadt ein anderes Gefühl. Im Sommer als stilvolles und verschlafenes Nest mit dem Staubzuckerauftrag herber Naturschönheit, öfter jedoch als Ansammlung grauer Häuser, hingeduckt im kalten Dezemberregen und zwischen den unbedeutenden Hügeln der Vor-Rhön. Es hat sich vieles geändert seit meinem »damals«. Die Grundtonart, e-Moll mit gelegentlichen Exkursionen nach As-Dur im Seitenthema, ist geblieben. Und bei den Vortragsanweisungen wird in Kissingen immer Andante lente e molto grave gespielt (man sehe sich dazu die Kurgäste an). Nur in den seltenen warmen Sommernächten scheint der Stadtbetrieb in ein leichteres con brio zu verfallen, geswingt oder gar gerockt hat Kissingen nie.
Das obere Ende der Fußgängerzone ist topographisch durch das »Mäuerle«, eine Trockenmauer aus Naturstein vor dem Landratsamt definiert. Kissingens einziger Sex-Shop, damals neu eröffnet, stand in guter Geschäftslage gegenüber eines Altenheimes in der Nähe der katholischen Haupt-Kirche (es gibt drei katholische Kirchen). Kissingens einziger Puff, oder der einzige, von dem ich wusste, war in der Kapellenstraße gegenüber dem Säumarkt, beides unterhaltsam auf meinem täglichen Schulweg und beides inzwischen abgerissen und neu bebaut.
Der Verfall der Stadtsubstanz geht weiter: Die Geschäfte der Innenstadt, damals ein Mix dessen, was der Mensch so brauchte, wandelten sich zu Geschäften, die verkaufen (wollen), was der Mensch nicht braucht: Indianerschmuck, Musik-CDs zum Kuscheln (früher hieß das FuMu, funktionelle Musik oder Aufzugsmusik) oder Lederwaren, die aus Plasten gefertigt sind. Eine wichtige Ausnahme von diesem Abwärtstrend ist die italienische Eisdiele in der unteren Ludwigstraße.
Zu Hause
Geld war immer knapp bei uns, aber wir waren nicht arm. Bis in die Jugendzeit trug ich alte Kleider auf, in denen vorher mein Cousin und dann mein großer Bruder gesteckt hatten. Ich fand das nicht unangenehm. Im Gegenteil, es waren oft urige Klamotten, die ich gerne trug. Ich weiß nicht, ob damals der Mode- und Gruppenzwang in der Schule noch nicht so stark war oder mich nicht erreicht hat, in jedem Fall war die erzwungene Einfachheit im Großen und Ganzen ohne Probleme.
Wir hatten ein altes, aber wohnliches Haus am Rande der Stadt, auf einem kleinen Berg, besser gesagt einem Hügel gelegen. Drum herum waren Obstgärten, Wiesen und Äcker. Wir hielten Hühner und Karnickel, Hasen genannt, und eine gute Verbindung zur Natur oder was wir dafür hielten, aber keine Katze, keinen Hund. Der Boden war steinig und gab wenig Ernte her. Ein Teil der Äcker war an einen Bauern aus dem nächsten Dorf verpachtet, der sich mit seinem Pferdegespann im Frühling und Herbst abmühte, ein paar Kartoffeln oder etwas Getreide aus dem kargen Boden zu erwirtschaften. Unser extra eingezäunter Gemüsegarten hatte bessere Erde und Wasser, musste aber im Sommer dauernd bearbeitet und gewässert werden. Wir klauten – je nach Jahreszeit – frische Erdbeeren, Rhabarber oder Kohlrabi aus dem Garten und vernaschten alles auf der Stelle. Frische Kirschen, gleich drei verschiedene Arten vom Baum gepflückt, Mirabellen, Zwetschgen, Äpfel – alles war leicht zu haben und was übrig war, wurde gleich nach der Ernte zu Marmeladen, Säften und Konserven verarbeitet. Ich hatte in meiner Kindheit das Glück, vielerlei Sachen, die ich sonst nie gekannt hätte, auszuprobieren und zu kosten.
Um unser Einkommen aufzubessern, verkauften meine Eltern Flaschenbier, Limonade und frische Eier von unseren Hühnern oder Kirschen und Äpfel in der Erntezeit. Die Bierkundschaft war eine seltsame Mischung von Zeitgenossen. Da war ein Nachbar, Vertreter von Backwaren, der sich nach seiner Verkaufstour durch die Provinz ausratschte und bei einer Flasche Bier ungefragt seine absurden politischen Meinungen erklärte. Er war harmlos. Oder ein Kriegskrüppel aus der Sozialbausiedlung, der sich seine Tage vor dem Fernseher mit Bier erträglich soff und alle paar Tage zu uns gekrabbelt kam, um ein paar Flaschen Bier gegen die Realität einzukaufen. Oder die amerikanischen Soldaten, die gelegentlich mit dem Jeep vorfuhren, und gleich zwei, drei Kisten Bier mitnahmen und großzügig mit grünen Dollarnoten bezahlten, um damit am Flugplatz im Wald Grillpartys zu feiern.
Ich will kurz auf meine Vorfahren eingehen, insofern als sie auf mein Leben Einfluss hatten. Erstmal der Urgroßvater. Er war dank ererbten Geldes stinkreich. Er leistete sich öfter einen Sonderzug der damals neuen Eisenbahn, um zusammen mit seinen Kumpanen von Würzburg nach Kissingen zu fahren. Der Urgroßvater gründete die »Königlich privilegierte Freihandschützengesellschaft«, einen Schützenverein, der eine Schießanlage in dem Haus gebaut hatte, in dem ich groß wurde. Der reiche Urgroßvater hat es zusammen mit seinen Freunden geschafft, seinen gesamten Reichtum durchzubringen. Er verstarb einsam und unter bescheidenen Umständen. Sein Sohn, mein Opa, war ein braver Mann, der mir viel von den alten Zeiten erzählte, von dem Hund, den er einmal hatte, seinen Freunden, denen er nachtrauerte, von seiner Zeit als Wandergeselle im Erzgebirge und den vergangenen Tagen, als der Schießstand noch nach Pulverdampf roch. Er hatte Conrad Röntgen kennengelernt und in seiner Wohnung in Würzburg Schreinerarbeiten erledigt und beschrieb ihn als netten, freundlichen Menschen. Von seiner Zeit im Ersten Weltkrieg, in dem er in Galizien eingesetzt war, sprach er hingegen nie. Er war ein durch und durch friedliebender Mensch, dem es gelungen war, auch den Wirrungen der Hitlerzeit aus dem Weg zu gehen.
In den ersten sechs Jahren meines Lebens verbrachte ich fast jeden Tag mit meinem Opa. Er hat sicher hart gearbeitet, aber er hatte genauso Freude am Kegeln und Billard (mit einem eigenen, selbstgebauten Tisch) und hat es auch mal krachen lassen, wenn es am Samstagabend zum Tanzboden ging. Er hatte die richtige Work-Life-Balance, würde man heute sagen. So kam es, dass bei uns Waffen, Jagd und Schießen immer Themen waren, oft weiter befeuert von einem Onkel, der als verhinderter Jäger mich mit allerlei Zeitschriften (»Waffenjournal«) versorgte, uns oft eines seiner Schießgewehre lieh, mit denen wir dann auf Scheiben schossen oder bei Nacht Kaninchen jagten (und auch aßen). Was ich mit diesem Absatz sagen will, ist, dass ich im Alter von zehn Jahren gelernt hatte, mit Waffen umzugehen, sowohl technisch, aber auch im Hinblick auf Sicherheit und Moral.
Grundschule und Gymnasium
Die Volksschule war ein finsterer, trister Bau. Die Grundschule, Klieglschule genannt nach einem ausgewanderten Stifter oder Gönner, war ein Vorkriegsbau. Im Pausenhof ragte der Kellerereingang zu einem Luftschutzbunker, der immer verschlossen war, aus dem Boden. Die Lehrer sahen es gar nicht gerne, wenn wir dort spielten. Angeblich war es gefährlich, man munkelte von giftigen Gasen im Untergrund. Der Pausenhof war asphaltiert und die Heizung im Keller der Schule war ein dampfend-fauchendes Ungetüm, das mit Kohle befeuert wurde. Das Gebäude hatte seinen eigenen Geruch von Reinigungsmitteln und Bohnerwachs, das mit grünen Kehrspänen durch die Gänge gefegt wurde. Widerlicher Mief hing in der Turnhalle mit ihren alten, eisernen Turngeräten aus der Vorkriegszeit, die wie Folterwerkzeuge erschienen. Die Halle roch nach Staub und Schweiß und es gab keine Dusche, keine Umkleidekabine. Nach einer Stunde Sitzfußball auf dem dreckigen Bohnerwachsparkett blieb der Geruch der Halle den ganzen Tag an den Händen und in der Kleidung.
Die Klassen der Grundschule wurden nach Jungen und Mädchen und nach Religionszugehörigkeit sortiert. Meine erste Klasse war, zum Beispiel, die »1.k.Kn.«, die Kurzform für erste Klasse, katholische Knaben. Ja, sogar der Pausenhof war getrennt: Die Mädchen spielten mit Hüpfseilen unten auf einem geschotterten Pausenhof, die Jungen oben, auf der anderen Seite des Gebäudes, auf dem asphaltierten Platz. Koedukation, Mädels und Jungen in einer Klasse, sei »nicht gut für uns«, sagte man, und erreichte mich erst später, in der achten Klasse im Gymnasium. Ich habe wenig Erinnerungen an die frühe Schulzeit – und das ist wohl gut so. Erwähnt sei noch, dass wir in den ersten zwei Schuljahre unsere Aufgaben mit einem weißen Griffel auf eine schwarze Schiefertafel kratzten; auf der linierten Vorderseite Schreibübungen, auf der Rückseite durften wir Bilder malen, die wir uns ausdachten. Erst im dritten Jahr gab es Papier, Schreibhefte, in die wir die Buchstaben mit dem Tintenfüller malten. Kugelschreiber waren streng verboten und wurden uns vom Lehrer weggenommen.
Eine andere Einzelheit aus der Zeit der 1960er Jahre war die Spardose. Eine Art Sparschwein, das verschlossen war und nur von der Bank mit einem speziellen Schlüssel geöffnet werden konnte. Der Einwurfschlitz für Münzen hatte kleine Zähnchen, damit man nicht die Groschen oder Markstücke, die ein gutmeinender Onkel da vielleicht eingeworfen hatte, wieder aus der Dose herausfummelte. Es gab dann noch ein kleines Loch an der Oberseite, das dazu vorgesehen war, Geldscheine in gerollter Form aufzunehmen. Einmal im Jahr wurden die Dosen geöffnet. Das zwar am 30. Oktober, dem sogenannten Weltspartag, ein Begriff, der uns einreden sollte, dass Sparen gut, erstrebenswert und ein weltweites Phänomen sei. Anstatt Unterricht kam an diesem Tag der Vertreter der Sparkasse in die Schule, die Dosen wurden geöffnet, das Geld auf einem Brett abgezählt und dann handschriftlich im Sparbuch gutgeschrieben. Ich erzähle das, um die Stimmung der Zeit wiederzugeben. Wer sparte, war ein guter Mensch, das versuchte man uns in der Schule beizubringen. Man beachte den Kontrast zu der heutigen Null-Zins-Politik. Ich weiß nicht, ob das als Erziehung zum Kapitalismus vorgesehen war oder nur der Zeitgeist der 60er Jahre.
Der Übergang ins Gymnasium nach der vierten Volksschulklasse war in jeder Weise ein Aufstieg. Ein neues, ockerfarbenes Gebäude, helle Zimmer, Tische, die nach Holz und nicht nach Schweiß und nach gestern rochen, ein kürzerer Schulweg – alles war besser. Selbst das Signal, das den Vormittag in Schulstunden aufteilte. Im dunklen Bau der Grundschule läutete dazu eine Feuerklingel laut, erschreckend, harsch. Im Gymnasium dagegen kam zum Takt der Unterrichtsstunden ein harmonischer Gong aus dem Lautsprecher, vier Töne in Dur, absteigend, 5-3-1-5, ein Signal, dem wir oft erwartungsvoll entgegensahen. Zur Aufnahme ins Gymnasium war eine Prüfung notwendig. Drei Tage lang, aber selbst das empfand ich als angenehm, denn ich war mir sicher (warum eigentlich?), die Bewertung zu bestehen. Das Gymnasium nannte sich »Neusprachliches Gymnasium«, hatte aber im Kontrast zu seinem neuphilologischen Anspruch ein Pythagoras-Denkmal vor dem Eingang und schrieb Latein als Pflichtfach vor. Fünf lange, nutzlose Jahre. »Ubi bene, ibi patria«, »Wo es dir gut geht, da ist deine Heimat« lehrten sie uns in Latein. Selbst das war falsch, wie ich jetzt, nach vielen Jahren im Ausland, weiß.
Die 60er Jahre – Aufbruchstimmung
Die Freizeit, die Sommernachmittage, verbrachten wir im Freischwimmbad, einer prächtigen Anlage an einem Hang und mit Aussicht auf das Flusstal der Saale. Mir war damals nicht klar, wie schwierig es war, ein großes Schwimmbecken an einem Hang anzulegen. Auch hier, das muss erwähnt werden, leistete die amerikanische Garnison Hilfe bei den Erdarbeiten und alle Soldaten der Garnison bekamen deshalb – angeblich für alle Zukunft – freien Eintritt in das Bad.
Oder wir verbrachten die Nachmittage auf dem Rummelplatz, einem chaotischen Gelände, auf dem ein- oder zweimal im Jahr ein Zirkus oder Schausteller Schiffschaukeln und Autoscooter aufbauten. Schießbuden und der Geruch von gebrannten Mandeln und Popcorn. Vom Opa oder von der Mutter schnorrte ich zwei Mark extra zu meinem Taschengeld, um mich dort zu amüsieren. Woran ich mich gut erinnere, war der Song »Apache« von den Shadows, der in den Buden dauernd gespielt wurde. Ein Blick ins Internet zeigt, dass dies das Jahr 1960 oder 1961 gewesen sein muss. Samstags, am Nachmittag, kam im Fernsehen der »Beat Club«, eine Sendung – in Schwarz-Weiß –, die ich manchmal bei einem Freund sehen konnte. Die Musik der Zeit. Es wurden Titel vorgestellt wie: Herman’s Hermits, Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Titch (»Legend of Xanadu«), Manfred Mann (»Do Wah Diddy Diddy«), aber auch The Tornados (»Telstar«) sind Namen und Songs, die mir in Erinnerung geblieben sind. Damals hatte mein Vater seine kleine Schreinerwerkstatt als Probenraum an eine Band aus der Nachbarschaft vermietet, zum Leid der Nachbarn, die sich bitter über den Lärm beschwerten, wenn die Band samstags übte. Einer ihrer Songs war »Wooly Bully« von Sam The Sham & The Pharaohs. Unter der Woche schlich ich mich heimlich in den Proberaum und bewunderte die Instrumente und Verstärker. Die elektrischen Gitarren und Röhrenverstärker waren wie von einem anderen Stern. Manchmal setzte ich mich an das Schlagzeug und probierte – leise – ein paar Sachen aus.
Meine Mutter pflegte die Verbindung mit ihrer Verwandtschaft, Brüdern und Schwestern, die in der damaligen DDR und in Schlesien, heute Polen, lebten. Alle sechs Wochen wurden Päckchen mit Konsumgütern gepackt, die dort begehrt waren. Das waren Kaffee (Jacobs Krönung: »Mit dem ganzen Aroma«), Textilien aus neuen synthetischen Stoffen, zum Beispiel die fortschrittlichen Nylonhemden, die nie gebügelt werden mussten, aber schon bald vergilbten und im Sommer unerträglich auf der Haut klebten. Im Gegenzug kamen aus Polen Viktualien, Produkte der Landwirtschaft wie Schinken, Butter und geräucherte Würste. Ein Mal waren wir zu Besuch im Osten. In der Erinnerung geblieben sind endlos lange Eisenbahnfahrten und der Geruch von Dampflokomotiven, der im Osten deutlich anders war, denn dort wurden die Maschinen mit stinkiger Braunkohle befeuert.
Was hatten unsere Pakete damals, mit Vietnam heute, zu tun? Hier eine Erklärung:
Die Kaffeekrise in der DDR begann 1976. Damals waren die Weltmarktpreise für Kaffee aufgrund einer Missernte in Brasilien dramatisch angestiegen und zwangen die DDR, viel harte Währung für Kaffeeimporte auszugeben. Die Führung drosselte die Importe von Nahrungs- und Genussmitteln insgesamt, um dringend benötigte Devisen für Erdöl zur Verfügung zu haben. Mittelbar führte die DDR-Kaffeekrise zu Veränderungen im weltweiten Kaffeemarkt.
Die bis dahin angebotene preiswerteste Kaffeesorte »Kosta« wurde eingestellt und nur noch teurere Sorten angeboten. Daneben kam mit dem Kaffee-Mix eine Art Ersatzkaffee auf den Markt. Man ging davon aus, die Bevölkerung sei in der Lage, sich über Verwandte in der Bundesrepublik mit Kaffee zu versorgen. Die steigende Nachfrage für das typische Gegengeschenk der Ostdeutschen, den Dresdner Christstollen, bescherte der DDR-Wirtschaft ebenfalls Probleme.
Die Bürger der DDR lehnten den Kaffee-Mix überwiegend ab und empfanden den Kaffeemangel als Angriff auf einen wichtigen Bestandteil der Alltagskultur. Spottnamen wie »Erichs Krönung« wurden geprägt. Es kam zu empörten Reaktionen sowie zu Protesten. Als sich der Kaffeepreis wieder normalisierte, blieb die Devisenbeschaffung in den 1980er Jahren ein Problem, die zu Versorgungskrisen und zu Gesichtsverlusten der politischen Führung führten. Es wird angenommen, dass 20 bis 25 Prozent des gesamten Kaffeeverbrauches in der DDR in den Jahren von 1975 bis 1977 als Bestandteil des klassischen Westpakets aus der Bundesrepublik kamen. Dem Kaffee kam damit eine weit über die Rolle als Genussmittel und nach dem Öl als wichtigstem Welthandelsprodukt reichende Funktion als innerdeutsches Symbol zu.
Die Beziehungen zwischen der DDR und Vietnam waren eng und freundschaftlich. In den Jahren 1980 und 1986 wurden unter dem Eindruck der Kaffeekrise Regierungsabkommen geschlossen, um die Versorgung mit Kaffee zu stabilisieren. Die DDR lieferte die Ausrüstung und die Maschinen, die für den Anbau von Kaffee nötig waren, Vietnam erhöhte die Anbaufläche von 600 auf 8600 Hektar und schulte einheimisches Fachpersonal auch in der DDR im Pflanzenbau. Doch Kaffee braucht vom Anpflanzen bis zur Ernte acht Jahre. Im Jahr 1990 sollte es die erste verwertbare Ernte geben. Ironie der Geschichte: die Wiedervereinigung. Die DDR, die den Kaffee brauchte, existierte nicht mehr. Vietnam gelang es, sich auf dem Weltmarkt als zweitgrößter Anbieter zu etablieren. Dies führte 2001 – nun durch Überversorgung – zu einer weiteren globalen Kaffeekrise. 2008 war Deutschland vor den USA der größte Abnehmer vietnamesischen Kaffees.
Mein Vater, Ernährer und Geldverdiener der Familie, verließ das Haus immer früh am Morgen, während wir alle noch schliefen. Zu seinem Frühstück hörte er Radionachrichten. Wenn etwas außerordentlich Wichtiges berichtet worden war, schrieb er uns einen Zettel, den er auf dem Küchenofen oder Esstisch deponierte. Ich erinnere mich an drei solcher Zettel, die uns schon vor dem morgendlichen Haferbrei in Angst oder Beklemmung versetzten.
Der erste Zettel, in meiner Erinnerung war 1961, als die Berliner Mauer gebaut wurde. Wir hatten einen direkten Bezug zu dem Ereignis, denn nur Wochen zuvor, war die Familie einer Tante aus der »Ostzone« bei uns zu Besuch gewesen. Sie brachten im Auto Wertsachen, Gemälde, Teppiche mit, die sie bei uns einlagerten. Die Erwachsenen diskutierten bei jedem Essen, ob es besser sei, gleich dazubleiben, und die Existenz im Osten aufzugeben, oder ob die Situation doch nicht so dramatisch war, wie wir sie empfanden. Falsche Entscheidung: Sie fuhren zurück und konnten nach dem Mauerbau für Jahrzehnte nicht mehr ausreisen und uns besuchen.
Ein Jahr später – mein Vater schrieb nur die wirklich wichtigen Sachen auf – Atomkrieg! Oder doch nicht? Es war die Zeit der Kubakrise. Wir waren vorbereitet und trotzdem in Sorge, obschon es weit jenseits unserer Vorstellung lag, was ein Krieg mit solchen Waffen bedeutete. Wie hörten jeden Abend schweigend beim Abendessen die ausführlichen Sieben-Uhr-Nachrichten, während die Welt derweil am Abgrund stand und diesem immer näher zu rücken schien:
Die Kubakrise im Oktober 1962 war eine Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der UdSSR, die sich aus der Stationierung US-amerikanischer Mittelstreckenraketen vom Typ Jupiter auf einem NATO-Stützpunkt in der Türkei und die daraufhin beschlossene Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen auf Kuba entwickelte. Während des Schiffstransports nach Kuba drohte die amerikanische Regierung unter Präsident John F. Kennedy damit, dass sie Atomwaffen einsetzen würde, um die Stationierung auf Kuba zu verhindern. Die eigentliche Krise dauerte 13 Tage. Ihr folgte eine Neuordnung der internationalen Beziehungen. Mit der Kubakrise erreichte der Kalte Krieg eine neue Dimension. Beide Supermächte kamen während der Krise einer direkten militärischen Konfrontation am nächsten. Erstmals wurden die ungeheuren Gefahren eines möglichen Atomkrieges einer breiten Öffentlichkeit bewusst.
Wieder ein Jahr später lag da wieder so einen Zettel, der den ganzen Tag veränderte: »Kennedy in seinem Wagen erschossen!« Der Präsident war unbeschreiblich populär. Er hatte wenige Monate zuvor Berlin besucht und seine berühmten vier Worte auf Deutsch gesprochen: »Ich bin ein Berliner.« Es drehte sich nicht nur um Berlin, der Mann stand für Erneuerung, Wandel, Zukunft und vor allem eines: Frieden. Das strahlte weit, sogar bis in unsere Provinzstadt.
In den Jahren danach, so um 1965/66, berichtete das Radio täglich von Ereignissen in Jakarta. Die Nachrichten, die immer dann kamen, wenn ich mit den Hausaufgaben anfing, berührten uns nicht direkt und interessierten mich kaum, denn ich wusste nicht, wo Indonesien lag (irgendwo in der Südsee) und die Radionachrichten schienen nicht wichtig genug, um das Land im Schulatlas nachzuschlagen. Man sprach von Revolution, Umsturz, schweren Zeiten – alles war weit weg, am anderen Ende der Welt.
Die Massaker in Indonesien 1965 - 1966 waren Massenmorde an Mitgliedern und Sympathisanten der Kommunistischen Partei Indonesiens und chinastämmigen Bürgern durch Teile der indonesischen Armee unter dem Kommando des Generals Suharto. Das Morden begann im Oktober 1965 und folgte auf einen Putschversuch der sogenannten »Bewegung 30. September«, für den die kommunistische Partei (PKI) verantwortlich gemacht wurde. Auch eine große Zahl an Zivilisten beteiligte sich an dem Morden. Heute gilt als gesichert, dass die Putsch-Beschuldigungen gegen die PKI falsch waren. Die Vorgänge wurden in der offiziellen indonesischen Geschichte als heroische Taten verklittert, die dem Schutz des Landes vor dem Kommunismus dienten. Die gewaltsame Ausschaltung der Kommunistischen Partei wurde in den USA und Großbritannien von offizieller Seite begrüßt und heimlich unterstützt.
Danach wurde das Radio abgestellt, damit ich mich besser auf meine Aufgaben konzentrieren konnte. Wie wenig ahnte ich damals, dass ich dereinst einmal einen großen Teil meines Lebens in Indonesien verbringen würde und dass meine Zeit dort anfangs noch deutlich von der Suharto-Diktatur geprägt sein würde.
Kaum dass Jakarta und Indonesien aus dem Fokus der täglichen Neuigkeiten verschwunden waren, eröffneten die Nachrichten mit Meldungen aus Vietnam, wo jetzt der Krieg in vollem Gang war.
US-Kaserne, Kalter Krieg
Die US-Kasernen und das Militärgebiet, entstanden in der Vorkriegszeit, waren immer der Gegenpol zu Kissingens Kurbetrieb. Wie es mir damals schien, war die Garnison ein Fenster zu einer anderen, fremden Welt. Fremd schon alleine, weil ich (noch) kein Wort von dem amerikanischen Englisch verstand.
Das Thema der amerikanischen Garnisonstadt habe ich, je nach Lebensalter, verschieden erlebt. Als ich in der Grundschule war, gab es die Umgehungsstraße noch nicht, die die Kaserne mit dem Manövergelände verband, auf dem auch ein kleiner Flugplatz und eine Raketenstellung lagen. Das hatte zur Folge, dass die Panzer auf dem Weg ins Gelände durch die engen Straßen der Stadt fuhren. Und genau da entlang ging eine wesentliche Strecke meines Schulweges. Ich hatte Angst vor den riesigen Panzern und dem Lärm, den sie veranstalteten, weniger vor dem Dreck, noch weniger vor den Soldaten. Ein, zwei Meter auf dem Trottoir neben einem M48-Panzer oder – noch beängstigender – einem M88-Bergepanzer zu laufen, das war schrecklich und kam mindestens einmal in der Woche vor. An guten Tagen winkten wir Kinder und die Soldaten warfen grüne Konservendosen mit Erdnussbutter oder Schokolade vom Panzer, Reste ihrer Feldverpflegung. Mit der Erdnussbutter wussten wir zunächst nichts anzufangen, denn wir verstanden die Schrift auf der Dose nicht und hatten nicht die geringste Vorstellung, ob das braune Zeug in der Dose Schuhcreme, Pioniersprengstoff oder ein Lebensmittel war. Bis wir es probierten.
Wie zur Entschädigung war im Sommer, in der Woche vor dem 4. Juli, die US-Freundschaftswoche. Dazu wurde eine Parade mit zackiger Blasmusik in der Innenstadt abgehalten. Die Amis hatten blank geputzte, metallisch-glänzende Helme und führten als Maskottchen ein niedliches Pony mit im Zug. Noch besser waren die Tage davor. Heiße Tage, Jahrmarkstimmung. Es gab eine Waffenausstellung in der Kaserne und wir Kinder durften nach Herzenslust auf und in den Panzern herumkrabbeln und das Kriegsgerät besichtigen, anfassen, damit spielen. So weiß ich jetzt, wie sich die Züge eines Granatwerfers anfühlen und wie schwer die Colt-45-Pistole in der Hand wiegt. Dazu gab es frischen Orangensaft, Softeis und Erdnussplätzchen, die ein großer schwarzer Mann an uns verteilte. Trotz der Waffenschau hat mich der spielerische Umgang mit dem Kriegswerkzeug in keiner Weise militarisiert. Eher im Gegenteil.
Es war Kalter Krieg und die Notwendigkeit, sich einmal verteidigen zu müssen, hing schwer in der Luft. Meine Mutter hortete in einer Kiste ein paar Kilo Mehl, Öl, Nüsse. Mein Vater kam von der Arbeit und erzählte von einem Lehrgang gegen ABC-Waffen. Die seien angeblich viel weniger gefährlich, als man sich vorstellte. Man bräuchte sich nur nach dem atomaren Blitz hinzulegen, den Kopf mit einer Aktentasche abzudecken (wer hat immer so eine Tasche dabei?) und ein paar Minuten zu warten, bis alles vorbei sei. So mühelos, versuchte man uns damals nahezubringen, wäre das mit dem Atomkrieg. Kein Wunder, dass wir die Hawk-Raketenstellungen im Wald nie hinterfragten, nie überlegten, was oder wen die denn da schützten. Einen trockenen Kiefernwald und magere Wiesen? Etwa 1961 oder 1962 flogen amerikanische Jets fast täglich im Tiefflug Scheinangriffe auf die Stellungen im Wald hinter unserem Haus, wahrscheinlich um die Radaranlage (1991 abgebaut) auszuprobieren. Sie verschreckten dabei unsere Hühner im Garten, die sich von den Düsenjägern genauso fürchteten wie vor dem Habicht, der Küken stehlen will. Man munkelte, dass da im Wald Atomwaffen gelagert seien. Andere sagten, das sei völliger Quatsch. Ich habe vierzig Jahre gebraucht, bis ich die Wahrheit aus Einzelheiten im Internet zusammengepfriemelt hatte. Da waren tatsächlich eine Weile lang zwei atomare Artilleriegranaten gelagert (Reichweite etwa 30 km) und hätten nach Norden, in Richtung der Zonengrenze bei Bad Neustadt an der Saale abgefeuert werden sollen. Die Gefechtsköpfe lagerten ein paar Kilometer weiter in einer renovierten Munitionsfabrik aus dem Zweiten Weltkrieg, die, praktischerweise und mitten im Wald einen Eisenbahnanschluss hatte. Vortrefflich angelegt. Erst jetzt ergeben meine alten Beobachtungen einen Sinn. Wahrscheinlich aus Gründen der Geheimhaltung hatte die US-Einheit in der Kissinger Garnison (2nd Squad, 14th Armored Cavalry) gar nichts mit den Atomgranaten zu tun. Die Soldaten für die atomare Artillerie kamen sozusagen auf Besuch aus anderen Landesteilen und wurden nach Wochen in andere Gebiete transferiert.
Warum ich das alles erzähle? Es war meine Kindheit und Jugend, meine Normalität zwischen Kaltem Krieg auf der einen Seite und Rock and Roll auf der anderen.
Urlaub und die Berge
Aber es gab auch andere wichtige Erlebnisse in diesem Zeitabschnitt: Urlaub, zum Beispiel. Es war die Zeit, in der »man« anfing, sich einen Urlaub zu leisten. Eine Nachbarsfamilie fuhr mit dem VW-Käfer und ihre drei Kindern nach Italien an die Adria und ihr Junge, mein Spielfreund, erzählte mir unglaubliche Einzelheiten aus dem fernen Ausland und vom Meer, das ich bis dahin noch nicht gesehen hatte.
Meine Eltern verreisten zunächst mit Freunden nach Österreich (»Mondsee«) und im Jahr darauf an den Gardasee in Italien und hörten monatelang nicht auf, von dem Land zu schwärmen, in dem die Zitronen blühen und brachten Kochrezepte und Farbfotos mit. Oder Eier, Hühnereier aus dem Ausland, um die Genetik unserer Hühnerschar zu verbessern. Immer wenn die Eltern verreist waren, kam eine Tante, um uns zu bekochen und den ganzen Betrieb mit Hühnern, Hasen, uns Kindern und Opa am Laufen zu halten. Tante Gertrude war eine außergewöhnlich gute Köchin und ihre hausgemachten Eierbandnudeln bleiben unvergessen.
Mein erster Sommerurlaub ging mit dem Zug nach Berchtesgaden, davor übernachteten wir zwei Tage in München. Mein Vater, der in seinen jungen Jahren einige Jahre in München gelebt und gearbeitet hatte, war der perfekte Fremdenführer. Er erklärte München wie kein anderer und obwohl wir nur die Theresienhöhe und das Deutsche Museum besuchten, hatte ich das Gefühl, alles Wichtige gesehen zu haben. Weil es regnete, verbrachten wir einen ganzen Tag im Museum, und betrachteten ausführlich jede Sammlung und Ausstellung, von der Mineralogie über Musikinstrumente bis hin zur Raumfahrt.
Ich hatte meine erste Kamera geschenkt bekommen, eine Kodak Instamatik-126 (mit Blitzlämpchen), ein Weihnachtsgeschenk. Ein Film mit zwölf Bildern für zehn Tage Urlaub, Berge, Wasser. So viel Neues, so viel zu sehen: Ein Salzbergwerk, das Hitlerhaus am Kehlstein, der Königssee – jeder der zehn Tage war ein Erlebnis. Dazu die Berge, die aus so vielen verschiedenen Arten von Stein bestanden. Ich glaube, im Laufe dieser Reise begann in mir die Idee zu keimen, später »was mit Steinen« zu machen; Geologie als Wissenschaft oder Studienfach war noch weit unter dem Horizont meines kindlichen Denkens.
Musik
Musik war immer präsent. Meine Eltern sangen in einem Chor und immer war Musik im Haus. Leider auch ein uraltes, arg verstimmtes, schwarzes Monstrum von Klavier. Weil das Klavier eben schon da war, schien es eine ausgemachte Sache, dass ich lernen sollte, darauf zu spielen. Ein Zugeständnis: Es wurde noch einmal gestimmt. Ich wollte lieber ein anderes Instrument erlernen, eines, das man mitnehmen kann, um dort zu musizieren, wo es Spaß macht: alleine auf einem Berg bei Sonnenaufgang oder – realistischer – mit Freunden vor dem Zelt, am Lagerfeuer. Ein Akkordeon zum Beispiel oder wenigstens eine Gitarre. Oder Trompete, Saxofon, egal, solange es in eine Kiste passt und transportabel war. Am Ende überwogen die wirtschaftlichen Überlegungen, es war kein Geld da, um ein neues Instrument zu beschaffen. Also doch Klavier. Mein Onkel, der verhinderte Jäger, versuchte, mich aus meinem Dilemma zu erlösen, und schenkte mir ein Horn, damit ich das Blasen auf einem Blechblasinstrument lernte. Ein Signalhorn ohne Ventile, das nur einen begrenzten Tonumfang hat. So sehr ich mich mit dem verflixten Horn abmühte, es führte letztendlich nirgendwo hin.