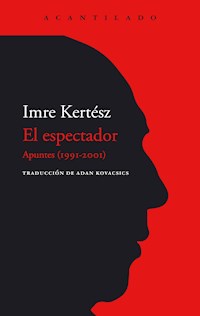7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Kertész trifft Kertész: ein Zwiegespräch über sein Leben und seine Literatur. Mit «Dossier K.» legt Kertész seine Autobiographie vor. Sie vereint Werkanalyse und Zeitzeugenschaft im besten Sinne: Von den familiären Wurzeln über die Schrecken des Nationalsozialismus und die Entstehung des «Roman eines Schicksallosen» bis hin zu jenem Leben zwischen Schauprozess, Aufstand und Diktatur, das Kertész im Budapest des Kalten Krieges führen musste. «So universal ist Kertész' Literatur, so undogmatisch und unaufgeregt, dass sie die Würde des Nobelpreises mittlerweile weit übersteigt.» (Neue Zürcher Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Ähnliche
Imre Kertész
Dossier K.
Eine Ermittlung
Aus dem Ungarischen von Kristin Schwamm
Vorbemerkung
Vielleicht ein Dutzend Tonbänder hat das Gespräch gefüllt, das mein Freund und Lektor Zoltán Hafner in den Jahren 2003/2004 für ein sogenanntes «General»-Interview mit mir aufgenommen hat. Das Dossier mit dem abgeschriebenen und redigierten Textmaterial erreichte mich in Gstaad, in einem Hotel dieser Schweizer Kleinstadt. Als ich die ersten Sätze gelesen hatte, legte ich den Manuskriptpacken beiseite und öffnete, sozusagen mit einer unwillkürlichen Bewegung, den Deckel meines Computers… So ist dieses Buch entstanden, das einzige meiner Bücher, das ich eher auf äußere Veranlassung als aus innerem Antrieb geschrieben habe: eine regelrechte Autobiographie. Folgt man jedoch dem Vorschlag Nietzsches, der den Roman von den Platonischen Dialogen herleitet, dann hat der Leser eigentlich einen Roman in der Hand.
I.K.
In Fiasko schreibst du: «Im Alter von vierzehneinhalb Jahren stand ich etwa eine halbe Stunde lang Auge in Auge dem Lauf eines feuerbereiten Leichtmaschinengewehrs gegenüber, das auf mich gerichtet war.» Das ist, glaube ich, im Hof der Gendarmeriekaserne passiert. Warum kommt diese Episode im Roman eines Schicksallosen nicht vor?
Vom Standpunkt des Romans aus gesehen war sie ein anekdotisches Moment, deshalb mußte sie draußen bleiben.
Doch vom Standpunkt deines Lebens aus gesehen hätte es ein entscheidendes Moment sein können…
Soll ich jetzt etwa über all das reden, worüber ich nie reden wollte?
Warum hast du dann darüber geschrieben?
Vielleicht gerade, um nicht darüber reden zu müssen.
So schwer fällt es dir?
Weißt du, das ist wie bei den Interviews mit den alten Überlebenden in der Spielberg-Serie. Ich hasse solche Sätze wie: Man hat uns in den Pferdestall getrieben… Wir wurden in einen Hof gedrängt… Man hat uns in die Ziegelei von Budakalász gebracht usw.
Warum? Ist es nicht so passiert?
Im Roman ja. Aber der Roman ist Fiktion…
Die bei dir, wie ich weiß, auf der Wirklichkeit basiert. Wie kamst du auf jenen engen Hof in der Gendarmeriekaserne?
Letztlich genau so, wie ich es im Roman eines Schicksallosen beschrieben habe. Mitten in der Nacht – im Sitzen war ich fest eingeschlafen, gegen die Knie meines Hintermannes gelehnt, mein Vordermann an die meinen – erwachte ich von Gebrüll und Sirenenheulen. Eine Minute später stand ich da draußen auf dem Hof, unter einem mondhellen Himmel, über den in dicht aufeinanderfolgenden Staffeln Bombenflugzeuge zogen. Auf der niedrigen Mauer hockten betrunkene Gendarmen hinter Maschinengewehren, die auf die im Kasernenhof eingezwängte Menge, auf uns, gerichtet waren. Es ist überflüssig, das alles zu erzählen, in Fiasko kannst du eine viel bessere Beschreibung davon lesen.
Ja, aber dort erscheint es so, als verstünde der Junge von alledem überhaupt nichts, er weiß nicht einmal, als wer oder was er dort hingekommen ist.
Im Grunde genommen war es auch so.
Und hast du dich nie für den, wenn ich so sagen darf, historischen Hintergrund dieser Szene interessiert?
Und ob ich mich dafür interessiert habe. Nur, verstehst du, die Verhältnisse waren ja nicht so einfach…
Also doch keine Fiktion, sondern Wirklichkeit…
Ich würde zwischen beiden keinen so scharfen Unterschied machen. Aber lassen wir das jetzt. Das Problem war, daß es im Kádár-Regime außerordentlich schwierig war, an Dokumente heranzukommen. Vor allem in den sechziger Jahren, als ich den Roman eines Schicksallosen schrieb. Als sei man geradezu zu Solidarität mit der Nazivergangenheit verpflichtet, wurden sämtliche Dokumente verborgen: Man mußte sich das meist lückenhafte Material aus den Tiefen der Bibliotheken herausfischen, die Verlage breiteten einen totalen Schleier über diese Vergangenheit. Schließlich konnte ich aber trotzdem ermitteln, daß im Hintergrund meiner Verhaftung der für Ende Juni 1944 geplante Gendarmerieputsch stand. Dieser Putsch verfolgte – im wesentlichen – das Ziel, auch in Budapest mit der Deportation der jüdischen Bevölkerung nach Deutschland beginnen zu können. Denn wie wir wissen, hatte Horthy, in Voraussicht des Kriegsausgangs und angesichts jener Deklaration der Alliierten, der zufolge nach dem Krieg alle, die an der Ausrottung der europäischen Juden mitgewirkt hatten, zur Verantwortung gezogen würden, die Deportationen in Budapest, seinem engeren Wirkungskreis, verboten. Das wollte die Gendarmerie ändern. Als ersten Schritt umstellten sie eines Morgens Budapest und brachten die Verwaltungsgrenzen der Stadt unter ihre Kontrolle. Bekanntlich erstreckte sich die Zuständigkeit der Gendarmerie ja nicht auf Budapest: Sie galt nur auf dem Land, in Budapest aber war die sogenannte «blaue Polizei» die zuständige Behörde. Nun ja, und irgendwie war es der Gendarmerie gelungen, sich auch die Polizei dienstbar zu machen: An jenem Tag verhaftete die Polizei alle Menschen, die den gelben Stern trugen, sobald sie die Grenzen Budapests übertraten – egal, ob sie dazu eine Sondergenehmigung besaßen oder nicht. Auf diese Weise wurde auch ich festgenommen, zusammen mit meinen 17Kameraden – allesamt vierzehn-, fünfzehnjährige Kinder–, die mit mir in der Shell-Raffinerie von Csepel, außerhalb der Stadtgrenze arbeiteten.
Soviel ich weiß, ist dieser Gendarmerieputsch schließlich erfolglos geblieben.
Ja. Generalleutnant Gábor Faragho, dem neben «Seiner Durchlaucht, dem Herrn Reichsverweser» die Aufsicht über die Gendarmerie oblag, hatte rechtzeitig von dem geplanten Putsch erfahren und seinerseits Einheiten der Armee zusammengezogen; das überzeugte die Gendarmerie ausreichend, und sie nahm Abstand von ihren Plänen.
Aber dich hatte man bereits festgenommen… Ist das auch so passiert, wie du es im Roman beschreibst?
Genau so.
Aber dann beschreibst du ja doch die Wirklichkeit. Warum beharrst du so sehr auf dem Begriff Fiktion?
Schau, das ist eine grundsätzliche Frage. Als ich mich Jahrzehnte später entschloß, den Roman zu schreiben, mußte ich quasi für den Hausgebrauch klar definieren, was den Unterschied ausmacht zwischen dem Genre des Romans und dem der Autobiographie, also «Erinnerungen». Allein schon, um nicht noch ein weiteres Buch hinzuzufügen zu der damals, in den sechziger Jahren, schon auf Bibliotheksdimension angeschwollenen… wie soll ich sie bezeichnen…
Holocaust-Literatur. Wolltest du sie nicht so nennen?
Doch, ja, heute nennt man sie so. Damals, in den sechziger Jahren, war das Wort Holocaust noch unbekannt. Es kam erst später in Gebrauch – nebenbei bemerkt, unkorrekterweise. Ja, jetzt fällt mir wieder ein, wie man damals sagte: Lager-Literatur.
Und ist diese Definition genauer?
Das wollen wir jetzt erst gar nicht anfangen zu analysieren.
Einverstanden, vielleicht kommen wir später darauf zurück. Im Augenblick wäre ich auch sehr viel mehr am Unterschied zwischen Fiktion und Autobiographie interessiert, schließlich wird der Roman eines Schicksallosen sowohl von den Kritikern als von den Lesern allgemein als «autobiographischer Roman» bezeichnet.
Fälschlicherweise, denn eine solche Gattung gibt es gar nicht. Entweder ist es Autobiographie oder ein Roman. Geht es um Autobiographie, dann beschwörst du die Vergangenheit herauf, bemühst dich, dich so gewissenhaft wie möglich an deine Erinnerungen zu halten, und es ist von größter Bedeutung, daß du alles so beschreibst, wie es in Wirklichkeit geschehen ist, das heißt den Tatsachen nichts hinzufügst. Eine gute Autobiographie ist wie ein Dokument: ein Epochenbild, auf das man «sich stützen» kann. Im Roman dagegen sind nicht die Tatsachen das Entscheidende, sondern allein das, was man den Tatsachen hinzufügt.
Aber ich weiß doch – und du selbst hast das in deinen Äußerungen mehrfach bestätigt–, daß dein Roman in vollem Umfang authentisch ist und sich jedes Element der Geschichte auf Dokumente stützt.
Das widerspricht nicht dem Begriff Fiktion. Überhaupt nicht. In Fiasko beschreibe ich, was ich alles unternommen habe, um die Vergangenheit wieder heraufzubeschwören, die Lageratmosphäre in mir zu neuem Leben zu erwecken.
Du hast immer wieder an deinem Uhrarmband gerochen…
Ja, weil der Geruch des frisch gegerbten Leders mich irgendwie an den Geruch erinnerte, der sich zwischen den Baracken von Auschwitz ausbreitete. Solche Wirklichkeitssplitter sind natürlich auch im Fall der Fiktion außerordentlich wichtig. Der wesentliche Unterschied besteht trotzdem darin, daß die Fiktion eine Welt erschafft, während man sich in der Autobiographie an etwas, das gewesen ist, erinnert.
Ich meine, daß auch das Erinnern ein Stück Welt erschafft.
Jedoch ohne dieses Stück Welt zu überschreiten. Das aber geschieht bei der Fiktion. Die Welt der Fiktion ist eine souveräne Welt, die im Kopf des Autors geboren wird und den Gesetzen der Kunst, der Literatur gehorcht. Und das ist ein großer Unterschied, der sich in der Form, der Sprache und der Handlung des Werkes widerspiegelt. Bei der Fiktion sind alle Details vom Autor erfunden, jedes Moment…
Du willst doch nicht sagen, daß du Auschwitz erfunden hast?
Und doch ist es in einem gewissen Sinn genau so. Ich mußte im Roman Auschwitz für mich neu erfinden und zum Leben bringen. Dabei konnte ich mich nicht an den äußeren, den sogenannten historischen Tatsachen außerhalb des Romans festhalten. Alles mußte auf hermetische Weise, durch die Zauberkraft von Sprache und Komposition in Erscheinung treten. Betrachte das Buch doch einmal unter diesem Gesichtspunkt: Schon von den ersten Sätzen an kannst du spüren, daß du in eine sonderbare, souveräne Welt eintrittst, in der alles mögliche passieren kann. Und während die Geschichte fortschreitet, verstärkt sich dieses Verlorenheitsgefühl beim Leser immer mehr, spürt er mehr und mehr, wie ihm der Boden unter den Füßen wegrutscht…
Ja, György Spiró hat das in seinem bemerkenswerten Artikel «Non habent fata» hervorragend beschrieben. Es war übrigens die erste wirklich ernsthafte Analyse, die zum Roman eines Schicksallosen erschienen ist. Aber wir sind völlig vom Thema abgekommen: Wir waren bei dem besagten Kasernenhof und daß die Gendarmen…
Sie erklärten uns, gesehen zu haben, wie wir der englischen Luftflotte vom Pferdestall aus mit Kerzen Zeichen gegeben hätten…
Du scherzt…
Nein, keineswegs, das haben sie tatsächlich behauptet. Zunächst hielt auch ich es für einen Scherz. Aber dann begriff ich, daß es alles andere als das war. Sie versprachen, uns alle zusammen «niederzumetzeln», wenn in der Umgebung auch nur eine einzige Bombe fiele, und man sah ihnen an, sie konnten es kaum erwarten, daß es endlich geschähe. Sie waren in Mordlaune, die meisten von ihnen sturzbetrunken, wie Hyänen, die Blut riechen. Eigentlich eine glänzende Szene, und dennoch war sie nicht in den Roman eines Schicksallosen zu integrieren. Es hat mir fast das Herz gebrochen. Siehst du, so ist es mit der Fiktion. Ihre Gesetze sind gnadenlos. Später habe ich die Szene aber in den Fiasko-Romanhinübergerettet.
Das klingt beinahe schon… nun, beinahe ein bißchen…
Zynisch?
Ich mochte es nicht sagen …
Aber damit verletzt du mich nicht. Ich betrachte mein Leben als Rohstoff für meine Romane – so denke ich einfach, und das macht mich frei von allen Hemmungen.
Dann frage ich also, was hast du in jener Nacht empfunden, als du noch nicht über diese distanzierende – ich möchte doch lieber Ironie sagen statt Zynismus: als du also noch nicht über diese Ironie verfügt hast, denn immerhin standest du damals dem Tod Auge in Auge gegenüber? Hattest du Angst?
Wahrscheinlich auch Angst. Daran erinnere ich mich heute nicht mehr. Viel wichtiger war aber ein ganz anderes Gefühl, eine Art Erkenntnis, die zu formulieren mir erst viele, viele Jahre später, in Fiasko, gelang: «Ich hatte das einfache Geheimnis der mir zugedachten Welt begriffen: überall und jederzeit erschießbar zu sein.»
Sicher eine ziemlich niederschmetternde Erkenntnis…
Ja, und auch wiederum nicht. Weißt du, es ist nicht so einfach, einem vierzehnjährigen Kind, vor allem wenn es von Kameraden, von Kindern gleichen Alters, umgeben ist, mit denen es sein Schicksal teilen kann, die Lebenslust zu nehmen. In ihm ist eine… eine unverdorbene Naivität, die es vor dem Gefühl totaler Hoffnungslosigkeit, totalen Ausgeliefertseins schützt. Einen Erwachsenen kann man in dieser Beziehung viel rascher zerbrechen.
Gründet sich diese Beobachtung auf deine eigene Erfahrung, oder hast du das eher gehört oder gelesen?
Sowohl selbst erfahren als auch bei anderen gelesen. Schau, seien wir ehrlich: Unter den unzähligen Büchern mit gleichem Sujet finden sich doch nur ganz wenige, die wirklich imstande sind, das unvergleichliche Erlebnis der Nazi-Todeslager authentisch zu beschreiben. Aber auch unter diesen Ausnahmeautoren sagen vielleicht die Essays von Jean Améry am meisten darüber. Es gibt ein phantastisch genaues Wort, das er dabei verwendet: Weltvertrauen. Nun, er beschreibt, wie schwer es ist, ohne dieses Vertrauen zu leben. Wer es einmal verloren hat, ist zu ewiger Einsamkeit unter den Menschen verurteilt. Ein solcher Mensch kann in dem anderen nie mehr den Mitmenschen, sondern immer nur den Gegenmenschen sehen. Améry wurde dieses Vertrauen von der Gestapo ausgeprügelt, als sie ihn in Belgien in einer zum Gefängnis umfunktionierten Festung folterte. Er hat Auschwitz vergebens überlebt, Jahrzehnte später vollstreckte er das Urteil an sich selbst und beging Selbstmord.
Bezeichnend, daß diese wunderbaren – auf grauenhafte Weise wunderbaren – Essays erst vor ein, zwei Jahren auf ungarisch erschienen sind, soviel ich weiß, in einer beschränkten Auflage des kleinen Verlags «Múlt és Jövő». Und auch das war nur eine bescheidene Auswahl aus seinen Werken. Aber kommen wir auf dein Weltvertrauen zurück.
Nun, ich glaube, daß ich dieses Vertrauen selbst noch im Zustand äußersten Verfalls… vielleicht nicht gerade ausgestrahlt habe, aber daß es mir doch immerhin anzusehen war. Ich hatte einfach die Vorstellung, daß es die Pflicht der Erwachsenenwelt war, mich von dort zu retten und wohlbehalten nach Hause gelangen zu lassen. Das mag heute ein wenig lächerlich klingen, aber so habe ich es damals wirklich empfunden. Und ich bin felsenfest überzeugt, daß ich diesem kindlichen Weltvertrauen meine Rettung verdanke.
Während unzählige andere Kinder…
… umgekommen sind. Ja. Es ist nicht leicht, Ausnahme zu sein.
Ist von den 17, mit denen du aus dem Bus geholt und nach Auschwitz gebracht worden bist, außer dir noch jemand am Leben geblieben?
Nein. Alle übrigen sind umgekommen.
Hast du darüber Gewißheit?
Meine Mutter hat nach dem Krieg eine Anzeige aufgegeben, und niemand hat sich darauf gemeldet. So wie sie übrigens auch im Sommer 1944, nachdem ich verschwunden war, eine Annonce in die Zeitung gesetzt hatte, daß die Eltern der Kinder, die an der Zollgrenze von Csepel verschwunden waren, sich melden möchten.
Eine solche Anzeige konnte im von den Deutschen besetzten Ungarn erscheinen?
Anscheinend ja, denn sie ist ja erschienen. Aber meine Mutter hat noch bizarrere Dinge unternommen. Sie hat sich aufgemacht und ist ins Kriegsministerium gegangen – ich glaube, so hieß es damals–, so, wie sie war, den gelben Stern auf der Brust.
Sie muß eine sehr mutige Frau gewesen sein.
Mutig war sie auch, vor allem aber hatte sie keine Ahnung von dem, was um sie herum geschah. Ihr «Weltvertrauen» blieb bis zum Schluß unerschüttert. Meine Mutter war eine schöne, elegante Frau, für sie gab es keine Hindernisse. Wenn sie mit ihrem gelben Stern – der Vorschrift entsprechend – «den hinteren Perron der Straßenbahn» bestieg, sprangen die Männer im Wageninneren auf, um ihr einen Platz anzubieten. Es war ihr Stolz, daß sie der damals berühmten Schauspielerin Anna Tőkes ähnlich sah – es kam vor, daß man sie auf der Straße um Autogramme bat. Sie war einfach nicht bereit, sich die Tatsachen bewußtzumachen und die Gefahr abzuwägen. Wie sie in das Büro eines hochrangigen Offiziers – eines Hauptmanns oder Majors – gelangt ist, will ich gar nicht mehr wissen. Aber gnädige Frau, sagte der Major zu ihr, haben Sie doch wenigstens die Güte, den gelben Stern abzunehmen… Kurz, meine Mutter verlangte, man solle ihr ihren Sohn zurückgeben oder ihr sagen, wo er sei und was mit ihm passiere. Und der Major kam dem auf der Stelle nach. Meine Mutter bekam die Auskunft, daß ihr Sohn mit seinen Kameraden nach Siebenbürgen transportiert worden sei und dort zu «Holzfällerarbeiten» in einem Forstbetrieb herangezogen werde, und obwohl sie das auch nicht gerade beruhigte, hat meine Mutter das geglaubt, zumindest vorübergehend, weil sie es glauben wollte. Die Menschen versuchten damals verzweifelt, sich ihre Träume von einer rationalen Ordnung der Welt zu erhalten.
Erstaunlich. Aber das bringt mich auf eine Frage, auf die ich Antwort suche, seit ich deine Bücher kenne. Waren die ungarischen Juden wirklich so ahnungslos? Waren sie sich tatsächlich derartig im unklaren über das Schicksal, das sie erwartete?
Ich kann nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen, die ich im engen Budapester Familien- und Bekanntenkreis gemacht habe: Dort hat niemand irgend etwas geahnt, ich habe dort nie den Namen Auschwitz vernommen. Heimlich – solange Juden ihre Radios noch nicht «abzuliefern hatten» – hörten alle jüdischen Familien BBC, und hörten sie etwas, das ihren Optimismus störte, winkten sie ab: «Englische Propaganda.»
Was kann der Grund dafür gewesen sein?
Es gab zahllose Gründe, historische wie psychologische. Tatsache ist, daß nach der Vernichtung der Don-Armee – in deren Verlauf auch unzählige jüdische Arbeitsdienstler umkamen, sie wurden zum Minenräumen auf dem Schlachtfeld eingesetzt – der Kriegsdruck ein wenig nachließ. Die vorübergehenden Erleichterungen von 1943 blendeten die jüdischen Bürger, sie glaubten, eine Sonderstellung einzunehmen. Die Nachricht von der «Schaukelpolitik» des Ministerpräsidenten Miklós Kállay verbreitete sich, man sprach davon, daß er sich hinter dem Rücken der Deutschen «mit den Alliierten arrangieren» werde. Am 19.März 1944 besetzten die Deutschen Ungarn, und in Birkenau wurde mit dem Ausbau der Krematorien und der Verlegung eines neuen Gleises begonnen, das für die Transporte aus Ungarn vorgesehen war. In Budapest traf ein hochrangiger SS-Offizier namens Eichmann ein. Zur gleichen Zeit erhielt der Judenrat das sogenannte Vrba-Protokoll. Rudolf Vrba, ein slowakischer Häftling, war nach langer und sehr gründlicher Vorbereitung aus dem Konzentrationslager Auschwitz geflohen und hatte ein Protokoll zusammengestellt, in dem er genau beschrieb, was in dieser Todesfabrik vor sich ging. Breiten Raum hatte er auch den Vorbereitungsmaßnahmen gewidmet, die zum Empfang der ungarischen Judentransporte getroffen wurden und das verhängnisvolle Schicksal dieser Transporte schon damals, zur Zeit der Vorbereitung, vorzeichneten. Der ungarische Judenrat diskutierte dieses Protokoll und entschloß sich, die jüdische Bevölkerung, also mehrere hunderttausend Menschen, mit deren Zusammentreibung in den kurzfristig errichteten Ghettos die Gendarmerie im übrigen schon begonnen hatte, nicht mit dem Inhalt bekannt zu machen.
Und wodurch ist diese Entscheidung des Judenrates zu erklären?
Wie ich glaube, durch nichts. Ich könnte auf deine Frage die äußerst paradoxe Antwort geben: Man wollte verhindern, daß unter der jüdischen Bevölkerung womöglich noch Panik ausbräche.
Ein bitteres Paradoxon… Und das traurigste daran ist, daß es leider trifft. Also wußtest auch du nicht, worauf der Zug mit dir zusteuerte.
Niemand wußte es. Mit mir waren sechzig Menschen im Viehwaggon, und nicht einer von ihnen hatte jemals den Namen Auschwitz gehört.
Die Szene im Roman eines Schicksallosen, als Köves durch die stacheldrahtvergitterte Fensterluke eine verlassene Bahnstation erblickt und im ersten Licht des Morgengrauens den Ortsnamen Auschwitz von dem Gebäude abliest: ist das Fiktion oder Wirklichkeit?
Getreue Wirklichkeit, die sich hervorragend in die Struktur der Fiktion einfügte.
In diesem Zusammenhang kam bei dir also nicht der Verdacht des Anekdotischen auf…
Nein, denn besser hätte ich es gar nicht erfinden können. Außerdem hätte ich auch nicht gewagt, so etwas zu erfinden.
Na siehst du…
Was sehe ich?
Daß du letztlich doch an die Wirklichkeit gebunden bist, die Wirklichkeit beschreibst. Und zwar die erlebte Wirklichkeit. Da ist zum Beispiel der Fußballplatz. Im Galeerentagebuch schreibst du, daß du dich genau erinnertest an den Auschwitzer…
… den Birkenauer…
… gut, den Birkenauer Fußballplatz, aber trotzdem nicht gewagt hattest, ihn in deinen Roman einzufügen, ehe du ihn nicht auch bei Borowski erwähnt fandest.
Ja, in seiner Erzählung Bitte, die Herrschaften zum Gas!. Auch Tadeusz Borowski gehört zu jener Handvoll Autoren, die in den Todeslagern etwas substantiell Neues über die menschliche Existenz zu entdecken und darzustellen vermochten. Er schrieb fünf, sechs große Erzählungen, in einer bestechenden klassischen Form und einem kristallinen Stil, die mich fast an die Novellen Prosper Merimées erinnern. Danach beging auch er Selbstmord. – Aber nun sag mir einmal, warum du bei jeder Gelegenheit triumphierst, bei der du mich bei einem konkreten wahren Detail oder, wie du es nennst: der Wirklichkeit ertappst?
Weil du mit deiner Fiktionstheorie die Wahrheit verwischst. Du verstößt dich aus deiner eigenen Geschichte.
Davon kann keine Rede sein. Nur daß mein Platz nicht in der Geschichte, sondern am Schreibtisch ist (obwohl ich damals noch kein solches Möbelstück besaß). Gestatte, daß ich große Beispiele als Zeugen aufrufe. Wäre zum Beispiel Krieg und Frieden auch dann ein gutes Buch, wenn es Napoleon und den Rußlandfeldzug nie gegeben hätte?
Darüber müßte ich nachdenken… Ich glaube, ja.
Durch den Umstand jedoch, daß es Napoleon wirklich gab und auch der Rußlandfeldzug Wirklichkeit war, dazu alles mit minutiöser Genauigkeit beschrieben ist und uns die historischen Tatsachen vor Augen führt: durch diesen Umstand wird das Buch doch noch besser, oder?
Richtig.
Wenn Fabrizio del Dongo, Stendhals junger Held in der Kartause von Parma, unschlüssig und verständnislos durch Wiesen und Wälder irrt, ununterbrochen in Geschütze und Reitertrupps stolpert und unverständliches Geschrei und Befehle hört, ist das für sich genommen eine interessante Fiktion, oder?
Ja.
Doch wenn wir erfahren, daß er gerade das Schlachtfeld von Waterloo überquert, macht sie das noch interessanter. Nicht wahr?
So ist es.
Wiederum nötigt es, wenn es um die Schlacht von Waterloo geht, zu Genauigkeit, da die Schlacht von Waterloo eine historische Tatsache ist.
Ich verstehe, worauf du mit deiner sokratischen Frage-Methode hinauswillst. Laß mich also weiterfragen. Du erzähltest, was deine Mutter alles unternommen hat, nachdem sie erfahren hatte, daß du in Polizeigewahrsam gekommen warst – was für ein lächerlicher Ausdruck in diesem Fall! Du hast jedoch nicht erzählt, wie sie von der Geschichte erfahren hatte. Soviel ich weiß, lebtest du ja bei deiner Stiefmutter.
Meine Stiefmutter hatte meiner Mutter einen Brief geschrieben, um sie über das Geschehene zu unterrichten. Und was für einen Brief! Dieser Stil! «Liebe Aranka» – so hieß meine Mutter. «Ich muß Ihnen eine unangenehme Sache mitteilen…» – «Natürlich habe ich mich sofort erkundigt…» Das Wort «natürlich» und die Euphemismen habe ich aus der Sprache meiner Stiefmutter «geklaut» und im Roman eines Schicksallosen benutzt. Sie war eine verheerende Person.
Was verstehst du unter verheerend?
Ich weiß auch nicht… In Gombrowicz’ Roman Ferdydurke gibt es einen Satz, ich zitiere ihn möglicherweise ungenau, aber sinngemäß lautet er so: Kennst du diese Art von Menschen, in denen du dich verkleinerst? Also so ein Typ war meine Stiefmutter.
Demnach hattest du es schwer mit ihr.
Und sie, die Arme, noch viel schwerer mit mir. Ich ertrug sie… ihre… Kurz, ich konnte sie einfach nicht ertragen. Vor allem ihren Geschmack. Stell dir vor, sie hatte ein mittel- oder eher hellgraues Kostüm, dazu kaufte sie sich einen schmalkrempigen roten Hut, eine rote Lacktasche und ein Paar rote Schuhe und glaubte, nun ungeheuer elegant zu sein. So gingen wir spazieren, «ein bißchen bummeln», wie sie es nannte. Es war fürchterlich, ich glaubte, im Boden versinken zu müssen. Zu alledem wollte sie, daß ich sie «Mutti» nannte, und diese Wunschvorstellung wurde auch von meinem Vater unterstützt. Sie versuchten es immer wieder, aber es wurde nichts daraus. Das Wort ging mir einfach nicht über die Lippen.
Es scheint, daß du schon in deiner Kindheit empfindlich für Worte warst. In deinem Roman Liquidation sprichst du direkt von einer Phobie gegenüber Worten.
Ja, ich hatte eine absurde Beziehung zur Sprache, bestimmte Worte lösten eigenartige Assoziationen in mir aus, und diese Beziehung erwies sich lange als unveränderbar. Doch darum ging es hier nicht. Das graue Kostüm und der rote Hut und dazu «Mutti»: das hat in mir ein Grauen ausgelöst, für das ich erst später einen Namen fand: Es war die Apotheose der Kleinbürgerlichkeit, vor der mich heute noch ebenso schaudert. Sosehr sie sich auch bemühte, ich blieb bei «Tante Kató», denn das paßte zu ihr, obwohl sie wesentlich jünger als meine Mutter war. Doch wir sollten uns jetzt vielleicht nicht in Kindheitserinnerungen verlieren. Am Ende willst du noch Babyfotos von mir sehen.
Ganz genau, du sagst es. Aber laß uns zunächst beim Thema bleiben. Mich interessiert, wie deine Familie war, wie du deine Kindheit verbracht hast und so weiter. Von deinem Vater hast du überhaupt noch nicht gesprochen. Eine so interessante Frau wie deine Mutter hat sich sicher nicht einfach in irgendwen verliebt.
Mein Vater jedenfalls war sicher verliebt, und das äußerte sich am ehesten in seiner schrecklichen Eifersucht. Meine Mutter dagegen wollte die Enge ihrer Familie hinter sich lassen, die drei Schwestern, die Stiefmutter und den mit materiellen Sorgen kämpfenden Vater in der kleinen Wohnung in der Molnár-Straße. Damals – wir befinden uns in den zwanziger Jahren – tat sich für ein Mädchen der Weg in die Freiheit meist durch die Ehe auf. Oder aber durch die Arbeit. Meine Mutter hatte schon im Alter von 16Jahren eine Stellung in einer Firma angenommen: Privatangestellte hieß das damals.
Dann war es also keine Liebesheirat?
Schau, für ein kleines Kind ist es äußerst schwer, das Liebesleben seiner Eltern zu analysieren. Mich, als ihr Kind, hat die Beziehung der beiden auf jeden Fall ziemlich mitgenommen.
Stritten sie sich?
Nicht allzu oft, aber wenn, dann ausgiebig. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen schönen Sommervormittag. Wir wohnten in der Nähe des Stadtwäldchens, in einer geräumigen und hellen Wohnung, wahrscheinlich in der Elemér-Straße. Ich weiß nicht, ob sie heute noch so heißt. Ich mochte damals etwa drei, vier Jahre gewesen sein. Eher vier als drei, da ich mich genau daran erinnere. Und es muß ein Sonntag gewesen sein, denn beide waren zu Hause. Sie schrien sich gegenseitig an. Ich konnte deutlich hören, daß die Rede vom Schwimmbad war. Mein Vater wollte nicht, daß meine Mutter ins Schwimmbad ging. Vermutlich befürchtete er, sie könnte dort ein Stelldichein haben. Mir ist nur nicht klar, warum er sie nicht selbst dorthin begleitet hat. Wahrscheinlich «des Kindes wegen» – das war ich. Kurz und gut, mein Vater griff sich die weiße Gummibadekappe meiner Mutter und riß sie in Stücke. Woraufhin sich meine Mutter der großen Schneiderschere bemächtigte und mit zwei Schnitten die Hutkrempe meines Vaters zur Strecke brachte. Ich sehe die verdutzt herabsinkende Hutkrempe noch heute vor mir. Es war ein grüner Filzhut. Ich schrie wie am Spieß. Am Ende ging meine Mutter ins Schwimmbad, während mein Vater mich mitnahm, um einen neuen Hut zu kaufen. Es wird also doch eher ein Sonnabend gewesen sein, da die Geschäfte am Sonntag ja nicht geöffnet hatten.
Hast du viele solche Erinnerungen?
Es gibt einige.
Später aber haben sich deine Eltern getrennt.
Auch diese Suppe mußte ich dann auslöffeln. Ich wurde in ein Knabeninternat gegeben, als Interner.
Läßt sich dieses Internat in deinem Kaddisch-Romanwiedererkennen?
Mit einer gewissen Mühe durchaus.
Sprichst du nicht gern darüber?
Doch, natürlich. Man erinnert sich schließlich immer gern an seine Kindheit, egal, wie schlimm und schwer diese Zeit auch war.
Wie weit kannst du deinen Stammbaum zurückverfolgen?
Das ist eine gute Frage. Nur hat sie mich nie wirklich interessiert. Kurz gesagt, solange ich auch immer nachsinne, ich bleibe bei meinen Großeltern stecken. Soviel ich weiß, waren meine Vorfahren einfache assimilierte Bürger jüdischen Glaubens, zum Teil auch Bauern.
Bauern?
Warum überrascht dich das? Mein Großvater väterlicherseits kam als Jude aus dem Kleinbauernstand. Bis er sich eines Tages aufgemacht hat, um die Welt zu sehen. Nach der Familienlegende ist er zu Fuß – und zwar barfuß – aus Pacsa, einer Gemeinde in der Nähe von Keszthely, nach Budapest gekommen. Wir sind am Ende des 19.Jahrhunderts, in der Zeit der großen Karrieren. Mein Großvater spazierte über die Kerepesi-Straße – die heutige Rákóczi-Straße