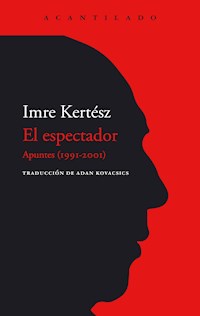7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Mit einem brüsken «Nein» antwortet B. auf die harmlose Frage eines Bekannten, ob er Kinder habe. Und so unerbittlich weigerte er sich in seiner Ehe, Kinder zu zeugen. In einem großen Monolog begründet der Erzähler seine scheinbar schockierende Absage. Eine «Todesfuge in Prosa, die in ihrer ergreifenden Schönheit noch einmal das geistige Erbe des Abendlandes aufleuchten läßt, bevor es im Grauen von Auschwitz untergeht» (Neue Zürcher Zeitung).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 179
Ähnliche
Imre Kertesz
Kaddisch für ein nicht geborenes Kind
Roman
Aus dem Ungarischen von György Buda und Kristin Schwamm
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Über Imre Kertesz
Am 9. November 1929 in Budapest geboren, wurde Imre Kertész 1944 nach Auschwitz deportiert und 1945 in Buchenwald befreit. Nach Kriegsende folgte die journalistische Tätigkeit bei der Tageszeitung «Világosság», die bald umbenannt und zum Parteiorgan der Kommunisten wurde. Nach seiner Entlassung bestritt Kertész seit 1953 seinen Lebensunterhalt als freier Schriftsteller und schrieb Musicals und Unterhaltungsstücke für das Theater. Im Jahre 2002 wurde er mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet.
Das bekannteste Werk des Autors, «Roman eines Schicksallosen», erschien auf Ungarisch 1975. Seitdem ist es in mehr als 40 Sprachen übersetzt worden. Die Verfilmung des Romans durch Lajos Koltai wurde einem internationalen Publikum im Wettbewerb der Berlinale 2005 präsentiert.
Weitere Veröffentlichungen:
Galeerentagebuch. 1993
Ich – ein anderer. 1998
Eine Gedankenlänge Stille, während das Erschießungskommando neu lädt. 1999
Fiasko. 1999
Die englische Flagge. 2002
Detektivgeschichte. 2004
Liquidation. 2005
Roman eines Schicksallosen. Das Buch zum Film. 2005
Inhaltsübersicht
«… streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng»
Paul Celan, Todesfuge
«Nein!» sagte ich augenblicklich, sofort und ohne zu zögern, gewissermaßen instinktiv, weil es inzwischen ganz natürlich ist, daß unsere Instinkte gegen unsere Instinkte arbeiten, daß quasi unsere Gegeninstinkte statt unserer Instinkte arbeiten, ja mehr noch, an ihrer Stelle – so geistreichelte ich, falls das geistreich genannt werden kann, das heißt, falls die nackte, jämmerliche Wahrheit geistreich genannt werden kann –, so erzählte ich also dem Philosophen, der mir entgegengekommen war, nachdem sowohl er als ich in dem verkümmernden und vor Krankheit, vielleicht vor Schwindsucht, fast hörbar keuchenden Buchenwald eingehalten hatten, diesem Buchenhain oder wie ich es nennen soll, ich gestehe, ich bin schwach und unwissend, was Bäume angeht, ich erkenne nur die Fichte an ihren Nadeln, und dazu die Platane, weil ich die Platane liebe, und was ich liebe, erkenne ich sogar noch heute, selbst mit meinen Gegeninstinkten erkenne ich es, wenn auch nicht mit jener würgenden, den Magen zur Faust ballenden, sprungbereiten, elektrisierenden, sozusagen erleuchteten Erkenntnis, mit der ich das erkenne, was ich hasse. Ich weiß nicht, warum bei mir immer alles und warum es mit allem anders ist, das heißt, falls ich es vielleicht doch wissen sollte, ist es einfacher, wenn ich es so weiß, daß ich es nicht weiß. Das würde mir viele Erklärungen ersparen. Doch anscheinend kann man Erklärungen nicht umgehen, stets erklären wir uns und alles, selbst das Leben, dieser unerklärbare Komplex von Phänomenen und Empfindungen, fordert uns Erklärungen ab, unsere Umgebung fordert uns Erklärungen ab, und endlich fordern wir uns selbst Erklärungen ab, bis es uns zu guter Letzt gelingt, alles um uns zu vernichten, auch uns selbst zu vernichten, uns selbst zu Tode zu erklären – so erklärte ich dem Philosophen, mit jenem Redezwang, jenem mich selbst anwidernden und doch nicht zu besiegenden Redezwang, der mich immer ergreift, wenn ich nichts zu sagen habe, und der, wie ich fürchte, derselben Wurzel entspringt wie meine Art, in Gasthäusern, in Taxis, bei der Bestechung amtlicher und halbamtlicher Personen üppige Trinkgelder zu verteilen, und wie gleicherweise meine übertriebene, bis zur Selbstaufgabe übertriebene Höflichkeit, als flehte ich ununterbrochen um meine Existenz, um diese Existenz. Oh Gott. Ich war bloß im Wald so vor mich hin gegangen – wenn auch nur in diesem kümmerlichen Eichenwald –, an der frischen Luft – wenn diese Luft auch einigermaßen verdorben ist –, um meinen Kopf ein wenig auszulüften, sagen wir das einmal so, weil es gut klingt, wenn wir nicht nach dem Sinn der Worte sehen, denn so wir nach dem Sinn sehen, haben die Worte, nicht wahr, keine Bedeutung, wie es auch mein Kopf nicht nötig hat, ausgelüftet zu werden, ich bin, im Gegenteil, außerordentlich zugempfindlich; ich verbringe – verbrachte – also meine Zeit hier, vorübergehend (und ich gehe jetzt nicht ein auf die Möglichkeiten, die dieses Wort bietet), hier, inmitten dieses ungarischen Mittelgebirges, in einem Haus, nennen wir es Erholungsheim, obwohl es auch noch als Arbeitsplatz angeht (denn ich arbeite immer, und dazu zwingt mich nicht nur das Fortkommen, würde ich nicht arbeiten, dann lebte ich, und lebte ich, nun, ich weiß nicht, wozu mich das zwänge, und es ist auch besser, das nicht zu wissen, wenngleich meine Zellen, mein Eingeweide es sicherlich ahnen, deshalb arbeite ich ja ununterbrochen: solange ich arbeite, bin ich, wenn ich nicht arbeitete, wer weiß, ob ich überhaupt wäre, also nehme ich es ernst, und ich muß es auch ernst nehmen, da es zwischen meiner Arbeit und meinem Fortbestehen die allerernstesten Zusammenhänge gibt, das ist ganz offenkundig), in einem Haus also, in dem einen Platz zugewiesen zu kriegen ich das Recht erworben habe, in der illustren Gesellschaft Intellektueller vom gleichen Schlage, denen ich ebendarum auch nicht ausweichen kann, wie still ich mich auch in mein Zimmer zurückziehen mag – ich verrate das Geheimnis meines Verstecks höchstens mit dem verhaltenen Klappern meiner Schreibmaschine –, wie leise ich auch die Gänge entlangschleiche, essen muß man aber doch, und dabei nehmen mich die Tischgenossen mit ihrer schonungslosen Anwesenheit in ihre Mitte, spazierengehen muß man doch auch, und dabei kommt mir in seiner Derbheit und so gar nicht dorthin passend, mit seiner braun und beige karierten Schirmmütze, seinem weitgeschnittenen Raglan, mit seinen schmalen, blaßgrünen Augen und dem großen, weichen, einem durchgekneteten und bereits aufgehenden Hefeteig ähnlichen Gesicht, mitten im Wald Doktor Oblath, der Philosoph, entgegen. Das ist sein ordentlicher bürgerlicher Beruf, übrigens auch durch die entsprechende Rubrik seines Personalausweises nachweisbar: Doktor Oblath ist ein Philosoph, wie Immanuel Kant, so wie Baruch Spinoza oder wie Heraklit von Ephesos Philosophen waren, so wie ja auch ich ein Schriftsteller und literarischer Übersetzer bin, ich mache mich selbst nur nicht noch lächerlicher durch die Größen, die ich hinter diesem Titel in Reih und Glied aufstellen könnte und die noch echte Schriftsteller und – manchmal – auch echte Übersetzer waren, weil ich auch ohnedies lächerlich genug bin mit meinem Beruf und weil die Tätigkeit als Übersetzer meinem Herumhantieren in den Augen mancher – vornehmlich der Behörden – einen Anschein der Objektivität und, aus anderem Grunde zwar, aber auch in meinen eigenen Augen, vielleicht einen gewissen Anschein eines nachweislichen Berufes verleiht.
«Nein!» tobte, heulte etwas in mir, augenblicklich und sofort, als meine Frau (ansonsten schon lange nicht mehr meine Frau) zum erstenmal darauf – auf dich – zu sprechen kam, und mein Gewinsel verstarb nur langsam, eigentlich wohl erst nach langen, langen Jahren zu einem melancholischen Weltschmerz, wie Wotans tobende Wut anläßlich des bekannten Abschiedes, bis gleichsam aus den Nebelgebilden der verwehenden Bläserstimmen, langsam und bösartig wie eine schleichende Krankheit, eine Frage in mir immer festere Umrisse annahm, und diese Frage bist du, genauer: diese Frage bin ich, jedoch durch dich fraglich gemacht, noch genauer (und dem stimmte auch Doktor Oblath zu): mein Dasein als Möglichkeit deiner Seins betrachtet, das heißt ich als Mörder, wenn die Genauigkeit ins Unendliche, ins Unmögliche gesteigert werden soll, und dies ist mit etwas Selbstpeinigung auch zu gestatten, denn es ist Gott sei Dank zu spät, es wird immer bereits zu spät sein, du existierst nicht, und ich kann volle Gewißheit darüber haben, daß ich in Sicherheit bin, nachdem ich mit diesem «Nein» alles zertrümmerte, alles zusammenstürzen und zu Staub werden ließ, vor allem meine mißlungene, kurzlebige Ehe, erzähle – erzählte – ich Doktor Oblath, dem Doktor der Philosophie, mit der Gelassenheit, die mich das Leben zwar nie lehren konnte, die ich aber jetzt schon so ziemlich geübt ausübe, wenn es unbedingt notwendig ist. Und diesmal war es notwendig, denn der Philosoph war in versonnener Stimmung genaht, das sah ich sofort an seinem leicht seitlich geneigten Kopf, auf dem seltsam platt die kecke Schirmmütze saß, so als habe sich mir ein spaßhafter Wegelagerer genaht, der schon einige Gläschen geleert hat und nun darüber nachsinnt, ob er mich niederschlagen oder sich mit etwas Lösegeld begnügen soll, aber Oblath sann, und fast hätte ich gesagt: leider, ganz und gar nicht über diese Frage nach, ein Philosoph pflegt nicht über Wegelagerei nachzudenken, und tut er es doch, so erscheint sie als gewichtige philosophische Fragestellung vor ihm, die Schmutzarbeit aber verrichten die Fachleute, nun, so etwas haben wir schon gesehen, obwohl es schiere Willkür und fast schon eine Verdächtigung ist, daß mir dies gerade im Zusammenhang mit Doktor Oblath einfällt, denn ich kenne seine Vergangenheit nicht, und er wird sie mir hoffentlich auch nicht erzählen. Nein, das nicht, er überraschte mich aber mit einer nicht weniger indiskreten Frage, als erkundige sich jener Wegelagerer, wieviel Geld ich in meiner Tasche habe, er begann, meine familiären Umstände zu erkunden, zwar indem er mich eingangs über seine eigenen Umstände unterrichtete, gleichsam als Vorschuß, gleichsam postulierend, daß, wenn ich alles über ihn erfahren könne, obwohl ich daran überhaupt nicht interessiert war, er damit ein Anrecht ableiten könne, meine … aber ich halte mit dieser Erörterung inne, weil ich spüre, daß mich die Buchstaben, die Worte mitreißen, ich drifte in eine falsche Richtung, in Richtung moralisierender Paranoia, bei der ich mich heutzutage leider öfter ertappe und deren Gründe mir allzu offenkundig sind (Einsamkeit, Isolation, freiwillige Verbannung), als daß sie mir Sorge bereiten könnten, habe ich sie doch selbst hergestellt, gleichsam als einige anfängliche Spatenstiche zu einer viel viel tieferen Grube, die ich noch, Erdklumpen für Erdklumpen, ausheben muß, damit es etwas gebe, das mich dereinst aufnimmt (obwohl es möglich ist, daß ich nicht in die Erde, sondern in die Luft grabe, denn da liegt man nicht eng), Doktor Oblath hatte mir ja, alles in allem, nur die unverfängliche Frage gestellt, ob ich Kinder habe; allerdings mit der für den Philosophen charakteristischen groben Offenheit, das heißt ohne Feingefühl und auf jeden Fall im ungeeignetsten Augenblick; woher hätte er aber auch wissen können, daß seine Frage mich, nicht zu leugnen, einigermaßen aufwühlt. Daß ich dann auf diese Frage mit meinem aus übertriebener, bis zur Selbstaufgabe übertriebener Höflichkeit stammenden Redezwang antwortete, der mich, während ich sprach, so sehr anwiderte, dennoch aber dies erzählte, dieses
«Nein!» sagte ich augenblicklich, sofort und ohne zu zögern, gewissermaßen instinktiv, weil es inzwischen ganz natürlich ist, daß unsere Instinkte gegen unsere Instinkte arbeiten, daß sozusagen unsere Gegeninstinkte statt unserer Instinkte arbeiten, ja mehr noch, an ihrer Stelle: ja, wegen dieses ganzen törichten Geredes, wegen meiner eigenen, freiwilligen und durch nichts zu begründenden (auch wenn ich eine Unmenge von Gründen habe, die ich zum Teil oben bereits aufgezählt habe, wenn ich mich richtig erinnere) Erniedrigung wollte ich es Doktor Oblath, dem Philosophen, heimzahlen, als ich ihn so beschrieb, wie ich ihn beschrieb, inmitten des verkümmernden Buchenwaldes (oder sei es Lindenhains), obgleich die flache Schirmmütze, der weitgeschnittene Raglan wie auch die schmalen, blaßgrünen Augen und das große, weiche, einem durchgekneteten und schon aufgehenden Hefeteig ähnliche Gesicht – das halte ich weiterhin aufrecht –, jawohl, ganz der Wirklichkeit entsprechen. Es geht bloß darum, daß all dies auch irgendwie anders hätte niedergeschrieben werden können, ausgeglichener, schonender und, ich sage jetzt etwas: vielleicht liebevoller, es ist aber zu fürchten, daß ich alles nur mehr so beschreiben kann, mit einer in Sarkasmus getauchten Feder, einer spöttischen, vielleicht auch ein wenig amüsanten (es obliegt mir nicht, dies zu beurteilen), aber in gewisser Hinsicht lahmen Feder, als stieße sie jemand immer zurück, wenn sie sich anschickt, gewisse Worte niederzuschreiben, so daß meine Hand letztlich andere Worte an ihrer Statt schreibt, Worte, aus denen sich einfach nie eine abgerundete, liebevolle Darstellung ergibt, vielleicht einfach deswegen, weil es zu fürchten ist, daß auch in mir keine Liebe ist, aber – oh Gott! – wen könnte ich wohl lieben und weshalb denn. Obwohl Doktor Oblath liebenswürdig sprach, derart liebenswürdig, daß sich mir einige seiner markanteren Bemerkungen unauslöschlich (ich hätte fast gesagt: verhängnisvoll) einprägten. Daß er kinderlos sei, sagte er, daß er niemanden habe außer einer alternden und sich mit den Sorgen des Alterns plagenden Gattin, wenn ich ihn richtig verstanden habe, denn der Philosoph drückte sich vager, ich könnte auch sagen: diskreter aus, indem er es mir überließ, zu verstehen, was ich verstehen will, und obwohl ich nicht verstehen wollte, verstand ich doch trotzdem. Da diese Sache mit seiner Kinderlosigkeit, setzte Doktor Oblath fort, ihm eigentlich erst in der letzten Zeit einfalle, jetzt aber dafür öfter, so habe er hier, auf diesem Waldpfad, eben jetzt gerade darüber nachgedacht, und siehe da, er könne nicht umhin, darüber zu sprechen, vermutlich, weil er auch älter werde und infolgedessen gewisse Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Möglichkeit, noch Kinder zu haben, für ihn schon langsam keine Möglichkeiten mehr seien, mehr noch, daß es unmöglich sei und daß er daran erst in diesen Tagen öfter denke, und zwar so, sagte er, «wie an ein Versäumnis». Hier blieb Doktor Oblath auf dem Waldpfad stehen, wir sind mittlerweile nämlich weitergegangen, zwei soziale Wesen, zwei Männer im Herbstlaub, ins Gespräch vertieft, zwei traurige Tupfen auf der Leinwand eines Landschaftsmalers, zwei die wahrscheinlich niemals existente Harmonie der Natur in ihren Grundfesten erschütternde Tupfen, bloß daran erinnere ich mich nicht mehr, ob ich mich Oblath oder ob er sich mir als Begleiter anschließt, daraus werden wir aber doch keine Frage der Eitelkeit machen, ja, natürlich schließe ich mich Doktor Oblath an, wahrscheinlich, um von ihm loszukommen, denn so kann ich, wann es mir gefällt, umkehren; da also blieb Doktor Oblath auf dem Waldpfad stehen, er brachte mit einer einzigen schwermütigen Bewegung Spannung in sein aufgehendes, stellenweise sogar schon üppig überquellendes Gesicht, er warf nämlich den Kopf mitsamt der kecken, spitzbübischen Mütze in den Nacken und warf seinen Blick, als wäre er ein jämmerliches, zerschlissenes, doch noch in seiner Verlassenheit dienstbereites Kleidungsstück, auf den Ast uns gegenüber. Und indem wir so standen, stumm, ich in der Resultante der Anziehungskraft Oblaths und Oblath in der des Baumes, regte sich ein Gefühl in mir, das mir sagte, daß ich bald Zeuge einer vermutlich vertraulichen Äußerung des Philosophen werden würde; und so kam es auch, als Doktor Oblath endlich sprach und sagte, daß er, wenn er sage, er empfinde das, was geschehen sei, oder eher was nicht geschehen sei, als Versäumnis, so habe er dabei nicht den Gedanken an eine Fortsetzung im Kopf, an diese gewissermaßen abstrakte und, es sei eingestanden, im Grunde doch befriedigende Beruhigung, daß man seine persönlichen und überpersönlichen Angelegenheiten auf Erden erledigt – vielmehr, und das sei es gerade, nicht erledigt – hat, das heißt über die Selbsterhaltung hinaus das Weiterleben, das Überleben dieses seines Daseins, also seines Selbst, verlängert und vervielfältigt in den Nachkommen, das (über die Selbsterhaltung hinaus) als eine, man könne sagen transzendentale, aber doch recht anschauliche Pflicht des Menschen dem Leben gegenüber gilt, damit er sich nicht als verstümmelt, überflüssig und letzten Endes impotent vorkomme; und auch nicht den Gedanken an die bedrohlichen Aussichten eines Alters ohne Stützen, nein, er fürchte sich in Wirklichkeit vor etwas anderem: «vor der Gefühlsverkalkung», so sagte es Doktor Oblath, mit denselben Worten, als er auf dem Waldpfad wieder weiterging, anscheinend unserem Stützpunkt, dem Erholungsheim, entgegen, in Wirklichkeit aber, jetzt wußte ich es bereits, der Gefühlsverkalkung. Und auf diesem seinem Weg wurde ich zu seinem getreuen Begleiter, von seinen erschütternden Worten gebührlich erschüttert, doch an seiner Angst schon weniger Anteil nehmend, an der Angst, die, wie ich fürchte (genauer, worauf ich vertraue, mehr noch: wie ich mit Sicherheit weiß), nur eine augenblickliche und somit auf jeden Fall heilige und gewissermaßen in die Ewigkeit wie in ein Weihwasserbecken einzutauchende Angst ist, denn wir werden uns, wenn sie herantritt, nicht mehr vor ihr fürchten, wir werden uns nicht einmal daran erinnern, daß sie uns einst fürchten machte, denn dann hat sie uns ja bereits überwunden, wir sitzen bis zum Hals in ihr, sie gehört uns und wir gehören ihr. Denn auch das ist nur ein Spatenstich an der Grube, an der Grabesgrube, die ich in die Luft grabe (denn dort liegt man nicht eng), und daher, sage ich, ich spreche aber nicht zum Philosophen, nur zu mir selber, vor der Gefühlsverkalkung muß man sich nicht fürchten, sondern sie annehmen, wenn nicht nachgerade begrüßen, wie eine uns entgegengestreckte helfende Hand, die uns zwar zweifellos näher zur Grube hilft, aber sie hilft: denn, Herr Kappus, die Welt ist nicht gegen uns, sind Gefahren da, so müssen wir versuchen, sie zu lieben; obwohl, werfe ich ein, ich spreche aber nicht zum Philosophen und auch nicht zu Herrn Kappus, diesem Glückspilz, der so viele Briefe von Rainer Maria Rilke bekommen konnte, ich spreche nur zu mir selber: ich bin bereits soweit, nur noch diese Gefahren zu lieben, und ich glaube, auch das ist nicht so ganz in Ordnung, auch darin ist etwas Falsches, das ich fortwährend höre, wie es auch manche Dirigenten sofort aus dem Tutti heraushören, wenn, nehmen wir an, das Englischhorn wegen eines, nehmen wir an, Druckfehlers in den Noten um einen halben Ton höher ertönt. Diesen falschen Ton höre ich nicht nur in mir, sondern auch um mich herum, ich höre ihn in meiner näheren und weiteren, in meiner sozusagen kosmischen Umgebung höre ich ihn fortwährend, wie auch hier, inmitten der widernatürlichen Natur, umgeben von kranken Eichen (oder Buchen), bei dem übelriechenden Rinnsal und unter dem schmutzfarbenen Himmel, der durch das schwindsüchtige Laub schimmert, wo ich, lieber Herr Kappus, in keiner Weise die Eingebung der Idee, Schöpfer zu sein, zu beugen, zu bilden, fühle, der Idee, die, nicht wahr, nichts wäre ohne ihre fortwährende große Bestätigung und Verwirklichung in der Welt, nichts ohne die tausendfältige Zustimmung, die Tieren und Dingen … Ja, sie haben uns die Freude vergeblich verdorben (um darüber nur soviel zu sagen), insgeheim, wenn wir stumm und intensiv auf unseren Blutkreislauf und auf unsere schrecklichen Träume achten, insgeheim wollen wir eigentlich – und ich verspüre die allem und allen entströmende tausendstimmige Harmonie nur hierin –, wollen wir noch immer und unerschütterlich leben, auch so schlaff, so freudlos, so krank, ja selbst so und auch dann, wenn wir noch so unfähig sind und wenn es noch so unmöglich ist, zu leben … Ebendarum, aber auch um nicht irgendwie in dieser gefühligen Stimmung steckenzubleiben, in der ich, wie übrigens fast in allem, oder zumindest fast in allem, an dem auch ich teilnehme, wieder einmal den falschen Ton des Englischhorns hörte, stellte ich ihm die wahrlich einschlägig philosophische, wenn auch nicht gerade kluge Frage: Warum das so sei? Diese ganze Gebrechlichkeit? Und wo und wann wir unsere Rechte endgültig «verschissen» hätten? Warum wir derart unerbittlich und endgültig nicht mehr nicht wissen könnten, was wir wissen? Und so weiter, als wüßte ich nicht, was ich weiß, und all dies von meinem nicht zu besiegenden Redezwang, als sei er ein Horror vacui, getrieben: Und jetzt nahm Doktor Oblaths Gesicht den Ausdruck des in Ungarn lebenden mittleren Intellektuellen mittlerer Größe und mittleren Alters mit mittlerem Einkommen, mittleren Ansichten und mittleren Aussichten ein, und seine Augen verschwanden vollkommen in den Falten seines zynisch-glücklichen Lächelns. In seine geölte, an Umschweife gewohnte und eigentlich selbstgewisse Stimme, die ihm zuvor nur wegen der drohenden Nähe lebensvoller Dinge kurz versagt hatte, kehrte auch fast augenblicklich Objektivität zurück, sogar Nüchternheit; und so zogen wir nach Hause, zwei eigentlich gut gekleidete, gut ernährte und recht stattliche mittlere Berufsintellektuelle mittleren Alters und mittlerer Ansichten, zwei Überlebende (jeder von uns auf seine Art), zwei noch immer Lebende, zwei Halbtote, und wir erörterten, was zwischen zwei Intellektuellen noch, ganz überflüssig, erörtert werden kann. Wir erörterten, friedlich und gelangweilt, warum man nicht sein kann; daß die bloße Existenz des Lebens eigentlich eine Unkultiviertheit sei, denn in einem höheren Sinne und aus einem höheren Blickwinkel betrachtet, dürfte das Sein gar nicht sein, allein schon um dessentwegen nicht, was geschehen ist und was, finden wir uns damit ab, immer neu geschieht, das ist ein durchaus ausreichender Grund, abgesehen davon, daß die kultivierteren Köpfe dem Sein das Sein schon längst verboten haben. Außerdem kam noch zur Sprache – und an alles kann ich mich natürlich nicht erinnern, denn in diesem aus purer Verlegenheit und Zufall zustande gekommenen Gespräch tönten, besser: tönten hohl, Hunderte ähnlicher Gespräche nach, wie auch in einem Schöpfergedanken tausend vergessene Liebesnächte aufleben und ihn mit Hoheit und Höhe erfüllen – an alles kann ich mich wirklich nicht erinnern, ich glaube aber, wir sprachen noch über folgendes: Ob es denn nicht möglich sei, daß die gesamte, auf das Leben abzielende und sich unwissend gebende Anstrengung des Seins keineswegs das Zeichen irgendeiner unbefangenen Naivität sei, dies sei nun auch als Übertreibung wirklich unmöglich – im Gegenteil, es sei ein Symptom dafür, daß das Sein sich nur so, unwissend, fortsetzen könne, wenn es sich schon um jeden Preis fortsetzen müsse. Und, gesetzt den Fall, es gelänge nun nicht, zu überleben, was natürlich nur auf einer höheren Ebene (so Doktor Oblath) gelingen könne, dafür aber gebe es nur (Duett:) nicht nur keinen Schimmer eines Anzeichens, viel eher zeige sich das Gegenteil, nämlich das Versinken in Unwissenheit … Des weiteren, daß die wissend eingegangene Unwissenheit lediglich die Syndrome der Schizophrenie … Und noch weiter, daß demzufolge zum Erleben des Weltgeistes (ich) und für seine Realisation (Doktor Oblath), auf die übrigens jeglicher Weltgeist zu jeglicher Zeit ziele, heute mangels Glaubens, Kultur und sonstiger feierlicher Mittel einzig und allein die Katastrophe