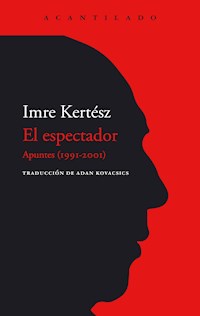6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Nach dem Sturz einer obskuren Diktatur werden die Schergen vor Gericht gestellt. Einer von ihnen, Antonio Martens, legt sich selbst Rechenschaft ab und vertraut das Manuskript seinem Pflichtverteidiger an: Es geht um die Akte Salinas, um den tragischen Fall eines Vaters und eines Sohnes, die vom Apparat zermalmt wurden. «Imre Kertész erzählt atemberaubend von einem Alptraum.» (Der Spiegel) «Eine höchst artistische Parabel über den Polizeistaat, geschrieben schon 1976. Wir lernen: Unschuld ist in der Diktatur nicht vorgesehen, und: Schuld lässt sich jederzeit herstellen.» (Frankfurter Rundschau) «So universal ist seine Literatur, so undogmatisch und unaufgeregt, dass sie die Würde des Nobelpreises mittlerweile weit übersteigt.» (Neue Züricher Zeitung) «Ein konzentriertes Lehrstück über die Selbstverständlichkeit und Alltäglichkeit des Amoralismus.» (Die Zeit)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 117
Ähnliche
Imre Kertész
Detektivgeschichte
Über dieses Buch
Nach dem Sturz einer obskuren Diktatur werden die Schergen vor Gericht gestellt. Einer von ihnen, Antonio Martens, legt sich selbst Rechenschaft ab und vertraut das Manuskript seinem Pflichtverteidiger an: Es geht um die Akte Salinas, um den tragischen Fall eines Vaters und eines Sohnes, die vom Apparat zermalmt wurden.
«Imre Kertész erzählt atemberaubend von einem Alptraum.» (Der Spiegel)
«Eine höchst artistische Parabel über den Polizeistaat, geschrieben schon 1976. Wir lernen: Unschuld ist in der Diktatur nicht vorgesehen, und: Schuld lässt sich jederzeit herstellen.» (Frankfurter Rundschau)
«So universal ist seine Literatur, so undogmatisch und unaufgeregt, dass sie die Würde des Nobelpreises mittlerweile weit übersteigt.» (Neue Züricher Zeitung)
«Ein konzentriertes Lehrstück über die Selbstverständlichkeit und Alltäglichkeit des Amoralismus.» (Die Zeit)
Vita
Imre Kertész, 1929 in Budapest geboren, wurde 1944 als 14-Jähriger nach Auschwitz und Buchenwald deportiert. In seinem «Roman eines Schicksallosen» hat er diese Erfahrung auf außergewöhnliche Weise verarbeitet. Das Buch erschien zuerst 1975 in Ungarn, wo er während der sozialistischen Ära jedoch Außenseiter blieb und vor allem von Übersetzungen lebte (u.a. Nietzsche, Hofmannsthal, Schnitzler, Freud, Joseph Roth, Wittgenstein, Canetti). Erst nach der europäischen Wende gelangte er zu weltweitem Ruhm, 2002 erhielt er den Literaturnobelpreis. Seitdem lebte Imre Kertész überwiegend in Berlin und kehrte erst 2012, schwer erkrankt, nach Budapest zurück. Er starb am 31. März 2016.
Weitere Veröffentlichungen:
Kaddisch für ein nicht geborenes Kind. 1992
Galeerentagebuch. 1993
Ich – ein anderer. 1998
Eine Gedankenlänge Stille, während das Erschießungskommando neu lädt. 1999
Fiasko. 1999
Die englische Flagge. 2002
Liquidation. 2005
Roman eines Schicksallosen. Das Buch zum Film. 2005
Dossier K. 2006
Briefe an Eva Haldimann. 2009
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel «Detektívtörténet» bei Magvető, Budapest.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2011
Copyright © 2004 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © 1977, 2001 by Imre Kertész
Lektorat Ingrid Krüger
Covergestaltung any.way, Cathrin Günther
Coverabbildung © bpk / Ministère de la Culture, France – Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN / André Kertész
ISBN 978-3-644-01331-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Im Frühjahr 1976 beendete ich meinen Roman Der Spurensucher und reichte ihn, wie es sich gehörte, bei einem staatlichen Buchverlag ein. Etwas anderes konnte ich wohl auch kaum tun, denn in Ungarn gab es damals ausschließlich staatliche Buchverlage. Die beiden Verlage, die sich auf die sogenannte «ungarische Gegenwartsprosa» spezialisiert hatten, unterschieden sich in meinen Augen insofern voneinander, als mein Roman eines Schicksallosen von dem einen abgelehnt, von dem anderen aber verlegt worden war. Ich brauche wohl nicht zu sagen, daß ich mich an den letzteren wandte, und das Manuskript gelangte schließlich, von entsprechenden Lektoratsgutachten begleitet, zum Verlagsdirektor, einem gutgekleideten, silberhaarigen, äußerst verschlagenen und vorsichtigen Herrn, den die Bitternis vieler Kompromisse und der leichte Hauch französischen Cognacs umgab. Er habe den Spurensucher gelesen, erklärte er, und würde ihn auch gern herausgeben, wenn er ein wenig umfangreicher wäre. Zumindest zehn Druckbogen seien nötig, damit ein Buch einen «Korpus» habe, mein Manuskript jedoch ergebe nicht mehr als sechs Druckbogen, wenn überhaupt. Ich solle doch noch irgend etwas dazuschreiben, schlug er vor.
Da fiel mir die Detektivgeschichte wieder ein. Es war eine uralte, flüchtige Idee von mir, mit der ich eine Zeitlang herumgespielt und die ich dann, während ich den Roman eines Schicksallosen schrieb, vergessen hatte. Auf den ersten Blick schien der Stoff auch nicht gerade ein verlegerischer Leckerbissen zu sein. Wie konnte man in einer auf illegalem Wege an die Macht gelangten Diktatur, vor der Nase beflissener Zensoren, eine Geschichte veröffentlichen, in der es um die Technik einer auf illegalem Weg hochgekommenen Macht geht? Wenn ich mir einen geschickten Vorwand suchte, hätte ich die Wirksamkeit, den Radikalismus der Geschichte gefährdet. Schließlich entschloß ich mich, nichts von der Ungeheuerlichkeit der Handlung zurückzunehmen, den Ort der Geschichte aber in ein imaginäres südamerikanisches Land zu verlegen.
Diese Arbeit bedeutete für mich eine ungewöhnliche Herausforderung. Einerseits hatte ich noch nie ein Stück Prosa geschrieben, das nicht aus unmittelbarer und drängender existentieller Not hervorgegangen war. Eine Geschichte aus dem Ärmel zu schütteln: das ist nicht gerade meine Gattung. Mein schriftstellerischer Organismus – wenn ich so sagen darf – war sozusagen auf lange Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauernde, problematische Arbeiten trainiert; die Detektivgeschichte aber mußte ich innerhalb von zwei Wochen niederschreiben, damit mein Buch die immer eng bemessene «Durchlaufzeit» der staatlichen Buchfabriken schaffen und noch im folgenden Jahr, 1977, erscheinen konnte.
Jetzt, 27 Jahre später, hält der Leser die erste fremdsprachige Ausgabe der Detektivgeschichte in der Hand. Ich hoffe, sie hat bis heute etwas von der frischen Inspiration ihrer Entstehung bewahrt.
September 2004
I.K.
1
Das Manuskript, das ich im folgenden veröffentliche, hat mir mein Mandant Antonio R. Martens anvertraut. Wer er ist, werden Sie von ihm selbst erfahren. Vorwegnehmend sei nur gesagt, daß er ein für sein intellektuelles Niveau überraschendes Schreibvermögen bewies, wie nach meinen Erfahrungen übrigens jeder, der sich einmal im Leben entschließt, seinem Schicksal ins Auge zu blicken.
Ich war sein von Amts wegen bestellter Verteidiger. Martens hat die ihm von der Anklage zur Last gelegte Mitschuld an mehrfachem Mord im Verlauf des Strafverfahrens weder zu leugnen noch zu beschönigen versucht. Er verkörperte keine der beiden Verhaltensarten, die ich aus meinen bisherigen Erfahrungen mit solchen Fällen kenne: hartnäckiges Leugnen, sowohl hinsichtlich der Sachbeweise wie der persönlichen Verantwortung, oder jene Art wehleidiger Reue, deren eigentliches Motiv brutale Mitleidlosigkeit und Selbstmitleid sind. Martens gab seine Schuld hemmungslos, aus freien Stücken und bereitwillig zu Protokoll, mit einem so gefühllosen Gleichmut, als spräche er nicht von seinen eigenen, sondern den Taten eines anderen. Von denen eines anderen Martens, mit dem er nicht mehr identisch, für dessen Handlungen er aber die Konsequenzen auf sich zu nehmen ohne weiteres bereit war. Ich hielt ihn für einen durch und durch zynischen Menschen.
Eines Tages wandte er sich mit einem überraschenden Wunsch an mich: Ich solle für ihn erwirken, daß man ihn in seiner Zelle schreiben ließ.
«Worüber wollen Sie schreiben?» fragte ich ihn.
«Darüber, daß ich die Logik verstanden habe», erwiderte er.
«Jetzt?» fragte ich überrascht. «Und während Ihrer Taten etwa nicht?»
«Nein», entgegnete er. «Währenddessen nicht. Davor hatte ich sie einmal verstanden. Und nun habe ich sie von neuem verstanden. Währenddessen aber vergißt man sie. Doch was soll’s», winkte er ab, «das können Leute wie Sie ohnehin nicht verstehen.»
Ich verstand es besser, als er dachte. Nur wunderte ich mich: Ich hatte nicht damit gerechnet, daß sich in Martens – nachdem er als unwichtiges Schräubchen einer Maschinerie jede Fähigkeit einer souveränen menschlichen Persönlichkeit zu Urteil und Durchblick aufgegeben hatte – diese Persönlichkeit noch einmal melden und ihre Rechte fordern würde. Daß er also zu sprechen und sein Schicksal zu erklären wünschte. Nach meinen Erfahrungen kommt das äußerst selten vor. Und nach meinem Dafürhalten hat ein jeder das Recht, das zu tun und es auf seine eigene Art zu tun. Selbst Martens. Ich erwirkte also für ihn, was er sich gewünscht hatte.
Wundern Sie sich nicht über seine Ausdrucksweise. In Martens’ Augen mußte die Welt wie ein Wirklichkeit gewordener Groschenroman erscheinen, wo alles mit der erschreckenden Gewißheit und nach den zweifelhaften Gesetzmäßigkeiten der Dramaturgie oder – wenn es besser gefällt: Choreographie von Schauergeschichten ablief. Und erlauben Sie mir – diesmal nicht zu seiner Verteidigung, sondern allein der Wahrheit zuliebe – hinzuzufügen: Diese Schauergeschichte wurde nicht von Martens allein, sondern von der Wirklichkeit geschrieben.
Das Manuskript hat Martens am Ende mir übergeben. Der hier folgende Text ist authentisch. Ich habe nirgends eingegriffen, von solchen Korrekturen abgesehen, die wegen stilistischer Unzulänglichkeit unerläßlich waren. Die Aussage aber blieb in allen Fällen unangetastet.
2
Ich will eine Geschichte erzählen. Eine einfache Geschichte. Sie können sie auch ungeheuerlich nennen. Doch das ändert nichts an ihrer Einfachheit. Ich möchte also eine einfache und ungeheuerliche Geschichte erzählen.
Ich bin Martens. Ja, ebender Antonio Rojaz Martens, der gegenwärtig vor den Richtern des neuen Systems steht: vor den Volksrichtern – wie sie sich gern nennen. Sie können zur Zeit mehr als genug über mich lesen: Die reißerischen Boulevardblätter sorgen dafür, daß mein Name in ganz Lateinamerika bekannt wird, ja vielleicht sogar drüben, im weit entfernten Europa.
Ich muß mich beeilen, wahrscheinlich ist meine Zeit knapp. Es geht um die Salinas-Akte: um Federigo und Enrique Salinas, Vater und Sohn, Eigentümer der im ganzen Land bekannten Kaufhauskette, deren Tod die Leute damals so überraschte. Dabei war man damals nicht mehr so leicht zu überraschen. Doch kein Mensch hätte Salinas für einen Verräter gehalten, der seinen Namen für den Widerstand hergibt. Der Oberst hat dann später auch bereut, ein Kommuniqué über die Hinrichtung herausgegeben zu haben: Es hat ohne Zweifel eine starke moralische Wirkung hervorgerufen, eine viel zu starke und völlig überflüssige. Doch wenn wir kein Kommuniqué herausgegeben hätten, hätte man uns Vernebelung und Gesetzesbruch vorgeworfen. So oder so, in dieser Sache konnte man nur falsch handeln. Der Oberst hatte das übrigens bereits vorausgesehen. Ehrlich gesagt, ich auch. Aber welchen Einfluß hätte schon die Überzeugung eines Ermittlungsbeamten auf den Lauf der Dinge haben können?
Damals war ich noch neu beim Corps. Ich war von der Polizei herübergekommen. Nicht von der Politischen – die war schon längst dort –, sondern von der Kripo. «Du, Martens», sagt eines Tages mein Chef zu mir, «hast du nicht Lust, hinüberzugehen?» Ich frage: «Wohin?», denn ich bin ja schließlich Polizist und kein Gedankenleser. Er deutet mit dem Kopf zur Seite. «Hinüber», sagt er, «zum Corps.» Ich sagte weder ja noch nein. Man war bei der Kripo gut dran. Allerdings hatte ich die Nase schon ein bißchen voll von Mördern, Einbrechern und ihren Nutten. Damals wehte ein neuer Wind. Ich hörte von manchem Aufstieg. Es hieß, wer sich bemüht, habe Zukunft. «Das Corps fordert Leute an», fuhr mein Chef fort. «Ich habe nachgedacht, wen ich empfehlen könnte. Du, Martens, bist ein fähiger Mann. Und dort kannst du dich rascher profilieren», fügte er hinzu.
Tja, so ungefähr hatte ich mir die Sache auch vorgestellt.
Ich absolvierte den Lehrgang, und man wusch mir das Gehirn. Aber nicht genug, bei weitem nicht genug. Es blieb noch eine Menge drin, viel mehr, als ich gebrauchen konnte – doch sie hatten es eben verdammt eilig. Damals war alles eilig. Es hieß, Ordnung zu schaffen, die Konsolidierung voranzubringen, das Vaterland zu retten, den Widerstand zu liquidieren – und es sah aus, als läge das alles auf unseren Schultern. «Das kommt alles mit der Praxis», wurde immer wieder gesagt, wenn einem etwas Kopfschmerzen machte. Hol mich der Teufel, wenn ich da auch nur irgend etwas gelernt habe. Doch der Job interessierte mich. Und noch mehr die Bezahlung.
Ich kam in die Gruppe von Diaz (dem Diaz, nach dem jetzt vergeblich gefahndet wird). Wir waren zu dritt: Diaz, der Chef (ich kann jedem versichern, daß man ihn niemals finden wird), Rodriguez (der bereits zum Tode verurteilt worden ist: nur zu einem einzigen, dabei hätte der Lump hundert Tode verdient) und ich, der Neue. Und natürlich Hilfspersonal, Geld, weitreichende Befugnisse und eine unbegrenzte Technik, über die ein einfacher Bulle nicht einmal etwas zu lesen gewagt hätte, um sich nicht zu weit in sie einzuleben.
Und dann ging bald der Fall Salinas los. Allzufrüh, verdammt früh. Gerade zu der Zeit meiner stärksten Kopfschmerzen. Doch er ging nun mal los, und es war nichts zu machen: Ich werde mich nie wieder von ihm befreien können. Ich muß ihn also erzählen, um ein Zeugnis zu hinterlassen, bevor ich abtrete … bevor man mich hinüberschickt. Doch lassen wir das: das beschäftigt mich jetzt am allerwenigsten. Ich war immer darauf gefaßt. Unser Beruf ist riskant, wenn du einmal damit angefangen hast, bleibt nur noch die Flucht nach vorn – wie Diaz sich auszudrücken pflegte (Sie wissen ja: der, nach dem vergeblich gefahndet wird).
Wie hat es eigentlich angefangen? Und wann? Erst jetzt, da ich meine Erinnerungen ordne, merke ich, wie schwer es für mich ist, die ersten Monate des Sieges heraufzubeschwören: und nicht nur wegen der Salinas. Nun ja, den Tag des Triumphs hatten wir auf jeden Fall schon lange hinter uns, soviel steht fest – o ja, schon ziemlich lange. Die Straßentransparente hingen bereits langsam durch und verschlissen, die Triumphlosungen waren verwaschen, die Fahnen erschlafft, die Lautsprecher auf den Straßen röchelten die Märsche nur noch heiser.
Ja, so sah ich es am Morgen, jedesmal, wenn ich die Stadt durchquerte, von zu Hause bis zu dem uns allen wohlbekannten klassischen Palais, in dem das Corps sich etabliert hatte. Am Abend nahm ich davon überhaupt nichts wahr. Nein, abends spürte ich nur noch die Kopfschmerzen, die ich von alldem hatte.
Zu dieser Zeit kamen viele unangenehme Dinge auf uns zu. Der Honigmond war vorbei: Die Bevölkerung war gereizt. Auch der Oberst. Und zu allem Überfluß bekamen wir Wind von dem geplanten Attentat. Wir mußten es verhindern – oder hätten es zumindest verhindern müssen, mit allen Mitteln: das verlangten der Oberst und das Vaterland von uns.