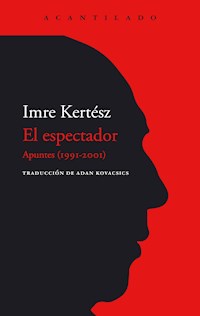19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Dreißigjährig, nach Jahren erfolgloser Arbeit an seinem ersten Romanprojekt «Ich, der Henker», den Bekenntnissen eines Naziverbrechers, entschließt Imre Kertész sich zu einer «nüchternen Selbstprüfung». Daraus erwächst zwischen 1958 und 1962 sein erstes Tagebuch – 44 eng beschriebene Blätter. Und während er noch mit Musik-Komödien für die Budapester Bühnen seinen Lebensunterhalt verdient, hält er hier minutiös sein Denken, Lesen und Schreiben fest: vom Entschluss, statt der Henker-Bekenntnisse nun die Geschichte seiner Deportation zu schreiben – also «meine eigene Mythologie» –, bis hin zur Fertigstellung der ersten Kapitel. Dazu die unablässige Auseinandersetzung mit Dostojewski, Thomas Mann und Camus, mit deren Hilfe er die für diesen beispiellosen Entwicklungsroman benötigte Technik findet. «Der Muselmann», so sollte der «Roman eines Schicksallosen» ursprünglich heißen. Zehn weitere Jahre würde Kertész noch zu seiner Vollendung brauchen, um anschließend zu erleben, wie das Buch, das dreißig Jahre später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden würde, im sozialistischen Ungarn zunächst abgelehnt wurde. Vom Zustand des «Muselmanns», jener «zerstörend süßen Selbstaufgabe», die Imre Kertész in Buchenwald kurz vor der Befreiung selbst kennengelernt hatte, erzählen die eindrücklichsten Seiten dieses Arbeitstagebuchs: «Der Mensch kann nie so nahe bei sich selbst und bei Gott sein wie der Muselmann unmittelbar vor dem Tod.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Ähnliche
Imre Kertész
Heimweh nach dem Tod
Arbeitstagebuch zur Entstehung des «Romans eines Schicksallosen»
Herausgegeben und ins Deutsche übertragen von Ingrid Krüger und Pál Kelemen
Mit einem Nachwort von Lothar Müller
Über dieses Buch
Dreißigjährig, nach Jahren erfolgloser Arbeit an seinem ersten Romanprojekt «Ich, der Henker», den Bekenntnissen eines Naziverbrechers, entschließt Imre Kertész sich zu einer «nüchternen Selbstprüfung». Daraus erwächst zwischen 1958 und 1962 sein erstes Tagebuch – 44 eng beschriebene Blätter. Und während er noch mit Musik-Komödien für die Budapester Bühnen seinen Lebensunterhalt verdient, hält er hier minutiös sein Denken, Lesen und Schreiben fest: vom Entschluss, statt der Henker-Bekenntnisse nun die Geschichte seiner Deportation zu schreiben – also «meine eigene Mythologie» – , bis hin zur Fertigstellung der ersten Kapitel. Dazu die unablässige Auseinandersetzung mit Dostojewski, Thomas Mann und Camus, mit deren Hilfe er die für diesen beispiellosen Entwicklungsroman benötigte Technik findet.
«Der Muselmann», so sollte der «Roman eines Schicksallosen» ursprünglich heißen. Zehn weitere Jahre würde Kertész noch zu seiner Vollendung brauchen, um anschließend zu erleben, wie das Buch, das 30 Jahre später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden würde, im sozialistischen Ungarn zunächst wegen seiner ungewöhnlichen Sicht des Holocaust abgelehnt wurde.
Vom Zustand des «Muselmanns», jener «zerstörend süßen Selbstaufgabe», die Imre Kertész in Buchenwald kurz vor der Befreiung noch selbst erfahren hat, erzählen die eindrücklichsten Seiten dieses Arbeitstagebuchs: «Der Mensch kann nie so nahe bei sich selbst und bei Gott sein wie der Muselmann unmittelbar vor dem Tod.»
Vita
Imre Kertész, 1929 in Budapest geboren, wurde 1944 als 14-Jähriger nach Auschwitz und Buchenwald deportiert. In seinem «Roman eines Schicksallosen» hat er diese Erfahrung auf außergewöhnliche Weise verarbeitet. Das Buch erschien zuerst 1975 in Ungarn, wo er während der sozialistischen Ära jedoch Außenseiter blieb und vor allem von Übersetzungen lebte (u. a. Nietzsche, Hofmannsthal, Schnitzler, Freud, Joseph Roth, Wittgenstein, Canetti). Erst nach der europäischen Wende gelangte er zu weltweitem Ruhm, 2002 erhielt er den Literaturnobelpreis. Seitdem lebte Imre Kertész überwiegend in Berlin und kehrte erst 2012, schwer erkrankt, nach Budapest zurück, wo er 2016 starb.
Die Herausgeber und Übersetzer:
Ingrid Krüger, nach Studium der Germanistik Journalistin, dann Lektorin, Schwerpunkt DDR- und russische Literatur. Nach der europäischen Wende gewann sie den bis dahin im Westen unbekannten Imre Kertész für den Rowohlt Verlag und betreut seither die deutschen Ausgaben seiner Werke.
Pál Kelemen, 1977 geboren, Dozent am Institut für Literatur- und Kulturwissenschaft an der Eötvös Loránd Universität Budapest. Veröffentlichte u.a. die Monografie «Kertész und die Seinigen» (zus. mit Miklos Györffy, 2009) sowie eine Auswahl von Texten Miklós Mészölys in der deutschen Übersetzung von Wilhelm Droste, «Spurensicherung» (2021).
Arbeitstagebuch 1958–1962
29.11.1958 Wie ich hörte, gibt sich T.K.,[1] dieser freundliche Dummkopf, keineswegs zufrieden mit den Aktivitäten, die er in der Werbung und im sonstigen Literaturbusiness entfaltet. Er will etwas Bleibendes schaffen, den Abdruck seines Geistes in der Nachwelt hinterlassen, Kunst will der Unglückliche machen und breitet zu diesem Zweck weiße Blätter vor sich aus, die es ihm jedoch nicht zu beschreiben gelingt. Auf der Suche nach Themen und Erlebnissen legt er jetzt leichtsinnig Pausen im Literaturgeschäft ein, frequentiert prominente Ferienorte und sucht die Bekanntschaft von Ausländern, um Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln. Er merkt nicht, dass er in der ständigen Erwartung, ihm oder um ihn herum möge endlich etwas passieren, Gegenstand und Opfer einer stillen und gnadenlosen Ironie wird, die er unbedacht herausfordert und auf sein Haupt zieht.
Was weiß ein Outsider vom «dichterischen Erlebnis»? Da ist ein fatales Missverständnis am Werk, das einerseits von jenen Schreihälsen geschürt wird, denen Extremismus wichtiger ist als Würde, andererseits von jenen Frommen, die in ihrer begeisterten Sanftmut nichts von der rauen Unbestechlichkeit des Berufs wissen. Ein «dichterisches Erlebnis» zu suchen, ist jedenfalls naiv, wenn auch vielleicht ein vergnüglicher und auch nicht uneffektiver Zeitvertreib. Besonders, wenn man sich dabei die Distinguiertheit des Gentlemans bewahren kann und nicht vergisst, sich die Hände öfter mit alkoholischem Wasser zu waschen. Aber was für ein Schriftsteller kann aus einem Gentleman werden?
Oder ist T.K. vielleicht gewillt, sich unwiderruflich und verhängnisvoll in etwas hineinzubegeben? Nun, in dem Fall könnte er, falls er auf dem Tiefpunkt immer noch Trost in der Vorstellung findet, hoffen, dass das Scheitern und das erfahrene Elend ihn schließlich doch zum Schriftsteller abhärten. Dann wird er darauf kommen, dass sich zum dichterischen Erlebnis niemals das erhöht, dem wir nachrennen und das uns gefällt, sondern nur das, was wir gezwungen sind zu erleben, unser Schicksal an sich. Und dass wir uns zum Erleben nicht nach draußen, in die Welt begeben müssen, sondern eher nach innen, in uns selbst. Diese Expedition wird sicher weniger vergnüglich werden, doch am Ende landet vielleicht etwas auf dem weißen Papier, und das war doch das Ziel, oder nicht?
27.12.1958 Könnte ich beten, wie es zur Weihnachtszeit üblich ist, klagte ich sicher so:
Mein Leben ist voll Elend. Mein Leben ist ein grauer Psalm des Elends. Mein Leben ist das Elend allen Elends. Ich gehe von Anfang an auf dem weiten, öden Feld des Elends. Ich kenne alle bitteren Schattierungen des Elends. Denn ich wurde von Kindheit an in Elend unterrichtet. Denn ich wurde schon von schändlichem leiblichem Elend gequält. Denn der Hunger hat mich schon bis ins Mark getroffen, genauso wie das schwarze Elend der Seele. Mein Leben ist ein grauer Psalm des Elends. Gib, Herr, oh gib, dass ich am Ende nicht elendiglich bin!
Heute Nacht habe ich nicht geschlafen. Heute Nacht hatte ich das Gefühl, dass es von dem Punkt, den ich jetzt erreicht habe, kein Hochkommen mehr gibt, nur Niedergang. Heute Nacht hatte ich das Gefühl, dass beides quasi ein und dasselbe ist. Heute Nacht hatte ich das Gefühl, mich nicht mehr rühren zu dürfen. Heute Nacht hatte ich das Gefühl, sterben zu müssen.
Und auch heute Morgen spürte ich, dass ich nur noch nach meinem Tod leben kann.
31.12.1958 Die Krux jedes Künstlers, für die er schmerzlich-schöne Worte sucht, hat nur einen Namen: Langsamkeit.
01.01.1959 Ein glückliches neues Jahr für uns beide![2]
02.01.1959 Was war also die Lektion aus der großen Tirade von M.H.[3]? Kleine Geister werden durch große Bildung verwirrt.
17.01.1959 Es ist immer weniger, was den Menschen an seine Menschlichkeit erinnert. Und das Schlimmste ist, wir beginnen nicht den Tieren zu gleichen, sondern unseren unvollkommen konstruierten, zu Exzess und Fernsteuerung neigenden Automaten.
18.01.1959 «Ich, der Henker»[4] ist in erster Linie und vor allem Selbstironie. Vielleicht wird das nie jemand herausfinden.
05.03.1959 An diesem Punkt meines Lebens wird eine nüchterne Selbstprüfung für diese Aufzeichnungen unumgänglich. Ich habe das Gefühl, mich auf das kurioseste und inkonsequenteste Abenteuer meines Lebens eingelassen zu haben, als ich im letzten Monat, nach der kompromisslosen Beharrlichkeit von mehr als drei Jahren, schnell und geschäftsmäßig ein Theaterstück[5] schrieb, eines dieser fabrikartigen Werke, die heutzutage dazu dienen, ein dahergelaufenes Publikum zu vergnügen. Im Übrigen möchte ich gleich bemerken, dass mir diese Arbeit – für die ich mich schon unfähig hielt – gar nicht schwerfiel und den Anforderungen vollauf angemessen war. Ja, beim Schreiben hatte sie sogar einen gewissen Reiz für mich, besonders der zweite Akt, der meine Phantasie geradezu fesselte. Als ich endlich fertig war, überkam mich mit Macht die unvermeidliche Reaktion der Enttäuschung, und in dem zweitägigen qualvollen Zustand seelischer Verstörung und Verfremdung fragte ich mich fast schon, ob die drei Jahre und die ganze Energie, die ich an «Ich, der Henker» verschwendet habe, nicht ein Irrtum gewesen sind. Über diese Bedenken bin ich inzwischen glücklich hinweg und entschlossen, diese Komödie – über den möglichen finanziellen Gewinn hinaus – voll zu meinem Vorteil zu nutzen.
Jedenfalls war es eine sensationelle Überraschung für mich, dass ich fähig bin, zügig zu arbeiten. Den zweiten Akt habe ich in vier, den dritten in drei – nicht ganz drei – Tagen fertig gemacht, den ersten hatte ich zum größten Teil von einer früheren Arbeit. Ich schrieb sorglos, mit der Freiheit der Willkürlichkeit, ohne große Kontrolle, ohne achtzugeben – und das war zu meiner großen Überraschung ungemein wohltuend. Unwillkürlich ergibt sich daraus der Schluss, dass ich mich in den letzten drei Jahren zu sehr in meinen Roman vergraben habe, dessen Fruchtlosigkeit mich viel stärker bedrückte, als ich dachte. Von dieser drückenden Last, der unglücklichen Konstellation der Unproduktivität, hat mich diese alberne und unschuldige – und harmlose – Arbeit fast schlagartig befreit, die, wie niederschmetternd es sonst auch sein mag, über meine ganze bisherige Arbeit triumphiert, indem sie fertig geworden ist.
Sie hat mich von der unglücklichen Konstellation der Unproduktivität befreit, sagte ich, aber das können natürlich erst die kommenden Monate erweisen. Trotzdem schieße ich mir dieses Glück vor, denn ich spüre, dass ich einen großen Schritt näher an eine Methode herangekommen bin, mit der ich viel mehr aus mir herausholen kann als bisher. Entweder lag das Problem am Roman oder an meiner Arbeitsmethode – das werde ich in den nächsten Tagen herausfinden. Auf jeden Fall gab es schon mit dem Roman selbst genügend Probleme, ehe aus «Der Einsame von Sodom»[6] «Ich, der Henker» geworden ist – das ist ein eigenes Thema, ein eigenes kleines Buch, das ich sicher einmal schreiben werde. Jedenfalls ist es eine Tatsache, dass ich von diesem Roman nach drei Jahren ständiger Arbeit nur ein einziges fertiges Kapitel vorweisen kann, und mit dem bin noch nicht einmal zufrieden – eine erschreckende Bilanz. Und dazwischen gar nichts, wenn ich die Novelle «Bohnensuppe»[7] nicht zähle, an die ich ein halbes Jahr vergeudet habe und die nichts als die Fehlgeburt eines guten Themas ist. Kein Wunder also, dass ich zuletzt erschrak und sehr misstrauisch mir gegenüber geworden bin – nein, kein Wunder, ein Wunder ist nur, dass ich auch in diesem Zustand die Arbeit forciert habe. Aber was sollte ich tun, wenn ich doch so viel vom Erscheinen dieses Romans abhängig gemacht habe? Von der entscheidendsten und scheußlichsten Abhängigkeit aber: der finanziellen, wird mich dieses Theaterstück vielleicht für eine Weile befreien, und an die damit gewonnene Freiheit knüpfe ich all meine weiteren Erwartungen. In diesem Jahr muss sich alles entscheiden.
Ehe ich mich wieder dem Roman zuwende, habe ich mir zur Vorbereitung und Erholung zwei Dinge vorgenommen: Zuerst lese ich «Schuld und Sühne», das mich schon lange reizt und seit Monaten unangerührt daliegt, ich könnte keine geeignetere Zeit für die Lektüre finden. Wenn ich das Buch gelesen habe, werde ich eine Novelle schreiben und erst dann zu «Ich, der Henker» zurückkehren.
Den ersten Teil von «Schuld und Sühne» habe ich schon gelesen und stehe völlig unter dem Eindruck der Dimension und großen, abenteuerlichen Kühnheit dieses Unterfangens. Ich bin jetzt überzeugt, dass dieses Buch mehr als jedes andere nicht nur die Problematik, sondern auch den Stil und den ganzen Geist der «modernen» Literatur beeinflusst hat. Die Exposition des Romans fasziniert durch die unvergleichliche Kühnheit, die Ungerührtheit und unbestechliche Strenge, mit der die Geschichte bis zu dem belauschten Gespräch zwischen Lisaweta und der Frau des Händlers auf dem Heumarkt entfaltet wird. Der erste Besuch bei der Alten, der Brief der Mutter, den sich der Autor nicht scheut, in aller Länge vor dem Leser auszubreiten, Raskolnikows schrecklicher Traum – alles ist vollkommen und überwältigend vielseitig. Die Vorstellung Marmeladows geschieht an der einzig möglichen Stelle, der Autor nimmt im Interesse der Sache sogar den Anschein von Verworrenheit und Langeweile auf sich, und wie trefflich ist Marmeladows Monolog, wiederum die einzig mögliche Charakterisierung dieser Figur! Dennoch wird man gewisse Zweifel nicht los: Marmeladows Wohnung, die Szene bei der Bank mit dem heruntergekommenen jungen Mädchen, dann später die Frau, die gerade im richtigen Augenblick vor Raskolnikow ins Wasser springt – vielfach auch das Milieu: der Gestank, der Dreck, die schwankenden Betrunkenen – all das fast märchenhafte Elend, das nicht immer den Stempel der Realität trägt, reizt einen mitunter zu missmutigem Widerspruch; vielleicht fehlt hier eine gewisse Plastizität, um uns von der Realität des dargestellten Lebens zu überzeugen, vielleicht eine kühlere und genauere Betrachtung, mehr französische Formarroganz und Darstellungsroutine. Wir befinden uns in einer phantastischen und extremen Welt, ungewisse Farben – grüne Gesichter, algenfarbene Haare, gelbliche Augen –, gleichsam auf dem Grund des Meeres, wo selbst die einfache Koralle wie ein Ungeheuer wirkt und wo das Licht in der irrlichternden Bewegung der Wassermassen verblasst, wo uns seltsame Geräusche erschrecken, groteskes Grinsen, krankhafte Lust und Trugbilder.
Umso plastischer und entsetzlicher in ihrem Realismus ist die Beschreibung des Mordes. Da mordet der Leser zusammen mit Raskolnikow und durchlebt mit ihm die ungeheure Erregtheit des Wartens hinter der Tür, während die unerwünschten Besucher an der Türklinke rütteln und der Haken in der Öse hüpft – schauerlich! Überhaupt, die Veranschaulichung, wie der geheime, verborgene Wille unwiderstehlich, langsam und unerbittlich wie das Schicksal selbst von dem Jungen Besitz ergreift, ihn überwältigt und sich zu eigen macht – etwas Vergleichbares habe ich noch nirgends und von niemand gelesen. Man spürt den Atem des Unausweichlichen, des Fatums, wie bei den Urmythen. Und dieses Erlebnis verdirbt selbst das Gespräch nicht, das Raskolnikow – wiederum ganz zufällig – an einem Nachbartisch belauscht, wo gerade ein Student ausgerechnet die Lebensumstände der Alten schildert und – zufällig – die Gedanken Raskolnikows ausspricht. Da erkennt man wieder die Mischung aus unheimlicher Seelenkenntnis und leicht naiver Romantisierung. Dieser naive Zug Dostojewskis tritt im Übrigen auch sonst zutage, so – um anderes beiseitezulassen – im Charakter Rasumichins, der höchst merkwürdig in seine Umgebung passt. Aber auch in Luschin, diesem pedantischen, ehrgeizigen und wohltätigen Selfmademan, diesem Liebhaber neuer Ideen, dessen Charakterisierung – zumindest im ersten Teil – enttäuschend einfältig ist und der eher zu irgendeiner Komödie, sagen wir zum «Revisor» oder zu einer humoristischen Tschechow-Novelle, passen würde als zu den Figuren von «Schuld und Sühne». «Selbst die Krümmung seines Rückens drückte noch aus, mit welcher furchtbaren Kränkung er davonging» – in einer Komödie geht eine komische Nebenfigur so ab.
Überhaupt spüre ich die Bühnentauglichkeit bei jedem Dostojewski-Werk, das hängt eng mit der Herangehensweise des Autors zusammen – ich weiß nicht, ob das noch jemandem aufgefallen ist. Das zerstört die Wirkung seiner Romanszenen manchmal, steigert sie aber auch manchmal zu unglaublicher Größe. Wie bestürzend großartig ist zum Beispiel die Szene, in der Rasumichin und Sossimow am Bett Raskolnikows die Chancen für eine Aufdeckung des Mordes erwägen. Die ganze Zeit sprechen Rasumichin und Sossimow, Raskolnikow schweigt und wirft nur ab und zu eine vor Schreck verwirrte Frage ein. Und dabei charakterisiert der Autor den Gemütszustand Raskolnikows auch nicht mit einem Wort, verlässt sich vollkommen darauf, dass der Zuschauer – unwillkürlich habe ich Zuschauer statt Leser geschrieben – sich vorstellt und errät, wie peinigend dieses Gespräch für Raskolnikow ist.
Übrigens hätte ich eben, als es um das Überhandnehmen des Mordgedankens in dem Jungen ging, noch notieren sollen, für wie genial ich es halte, dass der Autor es nicht versäumt, darauf hinzuweisen, dass Raskolnikows Tat im Dienst eines völlig zum Selbstzweck gewordenen Willens stand. Es gibt bei Raskolnikow einen Moment, wo er sich dessen selbst bewusst wird, und zwar als er grade im Begriff ist, seine ganze Beute ins Wasser zu werfen. Gewiss, ganz gewiss hat Raskolnikow nicht gemordet, um seine bedrückenden materiellen Probleme zu lösen. Aber warum dann? Die Antwort versteckt sich dort, wo sich, zuerst unmerklich, leise, dann immer unwiderstehlicher, Raskolnikow zu seiner Realisierung zwingend, der Wille selbst herausformt, blutig, furchterregend und großartig. Ich bin gespannt darauf, im Laufe der nächsten Teile Einblick in dieses dumpfe, dunkle und heftig zum Licht drängende Versteck zu erhalten.
07.03.1959 Es wäre natürlich schlau, meine Karriere als Komödienschreiber voll auszukosten. In dieser Sache steckt so viel Ironie, dass sie für das Schmachvolle daran trösten kann – falls mir dieser Sinn nicht mit der Zeit verloren geht und der Zwang zur Anpassung mich noch dazu bringt, stolz auf das zu sein, was ich gemacht habe. Es beginnt nämlich zu meiner Überzeugung zu werden, dass dieses Stück mir Namen und Ehre machen wird, eher als alles andere, was ich unter großen Mühen und Bedenken plane. Wie auch immer: Ich fange an, an das Schlechte zu glauben. Solide Sachen und Qualität sind heutzutage nicht gefragt. Den Preis dafür, die Tränen der Selbsterkenntnis, wollen und können die Leute nicht bezahlen. Sie wollen lieber lachen. Sie wollen Spaß haben, vergessen, verlangen neue Zirkusattraktionen. Wenn sie das alles noch offen sagen würden! Aber nein, die grotesken Reste guter Erziehung, eine Art oberlehrerhafte Überheblichkeit lassen sie glauben, sie seien Literaturliebhaber, und die fabelhafte, nie dagewesene Möglichkeit, dass sie mitreden, den Geschmack diktieren, einen neuen Gott erschaffen können: den Erfolg – all das liefert ihnen die Kunst vollkommen aus und gibt die, die sie pflegen, in ihre Hände. Weil sie glauben möchten, das Geistige zu fördern, lassen sie weder in der Operette noch im Kolportageroman von der Literatur ab. Sie entdecken den literarischen Geist überall, wo er nicht vorhanden ist, nur um sich selbst zu schmeicheln und Halbbegabte zu Göttern zu erheben, indes das wahre Talent hoffnungslos verloren geht.
Aber man sollte die Ärmsten auch verstehen. In den letzten Jahrzehnten haben ihnen Kunst und Geisteswissenschaften so viel Ungeheuerliches unter die Nase gerieben, sie so sehr ihres Selbstwertgefühls und ihrer Selbstachtung beraubt, dass sie sich nun in plattem Optimismus und seichter Stammtischweisheit suhlen wollen. Über uns nur Gutes oder nichts, schreien sie, wir hassen diejenigen, die uns kennen und ungebeten die Wahrheit vor uns ausbreiten. Wir wollen Literatur, ja, aber ermutigende Literatur, möglichst mit Musik – und kein Stirnrunzeln, keine Verdrossenheit, kein strenges Spielverderben. Ich spüre, dass da unweigerlich eine Ära zu Ende gegangen und in Chaos versunken ist: die Harmonie zwischen der Kunst und dem Menschlichen. Beide gehen immer starrsinniger ihren eignen Weg, die Wege scheiden sich immer mehr, und die Begegnung ist fast hoffnungslos. Die Poesie ist bereits tot. Die Literatur versucht es immer noch. Verzweifelte Prosaisten bemühen sich, mit raffinierten Jongliertricks die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu lenken, und schmuggeln beherzte Gesten des Gewissens in ihre schwindelerregenden Taschenspielereien. Hier und da wird ihnen noch mit Schaudern applaudiert. Langsam aber wendet man sich von diesen unheimlichen Artefakten ab und einem anderen Kampfplatz der Manege zu, wo die Vorführung nicht so haarsträubend ist, sondern garantiert gelingt und nachsichtsvoll ist und dem Zuschauer regenbogenfarbener Flitter statt Blut gezeigt wird.
Ich glaube nämlich, dass die Kunst zutiefst menschlich ist. Ich glaube, dass der Mensch seit Anbeginn ein tränenreiches Mitgefühl für die Gestaltung des Menschlichen hat. Aber der Mensch entfremdet sich dem Menschlichen zunehmend. Ich habe es schon einmal irgendwo auf diesen Seiten geschrieben[8], aber ich muss es noch einmal sagen: Wir beginnen, unsere menschlichen Züge zu verlieren. Und das Schlimmste ist, wir fangen nicht mal an, den Tieren zu gleichen, sondern unseren unvollkommen konstruierten Automaten, die zu Exzessen und Fernsteuerung tendieren. Ich erwarte nichts Gutes. Etwas Schreckliches muss da zugegen sein, wo der Mensch sich nicht durch Kunst läutern kann und will, sondern seine Tränen mit störrischer Schroffheit erstickt und Grauen um sich verbreitet. Da liegt ein verhängnisvolles Missverständnis vor, dessen Schutzengel Dummheit und Gewalt sind. Solange dieses Missverständnis nicht aufgeklärt ist, werden wir alle im dunklen Schatten der Katastrophe leben.
Um zu «Schuld und Sühne» zurückzukehren, ich bin bei der Lektüre des zweiten Teils, und das gespaltene Gefühl, von dem ich schon vorgestern schrieb, verstärkt sich bei mir. Ich stehe verständnislos vor der Weitschweifigkeit und Langeweile des Anfangs und kann mir nicht erklären, wozu die langen Gespräche zwischen Awdotja Romanowna und Pulcheria Alexandrowna da sind, die an die besten Seiten von Onkel Moritz Jókai[9] erinnern: Ihnen entströmt nichts als massive Langeweile. Als wären diese beiden Frauenfiguren, zumal die Mutter, nicht von dem gleichen Dichter gestaltet, der Raskolnikow, Sossimow, Lisaweta, die alte Wucherin und Marmeladow erschuf. Ich gestehe, ich finde die ganze Situation, Rasumichins Hin und Her zwischen Raskolnikow und den Damen, banal, müde und gezwungen. Zudem durchzieht das Ganze eine geschmacklose Komik, ein aus der Burleske bekannter Geist des Missverständnisses, wenn die unschuldigen Damen Raskolnikow gegenüberstehen und den lieben Jungen mit ihrer zähen Besorgnis verhätscheln, der ganz nebenbei ein Raubmörder ist. Raskolnikow müsste in dieser Situation leiden, doch er fühlt sich einfach nur gequält, und so geht es auch dem Leser, der sich verlegen am Kopf kratzt und ungeduldig darauf wartet, dass die schwatzhafte Mama und das stolze Schwesterchen ihn endlich mit Raskolnikow allein lassen, um seinen einsamen und düsteren Weg weiter begleiten zu können. Rasumichins Liebesaufwallung und teddybärhaftes Geschwätz – nun, das passte wiederum besser zu einem auf naiv ernsthafte Weise romantischen Schriftsteller als zu einem, der einen Mord vom Entschluss bis zur Ausführung mit einer so wollüstig langsamen, grauenvoll unerbittlichen Linienführung vorantreibt und der in der Beschreibung der auf den Mord folgenden Nacht eine so enervierende Seelenkenntnis bezeugt, wenn der überreizte Raskolnikow in einen ohnmächtigen Schlaf versinkt, anstatt die Indizien rasch verschwinden zu lassen.
Natürlich verstehen wir, worum es geht. Der Autor möchte den Kontrast unterstreichen zwischen dem alten, normalen Leben Raskolnikows und dem Leben, in das er durch seine Tat schlittert. Raskolnikow entfremdet sich den Menschen, auch seinen Lieben – obwohl in Klammern anzumerken ist: Er hätte nicht morden müssen, es hätte genügt, sich ein wenig darauf zu besinnen, dass er für die einfältige Mama und das arme Schwesterchen keine anderen Gefühle zu hegen braucht als wohlwollende Freundlichkeit. Jedenfalls wird er die Lösung für sein Leben nicht bei seiner Familie finden – aber um das herauszubekommen, ist es vielleicht nicht nötig, die Langeweile derart zu überziehen und dem Leser so lange die Gesellschaft gewöhnlicher, nichtssagender Menschen aufzuzwingen. Den Dialogen fehlt alles Faktische, jede höhere, weiter reichende Bedeutung, mit Ausnahme einer Bemerkung Sossimows über Geisteskrankheit, von der er sagt: «Die Ausführung ist manchmal meisterhaft, sogar raffiniert, aber die Steuerung und der Beweggrund sind verschwommen und das Resultat von allerlei krankhaften Empfindungen. Ähnlich wie in unseren Träumen.» – Ja, das war wieder Dostojewski, aber dann verstummt er wieder für lange Zeit, ja, bedient sich sogar solcher unzulässigen Kunstgriffe wie den Ausbruch von Dunja, bei dem sie erklärt: «Ich habe noch niemand umgebracht.» Natürlich rutscht ihr das ganz zufällig heraus, aber da sie in Gesellschaft eines Mörders ist, hat die Bemerkung eine Pointe. Situationstragik, wenn es diesen Ausdruck gäbe. Stattdessen gibt es nur Situationskomik – so geht das Ganze also schal aus, zumal der Autor Raskolnikow eilends erblassen und zurückweichen lässt.