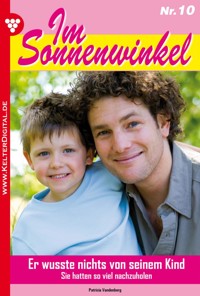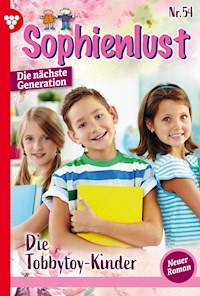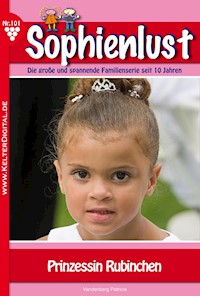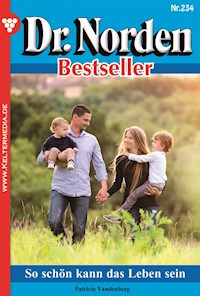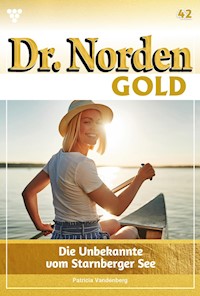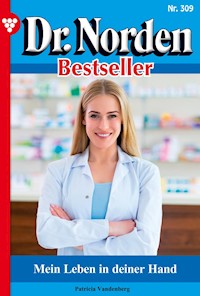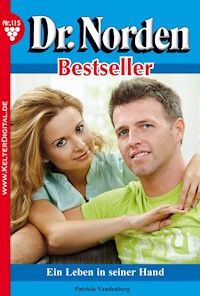
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Dr. Norden Bestseller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Dr. Norden ist die erfolgreichste Arztromanserie Deutschlands, und das schon seit Jahrzehnten. Mehr als 1.000 Romane wurden bereits geschrieben. Deutlich über 200 Millionen Exemplare verkauft! Die Serie von Patricia Vandenberg befindet sich inzwischen in der zweiten Autoren- und auch Arztgeneration. Patricia Vandenberg ist die Begründerin von "Dr. Norden", der erfolgreichsten Arztromanserie deutscher Sprache, von "Dr. Laurin", "Sophienlust" und "Im Sonnenwinkel". Sie hat allein im Martin Kelter Verlag fast 1.300 Romane veröffentlicht, Hunderte Millionen Exemplare wurden bereits verkauft. In allen Romangenres ist sie zu Hause, ob es um Arzt, Adel, Familie oder auch Romantic Thriller geht. Ihre breitgefächerten, virtuosen Einfälle begeistern ihre Leser. Geniales Einfühlungsvermögen, der Blick in die Herzen der Menschen zeichnet Patricia Vandenberg aus. Sie kennt die Sorgen und Sehnsüchte ihrer Leser und beeindruckt immer wieder mit ihrer unnachahmlichen Erzählweise. Ohne ihre Pionierarbeit wäre der Roman nicht das geworden, was er heute ist. Auf schnellstem Wege fuhr Dr. Daniel Norden zu Frank Michel, dessen junge Frau aufgeregt in der Praxis angerufen hatte. Da er Reni Michel kannte, war der Arzt überzeugt, dass es sich tatsächlich um einen Notfall handelte, denn das junge Ehepaar war keinesfalls zimperlich oder wehleidig. »Er kann nicht mehr sprechen«, sagte Reni Michel bebend, als sie Dr. Norden die Tür öffnete. »Mein Gott, er erstickt.« Dr. Norden konnte sich gleich überzeugen, dass der junge Mann tatsächlich nahe am Ersticken war. Und ihm kam ein entsetzlicher Gedanke, als Reni hastig sagte, dass es gestern mit leichtem Fieber angefangen hätte, nicht schlimm genug, dass man ihn rufen wollte. Aber nun glühte Frank Michel und war nicht mehr ansprechbar. Dr. Norden überlegte nicht lange, er redete auch nicht, er bestellte den Notarztwagen. »Ihr Mann muss auf schnellstem Wege in eine Spezialbehandlung, Frau Michel«, sagte er überstürzt. »Ich kann hier momentan gar nichts machen.« Sechs Minuten später schon wurde der Kranke mit Blaulicht und Martinshorn in die Klinik gefahren. Er kam sofort auf die Intensivstation und wurde völlig isoliert. Dr. Norden hatte dem Chefarzt Dr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Norden Bestseller – 115 –
Ein Leben in seiner Hand
Patricia Vandenberg
Auf schnellstem Wege fuhr Dr. Daniel Norden zu Frank Michel, dessen junge Frau aufgeregt in der Praxis angerufen hatte. Da er Reni Michel kannte, war der Arzt überzeugt, dass es sich tatsächlich um einen Notfall handelte, denn das junge Ehepaar war keinesfalls zimperlich oder wehleidig.
»Er kann nicht mehr sprechen«, sagte Reni Michel bebend, als sie Dr. Norden die Tür öffnete. »Mein Gott, er erstickt.«
Dr. Norden konnte sich gleich überzeugen, dass der junge Mann tatsächlich nahe am Ersticken war.
Und ihm kam ein entsetzlicher Gedanke, als Reni hastig sagte, dass es gestern mit leichtem Fieber angefangen hätte, nicht schlimm genug, dass man ihn rufen wollte. Aber nun glühte Frank Michel und war nicht mehr ansprechbar.
Dr. Norden überlegte nicht lange, er redete auch nicht, er bestellte den Notarztwagen.
»Ihr Mann muss auf schnellstem Wege in eine Spezialbehandlung, Frau Michel«, sagte er überstürzt. »Ich kann hier momentan gar nichts machen.«
Sechs Minuten später schon wurde der Kranke mit Blaulicht und Martinshorn in die Klinik gefahren. Er kam sofort auf die Intensivstation und wurde völlig isoliert.
Dr. Norden hatte dem Chefarzt Dr. Poll seine Vermutung mitteilen können. »Legionella pneumophila«, so wurde diese Krankheit bezeichnet, oder schlicht Legionärskrankheit. Und Dr. Norden war nur auf diese Vermutung, die er selbst nicht als Diagnose bezeichnen wollte, gekommen, weil er sich erst vor ein paar Tagen mit dieser seltsamen, schrecklichen Erkrankung befasst hatte, als ein mysteriöser Todesfall bekannt geworden war, bei dem die gleichen Symptome verzeichnet wurden wie bei Frank Michel.
Obgleich dieser ein junger, kräftiger, sportlicher und widerstandsfähiger Mann war, konnte jetzt noch niemand sagen, ob man ihm Rettung bringen könnte, zu rätselhaft war diese Krankheit. Dr. Norden wusste nicht, wie er Reni Michel trösten sollte, die im dritten Monat schwanger war.
Tief in sorgenvolle Gedanken versunken, verließ er das Krankenhaus, nachdem ihm die Kollegen versprochen hatten, ihn auf dem Laufenden zu halten. Er stieß mit einem schlanken Mann zusammen.
»Verzeihung«, murmelte Daniel Norden, dann starrten sich die beiden Männer an.
»Daniel Norden«, sagte er staunend.
»Günter Marschall«, staunte Daniel nicht weniger. »Wieder im Lande?«
»Seit gestern. Habe eine Patientin aus Bombay hergebracht, die ich gerade besuchen will.«
»Ich habe es gerade furchtbar eilig«, sagte Daniel. »Bin aus der Sprechstunde weg. Musste auch einen Patienten herbringen. Aber Sie kommen mir gerade wie gerufen! Könnten Sie mich besuchen, Günter?«
»Aber gern. Ich habe viel Zeit«, erwiderte der andere müde.
»Gleich heute Mittag, in der Privatwohnung? Ich sage meiner Frau Bescheid. Sie wird sich freuen.«
»Abgemacht«, erwiderte Günter Marschall. »Ich weiß, wie gefragt Sie sind. Von mir kann man das ja nicht sagen.«
Es klang bitter. Aber Dr. Norden hatte keine Zeit, jetzt auch noch über ihn nachzudenken. Sie würden sich ja sehen und miteinander sprechen können. Er musste zu seinen Patienten und er musste auch noch Reni Michel Bescheid sagen.
Aber er wusste auch, dass Dr. Günter Marschall, der eigentlich Chirurg war, sich sehr mit Viruskrankheiten befasst hatte. Freude über das Wiedersehen konnte er noch immer nicht empfinden, denn dazu waren seine Gedanken zu sehr bei Frank Michels rätselhafter Erkrankung.
Gestern hat es angefangen, dachte er, vielleicht haben wir dann noch eine Chance. In Fällen, die ihm bekannt waren, hatte man immer erst eine Grippe vermutet und die entsprechende Behandlung durchgeführt. Wenn man jetzt sich gleich auf die Lunge konzentrierte, konnte man vielleicht doch noch etwas für Frank Michel tun.
Loni, seine Arzthelferin, sah es ihm sofort an, wie besorgt er war. Da sagte sie lieber gar nichts. Es gab auch noch genug zu tun, obgleich ein paar Patienten das Warten zu lang geworden war, wenngleich sie für den geplagten Dr. Norden alles Verständnis aufbrachten. Sie wussten, dass er niemanden im Stich ließ, aber er konnte nicht überall gleichzeitig sein.
Daniel hatte auch keine Zeit, seine Frau Fee anzurufen, aber wenn der Besuch auch überraschend kam und zum Essen bleiben sollte, würde Fee ganz schnell noch etwas Besonderes zaubern.
So war es denn auch. Wenigstens konnte Daniel zehn Minuten vor Dr. Günter Marschall da sein, und die gute Lenni trat in der Küche gleich voll in Aktion.
Fee dachte jetzt etwas anderes. »Wir werden die Kinder zu Lenni in die Küche schicken«, sagte sie. »Günter braucht nicht gleich wieder an seine Tragödie erinnert zu werden.«
Und da die drei kleinen Nordens sowieso nicht begeistert waren, wenn ein Doktor kam, noch dazu einer, den sie nicht kannten, verzogen sie sich auch rasch, als es läutete. Da wurde ja sowieso nur was geredet, was sie nicht verstanden. Da war es bei Lenni gemütlicher.
Lenni fühlte sich keineswegs gekränkt, obgleich sie sonst auch immer am gemeinsamen Tisch mitaß. Sie wusste, dass es einen triftigen Grund haben musste, wenn die Kinder ausgeschlossen wurden, doch den sollte sie erst später erfahren.
Fee begrüßte Günter Marschall herzlich. »Wir freuen uns, Günter«, sagte sie. »Bleiben Sie in der Heimat?«
»Vorübergehend«, erwiderte er.
»Und wenn wir jemanden wüssten, der Sie mit Kusshand nehmen würde?«
»Mich doch nicht«, sagte er bitter. »Reden wir lieber davon, was Daniel auf dem Herzen hat.«
»Aber später kommen wir darauf zurück«, sagte Fee. Und sie wollte nicht, dass beim Essen von schweren Krankheiten gesprochen wurde.
Günter schmeckte es. »Ewig nicht mehr so gut gegessen«, sagte er anerkennend und dankbar. »Bei Ihnen scheint alles in Ordnung zu sein.«
»Wir sind zufrieden«, sagte Fee.
Er fragte nicht nach den Kindern, und sie wusste zu gut, warum er das nicht tat. Er hatte nicht verwunden, was ihn aus der Heimat in die Fremde getrieben hatte.
Beim Kaffee sprach Daniel dann von Frank Michels mysteriöser Krankheit, und er erwähnte auch, welche Vermutungen er hegte.
»Ich kann es nicht beurteilen, wenn ich den Patienten nicht gesehen habe«, sagte Günter, »aber mir ist bekannt, dass mehrere Fälle dieser Legionärskrankheit aufgetreten sind.«
»Würden Sie mir genau sagen, was Sie darüber wissen?«, fragte Daniel.
»Aber gern, so unerfreulich das Kapitel auch ist. Aber jetzt wird es höchste Zeit, dass etwas unternommen wird, denn die Fälle häufen sich.«
Er trank den köstlichen Mokka aus, denn der sollte ja nicht kalt werden. Dann begann er. »Es ist Ihnen ja bekannt, dass man zum ersten Male über diese Krankheit erfuhr, als sich die Teilnehmer am Vietnam-Krieg trafen und nach einer Woche neunundzwanzig gestorben waren. Daher hat die Krankheit auch die Bezeichnung bekommen.«
»Ja, das ist mir bekannt, und auch, dass man ein Jahr später feststellte, dass der Erreger eine kleine Stäbchenbakterie ist. Aber bis heute weiß man doch nicht, woher dieser Erreger kommt und wie er entsteht.«
»Es wäre ein Segen, wenn das herausgefunden würde«, sagte Günter Marschall. »Die Bakterie kann man jetzt schon als Killer bezeichnen. Vermutungen werden genügend angestellt. Aber das Tragische ist ja, dass man diese Bakterie erst mit Sicherheit nach dem Tod im Lungengewebe feststellen kann. Und es gibt kein typisches Krankheitsbild. Erscheinungen wie bei der Grippe, doch selbst auf Penicillin sprechen die Patienten nicht an. Die Meinungen gehen so weit auseinander, dass sich die Kollegen schon zu streiten beginnen, und ich möchte mich in einen solchen Streit nicht einmischen.«
»Aber uns können Sie doch sagen, was Sie meinen, Günter«, bat Fee.
»Was ich meine, ist nicht zu beweisen. Ich glaube sogar, dass die Krankheit eventuell durch Umweltverschmutzung hervorgerufen wird, durch Stoffe, gegen die wir wiederum noch keine Abwehrstoffe im Körper entwickelt haben. Manche vermuten, dass Klimaanlagen schuld sein könnten. Ich meine eher, dass gewisse Materialien im Nährboden sind, vielleicht Giftstoffe. Aber ich tappe auch im Dunkeln. Jedenfalls kann man nur helfen, wenn die Lunge befreit werden kann, wenn man verhindert, dass das Gewebe aufquillt und die Luftröhrchen abquetscht, und wenn man dann noch Glück hat und das zentrale Nervensystem nicht angegriffen wird.«
»Von der Hand zu weisen ist es nicht, dass Klimaanlagen buchstäblich zu Bakterienschleudern werden können«, sagte Daniel. »Der Überzeugung bin ich schon lange und finde es bei vielen Patienten bestätigt, die nur bei künstlicher Belüftung und Beleuchtung arbeiten. Aber es werden ja immer mehr solche Bunker gebaut, oder auch Hochhäuser mit vielen Fenstern, die man aber nicht öffnen kann. An die Menschen, die darin arbeiten müssen, wird zuletzt gedacht.«
»Ich kann schon in kein Kaufhaus mehr gehen, weil ich da Platzangst kriege«, sagte Fee.
Daniels Gedanken waren schon vorausgeeilt. »Wissen Sie ein Mittel, was diesem jungen Mann helfen könnte, Günter?«, fragte er drängend. »Irgendetwas muss man doch tun. Seine Frau erwartet ein Baby.«
Günter Marschalls Gesicht verdüsterte sich. »Und wenn ich eines wüsste, würde man es mir nicht abnehmen. Mir nicht, Daniel. Karen hat ganze Arbeit geleistet. Man betrachtet mich schon mit Misstrauen, wenn ich eine Patientin besuche, der ich glücklicherweise das Leben retten konnte.«
»Diese Patientin, die Sie vorhin besuchen wollten?«
»Ja, Dorrit Vanhoven.«
»Die Industriellenwitwe?«, fragte Fee.
»Ja, sie starb fast an einem Insektenstich, und zufällig war ich zur Stelle. Aber hier schaut man mich an, als hätte ich sie töten wollen, um dann als ihr Retter dazustehen.«
»Sind Sie nicht zu misstrauisch, Günter?«, fragte Daniel.
»Einem Mann, dem von seiner Frau nachgesagt wird, dass er das Leben seines Sohnes auf dem Gewissen hat, traut man alles zu. Ich musste mich an den Gedanken gewöhnen, aber ich kann es nicht. Darüber werde ich nie hinwegkommen.«
»Niemand hätte ihn retten können«, sagte Daniel, »das ist doch erwiesen.«
»Aber Karen gibt keine Ruhe. Sie will nicht zur Ruhe kommen.«
»Vielleicht deshalb, weil sie ihr Gewissen nicht beschwichtigen kann«, sagte Fee ruhig. »Der Junge wäre nicht vom Balkon gestürzt, wenn sie aufgepasst hätte.«
»Aber er lebte, und nach der Operation starb er«, sagte Dr. Günter Marschall müde.
*
Und so war es vor drei Jahren gewesen. Dr. Günter Marschall und seine Frau Karen hatten ein neues Haus bezogen. Der dreijährige Dominik hatte vorher noch keinen Balkon gekannt. Er kletterte gern, und er kletterte auch an dem Balkon herum, während seine Mutter mit einer Freundin ein ewiglanges Telefongespräch führte, um über die Einweihungsparty zu sprechen. Nikki stürzte aus dem ersten Stockwerk auf die Steinfliesen der Terrasse. Dr. Günter Marschall, ein Chirurg, dem man eine große Zukunft prophezeite, operierte seinen Sohn, weil so schnell kein anderer zur Verfügung stand. Aber Nikki starb an den inneren Verletzungen. Und damit hatte ein Drama begonnen, das mit einer Ehescheidung endete. Karen Marschall wollte keinesfalls am Tode ihres Sohnes schuld sein, obgleich man ihr Verletzung der Aufsichtspflicht vorwarf. Aber eine Mutter war durch den Tod ihres einzigen Kindes wohl genug gestraft. Günter, der das Kind sehr geliebt hatte, verzweifelte, und er gab alles auf.
Fee hatte diese traurige Geschichte Lenni erzählt, während die beiden Männer immer noch über diese schreckliche, unerforschte Krankheit sprachen. Lenni hatte feuchte Augen bekommen.
»Der arme Mann, wie kann man ihm nur so mitspielen«, sagte sie.
»Es wird höchste Zeit, dass er merkt, dass er auch Freunde hat«, sagte Fee und ging wieder zurück zu den Männern.
»Wie weit seid ihr?«, fragte sie.
»Bin ich lästig?«, fragte Günter gleich ganz erschrocken.
»Aber keineswegs, im Gegenteil.«
»Günter hat mir eben ein Medikament gesagt«, erklärte Daniel. »Ich fahre zum Krankenhaus und spreche mit dem Chefarzt. Börner ist zugänglich.«
»Ich verabschiede mich«, sagte Günter rasch.
»Nein, ich möchte mit Ihnen über die Behnisch-Klinik sprechen, Günter. Sie brauchen dort ganz nötig einen Chirurgen. Und nun setzen Sie nicht gleich wieder so eine trübe Miene auf. Sie werden sich doch nicht Ihr ganzes Leben zerstören lassen.«
Daniel warf ihr einen Blick zu, der bedeuten sollte: Du machst es schon, Feelein. Und sie bekam von ihm einen zärtlichen Abschiedskuss, obgleich er in Eile war.
»Wir sehen uns noch, Günter. Fee verabredet das mit Ihnen. Wir bleiben jedenfalls in Verbindung.«
»Und wenn es schiefgeht?«, fragte Günter. »Es ist nicht gesagt, ob das Medikament etwas nützt.«
»Es ist jedenfalls besser, als gar nichts zu probieren«, sagte Daniel. »Ich nehme es auf mich.«
»Er hat Mut«, sagte Günter Marschall leise.
»Sie hatten auch Mut, als Sie Nikki operierten. Sie wagten alles.«
»Ich konnte ihn nicht retten«, murmelte er. »Jetzt wäre er sieben Jahre und würde in die Schule gehen.«
»Er hätte nie mehr gehen können, Günter. Er hätte im Rollstuhl gefahren werden müssen. Und wie wäre Karen dann als Mutter gewesen, wie hätte sie diese Bewährungsprobe bestanden? Ich verstehe Frauen nicht, die Männer in einer so schwierigen Situation im Stich lassen.«
»Wenn sie mich nur im Stich gelassen hätte«, sagte er bitter, »aber sie will mich zerstören, restlos. Auch deshalb, weil ich ihr nicht verzeihen kann.«
»Aber Sie haben sie in Schutz genommen bei der Verhandlung.«
»Nun ja, ich dachte, dass wir uns gegenseitig helfen könnten. Aber zwischen uns gab es keine Bindung mehr. Vielleicht hat nie eine echte Bindung bestanden. Sprechen wir nicht mehr davon, Fee.«
»Sie sollten nicht ständig auf der Flucht sein«, sagte sie eindringlich. »Gerade das könnten ihnen Übelwollende als Schuldbewusstsein auslegen. Sprechen Sie doch mal mit Dieter Behnisch. Ihnen ist er doch von früher her auch bekannt.«
»Ich kann doch nicht einfach hingehen und fragen, ob er mich nehmen würde«, sagte Günter leise.
Mein Gott, was haben sie aus diesem Mann gemacht, dachte Fee.
»Ich sagte doch schon, dass Dieter Sie mit Kusshand nehmen würde. Er und Jenny schaffen es mit den Assistenzärzten nicht mehr. Es liegen schlimme Wochen hinter ihnen. Sie müssen mal wieder Urlaub machen. Und Sie brauchen Ihre Arbeit, Günter.«
»Aber ich kann niemals ein Kind operieren, nie«, sagte er leise.
»Das ist in der Behnisch-Klinik so selten. Nur mal ein Notfall, sonst kommen sie doch alle in die Kinderklinik.«
»Aber gerade keinen Notfall«, sagte er tonlos.
»Sprechen Sie erst mit Dieter, und möglichst gleich. Ich rufe ihn an.«
»Ich möchte nicht, dass er Ihnen einen Freundschaftsdienst erweist.«
»Ach was, ich sage ihm nur, dass Sie ihm mal Grüß Gott sagen wollen. Mit dem Wagen sind Sie in vier Minuten dort. Es ist eine ganz moderne Klinik geworden, Günter. Und Dieter und Jenny sind prächtige Menschen.« Sie lächelte ihr umwerfendes Lächeln, dem niemand widerstehen konnte und fragte: »Oder soll ich Sie bei der Hand nehmen?«
Er schüttelte den Kopf. »Ihre Kinder habe ich noch nicht gesehen, Fee. Nur gehört. Sie haben sie ferngehalten.«
»Weil ich dachte, es könnte Wunden aufreißen, Günter«, sagte sie leise.
»Die haben sich nie geschlossen. Und ich fand Nikkis Grab ziemlich verwahrlost. Ja, ich würde gern hierbleiben, damit wenigstens dies nicht vergessen wird.«
Er tat ihr unendlich leid. Er war fünfunddreißig und bereits ein gebrochener Mann.
Aber sie wusste auch, wie viel Karen dazu beigetragen hatte, damit er so wurde. Und sie wusste auch, welches Leben Karen Marschall führte.
Aber Günter durfte sich nicht verkriechen. Er musste den Tatsachen ins Auge sehen. Er durfte sich von dieser Frau nicht vollends in den Abgrund stoßen lassen. Er war ein begnadeter Chirurg gewesen. Einer, der nicht nur vom Skalpell fasziniert war. Über manche Operationen, die er ausgeführt hatte, war lange gesprochen worden, und diese Patienten, denen er das Leben gerettet hatte, hatten auch zu ihm gehalten, aber wieder einmal hatte die Missgunst mancher Kollegen überwogen, der Neid, der Fee und ihrem Mann immer unbegreiflich bleiben würde.
Das Gespräch, das sie mit Dr. Dieter Behnisch führte, war kurz. Sie kannten sich lange und so gut, dass sie gar nicht viel zu sagen brauchte. »Ich werde ihn als rettenden Engel begrüßen«, sagte Dieter. »Zufrieden, Fee?«
»Du kannst zufrieden sein, wenn er bleibt.«
*
Ein wenig der Zweifel bröckelte schon von Günter Marschall ab, als er auch in der Behnisch-Klinik mit Herzlichkeit empfangen wurde.
»Das ist für uns eine ganz große Freude«, sagte Jenny. »Wie lieb von Fee, dass sie Sie uns nicht vorenthalten hat.«
Da Jenny selbst lange Zeit in Entwicklungsländern gearbeitet hatte, wusste sie, dass Günter Marschall in den Jahren seiner Abwesenheit mehr Rückschläge als Ermunterungen hatte hinnehmen müssen.
»Wenn Sie jetzt etwa eine Stellung suchen, Kollege, ich kann Ihnen gleich eine anbieten«, sagte Dieter unverblümt. »Aber schauen Sie sich die Klinik erst mal an, ob sie Ihren Ansprüchen genügt.«
Er verstand es, die Hemmungen zu überspielen und Günter schaute sich um.
»Ich stelle ja keine Ansprüche, aber um diese Klinik könnte man Sie beinahe beneiden, wenn ich zu solchen negativen Gefühlen fähig wäre. Wissen Sie, unter welchen Bedingungen ich arbeiten musste.«
»Jenny weiß es aus Erfahrung. Sie hat das ja mitgemacht«, erwiderte Dieter, »aber dafür habe ich eine Frau und Partnerin gefunden, die mir manches voraus hat.«
»Übertreib nicht, Dieter«, warf Jenny ein.
»Auch um Ihre Frau sind Sie zu beneiden«, sagte Günter, »und das sage ich ehrlich. Es ist gut, wenn man jemanden zur Seite hat, der nicht nur reden, sondern auch verstehen kann.«
»Hier hätten Sie jedenfalls einen Wirkungsbereich, in dem Sie verstanden und auch geschätzt werden«, sagte Dieter. »Meinetwegen könnten Sie morgen anfangen. Dann könnten wir in vierzehn Tagen fahren. Geplant hatten wir es ja, aber schon fast wieder verworfen.«
»Sie denken gar nicht zurück?«, fragte Günter beklommen.
»Natürlich denke ich zurück. Ich habe nicht vergessen, welches Unrecht Ihnen zugefügt wurde. Aber es gab sehr viele, die Ihre Partei ergriffen haben. Sie waren in der Überzahl. Und es gab einige Kollegen, die sich gedrückt haben, Ihren Sohn zu operieren.«
»Ich wusste, wie groß das Risiko ist, aber ich musste es doch wenigstens versuchen«, sagte Günter leise.
»Sie haben es gewagt, aber das Wunder, auf das jeder in einer solchen Situation hoffen würde, geschah nicht. Für uns würden Sie jedenfalls der rettende Engel sein. Mehr kann ich nicht sagen.«
»Es gibt viele fähige Chirurgen«, sagte Günter stockend.
»Ja, gewiss, aber die haben andere Ambitionen, als an einer verhältnismäßig kleinen Privatklinik zu arbeiten. Wir hatten schon ein paarmal Glück, aber allzu lange blieb keiner, weil sich andere Möglichkeiten auftaten. Belegärzte könnte ich schon bekommen, aber dazu reichen die Betten nicht aus. Unter zwanzig Betten rentiert es sich für keinen, das ist die Ansicht. Und bei uns bleiben im äußersten Fall mal zwei für ein paar Tage frei. Arbeit gibt es allerdings genug.«
»Wenn Sie mir zugestehen, dass ich keine Kinder zu operieren brauche, komme ich gern«, sagte Günter.
»Okay, wenigstens gilt das Versprechen, solange Sie sich nicht freiwillig einmal zu einer solchen Operation entschließen sollten.«
»Nie, das werde ich nie mehr können«, sagte Günter.
»Es ist auch höchst selten der Fall, dass wir mal einen Unfall oder einen Blinddarm bei einem Kind bekommen. Höchstens dann, wenn einer von den Eltern schon mal hier operiert wurde. Aber ich billige Ihnen völlige Entscheidungsfreiheit zu, falls solch ein Fall einmal eintreten sollte, wenn Jenny oder ich nicht zugegen sind.«
»Wollen Sie sich nicht erst überzeugen, ob ich überhaupt noch anknüpfen kann an meine früheren Fähigkeiten?«
»Das werden wir natürlich. Wir werden Ihnen sogar ganz gehörig auf die Finger schauen, mein Lieber. Der Ruf unserer Klinik ist uns schließlich auch was wert. Aber ein Chirurg wie Dr. Marschall vergisst nicht, was er einmal konnte, davon bin ich überzeugt.«