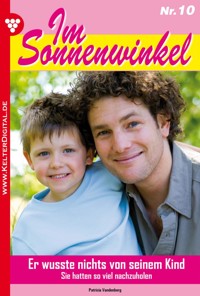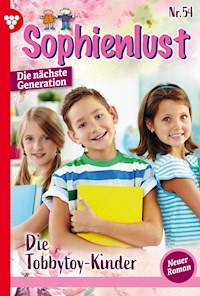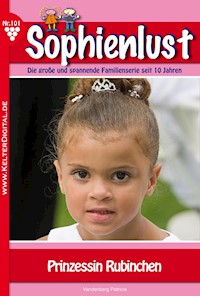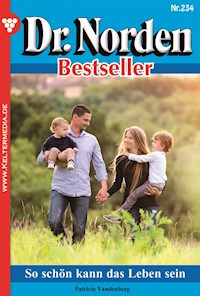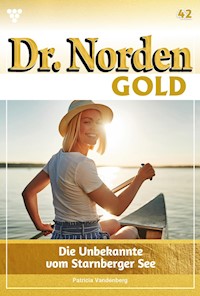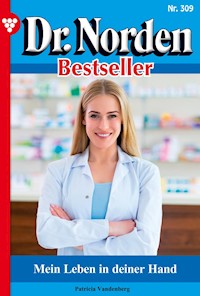
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Dr. Norden Bestseller
- Sprache: Deutsch
Für Dr. Norden ist kein Mensch nur ein 'Fall', er sieht immer den ganzen Menschen in seinem Patienten. Er gibt nicht auf, wenn er auf schwierige Fälle stößt, bei denen kein sichtbarer Erfolg der Heilung zu erkennen ist. Immer an seiner Seite ist seine Frau Fee, selbst eine großartige Ärztin, die ihn mit feinem, häufig detektivischem Spürsinn unterstützt. Dr. Norden ist die erfolgreichste Arztromanserie Deutschlands, und das schon seit Jahrzehnten. Mehr als 1.000 Romane wurden bereits geschrieben. Die Serie von Patricia Vandenberg befindet sich inzwischen in der zweiten Autoren- und auch Arztgeneration. Dr. Antonia Gabriel war schon eine halbe Stunde im Labor, als der Chef kam. Für sie war Dr. Magnus jedoch mehr als der Chef, wenn sie es auch sehr gekonnt für sich behielt. Manchmal aber hatte sie doch das Gefühl, daß wenigstens er ihre geheimsten Gedanken erraten konnte, und dann wurde sie unsicher. »Guten Morgen«, begrüßte er sie leise. Eine direkte Anrede vermied er immer. Sie blickte auf und erwiderte den Gruß. Ein Schatten fiel über ihr Gesicht. Er sah noch erschöpfter aus, als an den vergangenen Tagen, aber sie wagte nicht, eine Frage zu stellen. »Wir müssen noch einiges durchsprechen«, erklärte er. »Ich fliege morgen nach Paris. Ich kann es nicht mehr aufschieben. Es hängt zuviel davon ab.« »Geht es Ihrer Frau schlechter?« fragte sie stockend. »Was heißt schlechter. Es geht immer gleich schlecht, aber wenn es so weitergeht, könnt ihr mich noch vor ihr begraben.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Norden Bestseller – 309 –
Mein Leben in deiner Hand
Patricia Vandenberg
Dr. Antonia Gabriel war schon eine halbe Stunde im Labor, als der Chef kam. Für sie war Dr. Magnus jedoch mehr als der Chef, wenn sie es auch sehr gekonnt für sich behielt.
Manchmal aber hatte sie doch das Gefühl, daß wenigstens er ihre geheimsten Gedanken erraten konnte, und dann wurde sie unsicher.
»Guten Morgen«, begrüßte er sie leise. Eine direkte Anrede vermied er immer.
Sie blickte auf und erwiderte den Gruß. Ein Schatten fiel über ihr Gesicht. Er sah noch erschöpfter aus, als an den vergangenen Tagen, aber sie wagte nicht, eine Frage zu stellen.
»Wir müssen noch einiges durchsprechen«, erklärte er. »Ich fliege morgen nach Paris. Ich kann es nicht mehr aufschieben. Es hängt zuviel davon ab.«
»Geht es Ihrer Frau schlechter?« fragte sie stockend.
»Was heißt schlechter. Es geht immer gleich schlecht, aber wenn es so weitergeht, könnt ihr mich noch vor ihr begraben.«
Er erschrak selbst, als er es ausgesprochen hatte, denn Antonia sah ihn voller Entsetzen an. »Nein«, stieß sie hervor, »bitte, sagen Sie doch nicht so was.«
Seine Augenbrauen hatten sich zusammengeschoben, sein markantes Gesicht wirkte mehr als düster.
»Sie müssen wissen, Antonia, ich habe nicht nur eine kranke Frau, ich habe dazu auch noch eine Schwägerin, die eine Nervensäge ist, aber vielleicht hat sich das bereits herumgesprochen. Oft genug ruft sie ja an.«
Er hatte sie »Antonia« genannt, das tönte in ihren Ohren. Und jetzt betrachtete er sie mit einem Blick, der sie lähmte wie ein elektrisierender Schlag.
»Sie sollten mich nach Paris begleiten«, fuhr er fort, »damit ich einmal wieder mit einem normalen, vernünftigen Menschen reden könnte.« So viel Bitterkeit lag in den Worten, daß es sie schmerzte.
»Nein«, erwiderte sie leise, »es würde nur Gerede entstehen, das sage ich, weil ich vernünftig bin.«
»Und Sie haben wie immer recht. Es würde Gerede geben, das ich um Ihretwillen vermeiden will und muß. Was mich betrifft, Antonia, ist mir so ziemlich alles egal. Schlimmer kann es nicht mehr kommen.«
Er sah verzweifelt aus. Sie war bis ins Innerste erschüttert.
»Wenn Sie sich einmal aussprechen möchten, es würde sich ja sicher eine Gelegenheit finden«, flüsterte sie. »Aber Sie dürfen nicht verzagen. Ich kann Sie so gut verstehe. Meine Mutter war sieben Jahre krank und ich weiß, was mein Vater mitgemacht hat und wir auch. Aber das kann ja kein Trost sein.«
»Es ist ein Trost, weil Sie es sagen, Antonia, und wie Sie es sagen. Ich wünschte so sehr, ich könnte die Zeit zurückdrehen, aber… bitte, verzeihen Sie, daß ich mich so gehenließ.«
Und bevor sie noch etwas erwidern konnte, war er wieder draußen. Sie konnte sich nicht mehr auf ihre Arbeit konzentrieren, obgleich diese sehr wichtig war. Sie mußte immerzu an Torsten Magnus denken, und sie hatte in diesen Minuten begriffen, daß ihr dieser Mann unendlich viel bedeutete und sie Angst um ihn hatte.
*
Nach der Sprechstunde am Vormittag machte Dr. Norden seinen täglichen Besuch bei Renate Magnus, und das schon seit acht Monaten, seit sie zum letzten Mal aus dem Therapiezentrum heimgekommen war.
Seit dieser Zeit hatte Vera Link, Renates Schwester, das Regiment im Hause übernommen, und seit einiger Zeit hegte Dr. Norden sogar den Verdacht, daß sie Renate veranlaßt hatte, nach Hause zu gehen und sie auch weiterhin beeinflußte, nicht wieder in einen Klinik- oder Sanatoriumsaufenthalt einzuwilligen, obwohl es kaum noch zu verantworten war, die Kranke nicht unter ständiger ärztlicher Kontrolle zu halten.
Die Hausangestellten hatten bereits gekündigt, und so war neben Vera Link nur eine Tagespflegerin im Haus und jeden Vormittag die Zugehfrau, die sich aber strikt weigerte, auch im Krankenzimmer Ordnung zu schaffen, nachdem sie schlimm von Renate Magnus beschimpft worden war. Frau Schobel hatte Dr. Norden gegenüber mehrmals bemerkt, daß sie überhaupt nur käme, weil ihr Dr. Magnus leid täte und ihr Sohn ja in der Chemie-Fabrik beschäftigt sei, die Dr. Magnus gehörte. Es gab Probleme über Probleme in diesem Haus, und Dr. Norden blieben sie nicht verborgen, da in letzter Zeit auch dem Hausherrn die Nerven durchgingen, und dafür hatte der Arzt alles Verständnis.
Renate Magnus hatte sich mit ihrem Leiden nicht abgefunden. Sie tyrannisierte ihre ganze Umgebung, Vera ausgenommen, die eine ganz besondere Art hatte, mit der jüngeren Schwester umzugehen.
Gewiß war Renate eine bedauernswerte Frau, aber für Dr. Norden war es ein ziemlicher Schock gewesen, als er erfuhr, daß sie schon die ersten Anzeichen einer Multiplen Sklerose mit in diese Ehe brachte. Von ihren Eltern aus gesehen, konnte man es sogar als arglistige Täuschung bezeichnen, daß sie diese Heirat so forciert hatten. Gewiß war Torsten Magnus in das bildhübsche Mädchen verliebt gewesen, aber die Heirat war buchstäblich erpreßt worden, weil Renate nach einem gemeinsamen Urlaub an der Riviera, den ihre Eltern arrangiert hatten, schwanger war. So war Torsten Magnus verheiratet, ehe er es sich versah, und als sein Vater noch zwei Jahre später an einem Herzinfarkt starb, wurde ihm auch noch die Last aufgebürdet, eine ziemlich heruntergewirtschaftete Fabrik zu übernehmen, da sich der alte Magnus allem technischen Fortschritt verschlossen hatte. Da war es Eberhard Link gewesen, der finanziell einstieg, und so war Torsten seinem Schwiegervater noch mehr verpflichtet.
Torsten war als Chemiker fast genial zu nennen, und mit jugendlichem Optimismus hatte er auch alles nicht so schwer genommen. Auch Renates Krankheit nicht, obgleich er dann erfuhr, woran sie litt, nachdem sie eine Fehlgeburt gehabt hatte und der Frauenarzt ihm sagte, es sei besser, sie würde keine Kinder mehr bekommen. Er wollte gar keine Kinder von Renate. Er hatte bezüglich dieser Ehe keine Illusionen mehr. Er stürzte sich in die Arbeit, und er hatte Erfolg.
Renate kam in ein Sanatorium. Es gefiel ihr dort sehr gut. Sie lernte einen jungen Mann kennen, der ihr Schicksal teilte, der sie anbetete, und sie lebte auf. Ja, sie sprach sogar von Scheidung, denn über die Tragweite ihrer Krankheit war sie sich nicht bewußt.
Ihr Vater rief sie zur Ordnung, sagte ihr wohl recht kraß die Wahrheit, aber auf dem Heimweg verunglückte er tödlich und das war für Renate ein solcher Schock, daß sich ihr Zustand schlagartig verschlechterte. Hinzu kam, daß ihre Mutter bald einen neuen Partner fand und sich von Magnus auszahlen ließ, was ihm allerdings nur recht sein konnte.
Für andere Frauen hatte Magnus kein Interesse. Er war jetzt mit seiner Arbeit verheiratet, was dieser und der Fabrik sehr gut bekam. Renate war dann wieder im Sanatorium, bis sich Vera einmischte.
Dies alles hatte Dr. Norden im Laufe der Zeit von Torsten Magnus selbst erfahren, der ab und zu auch mal einen Menschen brauchte, mit dem er reden konnte.
Aber er bedauerte ihn auch, als er dann Vera Link so richtig kennenlernte. Frau Schobel hatte gesagt, daß sie nicht nur Haare auf den Zähnen hätte, sondern sogar eine Giftschlange wäre, vor der man sich hüten müsse.
Als Dr. Norden an diesem Mittag das Haus betrat, öffnete ihm nicht wie sonst Vera Link, sondern Amalie Zeitler, die Pflegerin. Sie war um die Fünfzig, kräftig und nicht aus der Ruhe zu bringen.
»Es geht ihr verdammt schlecht«, sagte sie gleich. »Frau Link ist in die Stadt gefahren, da scheint es was gegeben zu haben. Aber sie muß auch eine sehr schlechte Nacht gehabt haben. Es hat böse in ihrem Zimmer ausgeschaut.«
Und jetzt war Renate Magnus in einem völlig desolaten Zustand. Daß sie einmal bildhübsch war, war schon lange vergessen. Aufgeschwemmt, von Alkohol und Zigarettenkonsum, den niemand zu bremsen vermocht hatte, weil sie ja anscheinend von ihrer Schwester damit versorgt wurde, wenn diese es auch bestritt, gezeichnet, hing sie in ihrem Bett, das chaotisch aussah.
»Frau Magnus, hören Sie mich?« fragte Dr. Norden, aber sie reagierte nicht. Er hob ihre Lider, horchte ihr Herz ab. »Sie muß in die Klinik, Schwester Amalie«, sagte er. »Ich rufe den Krankenwagen.«
»Sie wird toben«, murmelte Amalie Zeitler.
»Sie wird nicht toben, dazu ist sie nicht in der Lage. Ich rufe jetzt Dr. Magnus an. Er wird bestimmt keine Einwände erheben.«
»Der kann einem ja wirklich nur leid tun«, meinte Amalie Zeitler. »Sieht selbst aus wie das Leiden Christi, Gott möge mir verzeihen.«
Zuerst meldete sich Antonia Gabriel, die Dr. Norden kannte. Mit einer Grippe war sie mal bei ihm gewesen, aber sie hatte sie rasch überwunden. Er hatte einen besonders guten Eindruck von ihr gewonnen. Eine intelligente junge Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben stand und gewiß keine, die ihren Weg über das Wohlwollen des Chefs machen wollte.
»Dr. Magnus ist gerade in einer Konferenz, aber wenn es wichtig ist, kann ich Sie verbinden lassen, Herr Dr. Norden«, sagte sie.
»Das ist eigentlich nicht nötig, Frau Dr. Gabriel«, erwiderte er ebenso formell, aber doch mit einem amüsierten Unterton, der ihr ein Lächeln entlockte. »Wenn Sie ihm nur ausrichten würden, daß ich Frau Magnus sofort in die Klinik bringen lassen muß.«
»Ist es sehr schlimm?« fragte Antonia hastig.
»Jedenfalls noch ein bißchen schlimmer als vorher. Sie ist bewußtlos. Wenn Dr. Magnus Zeit hat, kann er sich ja mit mir in Verbindung setzen«
»Ich werde es ihm ausrichten«, erwiderte sie tonlos. »Er ist auch nicht gerade gut beisammen.«
*
Renate Magnus war weggebracht worden in die Spezialklinik, eine halbe Autostunde von München entfernt. Man kannte sie dort, ihre Anamnese, ihre Verhältnisse. Solche Patientinnen brauchten nicht lange zu warten, sie waren immer willkommen. Man erging sich hier nicht in Sentimentalitäten. Man hatte es mit Kranken zu tun, deren Lebenszeit begrenzt war, die mehr oder auch weniger leiden mußten. Es kam auch auf die Einstellung an.
Es gab Kranke, die ihr Leiden mit bewundernswerter und respekteinflößender Größe trugen und es gab die andern, die sich in Ersatzbefriedigungen wie Alkohol und Nikotin flüchteten und auch, wenn sie da herankommen konnten, Drogen nahmen und eben dadurch ihre eigene Persönlichkeit viel früher verloren. Renate Magnus war dreißig Jahre, seit neun Jahren verheiratet, als verwöhntes Kind aufgewachsen, durchschnittlich intelligent aber wie schon gesagt bildhübsch, und sie hatte den Mann bekommen, den sie haben wollte. Als Liebling ihres Vaters hatte sie gesagt: Den Mann will ich, diesen Torsten Magnus, und Eberhard Link hatte alles getan, um ihr
zu diesem Mann zu verhelfen. Vera, die um drei Jahre älter, war nicht hübsch, und sie hatte keinen Mann gefunden, und als es endlich so schien, daß es zu einer Heirat kommen würde, hatte er sich als Bankrotteur herausgestellt, der dazu auch noch vor Gericht zitiert wurde.
Und da hatte sie plötzlich ihr Herz für ihre schon so kranke Schwester entdeckt, um sich mit aller Hingabe für sie einzusetzen. Man hatte es ihr anfangs sogar abgenommen, selbst Torsten war ihr dankbar gewesen.
Und bis zu diesem Tage war ihm nicht klar, daß sie raffiniert, geduldig und genau überlegt, einen Plan verfolgte.
Durchgedreht war Vera allerdings am Morgen. Denn bevor Amalie kam und nachdem Torsten das Haus verlassen hatte, hatte Renate lichte Momente nach dieser schrecklichen Nacht, in der sie von Wahnvorstellungen geplagt worden war.
»Jetzt weiß ich es, Vera«, hatte sie ihre Schwester angeschrien. »Du willst dir meinen Mann angeln. Du wartest nur darauf, daß ich sterbe. Aber du wirst Torsten nicht bekommen, keine wird ihn bekommen, und du machst, daß du weiterkommst. Ich will dich nicht mehr sehen.«
Dafür hatte es keine Zeugen gegeben, aber gleich darauf war Amalie gekommen. Vera hatte Renate noch die Tropfen einflößen wollen, aber Renate hatte ihr das Glas aus der Hand geschlagen.
»Geh doch, so geh doch endlich«, hatte sie gekreischt, und das hatte Amalie gehört. Und dann hatte sie nur noch gewimmert.
»Ich muß mal was besorgen«, hatte Vera zu Amalie gesagt. »Warum führt sie sich so entsetzlich auf. Ich habe ihr doch nichts getan. Mein Schwager war unfreundlich, aber er hat ja auch anderes zu denken.«
»Ich werde schon fertig mit ihr«, hatte Amalie gesagt. »Gehen Sie nur.«
Und Vera war gegangen. Was Amalie dann von Renate hörte, nahm sie nicht ernst. Sie hatte so oft mit solchen Kranken zu tun, man konnte sie nicht ernst nehmen in gewissen Stadien, aber es sollte doch eine Zeit kommen, in der Amalie Zeitler sich daran erinnerte und nachdachte.
Nun war Renate weggebracht worden, und Amalie wollte wenigstens ihr Zimmer in Ordnung bringen. Sie meinte, daß Frau Strobel das nicht sehen müsse. Sie räumte die leeren Flaschen weg, die in den Schränken versteckt worden waren, riß die Fenster auf, damit der Zigarettenqualm wenigstens ein bißchen abziehen konnte.
Dr. Norden hatte ja immer gemahnt, daß Renate nicht rauchen solle, über das Trinken hatte er gar nicht mehr gesprochen. Sie hatte alles abgestritten, und Vera hatte dann gesagt, daß sie ab und zu mal rauchen würde.
Für Schwester Amalie war das sowieso alles nicht geheuer. Aber sie wurde gut bezahlt, und sie redete eben auch nicht darüber, weil es ja für die Pflegerinnen eine Schweigepflicht gab.
Vera kam erst nach drei Uhr, frisch frisiert, perfekt gepflegt und ein neues Kostüm hatte sie auch an.
Sie begann zornig zu kreischen, als Amalie sagte, daß Renate in die Klinik gebracht worden sei.
»Ohne mich zu fragen«, schrie sie.
»Sie waren doch nicht da«, erwiderte Amalie ruhig. »Sie war bewußtlos, sie mußte versorgt werden.«
»Und was haben Sie ihr gegeben?« zischte Vera wütend.
»Die Tropfen, sonst nichts. Was wollen Sie mir unterstellen?«
»Ich meine es ja nicht so. Ich bin nur erregt. Aber ich brauche doch einmal ein paar Stunden für mich.«
»Ihnen macht doch niemand einen Vorwurf«, sagte Amalie mit stoischer Ruhe.
»Ich will Ihnen ja auch keinen machen. Ich fahre jetzt zur Klinik. Mein Schwager ist ja hoffentlich dort.«
»Das weiß ich nicht, aber er wurde von Dr. Norden informiert«, erklärte Amalie.
»Dann können Sie jetzt gehen. Wir werden Sie ja in nächster Zeit nicht brauchen.«
Hoffentlich nie mehr, dachte Amalie Zeitler und packte ihre Sachen.
Vera fuhr nicht gleich zur Klinik. Sie raffte erst noch einige leere Flaschen zusammen, die sie in Schränken und Schubladen versteckt hatte, weil Amalie und auch Frau Schobel sie nicht hatten sehen sollen, wobei allerdings beide wußten, was hier so verkonsumiert wurde, wenn sie nicht anwesend waren.
Veras Gedanken überstürzten sich, als sie die beiden Kartons zu ihrem Wagen trug. Daß es schlecht um Renate stand, wußte neben Dr. Norden und Amalie wohl keiner besser als sie, aber wie würde sich nun Torsten verhalten, wenn Renate sterben würde? Er hatte noch nie eine Andeutung gemacht, daß sie immer in seinem Hause bleiben könnte, obgleich sie das schon oft mehr oder weniger direkt herausgefordert hatte.
Bevor sie zur Klinik fuhren, brachte sie die Flaschen noch zum Container.
Freilich machte sie sich Gedanken, daß das nun ausgerechnet heute so kommen mußte, da sie tatsächlich mal mehrere Stunden nicht im Hause anwesend war, und man ihr das doch vorwerfen könnte, aber wie hätte sie auch ahnen sollen, daß Dr. Norden so schnell entschlossen handelte.
Vera überlegte, was sie Amalie Zeitler anhängen könnte, aber da war ja auch noch Torsten und der wußte, in welchem Zustand Renate gewesen war, als er das Haus verließ.
Als sie die Klinik erreichte, hielt sie Ausschau nach seinem Wagen, aber sie konnte ihn nirgends entdecken. Das war momentan noch beruhigend für sie, denn so konnte sie mit den Ärzten sprechen, bevor Torsten kam. Sie hatte jedoch keine Ahnung, wie gut die von Dr. Norden informiert waren und wie gut sie auch bereits Dr. Magnus kannten. Renate war ja schon hier gewesen, bevor Vera die Hausbetreuung übernahm, soweit man das so bezeichnen konnte.
Sie wurde höflich, aber reserviert empfangen. Dr. Oswald, der Leiter der Klinik, war ein älterer, gemütlich wirkender Arzt, mit wachsamen Augen. Sein erster Eindruck von Vera war, daß sie aufgetakelt sei. Man konnte es ihm aber nicht anmerken.
Dr. Reinhart war jünger und sah auch recht gut aus, und so gab sich Vera gleich ganz charmant, aber auch er war dafür nicht empfänglich, denn er war glücklich verheiratet.
»Ich konnte nicht ahnen, daß sich der Zustand meiner Schwester so rapide verändern würde«, erklärte sie hastig. »Ich bin Wochen nicht aus dem Hause gekommen und ausgerechnet heute…, sie muß sich wohl über etwas aufgeregt haben.«
»Das ist keineswegs gesagt«, erklärte Dr. Oswald ruhig und mit einem sarkastischen Unterton. »Es war zu erwarten, daß dieses Stadium früher oder später eintritt, und ich verrate Ihnen wohl kein Geheimnis, wenn ich sage, daß es das Endstadium ist. Das Herz spielt nicht mehr mit, die Leber ist kaputt, um es drastisch und deutlich verständlich zu sagen.«
Vera blickte zu Boden. »Es ist nicht meine Schuld«, stieß sie hervor.
»Das behauptet ja auch niemand«, sagte Dr. Oswald kühl, »wenngleich es nicht ganz verständlich ist, daß die Patientin mit Alkohol und Zigaretten versorgt wurde, in so reichlichem Maße.«
»Sie konnte telefonisch alles bestellen, dazu war sie ja in der Lage, und ich konnte es ihr nicht verbieten«, rechtfertigte Vera sich. »Den Vorwurf sollten Sie dann schon meinem Schwager machen.«
Das war der erste Hieb, den sie gegen ihn vorbrachte. Die beiden Ärzte tauschten einen Blick.