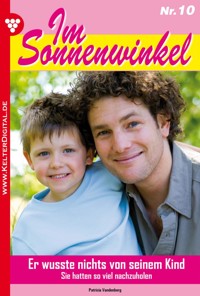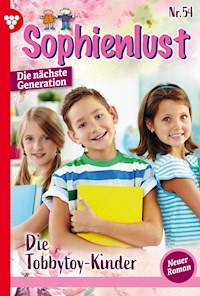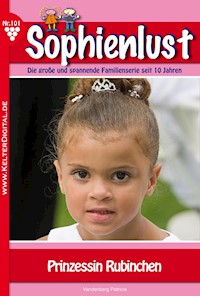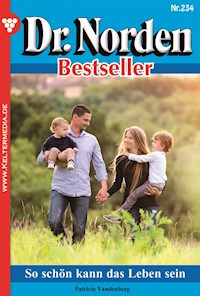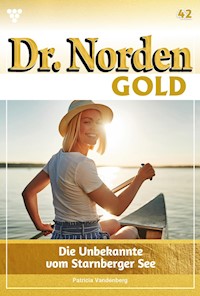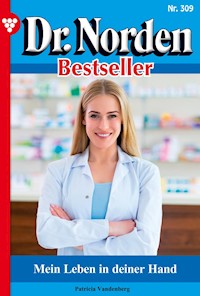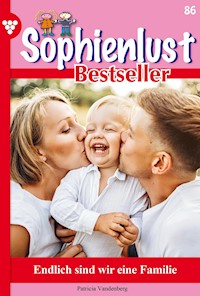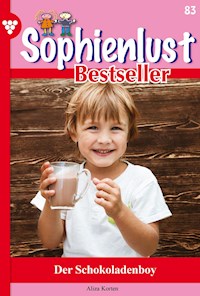Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust
- Sprache: Deutsch
Die Idee der sympathischen, lebensklugen Denise von Schoenecker sucht ihresgleichen. Sophienlust wurde gegründet, das Kinderheim der glücklichen Waisenkinder. Denise formt mit glücklicher Hand aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Diese beliebte Romanserie der großartigen Schriftstellerin Patricia Vandenberg überzeugt durch ihr klares Konzept und seine beiden Identifikationsfiguren. »Zum Donnerwetter, so geht es doch nicht!« Dr. Thomas Rodeck hieb mit der Faust auf den Tisch, dass das Geschirr klirrte. »Das wird ja ein Kuhhandel.« »Mäßige dich!«, mischte sich Cora Berger nörgelnd ein. »Wir kommen von einer Beerdigung.« »Genau das wollte ich sagen«, antwortete Dr. Rodeck. »Was soll der Junge denken? Wo steckt Robin überhaupt?« Augenblicklich schwiegen die streitenden Stimmen. Vor einer Stunde hatte man Professor Malte Rodeck zu Grabe getragen, und nun war sein Sohn verschwunden. Fritz Rodeck erhob sich. Er war der ältere Bruder des Professors und die Verkörperung eines der verknöcherten Beamten. »Wo wird er denn schon sein. Bei dem Hund oder im Schweinestall, wo er sich auch sonst immer herumtreibt«, meinte er unwillig. Dr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust – 479 –
Die Sehnsucht einer Mutter
Patricia Vandenberg
»Zum Donnerwetter, so geht es doch nicht!« Dr. Thomas Rodeck hieb mit der Faust auf den Tisch, dass das Geschirr klirrte. »Das wird ja ein Kuhhandel.«
»Mäßige dich!«, mischte sich Cora Berger nörgelnd ein. »Wir kommen von einer Beerdigung.«
»Genau das wollte ich sagen«, antwortete Dr. Rodeck. »Was soll der Junge denken? Wo steckt Robin überhaupt?«
Augenblicklich schwiegen die streitenden Stimmen. Vor einer Stunde hatte man Professor Malte Rodeck zu Grabe getragen, und nun war sein Sohn verschwunden.
Fritz Rodeck erhob sich. Er war der ältere Bruder des Professors und die Verkörperung eines der verknöcherten Beamten.
»Wo wird er denn schon sein. Bei dem Hund oder im Schweinestall, wo er sich auch sonst immer herumtreibt«, meinte er unwillig.
Dr. Thomas Rodeck, jüngerer Cousin und früherer wissenschaftlicher Mitarbeiter des Verstorbenen, war davon nicht überzeugt. Obwohl er sich nie allzu viel um Robin gekümmert hatte, weil seine Forschungsarbeiten ihn viel zu sehr in Anspruch genommen hatten, besaß er doch von allen Anwesenden den engsten Kontakt zu dem sechsjährigen Robin. Deshalb stand er sofort auf und verließ den Gasthof, in dem sie sich versammelt hatten, weil Stine, die alte Haushälterin des Professors, die er aus seinem Elternhaus übernommen hatte, sich geweigert hatte, diese Gesellschaft zu bewirten.
Atemlos, mit bleichem Gesicht, kam Dr. Thomas Rodeck wenig später zurück. Seine Suche nach dem Jungen war ebenso vergeblich gewesen wie die Fritz Rodecks.
»Robin ist verschwunden«, sagte er. »Mein Gott, auch das noch. Ich wage mich nicht mehr unter Stines Augen.«
»Er ist wie seine Mutter«, erklärte Cora Berger, geborene Rodeck, gehässig. »Genau wie sie!«
Dr. Rodeck warf ihr einen zornigen Blick zu, den sie mit einem hochmütigen beantwortete, bevor sie herablassend fortfuhr: »Im Übrigen hast du dich wohl am wenigsten einzumischen, Thomas. Du bist ja nur ein entfernter Verwandter.«
»Du wirst mir aber gestatten, dass ich in Sorge um den Jungen bin«, erwiderte er zornig. »Nein, so, wie ihr es euch vorstellt, geht es wirklich nicht. Wartet doch erst einmal ab, was Malte in seinem Testament bestimmt hat!«
Man hätte in diesem Augenblick eine Stecknadel zu Boden fallen hören können. »Hat er es überhaupt geändert?«, fragte Cora aufgeregt. »Es wäre ihm schon zuzutrauen, dass er es so gelassen hat, wie er es damals abgefasst hat, als er dieses Animiermädchen heiratete.«
»Halt endlich deinen Mund!«, verlangte ihr Mann, der Oberstudienrat Walter Berger. »Das wird ja peinlich.«
»Janice war kein Animiermädchen«, wies auch Thomas sie zur Ordnung.
Cora machte eine wegwerfende Handbewegung. »Du warst ja immer in sie verliebt«, spöttelte sie. »Zu dir hätte sie auch besser gepasst als zu Malte.«
»Ja«, dachte er, »das mag richtig sein. Jedenfalls hätte ich sie nicht gehen lassen. So nicht!«
»Ich schlage vor, dass wir uns morgen bei der Testamentseröffnung treffen«, erklärte er rau. »Ich muss jetzt Robin suchen.«
»Wir haben unsere Zeit auch nicht gestohlen«, ereiferte sich plötzlich Fritz Rodeck. »Ich habe Doktor Keßler unterrichtet, dass wir nur diesen einen Tag bleiben können. Wir werden uns heute Nachmittag in Maltes Haus treffen, ob es Stine passt oder nicht.«
Thomas hörte nicht mehr zu. Er unterhielt sich mit der jungen Bedienung, die ihm wenigstens einen Hinweis auf den Jungen geben konnte.
»Da war vorhin noch ein Herr mit einem blauen Wagen«, berichtete sie. »Ich habe den Jungen gesehen, wie er dort herumschlich. Aber der Herr sah sehr solide aus, nicht wie ein Kidnapper. Wenn Sie mich fragen, ich wäre auch ausgerückt, wenn ich der Junge gewesen wäre!«
Thomas konnte ihr die Kritik nicht einmal übel nehmen. Es war mehr als geschmacklos gewesen, in Robins Gegenwart all diese unerfreulichen Dinge zu erörtern. Denn Robin war mit seinen sechs Jahren ein sehr aufgeweckter Junge, und irgendwie hatte er doch an seinem Vater gehangen, wenn Malte es auch nicht verstanden hatte, mit dem Kind umzugehen.
Aber wer hatte das schon verstanden? Gut, die alte Stine hatte für den Jungen gesorgt, so gut es eben ging, aber die Mutter hatte sie ihm nicht ersetzen können.
Und er, Thomas? Was hatte er denn schon groß für ihn getan, außer dass er ihm hin und wieder ein Buch oder ein Spielzeug mitgebracht hatte? Die Reue kam zu spät. Eiskalt rann es Thomas den Rücken herab. Nein, seine Reue durfte nicht zu spät kommen. Er musste Robin finden. Sollten die anderen sich doch um die Erbschaft streiten. Er besaß die Ergebnisse der Forschungsarbeit, die er zusammen mit Malte durchgeführt hatte. Zwar war das Ziel noch nicht erreicht, aber die bisherigen Ergebnisse waren wertvoll. Sie hatten es sich zur Aufgabe gemacht, ein Heilmittel gegen bösartige Geschwülste zu finden. Davon war Malte geradezu besessen gewesen, und Thomas wusste jetzt auch, warum. Denn sein Cousin und Freund war an einer solchen Geschwulst gestorben.
Thomas dachte an vieles, während er mit seinem Wagen durch die Gegend fuhr und immer wieder nach dem Kind fragte, das jedoch niemand gesehen hatte.
*
Allein mit ihrem Mann, war Cora Berger bei Weitem nicht mehr so selbstsicher wie zuvor.
»Man kann uns doch wohl keine Schwierigkeiten machen, wenn der Junge auf und davon ist?«, erkundigte sie sich ziemlich kleinlaut.
»Verletzung der Aufsichtspflicht, die uns oblag«, erwiderte er unwillig. »Gar so auf eine Erbschaft versessen brauchst du dich auch nicht aufzuführen, Cora. Man muss ja annehmen, dass wir pleite sind.«
»Geht es uns etwa so gut, dass wir es uns leisten könnten, auf diese Erbschaft zu verzichen?«, fuhr sie ihn an. »Du mit deinem lächerlichen Gehalt. Wir haben drei Kinder. Zu einem Haus kommen wir sonst nie. Ich sehe eben alles realistisch.«
Er seufzte schwer. Gegen seine Frau kam er ohnehin nicht an. Natürlich wäre es auch ihm willkommen, wenn sie Malte Rodecks Haus erben würden, obwohl sie damit zugleich den Jungen in Kauf nehmen müssten. Aber Coras Bruder Fritz würde auch darauf spekulieren.
»An deiner Stelle würde ich heute Nachmittag jedenfalls einen anderen Ton anschlagen«, riet er seiner Frau, und seine Stimme klang beinahe drohend.
»Ach, du Schwächling«, herrschte sie ihn an. »Was bringst du denn schon auf die Beine!«
Seufzend ergab er sich in sein Schicksal, doch er ahnte, dass sich ein paar Zimmer weiter eine ähnliche Szene zwischen Fritz Rodeck und dessen Frau abspielte.
*
Vielleicht ist Robin zu Stine gelaufen, überlegte Thomas plötzlich. Es war zu Fuß zwar ein weiter Weg bis zum Haus des Professors, das ganz abgeschieden in einem unberührten Waldstück lag, aber vom Erdboden konnte der Junge doch nicht verschwunden sein.
Stine war vom Friedhof aus gleich mit dem Einspänner heimgefahren, den sie auch für ihre Besorgungen benutzte. Die knochige alte Frau mit dem schütteren grauen Haar, das im Nacken zu einem festen Knoten zusammengedreht war, blickte Dr. Rodeck über ihre Nickelbrille hinweg an, als er zu ihr in die Küche kam.
»Ist Robin hier?«, fragte er außer Atem.
»Er sollte doch bei dieser Gesellschaft bleiben«, erwiderte sie verächtlich. Aber sofort kam ein ängstlicher Ausdruck in ihre Augen. »Ist er nicht mehr dort?«
»Dann wäre ich nicht hier«, antwortete er erregt und strich nervös durch sein dichtes braunes Haar.
Stine kniff die Augen zusammen. Sie war mit den Rodecks nach dem Krieg aus dem baltischen Raum gekommen, und manch einer mochte sich wundern, warum sie so lange bei ihnen geblieben ist.
»Der Robin geht schon nicht unter«, knurrte sie. »Er ist wie seine Mutter. Jetzt werde ich ja ihren Namen wieder nennen dürfen«, fügte sie anzüglich hinzu.
»Stine, du weißt doch, dass ich nie etwas gegen Janice hatte«, entgegnete Thomas leise.
»Was Sie zu viel für sie übrig hatten, hatten die anderen zu wenig. Schon allein aus diesem Grund hätten Sie sich auch mehr um Robin kümmern müssen«, erwiderte sie anklagend.
»Ich kann leider nicht mit Kindern umgehen«, entgegnete er entschuldigend.
»Das hätten Sie lernen können. Aber ihr habt ja immer nur in eurem Labor gehockt. Da konnte die Sonne scheinen, oder der Himmel weinen, was habt ihr euch denn schon darum gekümmert, wo Robin steckt? Und jetzt zeigt er es euch allen. Recht hat er!«
»Stine, du weißt, wo er ist, sonst könntest du nicht so ruhig sein«, sagte Thomas eindringlich.
»Ich weiß es nicht«, beharrte sie. »Ich fühle nur, dass ihm nichts passiert ist. Ein Schutzengel ist bei ihm, und die Gedanken seiner Mutter.«
»Heute Nachmittag kommen sie zur Testamentseröffnung«, informierte er sie vorsichtig.
»Mich werden sie nicht zu sehen beommen«, erwiderte sie unwillig. »Diese Bande, diese habgierige Bande! Oh, ich kenne sie alle. Froh hätten sie sein sollen, dass der Professor eine solche Frau bekommen hatte, aber sie haben ihr das Leben zur Hölle gemacht, und ihm war seine Arbeit wichtiger als seine Frau.«
»Er war krank«, erinnerte Thomas leise. »Er war schon lange krank, Stine. Er wusste, dass er ihr nichts mehr sein konnte, sonst hätte er sie festgehalten.«
»Er hätte ihr das Kind lassen können«, brummte sie. »Ein Kind gehört zu seiner Mutter.«
Schweigend verließ Thomas das Zimmer und ging zu dem Anbau hinüber, in dem seine kleine Wohnung und das Labor lagen.
Wie war das damals gewesen? Warum hatte Janice auf ihren Sohn verzichtet?
Er sank an seinem Schreibtisch nieder und nahm ein Bild von ihr aus einer Schublade. Wie einen Schatz hatte er es aufgehoben und oft voller Schmerz und Sehnsucht betrachtet. Ob auch Malte das Bild seiner Frau manchmal in den Händen gehalten hatte? Nie wieder war ihr Name erwähnt worden seit jenem Tage, da Janice aus dem Haus gegangen war.
Thomas blickte in ein feines zartes Gesicht, umgeben von hellem Haar, in dem sich die Strahlen der Sonne zu brechen schienen, sodass sie dieses Gesicht wie ein Heiligenschein umrahmten. Ihre großen klaren Augen waren stets von einer fernen Trauer erfüllt gewesen, als ahnte sie schon kommendes Leid.
Wie war Malte, dieser schwerfällige, verschlossene Wissenschaftler, überhaupt zu dieser wunderbaren Frau gekommen, die zwanzig Jahre jünger war als er und schön wie ein Gemälde?
Thomas wusste es nicht, denn Malte hatte darüber nie gesprochen. Er selbst aber hatte gerade sein Studium beendet, als er die Nachricht von der Heirat bekam. Erst ein Jahr später, als Malte ihn bat, sein Mitarbeiter zu werden, hatte er Janice Rodeck kennengelernt.
Thomas rief sich auch diesen Tag in die Erinnerung zurück. Der Atem hatte ihm gestockt, als die zarte, bildschöne Frau in dem düsteren Wohnzimmer erschienen war. Malte liebte keine hellen Wände, keine hellen Bilder, keine lichten Farben, und Janice schien sich damit abgefunden zu haben. Sie hatte lediglich ihrem kleinen Sohn, den sie abgöttisch liebte, in der Mansarde ein helles luftiges Reich eingerichtet. Zu diesem Zimmer zog es Thomas nun.
Der große Raum war ordentlich aufgeräumt. Bunte, luftige Gardinen, von der Sonne schon verschossen, flatterten an den offenen Fenstern, deren Blick zum Wald ging. Das Haus hatte früher dem Forstmeister gehört und war ein wenig romantisch, so recht geeignet für einen versponnenen alten Gelehrten, aber nicht für eine junge, schöne blühende Frau, die das ganze Leben noch vor sich hatte.
»War Janice jemals glücklich gewesen?«, fragte sich Thomas. Er erinnerte sich, wie er mit ihr am frühen Morgen über die Wiesen und durch den Wald gelaufen war. Wie zwei übermütige Kinder hatten sie sich gefühlt. Und wie hatte sie dabei lachen können! Aber das Lachen war ihr vergangen, als die Familie immer mehr auf Malte Rodeck eingeredet und versucht hatte, Janice mit den schlimmsten Verdächtigungen aus seinem Leben zu verbannen.
Dr. Rodeck fragte sich, ob Malte sie nur deswegen hatte gehen lassen, oder ob nicht vielmehr das Wissen um seine Krankheit der Anlass dazu gewesen war. Hatte er ihr vielleicht sein schlimmes Sterben ersparen wollen, überlegte er, während er die kleinen Dinge betrachtete, die Robins Welt gewesen waren: Ein arg zerzauster Teddybär, eine kleine Holzeisenbahn, ein Schaukelpferd, Bilderbücher, Baukästen, alles ordentlich und so gehalten, als wollte er es sich für immer aufheben.
»Wo bist du, Robin«, dachte Thomas verzweifelt, und dann: »Wo bist du, Janice?«
*
Der Junge, um den sich alle seine Gedanken drehten, saß in Sophienlust still am Tisch und blickte vor sich hin.
Denise von Schoenecker legte ihre schönen schlanken Finger auf seine Hand und streichelte leicht darüber hin.
»Bitte, iss doch etwas, Robin«, bat sie freundlich.
»Ich will nicht zu denen zurück«, stieß er hervor.
»Bitte, bitte, lassen Sie mich hierbleiben, bis ich meine Mutti gefunden habe. Stine können Sie ja ruhig sagen, wo ich bin, und Thomas auch. Aber den anderen nicht! Sie haben mich nicht lieb. Sie haben auch meine Mutti nicht lieb gehabt, und ich mag nie wieder hören, was sie alles über sie sagen.«
Ein von Schmerz zerrissenes Kinderherz, was konnte Denise von Schoenecker und alle, die in Sophienlust lebten, mehr bewegen? Der Zufall hatte Robin ausgerechnet hierhergebracht, denn er hatte sich heimlich in Luis Olbergs Wagen verkrochen, der hergekommen war, um seine Lilly zu holen. Es war, überlegte Denise, wieder einmal eine Fügung Gottes, denn dieses verstörte Kind brauchte Hilfe, Trost und viel, viel Liebe.
»Alle hier sind nett zu mir«, sagte Robin schüchtern, »aber ich bin kein Waisenkind. Ich habe noch eine Mutti.«
Denise lächelte sanft. »Hier sind mehrere Kinder, die noch eine Mutti oder sogar Eltern haben, und wir halten auch kein Kind gewaltsam fest, wenn es nicht hierbleiben will.«
Robin sah sie nachdenklich an. »Ich möchte ja ganz gern hierbleiben, bis ich zu meiner Mutti darf. Aber sie wollen mich doch nur deshalb nicht zu ihr lassen, weil es ihnen um das Geld geht. Den ganzen Morgen haben sie von dem Haus und dem Geld geredet, und was Vater alles verschwendet habe mit seinen Wahnideen. So haben sie es genannt. Aber Vater wollte doch nur kranken Menschen helfen, das hat mir Thomas erklärt.«
»Du bist ja jetzt hier, Robin«, meinte Denise beruhigend. »Nun isst du erst einmal brav, und dann spielst du mit den anderen Kindern. Bei uns bist du gut aufgehoben, mein Junge.«
»Sie sprechen so lieb«, flüsterte er, »und Sie sind fast so schön wie meine Mutti.«
Welches Schicksal würden sie wohl diesmal erfahren, überlegte Denise. In aller Eile hatte sie Dr. Lutz Brachmann über ihren neuen Schützling unterrichtet und ihn gebeten, in Erfahrung zu bringen, wohin er eigentlich gehörte. Selbstverständlich war es ihre Pflicht, die nächsten Angehörigen zu informieren. Man konnte die Anwesenheit des Jungen in Sophienlust nicht einfach verschweigen, aber Denise traute sich nach ihren mehrjährigen Erfahrungen auch zu, das Beste für dieses Kind durchzusetzen.
*
Stine verschwand, als die Bergers mit ihrem alten Auto vorfuhren. Sie rümpfte die Nase. Wert auf Äußerlichkeiten hatte ihr Professor auch nie gelegt, aber er war auch nicht so habgierig gewesen wie seine Verwandten.
Manchmal hatte Stine zwar auch gedacht, dass er eine fixe Idee habe, aber einem so berühmten Wissenschaftler stand das wohl auch zu. So viele Kränze hatte der kleine Dorffriedhof noch nie gesehen wie heute und auch nicht eine so große Trauergesellschaft. Aber was konnte das dem Professor jetzt noch nützen?
Stine wollte es sich nicht eingestehen, aber jetzt machte sie sich auch schon Gedanken um Robin. Sie hatte bestimmt gedacht, dass er wenigstens ihr Bescheid sagen würde, wo er sich versteckt hielt. Schließlich musste er doch etwas zu essen haben, und Geld hatte er auch keines.
An schlechte Menschen, denen der Junge in die Hände fallen konnte, dachte Stine zu allerletzt. Für sie gab es keine schlimmeren Menschen als die Verwandtschaft von Professor Rodeck, Thomas ausgenommen.
Nun würde es im Haus wieder zugehen, überlegte sie zornig, als sie sich in den Wald schlich. Mit den Tieren kam sie besser zurecht als mit den Menschen, und die Bäume hatten ihr auch mehr zu sagen. Doch jetzt sprach sie mit sich selbst und schickte Bittgebete zum Himmel, dass Gott dem kleinen Robin seine Mutter zurückgeben möge.
*
Die drinnen im Haus versammelt waren, dachten anders. Sie verurteilten das Weglaufen des ungezogenen Jungen und überhäuften Thomas mit bitteren Vorwürfen, dass er nicht besser auf ihn geachtet habe.
Auch jetzt ging es vor allem um den Nachlass von Professor Malte Rodeck. Inzwischen war Dr. Keßler eingetroffen, ein alter Herr mit einem schmalen klugen Gesicht und schlohweißen Haaren, der keine Miene verzog, als man ihn mit Fragen bestürmte.
»Nehmen Sie doch bitte Platz, meine Herrschaften!«, bat er ruhig. »Ich habe hier alles schwarz auf weiß. Sie werden sofort erfahren, was mein Freund Malte Rodeck in seinem Testament bestimmt hat.«
Noch ahnten sie nicht, dass ihnen allen eine große Enttäuschung bevorstand. Erst als Dr. Keßler sagte: »Lange werde ich Sie nicht aufhalten«, befürchteten sie Schlimmes.
Das Testament war kurz und bündig: »Zu meinem Alleinerben bestimme ich meinen Sohn, zu seinem Vermögensverwalter Dr. Thomas Rodeck und zu seinem gesetzlichen Vormund meine geschiedene Frau, Janice Rodeck, geborene Vandermeer.«
»Das ist unmöglich«, unterbrach Cora Bergers harte Stimme die Stille, aber eine Handbewegung ihres Mannes brachte sie zum Schweigen.
»Das wird angefochten«, drohte Fritz Rodeck empört.
»Das steht Ihnen frei«, erwiderte Dr. Keßler kühl. »Bitte, hören Sie sich noch an, was Herr Professor Rodeck in diesem Brief hinterlassen hat.«