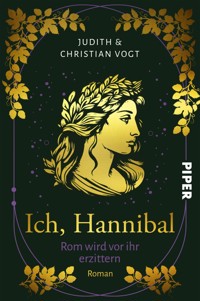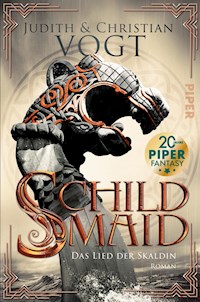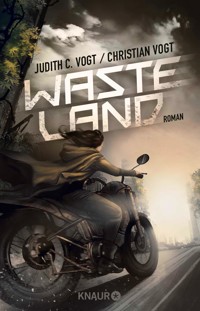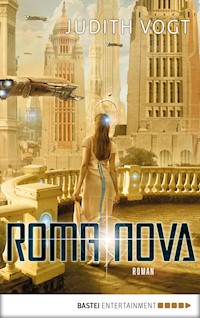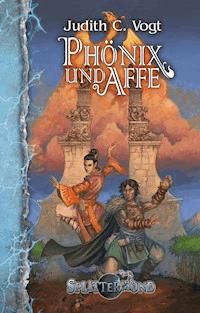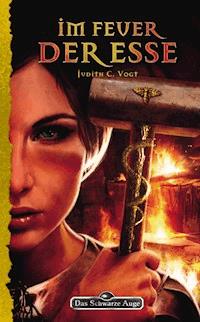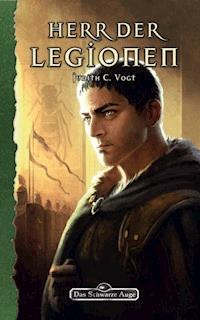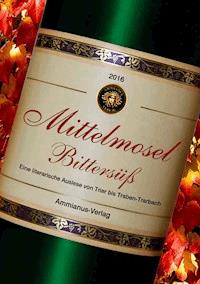Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Spiele
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Alle Wege führen nach Bosparan: Nicht nur die junge Alhanierin Shinja und der Aveshapriester Yagheer müssen feststellen, dass Schicksal und Zufall auf diesen Wegen Hand in Hand gehen. Auch für den jungen Legaten Jelianus, der kürzlich einen Putsch in Puninum angezettelt hat, heißt die nächste Sprosse auf der Karriereleiter Bosparan. Denn auf dem Meer nähern sich die gefürchteten Drachenboote der Torwjalder, und der von Visionen geplagte Dalek-Horas II. ist unfähig, dieser Bedrohung zu begegnen. Die Konflikte der Menschen spitzen sich um die Hunderttürmige zu, und selbst alte Echsenwesen, untiefe Göttinnen und falkengesichtige Halbgötter haben ihre Augen auf die Stadt und in die Herzen der Menschen gerichtet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Ulisses SpieleBand US25706Titelbild: Annika MaarAventurien-Karte: Daniel JödemannLektorat: Eevie DemirtelKorrektorat: Jeanette MarstellerUmschlaggestaltung und Illustrationen: Nadine Schäkel, Patrick SoederLayout und Satz: Mirko Bader
Copyright © 2017 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN und DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR. Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN 978-3-95752-652-6Ebook-ISBN 978-3-95752-654-0
Judith C. Vogt
Brennen soll Bosparan
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Präludium
»Hilf uns!«, hörte Yagheer in den Schatten.
Er wäre der Bitte gern nachgekommen – wenn es nur nicht so dunkel gewesen wäre.
Ein Gewicht lastete auf ihm, er konnte kaum den Kopf wenden. Herauszufinden, woher die Stimme kam, ob ihr Besitzer noch weit entfernt war oder schon sehr nah, fiel ihm schwer. Dieses Gewicht … Er versuchte, dagegen anzukämpfen, doch es lähmte seine Glieder. Sogar auf seiner Zunge lag es und verhinderte, dass er dem sich nun in gepresste Atemzüge wandelnden Hilfegesuch nachkommen konnte.
»Hilf … uns …« Kaum hörbar noch.
Schließlich gelang ihm ein Schritt, ein strauchelnder – wenn auch in die richtige Richtung. Zumindest vermutete er das.
Er tastete mit den Armen voraus. Endlich lockerte sich auch seine Zunge. Sie war pelzig, als habe sie sich in seinem Mund in eine Maus verwandelt. Er rang nach Atem, als ihn Übelkeit durchflutete.
»Wo … wo bist du?«
»Am Rand«, kam die Antwort von weitem. Sie hallte wider, Yagheer musste sich in einer Höhle befinden. »Wir werden fallen«, wehte es zu ihm hinüber. Nur ein Flüstern, doch wieder und wieder verstärkt vom Hall der Katakomben. Das Flüstern erhielt vielstimmige Echos, als hätten Schlangen ihre Stimmen hinzugefügt.
»Nur du … kannst verhindern, dass wir fallen …«
Das letzte Wort war so leise, dass er es nicht mehr hörte, er ergänzte es nur in seinem Kopf, und dort klang es nach.
Fallen – fallen – fallen.
Die Maus in seinem Mund bewegte sich. Er röchelte. Er mochte keine Mäuse, Götter, warum hatte er eine Maus gefangen? Kurz glaubte er, Anzuds helles rundes Auge in der Dunkelheit vor sich zu sehen. Der Steppenfalke hatte den Kopf schiefgelegt, sein goldenes Auge schien Yagheer fragend zu durchdringen, als wundere er sich, warum sein menschlicher Freund so viel Aufhebens um das Verschlucken einer Maus machte.
Dann war wieder alles dunkel, und Yagheer fiel auf die Knie. Er hustete, rang nach Luft und versuchte, dieses Ding loszuwerden.
Er erwachte. Die Exzesse der vergangenen Nacht hatten seinen Kopf in eine Trockenpflaume verwandelt. Augenblicklich strömte süßlich riechende Luft in seine Lungen. Zu seinem größten Unbehagen musste er feststellen, dass das Pelzige in seinem Mund sich tatsächlich als seine Zunge erwies.
Stöhnend schlug er die Augen auf. Ein nackter Rücken schirmte ihn vom ärgsten Licht ab, das gnadenlos durch die bunten Vorhänge fiel. Die Frau nahm ihr üppiges schwarzes Haar über der Schulter zusammen und begann, einen losen Zopf zu flechten.
»Es ist dir wohl ungemütlich mit mir geworden, Effendi«, lächelte sie.
»W-was?«, brachte er hervor.
»Wenn du so um dich trittst, Sohn der Freiheit, dann darf ich wohl mutmaßen, dass ich dich zu sehr beengt habe. Was will man auch anderes erwarten, selbst im Schlaf treibt dich die Unrast an.«
»Nein! Es war nur … ein Traum.«
Sie wandte sich um, ein angewinkeltes Bein berührte seine Seite, als sie sich über ihn beugte. Eine schwere goldene Kette mit zahlreichen rätselhaften Anhängern daran lenkte ihn beinahe mehr ab als ihre schweren Brüste darunter. Beinahe.
»Hier, unter den Augen von Baalat Khelevatan, ist nichts nur ein Traum«, lächelte sie.
***
Sie wusste nicht, ob sie über ihre eigenen Füße gestolpert war oder ob jemand sie gestoßen hatte. Vielleicht war es tatsächlich niemand, der ihr Böses wollte. Vielleicht war es Gama, die nach ihr stieß, damit ein Pfeil sie verfehlte oder ein Hieb oder auch nur ein Blick.
Egal, was dafür gesorgt hatte, dass ihre Schläfe Bekanntschaft mit dem hochaufragenden Pfeiler machte, der wie eines von sechs langen Beinen das Gewölbe der Halle trug – es tat kurz weh, ein helles Licht tauchte ihr Bewusstsein in Dunkelheit, und sie brach schlaff wie ein Mehlsack auf dem kalten Boden zusammen. »Shin…«
***
Von der Säule, vor der ihr bewusstloser Körper lag, ging ihr Geist rückwärts. Er wehte die breiten Stufen wieder hinab. Erneut ragte die Pyramide der Drachenhalle wie ein uralter Fingerzeig eines ungestalten Gottes vor ihrem geistigen Auge auf. Der Basar lag zu ihren Füßen, und sie näherte sich ihm, rückwärts die Treppe hinabhuschend. Körperlos schien ihr dieser Weg so viel leichter, trotz der nächtlichen Dunkelheit, trotz des Wissens, dass man sie entdeckt hatte und dass ihr Geist wieder in ihren Körper gehörte, dass sie aufstehen musste.
Doch ihr Geist trat auf das Muster des großen Basarplatzes, sie fühlte die Zeichen in den beinahe gläsern schimmernden Steinen, als trüge sie keine Sandalen. Wie helle Augen schienen diese Zeichen auf sie gerichtet, und sie erinnerte sich zum zweiten Mal an diesem Tag daran, was hier geschehen war.
Sie seufzte tonlos, um sie herum ein Wirbel aus Menschen. Sie bewegten sich schnell umeinander, als hielten sich Shinja und die Zeit auf verschiedenen Bahnen auf.
Und während sich ihre Zehenspitzen in die Glyphen zu ihren Füßen bohrten, während sie eine nach der anderen zu erspüren versuchte, hörte sie, wie jemand ihr die Geschichte der ermordeten Priesterinnen erzählte, und die Stimme erfasste sie wie ein Windstoß und sog sie zurück in die Zeit ihrer Ausbildung.
Sie kehrte zu den Augen einer alten Frau zurück. Die Shinja, deren Körper am Fuß der Säule in der Halle der Drachen lag, kannte die Geschichte bereits, doch die Shinja, an die sie sich erinnerte, kannte sie nicht und lauschte, zunächst mit Erstaunen, dann mit Fassungslosigkeit, schließlich mit Schrecken.
So viele Tode waren in Bey-el-Unukh, der Stadt am Nacken des Meeres, bereits gestorben worden. Geschah solche Barbarei nur hier? War Al’Hani verflucht, so etwas zu erleiden? Erleuchtet von Heshinjas Weisheit – und das Leiden war der Preis dafür?
Doch die lauschende Shinja war jünger und wagte nicht, so etwas zu fragen. Es klang so melodramatisch, so unreif. So wenig wissend für die Tochter der klugen Bilkis, in deren Andenken man sich ihrer angenommen hatte.
Die Priesterinnen auf dem Basar waren von den Anführern eines feindlichen Heers getötet worden. Von jenen, die aus der Ferne, aus dem Westen gekommen waren und Alhanien als ihr Eigentum betrachtet hatten. Die Priesterinnen hatten ihre Seelen sterbend mit dem Ort verbunden, mit dem Mosaik. Sie hatten sich zur Seele Bey-el-Unukhs zusammengeschlossen, ein Schwarm aus getöteten weisen Frauen. Doch dies war nun schon lange her und der Schatten im Westen nicht mehr als das: ein Schatten.
Nur sieben Jahre jedoch war es her, dass ein neuer Feind sich über die Stadt am Nacken des Meeres und das Land Alhanien hergemacht hatte. Erneut waren ihm zahllose weise Priesterinnen zum Opfer gefallen, jenem Feind, der sie von innen heraus zu fressen begonnen hatte wie ein Parasit in einem Bienenstock. Wie ein Pilz, der die Insekten in den Wahnsinn trieb.
Seit sieben Jahren herrschte der Tyrann Amagomer, der Gemahl einer toten Königin, in einem Land, in dem kein Mann herrschen durfte. Doch seine Hand lähmte eines jeden freien Menschen Waffenarm. Der Saum seines mit Zauberzeichen bestickten Königsmantels knebelte jeden Mund, der gegen ihn sprechen wollte, seine Lanze durchbohrte jedes Herz, das gegen ihn Mut fasste.
Vor Shinja auf dem Tisch waren es beinahe kindliche kleine Hände, die sich um einen Tonbecher legten. Die alte Frau, der diese Hände gehörten, beugte sich vor und blies in die heiße Flüssigkeit. Dann trank sie. Dabei wandte sie den Blick nicht ab.
Shinja wusste, dass die Frau erblindet war, das Alter hatte es mit sich gebracht. Sie selbst sagte, dass sie nur noch Helligkeit von Dunkelheit unterscheiden könne, und doch sei das genau die richtige Gabe für sie.
Eine Gabe, kein Fluch, den das Alter brachte. Shinja lächelte. Sie hatte stets geglaubt, dass alte Menschen die jungen beneideten. Ihre Gesundheit. Ihre Schönheit. Die Möglichkeiten, die noch vor ihnen lagen – noch ungenutzt, noch nicht verschwendet. Dass die Alten im Rückblick feststellen würden, was sie vergeudet hatten.
Doch die vergangenen Jahre, all die Scheidewege und die eingeschlagenen Richtungen, egal ob richtig oder falsch, umgaben diese Frau mit Frieden. Und dieser Frieden brachte Shinja Unruhe. Würde sie ebenso gelassen auf ihr eigenes Leben zurückblicken können? Würde sie früh sterben? Würde sie voller Gram sein, weil sie Schlechtes getan haben würde? Sie blinzelte und versuchte, der Alten erneut zu lauschen, die nicht von Amagomer dem Tyrannen sprach, sondern von den Herzen der Menschen im Westen.
»Ich kenne ihre Herzen, Shinja. Ich habe nicht nur hineingeblickt, nein, ich habe ein Herz wie ihres besessen. Ein Mann vollbringt Unrecht auf schlechte Weise, wenn er weiß, dass es Unrecht ist. Nein, ihr Herrscher wähnt sich im Recht, wenn er sich den Untergang Alhaniens wünscht. Er wähnt sich im Recht, wenn er unsere Göttinnen von ihren Sockeln wirft und unsere Priesterinnen tötet. Wir haben seinen Vorvätern in diesem Land getrotzt, und das, nach dem er trachtet, ist ein gerechter Krieg – zumindest von seinem Standpunkt aus.«
»Aber das heißt nicht, dass er siegen wird«, flüsterte Shinja und sah den Dampfschwaden nach, die aus dem Becher stiegen und sich rasch auflösten.
»Doch, das heißt es«, widersprach die Alte mit traurigem Lächeln.
»Aber auch hier werden die Krieger für die richtige Sache kämpfen!«
»Amagomers Krieger, Kind? Amagomer selbst? Nein, er weiß, dass seine Sache Unrecht ist. Er weiß es, wenn er einfache Bauern mit seinem eigenen Schwert hinrichtet, denn jeder letzte Blick sagt ihm: Unrecht. Nein, Amagomer wird nicht siegen, Kind. Er vollbringt Unrecht auf schlechte Weise, weil er weiß, dass es Unrecht ist.« Eine kurze Pause. Ein Nippen am Tee. »Es ist so groß«, lächelte die alte Frau mit einer Sanftmütigkeit, die Shinja sich nicht erklären konnte. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie groß es ist.«
In den blinden Augen lag nun doch ein seltsames Sehnen in die Vergangenheit. Nun war der Frieden, der sie umgab, aufgewühlt. »Bosparan.«
Ihre Lippen bewegten sich noch, als die letzte Silbe verklungen war, als seien sie immer noch mit diesem Wort beschäftigt. Shinja konnte spüren, wonach es schmeckte. Nach blauer Ferne, nach Hügeln im Dunst. Und nach einer Katastrophe, die sie in den Untergang führen würde.
***
Sie riss ihren schmerzenden Kopf in die Höhe. Jemand zerrte an ihrem Arm. »…ja!« Sie hörte noch die letzte Silbe ihres Namens – sie konnte nicht länger als einen Wimpernschlag bewusstlos gewesen sein. Und die Hand gehörte ihrer Meisterin, gehörte Gama. Sie fuhr auf – waren sie noch nicht entdeckt?
»Sie kommen«, sagte Gama, griff nach Shinjas Arm und zog sie in die Höhe. Sie sah, worauf sie ausgeglitten war. Aus dem Stapel Pergamentrollen, den sie unter ihrem Umhang trug, war etwas herausgefallen. Ein flacher Stein oder eine Scherbe, vielleicht verborgen in den Rollen oder zwischen zwei Blättern. So oder so war ihr Fuß darauf ausgerutscht, und der Stein, der fortgeschlittert war, während ihr Kopf zuerst die Säule und dann Wegpunkte der Vergangenheit getroffen hatte, kam erst jetzt am Ende der Treppe zum Halt. Shinja fuhr herum. »Lass es mich holen!«
»Nein!« Das Wort kam wie ein Peitschenknall. Gama mäßigte ihre Stimme. Im inneren Gewölbe der Halle der Drachen stieg alles zur Kuppel auf und wurde lauter als beabsichtigt. »Nein, dazu ist keine Zeit. Wir müssen finden, weshalb wir hier sind – und außerdem brauchen wir ein Versteck!«
Shinja hatte die Aufzeichnungen über die Drachenhalle studiert. Sie würden das Wissen, das sich hier fand, aus den Klauen des gierigen Tyrannen und seiner Verbündeten reißen. Shinja kannte die geheimen alten Stiegen und Gänge, auf denen sie entkommen würden.
Noch einen letzten Blick warf sie auf den Stein, den sie verloren hatte. Wenn Gama ihn mitgenommen hatte, musste er wertvoll sein! Dann fügte sie sich. »Ja, Meisterin.«
Sie riss sich los und sah den gewaltigen geschuppten Drachenleibern entgegen, welche die Halle von drei Seiten einfassten, und deren Schädel in der Kuppel aneinander lagen. Glitzerndes Grün und schimmerndes Türkis in einer Halle, in der selbst ein Tyrann nur ein Insekt darstellte, krabbelnd unter so viel uralter Würde.
Doch dann wurde das marmorne Tor aufgestoßen, das jeden Laut von draußen gedämpft hatte. Der Mechanismus schnarrte und ächzte.
Zugleich waren auch im verborgenen Nebengang, den Shinja und ihre Meisterin als Eingang genutzt hatten, schwere Schritte zu hören. Sie waren entdeckt – doch zu früh, viel zu früh!
»Lauf!«, presste Gama hervor, und Shinja gehorchte.
Kapitel I – Der Tag der Schlangen
Ihr Raum lag in der Zeit verborgen.
Während sie die Zeit verstreichen sahen, wurden sie so vieler Tragödien Zeuge. Manchmal versuchten sie zu lenken, doch meist waren die Wesen dort draußen zu zerbrechlich, um ihrem Griff standzuhalten.
Es gab nur noch wenige Stellen, an denen die Wände der Zeit dünn genug waren. Orte, an denen Großes geschehen war oder Großes noch geschehen würde, und manches davon sah für die Menschen, die nun dort lebten, gering aus. Das Große lauerte an den Grenzen aller Zeitalter und trachtete danach, die Welt zu formen. Götter, Dämonen, Urkräfte und die großen Schicksale der alten Völker, die längst gegangen waren, obwohl sie sich für unsterblich gehalten hatten.
Die vier großen Alten vertrauten darauf, dass alles sich klug fügen würde. Alles, vom Anbeginn ihres Exils auf der anderen Seite der Zeit bis zu seinem Ende, an dem sie vielleicht wieder in die Welt hineintreten konnten. Meist vertrauten sie darauf, dass es irgendwann zu Ende gehen würde, dass die letzte Tragödie, die sie sehen würden, ihre eigene war, ein klug- und wohlgedichtetes Stück, das ihre uralten Götter zum Lachen und zum Weinen brächte.
Doch sie wussten nicht, wann es so weit sein würde.
Yagheer saß am Ufer des Barun-Ulah. Die Feste Krak Yerkesh, die Beständige, die Ewig-Erhabene, erahnte er in seinem Rücken. Die alabasternen Türme, die schlammfarbenen Mauern, die farbenfrohen Mosaike um die Tore hatten sich im hintersten Winkel seines Geistes niedergelassen und wollten ihn nicht loslassen.
Fliegen müsste man können, wie Anzud, der den ganzen Tag noch nicht zurückgekehrt war.
Yagheer hielt den Falken nicht wie ein Jagdtier, nicht mit einer Haube über dem Kopf auf einer Stange festgebunden. Anzud war frei und konnte kommen und fortfliegen, wie es seinem stolzen Gemüt beliebte.
Yagheer war vor weniger als einem Jahr aus Khunchom gekommen, und was ihn von dort vertrieben hatte, war nicht die Unrast gewesen, die jedem Priester des Avesha innewohnt. Bei Teilen der Strecke konnte er ohne zu übertreiben sagen, er sei um sein Leben gerannt.
Keiner in Yerkesh trachtete danach, seinen Kopf auf die lange Lanze eines Kataphrakten, eines Panzerreiters, zu spießen. Und doch wünschte er sich, der Ewig-Erhabenen den Rücken kehren zu können. Sein Dienst im Blütentempel des Avesha jedoch war noch nicht beendet.
Aber der Dienst an Avesha ist nicht das Ausharren in einem Tempel, flüsterte es in ihm, während er auf den trägen Barun-Ulah starrte, dessen in den Tiefen der Mitte saphirblaues Band an den Ufern von einem schlammigen Saum eingefasst wurde. Ein einzelner Flamingo stakste im Matsch herum, ungesehene Vögel zirpten müde aus den Büschen.
Yagheer starrte in den beinahe weißen Himmel, bis seine Augen tränten. Wo war Anzud?
Er seufzte und ließ sich mit dem Rücken auf den staubigen Felsen sinken. Die Sommerhitze setzte sich auf sein verkatertes Gemüt wie ein Ifriit, der beschlossen hatte, ihn auszuhöhlen.
Als Fata Morgana in seinem Geist beschworen sich die Bilder der letzten Tage aus dünner Luft. Der letzten Wochen, Monate. Tagsüber umgetrieben von den Gedanken der Nächte – Träume, wenn er schlafen konnte, Rachegedanken, wenn er es nicht konnte. Abends die Linderung bei Wein oder Stärkerem. Und morgens die Fragen, ob es Avesha war, der ihn rief, ob es bloßes Sehnen war, dem er seine Unrast verdankte, oder ob er auf Rache sann. Rache für Khunchom?
»Anzud«, murmelte er schläfrig und mit einem Gefühl der Taubheit in Nacken und Hinterkopf in die Sonnenhitze. »Du Bastard von einem Vogel! Ich hoffe, du bringst mir wenigstens eine Schlange heim.«
Heim. Das Wort war so dahingesagt, doch nun blieb es lange in der Luft stehen. Insekten summten. Yagheer wedelte mit der Hand.
»Großzügig nimmt der Herr der Weiten das Heim, um einem das Weit-fort zu geben. Du siehst mich in Dankbarkeit, Bruder Avesha. Gelangweilt. Ratlos, beizeiten. Aber dankbar.«
Yagheer schloss die Augen und fiel in einen Schlaf, der tapfer gegen seinen Restrausch ankämpfte.
***
Er döste traumlos und annäherungsweise erholsam, doch als er aufwachte, hatte die Sonne sich bereits so weit gesenkt, dass ihn fröstelte. Er stemmte sich auf die Unterarme. Seine Augen begannen sofort wieder, die frühe Abendluft nach Anzud zu durchkämmen, als hätte er sie nicht stundenlang ausgeruht. Er kam sich ein wenig dumm vor, als er den Falken plötzlich neben seinem Fuß bemerkte. Das Tier hockte auf dem Fels und legte den Kopf mit dem Bernsteinauge schief, als sei es sich nicht sicher, ob es lachen oder verzweifeln solle.
Yagheer war sich auch nicht sicher.
Er fühlte sich hohl. Ein Teil von ihm war froh, dass er einfach nur seinen Rausch hatte ausschlafen können. Ein anderer Teil fragte sich, warum er in diesem Schlaf keine Stimmen gehört hatte, warum er nicht wieder in den Höhlen gewesen war, in denen man ihn rief.
Ihn. Denjenigen, der die flüsternden Stimmen vor dem Fallen bewahren wollte.
Sie brauchen mich. Wer auch immer sie sind.
Nachdem er dem belustigt-tadelnden Blick von Anzud lange genug standgehalten hatte, sah er über die schattigen Hänge, auf denen sich der Staub, der Sand und der feine Dunst der vom Barun-Ulah angeschleppten und von der Sonne ausgedörrten Erde auf dem weißen und grauen Kalkstein der Satrapengräber ablegten. Von dort aus sahen die Toten auf den Barun-Ulah hinab. Auf Krak Yerkesh. Auf ihn, Yagheer ibn A’fRyad, Tulamide unter Haranijas. Khunchomer in der Stadt der Yerkisani, Priester des Avesha. Sohn des Sheikh A’fRyad ibn Yagheer, des Obersten Koptha der Kopthanim des Diamantenen Sultanats. Und tot ohne prunkvolles Grab.
Yagheer stand mit einem bitteren Ruck auf. »Lass uns gehen, Anzud.«
Er schlang die Arme um sich, rieb über seine kalten Unterarme. Das Tuch, das ihn vor der Sonne schützen sollte, entrollte sich auf seinem Kopf, er griff danach und schlang es wieder so, wie es sein sollte. Er steckte es mit der silbernen Feder fest, die er als Nadel benutzte.
»Ich träume von einer Höhle, etwas Unterirdischem«, sagte er zu Anzud gewandt und hob die Hand, als er den Turban fertig gebunden hatte. Der Falke schwang sich mit einigen faulen Bewegungen in die Luft und landete mit flatternden Flügeln und raschelnden Federn auf Yagheers vernarbtem Unterarm.
»Eine Höhle. Das ist nicht gerade die Gegend, in der du dich herumtreibst. Aber sag, Anzud, mein Auge in der Höhe, Glanz der Sonne: Wohin fliehen die Schlangen, wenn sie dir entkommen wollen?«
Er wandte sich zu den Satrapengräbern um, deren Pforten in den Höhen um seine Aufmerksamkeit wetteiferten. »In die Gräber?«
Er drehte sich weiter, bis sein Gesicht endlich wieder Yerkesh zugewandt war, das er den ganzen Tag gemieden hatte. Der gewaltige sandsteinerne Festungsbau, zu seinen Füßen die weiß getünchten Wohnhäuser, verschachtelt aufeinander und ineinander wie das Spielzeug eines Djinnenbaumeisters. Der Zwiebelturm des Aveshatempels ragte hinter den Mauern des uralten Krak auf.
»Kein toter Satrape will, dass ich ihn rette. Die Antwort auf meine Träume ist entweder in Yerkesh oder ganz woanders, Sohn der Sonne«, teilte er seinem Falken mit. »Zeig mir, wo sich deine Beute verkriecht!«
Anzud erhob sich, kurz stieß er sich mit seinen Krallen in Yagheers Arm ab, doch er war schon vorsichtiger geworden in den Jahren, in denen sie einander Gefährten waren. Yagheer straffte die Schultern und folgte dem Schatten des Vogels, der über Felsen, Gras und in der Sonne getrocknetem und aufgerissenem Schlamm auf Yerkesh, die Beständige, zu eilte.
***
»Und dies ist meine Tochter Yilia.«
Yilia erkannte die Stimme ihres Vaters kaum wieder. Normalerweise war befehlsgewohnt noch das Charmanteste, das man über den dröhnend-herrischen Bass des Familienoberhauptes der Cadicier sagen konnte. Doch nun hauchte er geradezu, er säuselte, und das Ergebnis war, dass sich zwei kohlschwarze Augen auf sie richteten. Sie waren unnatürlich schwarz, doch Yilia begegnete dem mit Gelassenheit. Dass er sich die Augäpfel färbte, war eine eher harmlose Geschichte im Gegensatz zu den anderen, mit denen man sie im Vorhinein vor Dalek-Horas Secundus hatte schrecken wollen.
Es war sicherlich zum einen der Neid gewesen, der aus ihren Freunden gesprochen hatte. Zum anderen war Yilia nach dem, was sie bisher im Palast des Herrschers gesehen hatte, geneigt zu glauben, dass ein Gutteil davon der Wahrheit nicht annähernd gerecht wurde.
Die schwarzen Augen starrten sie an, ohne zu blinzeln. Sie entgegnete den Blick versehentlich länger als einen Wimpernschlag, bevor sie bemerkte, dass ihr Vater ihre Hand schmerzhaft drückte. Sie kniete rasch nieder, senkte den Kopf und starrte auf Dalek-Horas’Schuhspitzen. Wie seine ganze Erscheinung waren auch sie heute von einem beinahe glänzenden Schwarz. Der Saum des Gewands verbarg den Rest seiner Füße. Aus den Augenwinkeln bemerkte sie, wie er mit den Fingern einer behandschuhten Hand zuckte. Eine winzige Geste nur, doch sie bedeutete wohl, dass sie sich wieder erheben durfte. Sie hielt den Blick nach wie vor gesenkt. Das Gesicht des Horas konnte sie ohnehin nicht mustern – er verbarg alles außer seinen Augen hinter einer geschwärzten Silbermaske, aus der menschliche Züge herausgearbeitet waren. Sein Haupt umgab eine schwarze Kapuze, darauf ruhte ein ebenfalls geschwärzter Lorbeerkranz.
Dalek-Horas Secundus’ Diener senkte nun ebenfalls den Kopf, und der höchste Herrscher der bekannten Welt wisperte etwas hinter seiner Maske.
»Dalek Secundus, Horas und Heliodan, möchte deiner Tochter Komplimente zu ihrer hübschen Erscheinung machen und ihrem freundlichen Benehmen.«
Yilias Vater zuckte zusammen, sie sah es aus den Augenwinkeln und erstarrte. Der Horas hatte also den zu langen Blick in seine Augen bemerkt. Der Sklave war ebenfalls schwarz, bis auf einen langen Schurz und eine breite Schärpe war es jedoch seine Haut, die den Gewändern des Horas’ Konkurrenz machte. Er fuhr fort, ohne dass sein Herrscher weitersprach: »Der Horas wünscht ihr einen fruchtbaren Leib, und der Heliodan einen scharfen Geist, auf dass das Geschlecht der Cadicier noch lange überdauere.«
»Ich danke für des Horas’ großzügige Worte«, hauchte Cadicius, und Yilia wusste nicht, ob auch hinter diesen Äußerungen eine versteckte Bedeutung lauerte.
»Yilia Cadicia, der Horas wünscht sich, von dir zu erfahren, wie du ihm dienen willst.«
Sie hob den Blick nicht. Noch einen Tadel würde ihr Vater nicht verkraften, dessen Gesicht trotz der Schichten aus weißem Puder bereits auffällig gerötet war.
»Ich will meinem Herrn dienen, dem Horas und Heliodan, indem ich mich zur Vorbereitung auf eine Tätigkeit in der Curia als Militärtribunin anbiete.«
Der Horas lachte kurz. Affektiert, so hätte sie es genannt, wenn einer ihrer Freunde auf diese Weise gelacht hätte. Der Sklave ließ sich nicht davon irritieren, seine marmorweißen Augen mit den schwarzen Pupillen und Iriden lagen ruhig wie Steine auf ihrem Gesicht. Seine Haut glänzte wie der Stoff, den der Horas um seinen Körper geschlungen hatte.
Den Sklaven um des Horas’ Körper geschlungen haben, korrigierte sie sich.
»Hast du dich darauf vorbereitet, als Tribunin zu dienen, Yilia Cadicia?«
»Ich habe die Schriften studiert. Vergangene Kriege. Taktiken.«
Erneut beugte sich der Sklave zu seinem Herrn herab, erneut wisperte Dalek-Horas hinter seiner Silbermaske.
Der Sklave richtete sich wieder auf, musterte sie, doch die Worte seines Herrn schienen nicht an Yilia gerichtet zu sein. Der Horas zuckte erneut mit seinen Fingern. Yilia verbeugte sich noch einmal tief in Ermangelung eines eindeutigeren Ratschlags von ihrem Vater und zog sich dann vom Podest des Throns zurück.
Ihr Vater ging so nah neben ihr, dass sie an ihrem Arm spüren konnte, wie sein Brustkorb sich im Rhythmus seines Atems hob und senkte. Er schwieg, und sie schwieg, doch der große Saal war voller Gemurmel, das sie zuvor nicht wahrgenommen hatte. Hinter ihr stieg ein hagerer Mann mit olivfarbener Haut die Treppen hinauf und kniete ebenfalls oben nieder. Der Horas empfing ihn offenbar nur für die Bruchteile eines Augenblicks, denn danach wandte der Mann sich wieder ab und holte Yilia und ihren Vater am Fuße der Treppe beinahe ein.
Legata Liphia winkte sie zu ihrer kleinen Gruppe von Altgedienten hinzu. Yilias Vater straffte sich, atmete durch und nahm das Angebot an. Yilia blieb einfach an seiner Seite. Sie fühlte sich, als habe sie vor Aller Augen eine gewaltige Dummheit begangen, doch erleichtert stellte sie fest, dass es niemand bemerkt zu haben schien. Keiner hatte seine Blicke auf den Horas gerichtet, gebannt folgte jeder seiner eigenen kleinen Unterhaltung.
Legatin Liphia führte seufzend ihr kristallenes Glas mit Wein an ihre Lippen, der so dunkelrot war, dass er den farblichen Vorlieben des Horas’offenbar genügte. Yilia rief sich in Erinnerung, was sie über die Legata wusste: Was an Soldaten aus Cuslicum mit ihr nach Bosparan zurückgekehrt war, konnte man eher als Manipel denn als Legion bezeichnen. Liphia selbst schien sich jedoch noch guter Gesundheit zu erfreuen, doch die Narben, die ihren Körper unmissverständlich zeichneten, ließen keinen Zweifel daran, dass sie sich an Gefechten zu beteiligen pflegte. Sie trug eine kurzärmlige Tunika unter ihrer Toga, sodass Yilia die Muskeln ihrer Oberarme sehen konnte. Die Unterarme waren von bronzenen Schienen bedeckt, dem einzigen Zeichen ihrer militärischen Tätigkeit.
Militärtribunin, spottete eine Stimme in Yilia. Jemanden wie Niria Liphia beraten, als bräuchte jemand wie sie meinen Rat!
Unangenehm berührt trat sie von einem Fuß auf den anderen. Der schwarze Blick des Horas’ schien noch auf ihrem Scheitel zu brennen. Doch vielleicht war es auch nur das grelle, magische Licht, dass den Horas in der Kuppel der Palastaula erfreute. Nur von den Wänden getragen ragte die Kuppel auf, und gleißende Linien zeichneten dort oben die Sternbilder über das Haupt des Herrschers.
Diese Leute brauchen mich nicht …
»Vierhundertsiebenundachtzig«, seufzte Danuvius gerade, der sich auf seine alten Tage noch einmal als Praetorianer verpflichtet hatte. Es war jedoch in seinem Falle mehr ein Ehrenamt, und so musste er sich nicht in die Reihe aus vierundzwanzig Purpurmänteln einreihen, die die hohen Stufen zum Thron des Horas’flankierten. »Wer ist vorher schon mit vierhundertsiebenundachtzig Überlebenden und der Nachricht eines verlorenen Feldzeichens zurückgekehrt und durfte sein Kommando behalten?«
»Wüsste ich nicht, dass sich hinter deinen harten Worten Freundlichkeit verbirgt, wäre ich nun unglücklich, Danuvius«, spottete Liphia. »Glaube mir, meine Ehre ist unbeschmutzt. Diese Torwjalder sind wie Daimonen. Der Horas und Heliodan weiß, dass er meine Expertise noch benötigt. Oder will er jedes Legatenkommando an unerfahrene verwöhnte Gören übergeben?«
Sie sah Yilia nicht an, doch diese wurde trotzdem rot. Konnte sie wissen, dass sie dem Horas – statt fruchtbar und gescheit zu sein – soeben ihre Hoffnung offenbart hatte, in den Stab einer Legion erhoben zu werden?
Ihr Vater drückte Yilia eines der Gläser in die Hand, die ein erstaunlich weißhäutiger Sklave den Gästen offerierte. Auch dieser Mann trug nur Schurz und Schärpe, beides in hellem silberdurchwirktem Leinen. Seine Haut war mattgepudert, und Yilia begann sich zu fragen, was diese Vorlieben des Horas’ für Schwarz und Weiß zu bedeuten hatten.
Etwas, das ich nicht verstehen kann. Weil mir kein göttliches Blut in den Adern fließt. Weil kein Ucuri-Funke meine Seele zum Leuchten bringt.
Das Blut der Cadicier reichte ihr vollkommen. Gerade im Moment färbte es ihre erhitzten Wangen vermutlich hellrosa. Und wenn sie eines anhand der gold und silber gleißenden Dekoration des Raumes und der Kleidung der Sklaven ahnte, dann dass diese lebendige Farbe wohl nicht das Wohlgefallen des Horas fand.
»Er könnte den militärischen Oberbefehl in den Kernlanden zurück an diese Shinxirbande geben«, knurrte Sacerdos Dalius, Hohepriester der Rondra, mit dunkler Vorahnung in der Stimme. Ihn kannte Yilia gut, wenn es auch umgekehrt vermutlich nicht der Fall war. »Sich überlegen, dass ihre Taktiken gegen die Unbeherrschtheit dieser Barbaren besser geeignet sind. Zumal ja mehrere Manipel der Agmen Rondrae und der Cuslicana die Achte im Süden unterstützen sollen. Im Dschungel gegen Wilde, Moskitos und den Durchfall kämpfen.«
Alle in der Runde, die sich weder Tischen noch Stühlen noch Liegen bedienen konnte, denn niemand außer dem Horas durfte sitzen, warfen einen Blick zum Kopfende der Aula und dem Thron, der ganz in Schwarz am Ende der Stufen aufragte. Yilia biss sich in die Wange, um nichts Altkluges zur Stellung der Legionen zu sagen. Eine Seite von ihr wollte beweisen, dass sie sich zu Recht als Tribunin vorgeschlagen hatte.
Nein. Ich will schweigen!, rief sie sich zur Ordnung. Die Blicke der Altgedienten in der Runde ihres Vaters galten nicht dem Horas, bemerkte sie nun. Sie waren an den Treppenstufen abgeglitten und hatten sich auf den Mann mit der olivfarbenen Haut geheftet, der hinter den Cadiciern zum Thron des Herrschers’ aufgestiegen war. Er stand nun am Rande des Mosaiks, das das bosparanische Imperium in der Mitte der Halle abbildete. Ein wettergegerbter Mann, dessen sauber getrimmter Bart und militärischer Haarschnitt von den weißen Sprenkeln der zweiten Lebenshälfte durchzogen waren. Seine Augen lagen tief in den Höhlen, die Haare der Augenbrauen standen ein wenig unaufgeräumt ab.
Liphia seufzte theatralisch. »Dolokanes Chaerea«, sagte sie dann, und ihre Stimme troff vor Spott. Sie trank ihr Glas aus. »Stets voller Hoffnung.«
»Das ist Chaerea?«, fragte Yilia leise, und ihr Vater schoss erneut einen warnenden Blick zu ihr hinüber, als befürchte er, sie würde etwas Dummes von sich geben.
»Das ist er. Ach, hätte er doch endlich das Kommando einer verdammten Legion! Am besten der Shinxiria. Er könnte sie in den Untergang führen, selbst dabei draufgehen und aufhören, uns mit seiner ständigen Anwesenheit zu belästigen!«, scherzte Danuvius.
Chaerea belästigte jedoch nicht. Sein Blick schweifte durch den Raum, über funkelndes Gold, glänzendes Schwarz und mattes, silbergesprenkeltes Weiß. Die Sklavinnen, die wie Statuen standen oder kauerten und als lebende Tische dienten, trugen das Gold als Puder auf ihren Gesichtern, ihre Perücken lagen wie Goldhelme um ihre Köpfe. Die männlichen Sklaven, meist dunkelhäutig oder weiß gepudert, huschten herum, und einer von ihnen eilte sich, Liphias Glas durch ein volles auszutauschen.
In all dieser fremdartig-geometrischen Pracht sah Chaerea seltsam verstaubt aus. Er wirkte wie jemand, dem niemals der Legatsposten für eine Legion angeboten werden würde, egal, wie lange er am Rand des Mosaiks stand und so tat, als sei er ein etwas heruntergekommenes Überbleibsel einer vergangenen Feierlichkeit, das vergessen worden war.
»Wo ist die Shinxiria stationiert?«, fragte Yilia, nun trotz des Blicks ihres Vaters ermutigt, am Gespräch teilzunehmen.
»An der falschen Grenze, offensichtlich. Ich wäre unserem erlauchten Horas und Heliodan und seinen werten Strategen zu größtem Dank verpflichtet, wenn er dieses Relikt aus der Vorzeit einmal gegen die Torwjalder entsenden würde«, sagte Liphia scharf, und die Männer und Frauen um sie herum sahen sie erstaunt und ein wenig betroffen an. »Nun? Ängstigt euch meine Ehrlichkeit?«, fragte sie in die Runde. »Manche von euch haben das Ohr des Horas. Criffus, mein Guter – die Provinzen versinken im Chaos, aber warum soll die Shinxiria sich dort verausgaben, wenn doch das Chaos von Westen, vom thalassischen Meer droht? Was nutzt es, Legionen in alle Himmelsrichtungen auszuschicken, nur nicht den Torwjaldern entgegen? Wenn wir dieses verdammte Großreich nicht halten können, dann wären wir doch wohl gut beraten, zumindest die Teile zu schützen, die uns am wichtigsten sind.«
Stille trat ein und Yilia hielt den Atem an. Dies war keine Stille, die sich nur über die Runde der zusammengesteckten Köpfe gelegt hatte. Liphias Stimme war im Zorn laut geworden, und alle Gespräche um sie herum waren verstummt, um wenigstens dem letzten Satz andächtig zu lauschen. Dalek-Horas Secundus saß aufrecht auf seinem Thron am Ende der großen, säulenlosen Halle. Sein Blick schnitt quer durch den Raum. Liphia erkannte ihren Fehler und hob stolz ihr Kinn, um dann den Rücken zu beugen.
»Dalek Zweiter seines Namens, Horas und Heliodan, wünscht, dass du diese Worte wiederholst«, forderte der Sklave an Daleks Seite. Liphia atmete hörbar ein und straffte sich dann wieder.
»Zu viele Legionen sind ausgesandt, um die Grenzen zu beschützen, Gebieter aller Lebenden! Doch Bosparan liegt am Yaquiro und die Torwjalder werden ihn früher oder später hinauffahren, denn das Juwel des Reiches strahlt ihnen hell entgegen.«
»Woher nimmt Legatin Liphia, die doch sicherlich Torwjalder erschlagen hat, ohne ihre Gedanken zu lesen, diese Gewissheit?«, fragte der Sklave ohne eine Regung in seiner Stimme.
»Dies entspricht dem Wesen der Torwjalder! Sie plündern an den Küsten, sie überfallen die Städte in den Buchten und die Fischerdörfer an den Mündungen der Ströme. Dann dringen sie weiter ins Umland vor. Was ihnen dort gefällt, bringen sie auf ihre Schiffe. Was ihnen nicht gefällt, brennen sie nieder. Und wenn sie gehen, dann nehmen sie nicht nur alles von Wert mit – sondern auch das Wissen um Wege, Flüsse und Siedlungen. Sie ziehen sich aufs Meer zurück, um wiederzukommen.«
»Und die Orks in Garetia? Die Alhanier? Die Tulamiden, die uns mit ihren aus dem Süden kommenden Menschenströmen Yaquiria Superior abspenstig machen wollen?«, fragte der Sklave, ohne dass der Horas sich regte.
»Sollen wir zulassen, dass die Tulamiden uns überrennen? Weil wir uns auf diese plündernden Narren aus Torwjald konzentrieren?«, rief der beleibte Grachus Petronimus, ehemaliger Stadtpraefectus, dessen Militärerfahrung nun auch schon einige Jahrzehnte zurücklag.
»Aber diese plündernden Narren können direkt von den Insulae Cyclopae zuschlagen!«, rief Liphia zu ihrer Verteidigung. »Und drei Legionen sind in Garetia verstreut!«
»Zwei sind an den Küsten im Süden«, ergänzte ein Tribun hilfsbereit.
»Eine wurde gerade unter deinem Kommando aufgerieben, Legatin Liphia«, zählte der Sklave weiter.
»Das weiß ich. Ich habe Glück, dass ich hier sein darf, um euch zu warnen!«, gelang es Liphia, diese Tragödie halbwegs zu ihren Gunsten zu biegen. Der Sklave schloss kurz die Augen und beugte sein Haupt zum Horas hinab. Yilia konnte nicht feststellen, ob der Horas seinem Diener irgendetwas mitteilte.
Vielleicht kann der Waldmensch Gedanken lesen!, durchfuhr es sie. Oder hinter der Maske des Horas’ ist gar nicht der Horas verborgen. Der irrwitzige Gedanke, der Sklave könne der Horas sein und der Horas der Sklave, fesselte sie für einen Moment. Gleichzeitig überkam sie die Angst, der Sklave könne eben diesen Gedanken in ihrem Kopf lesen.
»Legata Liphia wird gebeten, ihr Wissen von nun an bei der Administration des Castrum Baliirum zugutekommen zu lassen. Dann wissen wir Bosparan unter ihrem Schutz.«
»Was?«, fragte Liphia entgeistert, fasste sich dann jedoch und korrigierte sich: »Verstehe … ich das richtig, dass mich der Horas von … meinem Kommando entbindet?«
»Das ist korrekt, Niria von den Liphiern.«
Yilia riss ihren Blick vom Thron und den beiden schwarzen Gestalten los und musterte Niria, die hart schluckte.
»Ich … ich danke dem Horas für meine neue … meine Position.«
»Der Horas nimmt deinen Dank zur Kenntnis.«
»Darf … darf ich fragen, ob meine, ich will sagen, die Legio VI … ob sie neu ausgehoben wird?«
»Der Horas und Heliodan befindet, dass eine Legion, deren Feldzeichen verloren ist, aufgelöst werden muss. Doch dein guter Rat, Liphierin, sei angenommen. Die Shinxiria wird zum Schutz der Stadt zurückbeordert.«
Yilia fragte sich, ob dies alles der Sklave entschied – ob wirklich niemand die Strategen und den obersten Sacerdos des Rondrakults in dieser Angelegenheit befragte.
»Wir werden noch im Laufe dieses Festtags überlegen, wer vertrauenswürdig genug ist, dass er in den Führungsstab der Shinxiria erhoben wird. Der göttliche Vater unseres Horas’befand, dass sie die Kernlande niemals wieder betreten darf.« Der Sklave schloss mit einem langen Blick auf Liphia. Yilia bemerkte, dass beinahe alle, die mit Liphia gesprochen und getrunken hatten, von ihrer Seite gewichen und in den Hintergrund getreten waren. Dann jedoch hob er noch einmal an. »Doch so sei es nun. Der letzte Rat von Legatin Liphia sei hiermit angenommen.«
Einer der vier Capites der Praetorianer, der Leibwächter des Horas, schlug mit seinem Stab auf den Boden als Zeichen, dass die Feier weitergehen sollte. Liphia hob ihren Kopf, ihre Kiefer arbeiteten.
Yilia glaubte, sie würde nun einfach aus dem Raum stürmen. Die Götter wussten, dass sie an Liphias Stelle genau das getan hätte. Tatsächlich hatte sie es noch getan, im vergangenen Jahr, als ihr Vater ihre Verlobung mit Trestos Fabricius bekanntgegeben hatte, ohne sie vorher davon in Kenntnis zu setzen.
Doch das Oberhaupt der Liphierfamilie war kein kindisches Mädchen. Die ehemalige Legatin ertrug die Blicke mit allem Stolz, den sie noch in sich trug. Er drang ihr aus jeder Pore, und niemand wagte es, das Wort an sie zu richten.
Gesprächsfetzen trieben an Yilia vorbei, die nicht anders konnte, als die ehemalige Legatin von der Seite anzublicken und zu hoffen, dass diese ihr Starren nicht bemerkte. Nervös ordnete sie ihre Haare, die sie erst seit einem Tag kurzgeschnitten trug, weil ihr Vater gewünscht hatte, dass sie sich dem Horas als jemand vorstellte, der für eine militärische Position geeignet war – und das sollte sich auch in ihrem Äußeren widerspiegeln.
»Nun denn«, seufzte Yilias Vater. »Wenn die Fünfte zurückkehrt, hat Dolokanes Chaerea wohl doch noch die Gelegenheit, zu einem Kommando zu kommen.«
»Chaerea?«, fuhr Liphia herum, ihre Stimme kaum unter Kontrolle. Yilia sah aus den Augenwinkeln, dass der altgediente Soldat erstarrte, als er seinen Namen hörte. Yilias Vater hob beschwichtigend die Hände, doch Liphia war nicht mehr zu bändigen. Ohnehin schon ihres Kommandos enthoben, schien sie sich auch aller gesellschaftlichen Konventionen zu entledigen. »Chaerea! Ja, holt die Unruhestifter von der Shinxiria zurück! Macht Chaerea zum Legaten! Davon träumt er schon, seit seine Sandalen durchgelaufen sind und er kein Geld für neue hatte! Ha! Bevor ihr Chaerea einen Legatsposten gebt … nehmt doch … nehmt doch Cadicius’ verwöhntes Gör!«, schrie sie und zeigte mit dem Finger auf Yilia, die zurücktaumelte, als wäre der Fingerzeig das Geschoss einer Arcoballista.
Yilia hörte ihren Vater etwas rufen, Sacerdos Dalius versuchte, mit seiner an große Hallen gewöhnten Stimme dazwischen zu donnern, und bei den anderen Grüppchen aus Militärs und Comites brach Tumult aus. Erst als die Capites der Praetorianer die metallenen Enden ihrer Stäbe gleichzeitig auf den Marmorboden sausen ließen, kehrte Ruhe ein. Die Ruhe eines angespannten Wespenschwarms, der jeden Moment zum Angriff übergehen würde.
»Der göttliche Horas und Heliodan Dalek Secundus Invictus«, schrie der Sklave als Sprachrohr seines Herrn, »bestimmt zum Stab der Shinxiria, die Bosparan beschirmen wird, Dolokanes Chaerea als Militärtribun!«
Yilias Kopf fuhr zu Chaerea herum. Dieser presste die Lippen zusammen, Schweiß stand auf seiner Stirn, als sich Aller Augen wie unerträglich heiße Lampen auf ihn richteten. Yilia wusste, dass er schon in mehreren Legionen als Tribun gedient hatte, immer unter mächtigeren Männern und Frauen.
»Und zum Legaten der Shinxiria, um die Legionäre unter dem Zeichen der Hornisse zu befehligen, bestimmt seine Göttlichkeit Dalek-Horas Secundus Yilia Cadicia, auf persönliche Empfehlung der Niria Liphia.«
Die Stille, die sich senkte, war weder Betroffenheit noch Gehorsam. Es war Fassungslosigkeit. Yilia rang nach Luft, doch der Raum hätte ebenso gut mit Wasser gefüllt sein können. Sie stolperte einen Schritt zurück, und ihr Vater packte ihren Oberarm.
»Du wirst jetzt nicht den Raum verlassen«, zischte er in ihr Ohr. »Du wirst dich für diese große Ehre bedanken!«
Die entsetzten Blicke schienen Yilia zu würgen, doch ihr Vater schob sie unbarmherzig zu den zwölf steilen Stufen, die zum Thron des Horas’hinaufführten. Auch diesmal begegnete sie dort Dolokanes Chaerea, der sie mit einem Ausdruck ansah, als erwäge er, sie hier und jetzt zu ermorden. Sie fühlte sich klein und schmal neben ihm.
Wie eine Greisin, mit rasselndem Atem unter den Augen der versammelten Menge, mühte sie sich die Treppen hinauf und sank vor Dalek dem Zweiten auf die Knie. Ihr entging nicht, dass der Blick des Horas auf Niria Liphia geheftet blieb, statt sich ihr zuzuwenden.
Shinja rannte.
Sie hielt die Schriftrollen, die Pergamentstapel, das hölzerne Kästchen und das gewebte Tuch an sich gepresst; alles, was ihre Meisterin im Tempel ausgewählt hatte.
Ausgewählt, um es zu stehlen, dachte sie, und nun würden sie die Strafe dafür zahlen. Shinjas Meisterin hatte lange Zeit gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Zu lange.
Als der Tyrann Amagomer an die Macht gekommen war, hatte er die Zauberpriesterinnen, die sich nicht auf seine Mutter einschwören ließen, hingerichtet. Nichts war ihm heilig. Er war ebenso brutal vorgegangen wie die Invasoren, die einst aus dem fernen Bosparan gekommen waren, und vor Jahrhunderten bereits zum ersten Mal die Priesterinnen der schlangengestaltigen Heshinja verbrannt hatten.
Amagomer war jedoch ein noch ruchloserer Mann, ein Mensch ohne Gewissen – es gehört mehr dazu, das eigene Volk abzuschlachten als ein fremdes.
Gama hatte stets Kontakt zu den versteckten Frauen im Umland gehabt. Doch erst im letzten Jahr hatte sie beschlossen, dass die Zeit gekommen war, in der auch sie sich zu diesen wahren Hüterinnen von Heshinjas Wissen bekennen musste – zu jenen, die geflohen waren und sich versteckt hielten und noch immer Mädchen so unterrichteten, wie es Tradition gewesen war, als die Königinnen über Alhanien regierte.
Doch bevor sie floh, wollte Gama in Bey-el-Unukh zusammenraffen, was von größter Bedeutung war, und dieses Wissen in Sicherheit bringen. Shinja würde ihr loyal beistehen, denn das war es, was eine Schülerin tun sollte.
Durch das Tor waren Soldaten gestürmt, gekleidet in die Schuppenrüstung und die tropfenförmigen Helme der Nurbadi. Auch durch den Seiteneingang, durch den sich Gama und Shinja in die altehrwürdige Halle der Drachen gestohlen hatten, donnerten nun Stiefeltritte. Jemand schrie, dass sie anhalten sollten.
Dann schnalzte eine Bogensehne und ein Pfeil zerbarst an der Säule über Shinjas Kopf – ohne Zweifel ein Warnschuss.
Ihre Meisterin zog sie hinter jene Säule und zumindest für den Moment in Sicherheit. Sie sah Shinja an, das Gesicht wie aus Schatten gemeißelt, und flüsterte: »Zu spät, um in die Katakomben zu steigen …«
In den Katakomben der Halle der Drachen lag altes Wissen, so kostbar, dass es nie von dort wegbewegt werden sollte. Die Priesterinnen kamen zum Studieren hier hinab. Gama hatte entschieden, diesen Frevel zu begehen, das alte Wissen zu bergen, nur um vorher aufgehalten zu werden!
Mit fliegenden Fingern entledigte sie sich ihres langen Umhangs, den sie an der Schulter gefibelt hatte, und wickelte die Last der Bücher, die sie aus dem Tempel gestohlen hatte, und das Diebesgut ihrer Schülerin darin ein. »Nimm das.«
»Was? Warum ich?«
»Weil du schwerer tragen kannst als ich«, sagte Gama, doch Shinja erkannte die Lüge. Ihre Meisterin packte sie an der Schulter. »Los!«
Die kolossalen Drachenstatuen lagen wie lebende Wesen in der Halle. Eine mannshohe Tatze verbarg Shinja vor den nächsten Pfeilen, als der Oberste der Nurbadis den Befehl gab, die Frevlerinnen aufzuhalten. Die Spitzen der Geschosse barsten an den goldenen Drachenschuppen. Nur schaukelnde Lampen hatten die Krieger mitgebracht. Die Kuppel war von einem seltsamen Glanz erhellt, der bis hier hinabtroff. Mehr Licht gab es nicht in der Halle, und die Dunkelheit war eher für Fliehende als für ihre Verfolger von Vorteil. Shinja stolperte beinahe über eine gespreizte Kralle, fing sich wieder und sah sich nach ihrer Meisterin um. Gama stand neben der Tatze des Steingeschöpfs und hob die Hände.
»Meisterin!«
Die Frau mit der scharf geschnittenen Nase sah sich nicht zu ihr um.
»Shinja«, sagte sie leise, und das Trampeln der Stiefel auf den Stufen hinauf zum Zentrum der Halle übertönten den Namen beinahe. »Du musst den einzigen Ausgang nehmen, den sie nicht bewachen. Ich komme nach. Ich bin bei dir.«
»Ich gehe nicht ohne dich«, sagte Shinja fest und drückte den Umhang der Meisterin mit dem Gewicht aus Pergament und Wissen an sich.
Ihre Meisterin wandte sich um, auf ihren Lippen erwachte das spröde, seltene Lächeln, das sich Shinja manchmal kaum noch vorstellen konnte, weil ihre Meisterin so lange nicht mehr gelächelt hatte.
»Ich bin überall bei dir. Wie Mokoscha bei ihrem Bienenschwarm ist. Lass mich Mokoscha sein.«
Shinja verstand das Bild, und weil jede Alhanierin es verstehen würde, wusste sie, dass es leichter fiel, zurückzulassen, als zurückgelassen zu werden. Sie schüttelte den Kopf und zog ihre Kraft aus ihrem Inneren. Mokoscha, die große Bienenkönigin, hatte ihr Volk mit ihrem Leib beschützt.
Aber hier in dieser Halle befand sich kein Volk, das Gama beschützen musste. Nur ein wenig staubiges Pergament und eine einzelne Schülerin. Sie dachte gar nicht daran, die Ältere gewähren zu lassen. Sie hatten zu wenig erreicht – es lohnte sich nicht, dafür zu sterben!
»Komm mit!«, schrie sie, und der plötzliche laute Ruf ließ die Nurbadi ihre Bögen ziehen und in ihre Richtung vorrücken. Die ersten Stufen von der Vorhalle in die große Halle sprangen sie mit großen Schritten voraus.
Shinja sah sich um, doch die gigantische Halle war düster bis auf ein waberndes Licht in ihrer Spitze und leer. In der Mitte des kavernenartigen Raums stand ein schmaler, schmuckloser Schemel. Zwei schmale Stiegen schlängelten sich an den leblosen, von schimmerndem Metall ummantelten Drachenleibern entlang in die Höhe zur Quelle des seltsamen Glanzes, der die Halle mit seinem diffusen Licht erfüllte.
Es waren nur noch wenige Schritte zur Stiege. Von dort ragten vielleicht einhundert Stufen in die Höhe, teils gedeckt von Dunkelheit und den verschlungenen Leibern, teils schutzlos und ohne Deckung. Doch Shinja und ihre Meisterin waren keine hilflosen Frauen, die von diesen schmalen Treppen geschossen werden würden.
Shinja hörte am leichten Zittern in der Stimme des Obersten der Nurbadis, dass auch er es wusste. Sie sah es in den dunklen Augen, die nun aufmerksam die Halle nach ihnen absuchten.
Diese Männer fürchteten, wozu die Priesterinnen der Heshinja fähig waren. Shinja zerrte diese Kraft durch die Angst, die sie zu lähmen drohte, aus ihrem Inneren. Sie würde sie lehren, dass diese Furcht vor ihrer Macht und der ihrer Meisterin gerechtfertigt war.
»Ich gehe nicht allein! Du musst mir den Weg weisen!«
Sie zog Gama am Arm, doch diese blieb standhaft, während Shinja zurückstolperte über die Klaue eines Drachen, der Stoff ihres Bündels glitt ihr durch die Finger.
»Du hast alle Wege auswendig gelernt, die aus diesem Ort und aus dem Tempel der Schlange herausführen«, sagte Gama ruhig und ohne sich umzudrehen. »Ich war die, die das Wissen sammelte. Und das habe ich getan. Den Weg musst du jetzt finden.«
Als Gama ihre Hände senkte, wurde auch Shinjas erhobene Hand nach unten gezogen wie von einem Zwang. Sie spürte den Widerstand – doch es war nicht sie selbst, die sich gegen die Einheit mit ihrer Meisterin zur Wehr setzte. Die Luft riss plötzlich heftig an ihren Armen. Sie stöhnte, während sie versuchte, Gama alle Kraft zu geben, die sie besaß.
Die Meisterin flüsterte Worte, die im Raunen des Windes unterging, der sich nun in der stillen Halle formte. Sie hob und senkte die Hände, peitschte das Element auf und goss es in die Gestalt, die sie sich wünschte. Dann stieß sie die Arme nach vorn, der Wind heulte in den Winkeln der Halle, um die Säulen herum und durch die Gliedmaßen der steinernen Drachenleiber.
Männer schrien. Shinja spürte, wie sie taumelte, als wolle der Wind auch sie mitreißen. Sie stemmte sich entschlossen dagegen, nach hinten – und fiel beinahe erneut hin, als der Widerstand hinter ihr nachließ. Die staubige, geheimnisvolle Luft in der Halle der Drachen wurde nach vorn gestoßen. Kurz rang sie nach Atem, aufgewirbelter Staub legte sich ihr auf die Augen und in die Kehle.
Gama wich nicht zurück. Mit dem Wind trat sie vor, hochaufgerichtet an der Spitze der Vortreppe, über den Leibern der gerüsteten Nurbadi, die nun auf den Stufen lagen und stöhnten.
»Du da«, sagte sie leise. »Töte deine Kameraden.« Dann wandte sie sich zu Shinja um und wies mit dem gleichen Finger auf sie, der soeben auch den Weg in den Geist des Kriegers geöffnet hatte. Shinja wollte sich dagegen wehren, doch sie spürte, dass ihre Verteidigung schwach war, dass sie zu viel Kraft in die Welle aus peitschender Luft gesteckt hatte.
»Und jetzt, jetzt wirst du laufen!«, schrie Gama, und als Shinja die Stiege hinaufrannte, wusste sie nicht, wie viel von ihrer Flucht Zwang war und wie viel blanker Überlebenswille.
Aviothea stand auf dem Kopf. Hrutgar stöhnte. Dass das erste Geräusch, das seinen Körper nach der vorigen Nacht verließ, dieses widernatürliche Stöhnen war, bewies ihm, dass es besser wäre, sich nicht zu erinnern, warum sie auf dem Kopf stand. Es konnte nur Schlechtes dabei herauskommen.
»Geht das heute noch weiter?«, fragte sie ungnädig, die Fäuste in die Hüften gestemmt. Der Gedanke durchfuhr ihn, dass nichts an ihr auf dem Kopf stand außer sie selbst. Ihr Haar lag in vier ordentlichen dünnen Zöpfen auf ihren Schultern und baumelte nicht nach unten. Ihr Kleid rutschte nicht an ihr hinab. Ihre Brüste, die größer geworden waren, noch bevor ihr Bauch sich gerundet hatte, sahen auch nicht so aus, als wollten sie der umgekehrten Schwerkraft nachgeben.
Außerdem standen ihre Füße auf Gras.
»Denn ich weiß nicht, wie lange du das noch durchhalten willst«, fuhr sie fort, ihre Lippen ein schmaler Strich.
»Ich glaube …«, brachte er hervor, »ich glaube, ich stehe auf dem Kopf!«
»Es beruhigt mich ungemein, dass du das selbst herausgefunden hast, denn mir wäre nicht wohl bei dem Gedanken, dass die Hersire einen Idioten zu ihrem Anführer bestimmen könnten.«
Er stöhnte.
»Warum stehe ich auf dem Kopf?«
»Sieh es mal so. Hätten sie dich nicht aufgehängt, sondern in mein Bett geschafft, hättest du das alles hier über dir verteilt.«
Sie wies auf einen unappetitlichen Haufen aus viel zu wenigen Essensresten in viel zu viel alkoholischer Flüssigkeit zu ihren Füßen. Er stöhnte erneut auf.
»Ich habe den Wettkampf gewonnen. Man darf nur währenddessen nicht kotzen«, rechtfertigte er sich. »Und es ist vollkommen legitim, sich am Baum hängend von solch … derischen Angelegenheiten zu befreien.«
»Und hat Ögnir dir die Weisheit für eine neue … Saga zukommen lassen?«
»Ich würde sagen, die Vorträge der anderen werden auch nicht besser sein.«
Aviothea seufzte und zückte ein kleines Messer aus einer Lederscheide, die ihr an einem Band um den Hals hing. Er hatte ihr das Messer zur Verlobung geschenkt. Sie reichte es ihm.
»Du gibst mir mein Geschenk zurück?«, fragte er sie mit wachsendem Entsetzen. Sie griff an die verzierte Lederscheide und bedachte ihn mit einem strafenden Blick.
»Unsinn. Du sollst dich losschneiden. Ich würde dir vielleicht ein Frühstück empfehlen, wenn du heute noch weitere Albernheiten durchhalten willst.«
»Du verstehst das nicht. Du bist zu cyclopäisch, um das zu verstehen.«
Sie schenkte ihm ein kurzes Lächeln, das auf dem Kopf stand und schüttelte dann energisch ihre schwarzen Zöpfe.
»Oder meine Vorfahren haben einfach ihren Verstand nicht auf See gelassen«, schlug sie vor.
Seit mehr als zwei Generationen schon herrschten die Hjaldinger über das Reich beider Hylailos. Manche Sitten ließen sich miteinander verheiraten, so wie die Söhne und Töchter jener ersten See-Kuninge und ihrer Gefolgsleute mit den Söhnen und Töchtern der unterworfenen Cyclopäer. Und manche Sitten blieben fremd.
Aviothea stammte aus einer Familie, die sich ihren rein cyclopäischen Stammbaum bewahrt hatte – bis auf das Kind, das er mit ihr gezeugt hatte. Dass er sie erst heiraten wollte, wenn das Kind auf der Welt war, hatte ihren Eltern überhaupt nicht gefallen. Sie hatten sich darauf geeinigt, dass er sie heiraten würde, wenn er von der nächsten Herferd heimkam. Viele hielten es mittlerweile so, dass sie schon den Bund schlossen, bevor die Kinder ihren ersten Schrei taten. Man konnte sich nicht gegen alles verschließen, Hrutgar wusste das nur zu gut.
Wenn man sich gegen die Sitten eines eroberten Landes wehrte, würden sich die Herzen der ursprünglichen Bewohner niemals öffnen, und ein ewiger Sippenkrieg würde daraus resultieren. Hrutgar wäre nicht statt seines älteren Bruders und seiner erfahreneren Base Waltudis zum Hersir seiner Ottaskin gewählt worden, wenn er nicht genau dieses Wissen mitgebracht hätte. Er war bereits ein Kind Hylailos’ ,vor knapp dreißig Jahren in einem Fischerdorf nahe Rethis geboren, aufgewachsen mit den cyclopäischen Gören in Olivenhainen, an Felsküsten über azurblauer See und Sandstränden, von denen aus sie nach Perlen getaucht hatten. Mit fünfzehn war er mit seinem Vater in den Norden aufgebrochen, um das Land seiner Ahnen zu sehen. Der regenschwere Himmel, die graue See und die trübseligen Holzhäuser hatten ihn mit wenig Begeisterung erfüllt, und seine erste Herferd hatte ihn nicht nach Norden, sondern nach Süden geführt. Das Essen war dort besser. Die Menschen reicher. Die Beute lohnenswerter. Und wer konnte den Drachenbooten schon folgen, wenn sie sich erst einmal in die kristallklare und dennoch tückische Heimat der Cyclopensee zurückgezogen hatten? Felsen, Riesenkraken, tödliche Strömungen und plötzliche Untiefen waren nur einige der Unannehmlichkeiten, über die ein Hjaldinger lachte und Lieder sang.
Ein ähnliches Lied schwebte ihm auch vor, wenn er den Sagawettstreit nach dem Frühstück für sich entscheiden wollte. Er nahm Aviothea das Messer aus der Hand, zog sich stöhnend und mit protestierenden Muskeln im ganzen Körper in die Höhe, packte das Seil oberhalb seiner Füße und schnitt sich von dem verkrüppelten Baum mit der weißen Rinde los, an den ihn seine Otta in der Nacht gebunden hatte. Er schaffte es, seinen Sturz mit einer Hand am Seil zu einem kontrollierten Sprung werden zu lassen und landete nicht einmal in den Überresten jener Nacht.
Aviothea streckte die Hand aus und verlangte ihr Messer zurück.
Er wollte sie küssen, doch mit einem ähnlichen Stöhnen wie das, das er selbst beim Aufwachen ausgestoßen hatte, wich sie zurück und hielt ihn mit einer Hand auf seiner Brust auf Abstand.
»Ich bin froh, dass du noch lebst, Hrutgar. Aber du riechst nicht so.«
Er beließ es bei einem kurzen Streicheln ihres Bauchs.
»Du wirst stolz auf mich sein. Heute Abend wirst du stolz auf mich sein.«
Sie lächelte, und obwohl es ein spöttisches Lachen war, wusste er, dass er Recht hatte. Sie würde sehr stolz sein.
Kapitel II: Die Nacht des Mungos
Die vier einsamen Kreaturen hatten bereits gesehen, wie unter dem Lauf der Zeit die Göttlichkeit aus Göttern rann und von Dunklem ersetzt wurde.
Sie spürten, dass diese gewandelten Kreaturen am Rand der Welt lauerten. Und manche sandten ihre Agenten aus, um ihnen einen Weg zu bereiten. Eine Schlange aus der Tiefe war darunter, und in den Herzen der vier großen Alten weckte sie Furcht.
An Stellen, an denen die Haut der Zeit dünngewetzt war, konnten sie hinausblicken. Ein Mensch mit völlig schwarzen Augen sah ihnen entgegen, leblos wie ein Reptil. Sie zeigten ihm Bilder, Gedanken und Weisungen, wie sie es immer schon getan hatten. Doch der Geist der neuen Menschen war anders als der der alten, die Sklaven gewesen waren, und den neuen Menschen waren die Weisungen eine Last. Die Alten versuchten, Gedanken und Geist zu krümmen.
Viele Schicksale würden sich in eine einzige Richtung fügen.
Shinja rannte die Stufen hinauf, die schmale Stiege, die sich erst am gekrümmten Bein eines Drachen, dann an seinem Bauch hinaufwand. Dann entlang der breiten, mit einem bronzenen Glanz bedeckten Schuppen des Brustkorbs, kurz gedeckt von den gewaltigen Armen, die ebenfalls unten in der Halle ruhten, ihre Krallen in den Boden gegraben, als seien sie dort gelandet. Dann am Hals hinauf, bis dorthin, wo die drei Drachenschädel in der Spitze der gewaltigen Pyramide zusammentrafen.
Dort oben loderte weiß-bläuliches Licht, das sich weiter unten in Zwielicht verlor. Shinja blinzelte dagegen an. Wenn sie die Augen schloss, sah sie das gleißende Zeichen, das jenes Licht verströmte, direkt über dem Schemel, der verlassen in der Mitte der Kaverne stand.
Sie hatte sich alle Ausgänge aus der Halle der Drachen angesehen. Dies hier war der, den sie ausgeschlossen hatte.
Ein Pfeil schlug zu ihren Füßen ein.
Sie presste die Lippen zusammen, schickte einen rohen, ungeformten Gedanken zu Heshinja und sprang von der Plattform der obersten Stufe hinauf in das Licht der Glyphe, die seit Jahrhunderten das Sphärentor in der Halle der Drachen offenhielt.
Die unwirkliche Pforte kreischte lautes, gleißendes Licht, als sie zunächst dagegen prallte wie gegen eine Wand aus zäher Masse, und dann an mehreren Stellen ihres Körpers gepackt und hindurchgezogen wurde. Sie öffnete den Mund, um zu schreien, doch auch ihr Schrei wurde hinausgezogen in die Endlosigkeit zwischen den Welten.
Shinja wurde so klein, dass sie nur noch einen Bruchteil des Seins vom Nichts entfernt war. Sie kauerte in sich selbst.
Und das Licht schrie so lange, bis es dunkel wurde.
***
Anzud folgte den Schlangen nicht gern in die Tiefe. Seine Augen sahen im Dunkeln nicht gut, und seine Art war es, keiner Beute zu folgen, sondern sie zu schlagen, während sie noch ahnungslos war.
Doch natürlich wusste er, wohin sie krochen, wenn er nicht schnell genug war. An Orte wie diese vermochte nur Bruder Mungo zu folgen – und auch ihn würde Anzud schlagen, wenn er die Gelegenheit erhielt.
Doch er wusste, kein Mungo mundete so gut, wie Schlangen es taten. Anzud liebte Schlangen. Und sein menschlicher Gefährte hasste sie.
Manchmal kehrte Anzud heimlich in den Tempel des Vogelgestaltigen zurück, um die geopferten Innereien der auf dem Bauch Kriechenden vom Altar zu stehlen und zu verschlingen. Kalt waren sie weniger delikat, aber dennoch saftig und nicht zu verachten. Anzud dachte, Yagheer wüsste nichts von seinem Diebstahl.
Yagheer dachte, nirgends waren die Innereien, auf die Aveshas Blick bereits mit Freude gefallen war, besser aufgehoben als im Magen seines Steppenfalken.
Der Aveshapriester hatte seinen Lederhandschuh angezogen, und der Falke saß ruhig, aber wachsam darauf, während sie in die Dunkelheit traten.
Yagheer fühlte den raschen Herzschlag des Tiers und seinen eigenen, der dagegen beinahe beruhigend langsam ging – wenn auch nur im Verhältnis zum Vogel.
Seit dem Abend am Barun-Ulah waren bereits Tage vergangen. Tage, die Yagheer mit Suchen verbracht hatte. Nächte, in denen er häufig aufgewacht und lange Treppen hinuntergestiegen war, von seiner Kammer im Blütentempel durch die Türme des Kraks bis hinab in die Kühlkeller, von denen aus jedoch kein Weg weiter hinab führte. Er hatte Schriften gewälzt, und obwohl er für gewöhnlich einen raschen Geist besaß, erinnerte ihn seine Schwerfälligkeit mit den teils grausam kleinen Zeichen schmerzlich an die Zeit mit seinem Vater, der seinen geringen Willen zur schriftlichen Gelehrsamkeit stets verabscheut hatte.
Er hatte Shulamin, die ihm im Tempel des Baalat Khelevatan gewogen war, nach Erzählungen aus der Zeit der Stadtgründung gefragt. Die Geschichte hatte er natürlich bereits gehört, genau genommen wurde sie beim Hochfest der Yerkisani an jeder Ecke der Stadt erzählt, von Bettlern und Theatertruppen, von Märchenerzählerinnen und den Baalat-Priestern. Puppenspiele und Maskentheater, Scherenschnitte und Teppichmuster, Fresken und Statuen und die Darsteller des großen Triumphzugs des siegreichen Gottes zeigten, was unter Yerkesh verborgen war. Die Baalat-Priester stellten es sogar mit ihrem großen, öffentlichen Geschlechtsakt dar, in dem das Fest seinen Höhepunkt fand.
Yagheer fand es wenig erbaulich, dass es sich offenbar um ein Tor in die Welt der Ifriitim handelte.
Shulamin hatte jedoch noch mehr darüber gewusst, und auch seine kurzen Ausflüge in die Archive der Tempel hatten es ihm verraten: Die alte Stadt, die, auf deren Ruinen und Fundamenten Yerkesh erbaut worden war, war nicht von Menschenhand errichtet worden. Als er begriffen hatte, was dies bedeutete, hatte er auch erkannt, warum ihn diese Träume umtrieben.
Diese Kreaturen pflanzten in jede Stadt der Menschen ihr Übel! Und Avesha, der die Echsen hasst, schreit zu mir, dass ich das Werk meines Vaters fortführe. Anders als er und an anderen Orten. Doch es hat einen Grund, dass mein Vater den Bann erneuern wollte und dass ich dem Gott diene, der die Echsen am meisten hasst.
Die Träume wollten, dass er in der Tiefe Erkenntnis fand, und doch war er nun in die alten Wurzeln der Stadt unterwegs. Der weißhaarige Fischer am Flussschiffhafen hatte ihm gesagt, wo er suchen könne, an welcher Stelle uralte Ruinen zum Vorschein traten, wenn die Wasser des Barun-Ulah niedrig standen. Seit Yagheer aus Khunchom gekommen war, war der Strom breit und gut gefüllt gewesen, doch ab und zu hatte er sich im Sommer zurückgezogen und ganze Inseln aus Mauerwerk zum Vorschein kommen lassen.
Yagheers nackte Füße waren schlammverkrustet. Am Ufer hatte er nach den Stellen gesucht, die der Fischer ihm gewiesen hatte. Und von dort hatte Anzud einen Einlass gefunden, in den seine Beutetiere krochen.
Heute war Yagheer kein Falke. Heute war er ein Mungo.
Mit einer der kostbaren magischen Lampen aus dem Blütentempel in der einen Hand und dem Falken auf der anderen hatte er sich zwischen zwei gewaltige Sandsteinplatten gezwängt, durch Schlamm und Wasser in die Fundamente der großen Mauer des Krak. Sofort senkte sich die Dunkelheit auf ihn. Schmal schlängelte sich die Felsspalte hinein, glitschig war der Boden, und als es tiefer hinabging, stand das Wasser so hoch, dass es Yagheers Hose bis zur Hüfte durchnässte. Danach ging es aufwärts, die Lampe erhellte Trümmerstücke, die eine Kaverne bildeten.