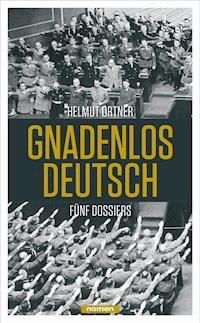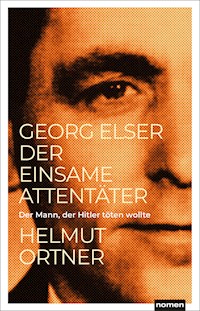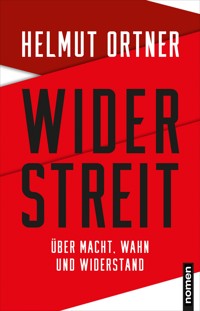Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nomen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kluge und pointierte Zeit-Diagnosen und Zeit-Reflexionen. Es geht um verdrängte Vergangenheit und kontaminierte Gegenwart, um religiöse Anmaßung und säkulare Verteidigung, um falsche Gerechtigkeit und inhumane Gnade, um populistische Wut und politischen Zorn. Es geht um das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, Autonomie und Konformismus, Moral und Effizienz, Wissen und Glaube: es geht um Selbstvergewisserung. Essays zum Stand der Dinge und zum Lauf der Zeit: ernüchternd, erhellend und provokant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Ortner
Dumme Wut. Kluger Zorn
Anklagen und Freisprüche
Politische Essays
Dumme Wut. Kluger Zorn
Anklagen und FreisprüchePolitische Essays
Gestaltung:BlazekGrafik, Rudolf Blazek, Frankfurt am Main
Copyright © der deutschsprachigen Originalausgabe:Nomen Verlag, Frankfurt am Main 2018
www.nomen-verlag.de
1. Auflage März 2018
© 2018, NomenVerlag
ISBN 978-3-939816-50-8
eISBN 978-3-939816-54-6
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Übersetzungen, Kopien, Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
»Ärger ist so anstrengend, dass man ihn für dasgroße Unrecht aufsparen sollte.«
Saul Bellow
Inhalt
—— Kleine Vorrede
Warum man den Zorn nicht einsperren, teilen oder exportieren kann
—— Die Gegenwart der Vergangenheit
Warum Herr Hanning vor Gericht steht – und schweigt
—— Politik ohne Gott
Warum die Religion etwas Wunderbares sein kann – als Privatsache
—— Ohne Gnade
Warum der Glaube an die Todesstrafe noch lebendig ist
—— Keine Stunde Null
Warum NS-Juristen straffrei ausgingen – und fast alle damit einverstanden waren
—— Der Führer lebt!
Warum Hitler ein medialer Popstar ist – und alle begeistert sind
—— Dumme Wut, kluger Zorn
Warum es höchste Zeit ist, den guten Ruf des Zorns wiederherzustellen
—— Anmerkungen und Literatur
—— Abdrucknachweis
——— Kleine Vorrede
Warum man den Zorn nicht einsperren, teilen oder exportieren kann
Wir kennen die Bilder. Immer wieder montags trafen sich in Dresden Tausende von Wutbürgern, um Rednern zu applaudieren, die für Volk und Vaterland den Notstand ausriefen, überall Gefahr und Verrat witterten und eindringlich vor Flüchtlingen und Lügenpresse warnten. Montag war Wut-Tag.
Deutsche hört die Signale! Geschrei, Gegröle, Gezeter – der akustische Soundtrack aller Empörten und Enttäuschten von Sachsen bis in die Niederungen heimischer Mittelgebirge, ein Sound, jederzeit imstande, kollektive reflexive Handlungshysterie zu entfachen. Die Echo-Welle des Unappetitlichen und Unangepassten, von der sich der national-gesinnte Wutbürger gerne mitreißen und mittragen lässt, hält ungebrochen an. Auch die gern zitierte »Mitte der Gesellschaft« ist von ihr erfasst. Flüchtlinge, Ausländer, Asylanten, kurzum »alles Fremde« – alles, was sich immer schon eignet als ideale Projektionsfläche für gesellschaftliche und politische Probleme im eigenen Planquadrat. Nationalistische Angst-Phantasien als Motor und Motivation, als Appell und Attacke. Es geht um die viel beschworene »nationale Identität« und diese besteht vor allem in der Abgrenzung nach außen. »Deutschland zuerst!«
Und so findet sich nun eine gewählte Heerschaar von AFD-Abgeordneten im Bundestag, um die gefühlte Heimat zu verteidigen – wenn es sein muss, um jeden Preis. Es geht um kulturelle Wurzeln, um Völkisches und das deutsche Volk, und vor allem: gegen »die da oben«. Gegen die politische Klasse, gegen »Volksverräter«, gegen »Alt-Parteien« und »Lügenpresse«. In jedem Fall »gegen«. Die Frage lautet: Ist das noch in Ordnung, ist das noch verfassungsgarantierte Narretei oder schon nazi-kontaminierter Wahn?
Ignorieren, Tolerieren oder Aufregen? Ja, es gibt sie, die mediale und politische Tendenz, alles im Konsensabgleich zu erledigen, so als sei unsere demokratische Hausordnung gleich in höchster Gefahr, wenn Sprache und Begriffe mal pubertär-rüpelhaft, mal politisch grenz-debil durchs Parlaments-Plenum, über die Plätze der Republik – oder samstags durch die Stadionkurven – zu laut und zu schrill daherkommen. Das ist mitunter unangenehm, anmaßend, abstoßend, gar grenz-debil. Was tun?
Wir sollten solcherlei Entgleisungen einerseits nicht mit allzu übertriebener Empfindsamkeit begegnen, den Rest – so sieht es unser Rechtsstaat vor – klären Staatsanwaltschaften und Gerichte. Andererseits: zu viel Verständnis und coole Toleranz gegenüber jeder Form politischer Dummheit und Devianz ist auch nicht immer die sinnvollste Reaktion. Vor allem die extreme Rechte provoziert gerne mit wirren Begriffen und lenkt damit ab von ihren noch wirreren Ideen. Also sollten wir uns nicht auf Begriffs-Rempeleien einlassen, nicht zu viel Höflichkeit und Sanftmut zeigen, sondern über Inhalte streiten – soweit ein Rest von Fähigkeit vorhanden ist, zuzuhören. Wer in der sprachlichen Auseinandersetzung seinen eigenen Wortschatz absichtlich stumpf macht und zu versöhnlich ist, der ist schon in der Defensive.
Die Autoren Per Leo, Max Steinbeis und Daniel Pascal Zorn rufen in ihrem Buch mit Rechten reden zu kognitiv-emotionaler Selbstdisziplin auf. Ihr Vorschlag: den »ewigen Loop von überspannter Empörung, selbstgerechten Überlegenheitsgesten und zersetzender Verachtung« zu durchbrechen. Das ist gut gemeint, verlangt aber mitunter altruistische Einsichten. Man müsse verstehen, wie sich die Streit-Dramaturgie entwickelt und in einer ungesunden Dynamik verheddert, so die Autoren. Ihr »Leitfaden« beschreibt ein reaktives Sprachspiel, dem die »Nichtrechten« immer wieder auf den Leim gehen. Die rechte Position kapert dabei das Spiel, indem sie die nervöse Empörungsreaktion der Gegenseite zum Kapital ihrer Selbstbestätigung macht. Abwehr, Zensur und Verleumdung der Gegenseite würden so zum Treibstoff der rechten Identitätsmaschinerie. Da ist was dran. Wer das AFD-Führungsduo Gauland und Weigel einmal in Talkshows erlebt hat, findet hier eindrucksvollen Anschauungsunterricht – und auch einen Vorgeschmack, wie die AFD-Fraktion im Bundestag zukünftig agiert. Verbaler Treibstoff für eine national-konservative – wenn es sein muss – auch rechte Identitätsmaschinerie – medial gut geölt, live aus dem Berliner Plenarsaal.
Da will auch die CSU als verlässlicher Begriffs-Lieferant nicht hintenan stehen. Wie weiland schon Franz-Josef-Strauß proklamierte, dass rechts von der CSU nichts wachsen dürfe, fordern nun auch dessen Nachkömmlinge pflichtschuldig ein AFD-grundiertes neues deutsches Heimatgefühl. Beispielsweise Alexander Dobrindt. In der Tageszeitung Die Welt, dem Leitmedium der bürgerlich-konservativen Mitte – fordert er einen längst überfälligen gesellschaftlichen Aufbruch, eine »konservative Revolution«. Unter »konservativen Revolutionären« versteht die Geschichtswissenschaft elitäre, antidemokratische und deutschnationale Kräfte, die gegen die »dekadente« Weimarer Republik gekämpft haben. Männer wie Oswald Spengler, Carl Schmitt und Ernst Jünger, die zu Gewaltfantasien und Apokalyptik neigten, denen die Moderne und mit ihr die »Zivilisation« als Grundübel galten. Stellt sich die Frage: Benutzt er diesen Begriff bewusst? Michael Angele findet für den Geist, der aus Dobrindts Traktat spricht, den Begriff »Extremismus der Mitte« – und weil dieser neue Extremismus der Mitte alte Feindbilder braucht, verbindet der CSU-Frontmann seine rhetorische Kraftmeierei mit einem rabulistischen Gestus gegen die »68er«, die als die großen Zerstörer dastehen. »Linke Ideologien, sozialdemokratischer Etatismus und grüner Verbotismus« hatten ihre Zeit. Eine »neue, konservative Bürgerlichkeit« braucht das Land, schreibt Dobrindt.
Vor allem braucht seine Partei die verlorenen Stimmen ihrer Stamm-Wähler, die bei der letzten Bundestagswahl bei der AFD statt der CSU ihr Kreuz machten. Grund genug, genau so zu sprechen, wie die Rechts-Populisten. Nur nebenbei wollen wir festhalten: Dobrindts Partei ist in Bayern seit etwa sechzig Jahren durchgehend und im Bund 17 der vergangenen 25 Jahre an der Regierung beteiligt. Es bleibt also eher diffus, worin der Aufbruch bestehen soll. Und die Frage: warum hat es bislang mit der konservativen Revolution nicht so richtig funktioniert? Christian Stöcker bringt in einer Spiegel-Kolumne das eigentliche Problem der Konservativen auf den Punkt: »Es fällt ihnen sehr schwer, den Wesenskern ihrer Weltanschauung klar zu formulieren. Vielleicht, weil sich Rassismus, Sexismus und Nationalismus nur die abgebrühtesten Rechtspopulisten zu formulieren trauen.«
Es geht um die Lufthoheit über Deutschlands Stammtische, um die Deutungsmacht von Heimat und Vaterland, Familie und »christlichen Werten« – und das gehört nun einmal zur DNA der Bayernpartei. Vor allem aber geht es um eines: um Machtgewinn oder Machtverlust. In Abwandlung des großen Volksphilosophen Sepp Herberger, der einst verlautbarte, dass das nächste Spiel immer das schwerste sei, gilt für die neuen Eiferer des Konservativen: die nächste Wahl ist immer die wichtigste. Der Kampf um »den Wähler draußen im Lande« ist also entbrannt. Lautstarke Empörungs-Rhetorik und eingespielte Leerformeln sind der Sound der Wahlkampfzeiten. Keine Partei pocht auf besondere Alleinstellungsmerkmale. Alle mischen mit. Wir haben uns daran gewöhnt.
Vor allem eine politische Leerformel wird mittlerweile als parteiübergreifende Floskel geradezu inflationär bemüht: »Man muss die Sorgen und Ängste der Menschen ernst nehmen!« Keine Anne-Willoder Maybrit-Illner-Runde kommt ohne sie aus. Von welchen Sorgen, von welchen Menschen und von wie vielen Menschen hier die Rede ist, verschwindet im Studio-Nebel. Es dominiert das Unbestimmte, Ungenaue, Unverbindliche. Und weil es allemal verträglicher ist, sich über den persönlichen Gefühlshaushalt seiner Bürger zu verständigen, anstatt über Klimawandel, Waffenexporte, Migrationsströme oder ungleiche Verteilung des Reichtums zu streiten, hat man einen Begriff aus dem weiten Feld der Beziehungsprobleme gewählt. Das ermöglicht es »ein Stück weit« – um es im Politiker-Duktus zu sagen – den politischen Streit zu entschärfen und zu neutralisieren. Aber Achtung: es liegt im Wesen des Gefühls, dass es nicht einfach wegrationalisiert werden kann. Die Nachhaltigkeit rhetorischer Vertröstungen ist begrenzt.
Beispiel: die G20-Schlusserklärung von Hamburg im Sommer 2017. Ein Dokument des Scheiterns. Voller Leerformeln und Unverbindlichkeiten, ein Papier, das an Dürftigkeit kaum zu überbieten ist. Kein Wort über die kriegerische Ökonomie der Welt, keine Silbe über das globale Zusammenwirken dieses gigantischen Zerstörungswerks und ihre Verantwortlichen, die Trumps und Putins samt ihren Komplizen und Nachahmern. Doch statt über den Totalausfall der Politik zu reden, wurde nach dem Gipfel nur noch über ein Wort diskutiert: Gewalt. Keine Frage, die gab es. Eine ohnmächtige, destruktive, militante Gewalt, flankiert und befeuert von häufig ebenso unsinnigen wie unverhältnismäßigen Einsätzen von Polizeikräften und Sondereinsatz-Kommandos. Über 30 000 Beamte waren vor Ort. Die Kosten allein für die Sicherheitsvorkehrungen: 32 Millionen Euro. Gesamtkosten des Gipfels: mindestens 72 Millionen. Doch darüber wurde politisch nicht gestritten, auch nicht über die Sinnhaftigkeit des Hamburger Polit-Events. Statt dessen verloren sich die Argumente gegen das G20-Treffen in der Militanz. Gewissermaßen war der Protest ebenso wortlos geworden wie die Politik.
Erst Monate später endet die Sprachlosigkeit. Ein Vize der Polizeigewerkschaft und CDU-Abgeordneter in der Hamburger Bürgerschaft äußert sich in einem Spiegel-Interview zu den Vorgängen, die er von beiden Seiten – gewissermaßen als aktiver Polizist und gewählter Politiker – er- und durchlebte. Joachim Lenders, so heißt der Mann, räumt ein: »… Natürlich hat es auch Fehler bei der Polizei gegeben, das zu kaschieren wäre dummes Zeug. …« Auch einen zeitweiligen »Kontrollverlust« der Polizeikräfte will er nicht in Abrede stellen. Gleichwohl aber, so der Doppel-Insider, könne man der Polizei keine großen Fehler vorwerfen. »Was sind große Fehler, was sind kleine Fehler?… Es war schlicht zu wenig Polizei im Einsatz. Dafür ist die Politik verantwortlich«, stellt Herr Lenders fest und stellt klar: »Wir sind ein Rechtsstaat. Die Polizei darf Straftaten nicht hinnehmen, auch kleinere Straftaten nicht. Es gibt keinen Ermessensspielraum.« Und deshalb ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zahlreiche Gewalt-Demonstranten – einige wurden bereits zu Haftstrafen verurteilt. Von Strafverfahren gegen Polizeibeamte indes ist nichts bekannt. Auch der Rechtstaat ist manchmal überfordert.
Widerstand beginnt dort, wo sich die Bürger gegen Ignoranz und Arroganz, die Verwandlung von Politik in Verwaltung oder Therapie auflehnen. Dann kann es mitunter laut und gewalttätig werden. Aus Empörung wird militante Attacke, flammender Protest, gewalttätige Revolte. Aus Wut zerstörende Gewalt. Ob »Links« oder »Rechts«, ob sogenannte internationale »Antifa« oder nationale »Pegida«: Wut ist lagerübergreifend unbeherrscht. Ein allzu alltäglicher Reflex, nicht selten auch sicht- und hörbarer Beleg für ein reduziertredundantes Weltbild, für ein einfaches Zurechtrücken komplizierter Wirklichkeiten und vor allem: Verweigerung des politischen Streits. Wut ist Stagnation.
Zorn dagegen kann Motor sein. Er ist zäh und ausdauernd. Er wächst. Er behält sein Ziel im Auge, identifiziert sein feindliches Terrain. Er setzt nicht auf blinde Gewalt, nicht auf coole Randale, nicht auf eruptive Militanz – sondern andauernden Disput, auf konstante Auseinandersetzung. Zorn, heißt es bei de Tocqueville, »kann man nicht einsperren, teilen oder exportieren«. Zorn sucht den konstruktiven, oft auch zähen Diskurs. Deshalb ist er für unsere Demokratie so unerlässlich.
In diesem schmalen Essayband geht es um Themen, die den Autor seit langem beschäftigen, ja zornig machen. Es geht um verdrängte Vergangenheit und kontaminierte Gegenwart, um religiöse Anmaßung und säkulare Verteidigung, um falsche Gerechtigkeit und inhumane »Gnade«. Es geht um das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, Autonomie und Konformismus, Moral und Effizienz, Wissen und Glaube: kurzum, es geht um Selbstvergewisserung.
Wenn bei der Lektüre hier und da Unmut und Empörung aufsteigt, vielleicht sogar in Zorn umschlägt – dann sind Sie auf dem richtigen Weg.
Helmut Ortner,
im Februar 2018
»Der deutsche Täter war kein besonderer Deutscher. Was wir über seine Gesinnung auszuführen haben, bezieht sich nicht auf ihn allein, sondern auf Deutschland als Ganzes.«
Raul Hilberg
——— Die Gegenwart der Vergangenheit
Warum Herr Hanning vor Gericht steht – und schweigt
Im westfälischen Detmold ging im Juni 2016 ein weltweit beachteter Prozess zu Ende. Vor Gericht stand ein 94-Jähriger Greis: der ehemalige Auschwitz-Wachmann Reinhold Hanning. Obwohl ihm die Richter keine konkrete Tatbeteiligung nachweisen konnten, wurde er wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 170 000 Fällen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Ein ungewöhnliches Urteil. Während der Verhandlung tat Hanning das, was die meisten seiner Generation seit 70 Jahren getan haben, wenn es um ihr Tun und Nichtstun zwischen 1933 und 1945 ging: er schwieg.
Nicht einmal seiner Familie habe er über Ausschwitz erzählt, berichteten seine Verteidiger. Hannings erwachsener Sohn saß hinten im Gerichtssaal: ratlos, sprachlos, verunsichert. Was wusste er über das Tun seines Vaters? Was hätte er wissen können? Hatte er ihn jemals befragt? Zu Hitler-Deutschland, zu Ausschwitz, zu seiner Zeit als junger Soldat? Zum Schweigen gehören häufig zwei: einer, der nichts sagt, und ein anderer, der nichts fragt. Nach dem Krieg wurde in vielen deutschen Familien geschwiegen.
»Sie waren knapp zweieinhalb Jahre in Auschwitz und haben damit den Massenmord befördert«, sagte Richterin Anke Grudda zu Beginn der Urteilsbegründung. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren gefordert. Sie sah es als erwiesen an, dass der frühere Wachmann des Vernichtungslagers mit seinem Einsatz zum Funktionieren der Mordmaschinerie in Auschwitz beigetragen hatte. Hanning war von 1943 bis 1944 in Auschwitz eingesetzt. Er hatte im Prozess zugegeben, Mitglied der SS-Wachmannschaft des Vernichtungslagers der Nationalsozialisten gewesen zu sein und vom Massenmord gewusst zu haben.
Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert. In der Verhandlung waren nach ihrer Ansicht keine Beweise für die direkte Beteiligung ihres Mandanten an den Morden vorgelegt worden. Er habe zu keinem Zeitpunkt Menschen getötet oder dabei geholfen. Er habe nur seinen Dienst als Wachmann verrichtet.
In einer Erklärung hatte Hanning Reue über seine SS-Mitgliedschaft bekundet. »Ich schäme mich dafür, dass ich das Unrecht sehend geschehen lassen und dem nichts entgegengesetzt habe.« Er wünschte, nie in dem KZ gewesen zu sein.
Man konnte ihm abnehmen, dass er das aufrichtig meinte. Aber das Gericht hatte dennoch Zweifel. Man habe »keine Möglichkeit gehabt, den echten Menschen Reinhold Hanning kennenzulernen«, stellte die Richterin nüchtern fest. Die Nebenkläger waren erst recht nicht von der Aufrichtigkeit der Reue des ehemaligen SS-Mannes überzeugt.
Hanning habe einen Beitrag zum »reibungslosen Ablauf der Massenvernichtung« geleistet, das Morden billigend in Kauf genommen. Da spielte es demnach eine untergeordnete Rolle, wie groß dieser Beitrag gewesen war, so das Gericht. Es gab ihn – und dadurch machte er sich schuldig. Die Richterin wandte sich direkt an den 94-Jährigen, der im Rollstuhl sitzend ihre Worte äußerlich weitgehend regungslos aufnahm. »Sie haben zweieinhalb Jahre zugesehen, wie Menschen in Gaskammern ermordet wurden. Sie haben zweieinhalb Jahre zugesehen, wie Menschen erschossen wurden. Sie haben zweieinhalb Jahre zugesehen, wie Menschen verhungerten.«
Hanning habe sich mit seiner Tätigkeit arrangiert, sei in Auschwitz zweimal befördert worden und habe sich nicht an die Front versetzen lassen. Dass er keinen Dienst an der Rampe verrichtet haben will, wo Menschen für den Arbeitseinsatz aussortiert und der Rest direkt in die Gaskammer geschickt wurde, sei eine Schutzbehauptung, so die Richterin. Mehr noch: sie äußerte ehebliche Zweifel.
»Dass Sie nie an der Rampe gestanden haben, halten wir für völlig abwegig.« Genauso sei »ausgeschlossen, dass Sie nicht ein einziges Mal erlebt haben, wie Menschen in die Gaskammern gingen«. Der Greis blickte zu Boden. Stille im Gerichtsaal.
Eine Stunde lang sprach Richterin Grudda. Ihre Worte markierten »einen Meilenstein in der Aufarbeitung des NS-Unrechts in Deutschland«, ließ der Staatsanwalt danach verlauten. Der Nebenklageanwalt sagte, es sei zum ersten Mal von einem deutschen Gericht gesagt worden, dass man als SS-Mann für alle Morde in Auschwitz mitverantwortlich sei. Tatsächlich sendete der Schuldspruch eine Botschaft: als SS-Angehöriger in Auschwitz war jeder zum Täter geworden. »Das gesamte Lager glich einer Fabrik, ausgerichtet darauf, Menschen zu töten«, sagte die Richterin. »In Auschwitz durfte man nicht mitmachen.«
Nach dem Prozess blieben viele Fragen: Kann die Justiz ein Verbrechen nach mehr als 70 Jahren noch sühnen? Kann ein Gericht jemanden angemessen bestrafen für die Beteiligung am Holocaust? Und was ist mit den Opfern? Kann ihnen überhaupt Gerechtigkeit widerfahren? Und vor allem die eine Frage, die über dem gesamten Verfahren schwebte: Warum hat es mehr als sieben Jahrzehnte gedauert, bis dem Angeklagten der Prozess gemacht wurde?
Die Antwort ist so einfach wie erschreckend. Weil die Gesellschaft, der Staat, die Justiz es nicht wollten. Nicht nach dem Krieg, nicht in der Adenauer-Republik, nicht in der sozialdemokratischen Brandt-Schmidt-Ära, nicht unter Helmut Kohl, auch nicht in der rot-grünen Regierungszeit (in der immerhin zahlreiche Kommissionen damit beauftragt wurden, die NS-Verstrickungen und personellen Kontinuitäten in den Ministerien zu untersuchen) noch in den zurückliegenden Jahren der großen CDU-SPD-Koalition.
Nun möchte man die Regierungen für das mangelnde Interesse der zuständigen Staatsanwaltschaften und Ermittlungsbehörden sowie die Verschleppung der Verfahren nicht unmittelbar verantwortlich machen – aber es fehlte durchweg an gesetzgeberischen Signalen. Es fehlte das »Wollen«, NS-Täter, als diese noch keine Greise waren, vor Gericht zu bringen.
»Dieses Verfahren ist das Mindeste, was eine Gesellschaft tun kann, um den Überlebenden des Holocaust ein wenig Gerechtigkeit widerfahren zu lassen«, sagte Anke Grudda, die Vorsitzende der Schwurgerichtskammer. Und: Der Fall sei eine Warnung an die heutige Generation vor den Versäumnissen der Justiz. So blieb das Strafverfahren vor allem ein Symbol. Es erinnerte daran, dass eine Beteiligung an staatlichen Massenmorden nicht ungesühnt bleiben darf, selbst wenn dies erst nach vielen Jahrzehnten geschieht.
Der SS-Wachmann wurde verurteilt – mit 94 Jahren. Ähnliche Verfahren wird es kaum noch geben. Auch das macht Hanning zur Symbolfigur: Der Schuldspruch gegen ihn erinnert daran, dass zigtausende Mörder, Schreibtischtäter und Mordgehilfen davonkamen. Man darf festhalten: Die Aufarbeitung des NS-Unrechts durch die deutsche Nachkriegsjustiz ist eine Geschichte der Verspätung und Verzögerung. Sie hat gründlich versagt. Ein beschämendes Versagen.
Einige Zahlen: In den drei Westzonen und der Bundesrepublik wurde von 1945 bis 2005 insgesamt gegen 172 294 Personen wegen strafbarer Handlungen während der NS-Zeit ermittelt. Das ist angesichts der monströsen Verbrechen und der Zahl der daran Beteiligten Menschen nur ein winziger Teil. Das hatte seine Gründe: Im Justizapparat saßen anfangs dieselben Leute wie einst in der NS-Zeit. Viele machten sich nur mit Widerwillen an die Arbeit. Auch politisch wurde auf eine Beendigung der Verfahren gedrängt, dafür sorgten schon zahllose Amnestiegesetze.