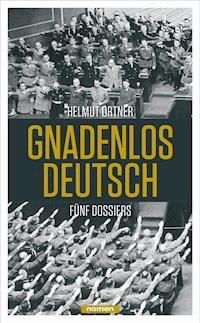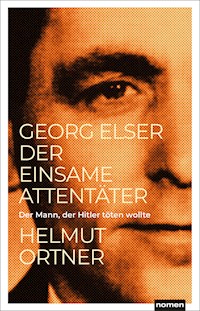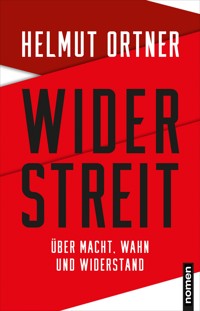Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Faust
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unsere Demokratie braucht den produktiven Streit, die Gegenrede und die öffentliche Debatte. Es geht um verdrängte deutsche Vergangenheit und kontaminierte Gegenwart, um religiöse Anmaßung und säkulare Verteidigung, um populistische Politik und Demokratie- Verachtung. Um Autonomie und Konformismus. Kurzum: Es geht um unsere Demokratie. Wir brauchen den produktiven Streit, die Gegenrede und die öffentliche Debatte. Demokratie, sagt Helmut Ortner, ist nicht unbedingt Gemeinschaft, Demokratie ist vor allem Gesellschaft, also das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Interessen, Sichtweisen und Meinungen. Seine Essays verstehen sich als Plädoyers für eine offene, reflektierte Streitkultur. »Denken im Gleichschritt – nichts ist schlimmer und demokratie- feindlicher« Helmut Ortner
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Ortner
HEIMATKUNDE
Falsche Wahrheiten.Richtige Lügen.
Politische Essays
Alle Vergangenheit ist nur ein Prolog.
William Shakespeare
Die Wahrheit ist die sicherste Lüge.
Jüdisches Sprichwort
Inhalt
PROLOG
DEMOKRATIE UND RECHTSTAAT
Über das Streiten und das Versöhnen
Streiten? Unbedingt!
»Verquere« Freiheitskämpfer, besorgte Demokraten
Beamtenland ist abgebrannt
Ohne Presse keine Freiheit
Die Welt ist nicht so harmlos, wie wir sie uns wünschen
Falsches Schweigen
Lob des Zorns
Schützt der Verfassungsschutz unsere Verfassung?
Zweierlei Solidarität
Staatsfeind, der ich bin
Die Lufthoheit des Wutbürgers
»Kriegstaugliches Mainset«
Zumutung Demokratie
VOLK UND VATERLAND
Über das Erinnern und Vergessen
Der Treueid von 1933
Ein Schatten, der auf ein Denkmal fällt
»Für immer ehrlos …!«
Der Tag, als die Bücher brannten
Der posthume Demokrat
Dienstbetrieb trotz Endkampf
Wir Nationalsozialisten
GOTT UND DIE WELT
Über den Glauben und das Vertrösten
Götterglaube und Seelenheil
Herr Steinmeier und der Garten Eden
Kniefall des Rechtstaats
Das Recht, über Gott zu lachen
Kein Schwert, sondern ein Schild
Kreuz, Kippa und Kopftuch
Seid umschlungen, Milliarden!
Sei still, es ist Feiertag!
Halleluja! Wunder gibt es immer wieder
EPILOG
Alles wird nie schlimmer …
ABDRUCKHINWEISE
Prolog
Ja, wir leben in turbulenten Zeiten. Alte Gewissheiten gelten nicht mehr. Die Hoffnung auf eine fortschreitende globale Demokratisierung und eine dauerhafte Weltfriedensordnung, wie sie noch vor Jahren möglich zu sein schien, hat sich aufgelöst. Stattdessen Krieg, Flucht, Hunger. Dazu das menschengemachte Klimadesaster. Man könnte angesichts dieser Wirklichkeiten zum Zyniker werden – kopfschüttelnd den Zustand der Welt als Beleg für die unüberwindbare Dummheit der Menschen betrachten. Die Entwertung der Welt schreitet voran – die Entwertung von Demokratie, die Entwertung von Frieden, die Entwertung von Menschenwürde.
Was tun? Was spendet Hoffnung und Trost? Gläubige Menschen haben hier einen Heimvorteil, im besten Fall wartet das himmlische Paradies. Der liebe Herrgott als Wegbegleiter, Hoffnungsträger und Sinnstifter; eine schöne Vorstellung, vor allem für jene, die nicht gern allein unterwegs sind. Für all jene aber – und ich fühle mich hier zugehörig –, für die das kein akzeptables Versprechen ist, bleibt nur der irdische Irrgarten.
Doch der Mensch ist Kant zufolge aus »krummem Holz« gemacht, aus dem »nichts Gerades gezimmert« werden kann. Er ist gierig, selbstbezogen, machtbewusst, opportunistisch, wankelmütig, verführbar. Kurzum: von Natur aus ein moralisch zweifelhafter Egoist. Keine guten Aussichten.
Nun gibt es Stimmen, die meinen, Politik müsse nicht nur Probleme lösen, sondern auch Sinn stiften. Von Werten und Leitkultur ist die Rede. Ich bin da entschieden anderer Ansicht: Dafür mag Religion zuständig sein (ich bin gottlos glücklich), nicht aber Politik. Am besten ist es, man kümmert sich um die eigene Sinnstiftung. Wir müssen schon selbst mit uns zurechtkommen. Es braucht also eine gute Balance, einen moderaten inneren Dialog zwischen Selbstzweifel und Selbstbewusstsein. Einen Pakt zwischen dem ICH und dem WIR. Eine produktive, friedliche Koexistenz.
Eine offene Gesellschaft lebt von Veränderung, von Auseinandersetzung, Debatte und Aufklärung. Aber Aufklärung ist kein Selbstzweck, kein Dogma, sondern eine Haltung, ein »Ethos«, wie Michel Foucault es formuliert. »Systemrelevant« sind Menschen, die sich trauen, die aufbegehren, gegen tradierte Denkmuster und Politschablonen andenken und neue Möglichkeiten und Perspektiven entwerfen. So sehr unsere Demokratie auf Konsens angelegt ist, es braucht Gegenrede und Widerstreit. Andauernd und unüberhörbar. Das ist der Sauerstoff für die Demokratie.
Es geht in diesen Zeiten (war es je anders?) darum, unsere offene Gesellschaft gegen ihre falschen Freunde und richtigen Feinde zu verteidigen. Gleich ob von rechts oder links. Gegen politischen Fanatismus und religiösen Wahn. Gegen Geschichtsvergessenheit und Populismus. Ich plädiere für plausible, rationale Argumente statt Bauchgefühl. Ideal, wenn beides wohldosiert zusammenkommt, dann stehen die Chancen gut, die Wirklichkeit zu bewältigen.
Die wichtigste Voraussetzung, um Wirklichkeit zum Besseren zu verändern, besteht darin, diese ungeschönt zur Kenntnis zu nehmen. Schlichte Hoffnung und naiver Optimismus sind die Totengräber vieler guter Ideen gewesen. Es gibt keine schnellen Lösungen.
Wie wir mit all dem zurechtkommen, als Einzelne und Einzelner? In jedem Fall sollten wir uns nicht zurückziehen ins Private, gleichgültig werden, auf Besserung hoffen, statt aktiv zu werden. Vor allem: Wir sollten uns vergegenwärtigen, dass populistische Heutige und Ewiggestrige nach wie vor eine Minderheit sind, freilich eine laute.
Die nachfolgenden Essays, Kommentare und Reportagen sind eine Aufforderung zur Verteidigung der offenen Gesellschaft und eine Ermunterung zum produktiven Streit. Veröffentlicht wurden sie in den letzten Jahren in Tageszeitungen, Zeitschriften und auf Online-Magazinen. Hier erscheinen sie in der Originalfassung (Erscheinungsort und Datum finden sich im Anhang) – und sollen allesamt als Plädoyer gegen jede Form ideologischer Beschränktheit und Demokratieverachtung gelesen werden.
DEMOKRATIE UND RECHTSTAAT
Über das Streiten und das Versöhnen
Streiten? Unbedingt!
Demokratie ist eine Zumutung. Sie ist anstrengend, langwierig, bisweilen schlicht ermüdend. Viel bequemer ist es, wenn ein vermeintlich starker Mann (seltener, eine starke Frau …) durchregiert, wenn man sich als Bürger und Bürgerin nicht allzu viele Gedanken machen muss. Genau mit diesem Versprechen einer radikalen Reduktion von Komplexität locken die Feinde der Demokratie. Sie locken mit der Unfreiheit. Dennoch wollen die Menschen in großer Mehrheit in Demokratien leben. Je deutlicher sich die Feinde der Demokratie zu erkennen geben, umso kostbarer erscheint ihnen ihre Freiheit.
Freiheit – wer würde bezweifeln, dass sie den Kern von Demokratie bildet? Demokratie ermöglicht nicht nur Freiheit, sie ist selbst Ausdruck von Freiheit. Der Begriff stellt so etwas wie ihre Leitwährung da. An ihm müssen sich Institutionen und Verfahren messen lassen. Auf den ersten Blick scheint es so, als könne man sich – unter Demokratinnen und Demokraten – einvernehmlich auf den Wert der Freiheit einigen. Freiheit ist ein Schlüsselbegriff der Moderne, der die philosophischen und politischen Debatten wie ein Gravitationszentrum zusammenhält. Aber was genau wir mit Freiheit meinen, ist äußert unklar, mitunter heftig umstritten. Besteht Freiheit darin, ohne Geschwindigkeitsbeschränkung auf deutschen Autobahnen fahren zu dürfen? Oder umgekehrt darin, von der Belästigung und Gefährdung durch Raser »frei« zu sein?
Es gibt nicht wenige Stimmen – und es sind oft die lautesten –, die vor allem diese individuelle Freiheit verabsolutieren. Das Recht auf Anspruch auf individuelle Freiheit wird dann zur absoluten Größe: etwa bei der Impf-Freiheit. Wie auch immer man die staatliche Reaktion auf die Pandemie einschätzen will, als hysterisch, planlos, übertrieben oder aber als angemessen, klug und weitsichtig: Das Beispiel zeigt, was demokratische Politik heute im Kern umtreibt: die Frage nach der angemessenen Interpretation des Begriffs Freiheit. Genau diese Frage stellte die Pandemie. Oder allgemeiner: Sie stellt sich vor allem in Krisenzeiten.
Nun ist es eine Tatsache, dass wir in einem permanenten Krisenmodus leben. Die einzige verlässliche Erwartung an die Zukunft besteht darin, dass weitere Krisen auf uns zukommen werden: Corona, Krieg, Klima: Alte Gewissheiten verlieren ihre Gültigkeit, etwa die vom steten Wachstum, Frieden und Wohlstand. Die Wirklichkeit stellt uns vor die Frage, was uns das Leben in Freiheit eigentlich wert ist – und wie es um unsere Solidarität, um unseren Gemeinsinn wirklich bestellt ist?
Ist Demokratie nur ein Mechanismus, der es erlaubt, persönliche Selbstentfaltung, ökonomischen Wohlstand und ein individuelles »Streben nach Glück« zu ermöglichen? Oder geht es um mehr? Um ein Leben in Würde, ein Leben ohne Angst, ein Leben in Sicherheit? Was wollen wir uns zumuten, um diese Errungenschaften zu verteidigen, rhetorisch und politisch im Inneren, notfalls militärisch nach außen? In Zeiten, in denen führende Politiker unablässig verkünden, dass es mehrere Milliarden brauche, um die deutschen Streitkräfte »kriegstüchtig« zu machen, und – ebenso selbstverständlich – 6,7 Milliarden Euro fordern, allein im Jahr 2025.
Die weltweiten Krisen und Konflikte hinterlassen ihre Spuren: Laut einer Umfrage zum »Bedeutungswandel von Werten«, das die GKF (Institut für Marktentscheidung) 2024 durchführte, sind 68 Prozent der Befragten der Meinung, dass Sicherheit mehr Bedeutung haben wird. Nur vier Prozent glauben, dass dieser Wert weniger wichtig sein wird. Damit liegt Sicherheit auf dem ersten Platz. Und Sicherheit meint nicht allein die persönliche, sondern auch nationale Sicherheit. Der Krieg in der Ukraine markiert eine »Zeitenwende«, so der Bundeskanzler, und die Mehrheit der Deutschen scheint zu akzeptieren, dass diese gesellschaftliche Wirklichkeit ihren Preis hat. Ein milliardenstarkes Hochrüstungspaket für die Verteidigung provoziert kaum Widerspruch. Jahrzehntelang war unser Land im pazifistischen Wolkenkuckucksheim angesiedelt, wir Deutschen hielten uns raus und verweigerten jegliches Nachdenken über militärische Wirklich- und Notwendigkeiten. Sicherheit und Freiheit, alles, was eine Demokratie zusammenhält, hielten wir für den normativen, staatlich garantierten Dauerzustand. Ganz so, als gäbe es darauf einen Rechtsanspruch.
Festzuhalten ist: Eine Demokratie ist eben mehr als eine Service-Einheit oder ein All-inclusive-Angebot zur freien Verwendung – möglichst kostengünstig und von der Steuer absetzbar. Wenn wir uns darauf verständigen können, dass Demokratie nicht das ist, worauf die Bürgerinnen und Bürger Anspruch haben, sondern etwas, das uns in Anspruch nimmt – dann sind wir demokratiefähig. Nicht behelligt zu werden, sich nicht interessieren zu müssen, sich auf die bloße Beobachtung zurückzuziehen, allein auf seine Work-Life-Balance, auf die korrekte Entsorgung des Bio-Mülls oder laktosefreien Joghurt zu achten, nicht aber auf den Zustand gesellschaftlicher Wirklichkeit – das ist keine Option. Demokratie verlangt und verdient mehr.
Sie ist eine Zumutung, weil sie andauernder, empathischer Zuwendung bedarf. Sie lebt von Teilnahme und Teilhabe, von Verpflichtung und Verantwortung. Vom ICH zum WIR – das ist die Formel, die sich eine demokratische Gesellschaft im besten Falle selbst auferlegt. Sie beruht auf den Werten: Freiheit und Gleichheit – und aus diesen Werten ergibt sich eine Logik der demokratischen Repräsentation, die mit Wahlen geregelt wird.
Wahlen sind nicht Voraussetzung der Demokratie, sie sind eine Konsequenz der Demokratie – und eine Folge der Diskussion darüber, wie das Zusammenleben einer Gesellschaft organisiert werden soll.
Zu unserer freiheitlichen Gesellschaft gehört, dass Menschen ihr Herz ungestraft an Dinge hängen dürfen, über die andere nur den Kopf schütteln können. Denn: Es gibt nicht nur eine Sicht auf die Welt, auf die Wirklichkeit und die Sinnhaftigkeit des Lebens – auf das Zweckmäßige, auf das Notwendige. Demokratie heißt: Weltanschauungs-Freiheit. Im Kern beinhaltet sie den Gedanken, dass Individuen zentrale Rechte besitzen: körperliche Unversehrtheit, Meinungs-Rede-Freiheit, Religionsfreiheit, Recht auf Eigentum. Die Instanz, diese Rechte zu schützen, ist der Staat. Wir nennen ihn Rechtsstaat. Unser Rechtsstaat ist aber nicht nur ein verbindliches Instrument zum Schutz des Individuums. Er ist auch Garant dafür, Interessengegensätze zu moderieren.
Statt einer Ethnie, einer Klasse oder einer Religion hier ein Monopol auf Wahrheit zuzusprechen, vertraut der Rechtsstaat auf die Stärke des produktiven Streits, auf die Stärke des besseren Arguments – und auf einen gesellschaftsbefriedenden Konsens. Auf der Basis absoluter Wahrheitsansprüche ist Demokratie gar nicht möglich: Über Wahrheiten lässt sich nicht abstimmen. Wahrheiten sind nicht mehrheitsfähig und Interessen sind nicht wahrheitsfähig.
Und weil Interessen nicht wahrheitsfähig sind, entschließt sich die Demokratie, die verbindliche Entscheidung nicht über Wahrheitsansprüche zu begründen, sondern durch Verfahrensregeln: Gelten soll das, was die Mehrheit für richtig hält. Und es gilt so lange, bis eine neue Mehrheit etwas anderes beschließt.
Unsere Verfassung formuliert das, was in einer Gesellschaft Geltung beansprucht, und dieser Geltungsanspruch gilt für alle und jeden, unabhängig davon, ob er am Entstehen dieser Überzeugung beteiligt war oder nicht, unabhängig davon, ob ihm diese besonders vorteilhaft oder eher schwierig oder lästig erscheint. Entscheidend sind ausschließlich die rechtlich formulierten, für alle verbindlichen, gegebenenfalls auch einklagbaren Geltungsansprüche einer Verfassung.
Und noch eine Differenzierung kann hilfreich sein: Demokratie ist nicht unbedingt Gemeinschaft. Demokratie ist vor allem Gesellschaft – also das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Interessen, Sichtweisen und Meinungen.
Unsere Verfassung ist Text und Ideal zugleich. Sie allein gibt den verbindlichen Rahmen unseres Zusammenlebens, unseres Gemeinwesens vor: nicht die Bibel, nicht der Koran – auch nicht die Vereinssatzung des FC Bayern München. Ja, es wird viel protestiert im Land: Zu sogenannten Montags-Demos und Bürger-Spaziergängen trifft sich – vor allem im Osten des Landes – eine zornige Bürgerschaft, die gegen alle Missstände und gegen alles vermeintlich Ungerechte dieser Republik lautstark und mitunter historisch ahnungslos das Ende einer »Berliner-Diktatur« fordert. Was geht hier vor? Wirklichkeitsignoranz, Demokratieverachtung oder Verschwörungsphantasma, im schlimmsten Fall ist es eine Melange aus allem. Corona-Kritiker mit Blumenketten, Künstlerinnen, die naturwissenschaftliche Erkenntnisse infrage stellen, Journalisten, die sich als Rebellen gegen angebliche Sprechverbote inszenieren. Eine wirre, wahnhafte Protest-Bürger-Polonaise …
Einerseits: Wir könnten alle diese Formen des Aufbegehrens und Protests als Zeichen einer vitalen Demokratie, einer intakten Zivilgesellschaft deuten … Es wird nicht zu viel gestritten und protestiert, allenfalls häufig zu niveaulos, zu vulgär, zu egomanisch, zu überheblich, zu geschichtsvergessen. Anderseits. Demokratie ist eine fragile Konstruktion. Demagogen, Populisten Verschwörungserzähler und Untergangspropheten jeglicher Couleur erkennen und nutzen ihre Chance, sie zu schwächen. Und viele folgen ihnen bereitwillig.
Politisches Versagen, gepaart mit Verantwortungslosigkeit, generiert Misstrauen. Und stärkt Populisten, vor denen uns die Politprominenz doch beständig warnt – um dann ihrerseits einiges dazu beizutragen, dass immer mehr Menschen den Glauben an die Politik und das Parteiensystem und vor allem an die Steuerungsfähigkeit der Politik verlieren. Die Mehrheit der demokratisch gesinnten Bürgerinnen und Bürger wissen, es muss sich vieles ändern. Zugleich wollen sie ihren alten Alltag zurück. Daher wächst das Misstrauen gegen »die da oben« und schleicht sich die Überzeugung ein, unsere Demokratie sei unfähig, die jetzigen Probleme zu lösen. Auf dieser Grundlage gibt es eine Annäherung an die Narrative von rechts außen.
Wo aber Vertrauen fehlt, entstehen Enttäuschung, Rückzug, Ignoranz. Es folgt Teilnahmslosigkeit. Geringe Wahlbeteiligungen sind deutliche Zeichen. Auch das Votum für populistische Parteien. In einer Insa-Umfrage vom Juni 2024 kommt die AfD bei den im September staatfindenden Landtagswahlen in Thüringen auf 30 Prozent. Zur Erinnerung: Der Vorsitzende der dortigen AfD heißt Björn Höcke. Kein guter Zustand. Aber nicht allein die Verweigerung, an Wahlen teilzunehmen, und ein zweistelliges Votum für eine nationalistische, demokratieverachtende Partei sollten uns sorgen. Ein neuer Protesttypus hat in den politischen Diskurs Einzug gehalten.
Ich nenne ihn den/die libertäre/n Autoritäre/n. Er oder sie verklärt politisch nicht die Vergangenheit oder sehnt sich nach der starken Hand des Staates, sondern streitet lautstark für individuelle Freiheiten. Etwa frei zu sein von Rücksichtnahme, von gesellschaftlichen Zwängen – und frei von gesellschaftlicher Solidarität. Dieser libertäre Autoritarismus ist eine Folge der Freiheitsversprechen der Spätmoderne: Mündig soll er sein, der Einzelne, dazu noch authentisch und hochgradig eigenverantwortlich. Gleichzeitig erlebt er sich als zunehmend macht- und einflusslos gegenüber einer komplexer werdenden Welt. Das wird als Kränkung erfahren und äußert sich in Ressentiment und Demokratiefeindlichkeit.
Der Ruf nach alleiniger individueller Souveränität aber ist eine Bedrohung für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen – und die Verleugnung einer geteilten Realität. In dieser Rolle – das darf man festhalten – gefällt sich der etablierte Mittelstands-Hedonist, beruflich erfolgreich, gut versorgt und von akuten Armutsängsten weitgehend verschont, auch er mischt munter mit – mit pauschaler Politikhäme und Demokratieverachtung. Populismus verfängt auch auf dem Golfplatz. Wir müssen aufpassen, welcher Auslöser den demokratischen Himmel verdunkelt. Gesellschaften können Zivilität lernen – und verlernen. Es gibt einen Prozess der Ent-Demokratisierung, der Ent-Solidarisierung, der nur schwer reversibel ist.
Ich bin in Frankfurt am Main aufgewachsen und politisch sozialisiert worden. In Frankfurt wurde und wird immer gestritten. Engagiert und leidenschaftlich. Laut und zornig. Intensiv und kreativ. Rauh und militant. An Anlässen herrschte kein Mangel: gegen Startbahn-West, für bezahlbaren Wohnraum. Für und gegen eine neue Altstadt, für eine andere Verkehrspolitik, gegen einen völlig überforderten Oberbürgermeister, der für die große Mehrheit eine Zumutung ist, aber sich selbst penetrant großartig fand. Jetzt hat ihn die Frankfurter Bürgergesellschaft abgewählt.
Streit gehörte und gehört zum Sound der Stadt. Und das ist gut so.
Streit ist – ob in Frankfurt oder anderswo – der Sauerstoff für eine offene, liberale Stadtgesellschaft. Dissens, Aufbegehren, Widerstand sind keine Untugenden in einer freien Gesellschaft, sondern deren Grundlage. Streit ist konstitutiv für die Demokratie – auf allen Ebenen: privat, kollektiv, institutionell. Unsere Demokratie lebt von der Kontroverse. Nur durch ständige öffentliche Debatte können wir die unterschiedlichen Interessen erfolgreich koordinieren. Nur im Streit klären wir, was uns als Gesellschaft wichtig ist, welche Werte wir grundsätzlich vertreten wollen und welche politischen Entscheidungen wir als Gesellschaft zu tragen bereit sind. Am Ende aber steht der Kompromiss. Er darf nicht der Anfangspunkt einer streitbaren Diskussion sein, sondern deren Endpunkt.
Freilich, nicht jeder Streit ist anregend, erhellend und klug. Vor allem auf digitalen Plattformen wird beleidigt, gepöbelt, denunziert und erniedrigt. Von links und von rechts – und auch aus der sogenannten schweigenden Mitte. Ein mitunter schwer erträglicher rechtsfreier Echoraum, in dem Hass-Tiraden als freie Meinungsäußerung reklamiert werden.
Ob es um Corona, den Klimawandel oder die Größe des Publikums bei den Montagsdemos geht, wir sollten »alternative Fakten« nicht leichtfertig als Versatzstücke einer Parallelwelt verstehen, sondern als gezielte Nebelkerzen im Kontext polarisierter Debatten. Sie wirken nicht als Beitrag zur Konstruktion einer alternativen Realität, sondern als kommunikative Realitätsdestruktion, die es erlaubt, wider besseres Wissen weiterzumachen wie bisher.
Auch in TV-Talkshow-Politrunden ist man gern auf Radau aus. Schon die Auswahl des Teilnehmerkreises folgt dieser Dramaturgie. Hier scheinen differenzierte Positionen weniger gefragt zu sein als laute Diskurs-Trompeten, die ihren Standpunkt möglichst schrill vorstellen. Der Volksmund sagt – möglicherweise aus gutem Grund: »Wer schreit, hat unrecht«. Wobei wir ebenfalls wissen: Auch im leisen, sanften Ton versteckt sich oft die gemeine Lüge, die rhetorische Falschmünzerei, die bornierte Besserwisserei …
Wie und wodurch aber kann ein produktiver, ein erkenntnisreicher, guter Streit entstehen? Das Formulieren der eigenen Position, der Haltung, der These, des Gedankens, also das Deutlichmachen, wofür man steht, ist der erste Schritt eines produktiven Streits. Wenn alle Beteiligten den gleichen Raum und die gleiche Aufmerksamkeit bekommen, dann kann ein guter Streit beginnen.
Hierzulande gilt der oft beschworene »Grundkonsens der Demokraten« als das stabilisierende Fundament der Nachkriegsrepublik. Statt Streiterei und Debatte wünscht man sich Kompromiss und Konsens. Aber Vorsicht: Zu viel – vor allem zu leicht und schnell erreichter – Konsens begünstigt schalen Opportunismus, er belohnt Kritiklosigkeit, er bedroht die Individualisierung des Denkens. Darum: Konformismus statt Pluralismus.
Doch Konsens ist kein Allheilmittel. Neues entsteht nur da, wo ausgeschert wird: aus eigener Denkfaulheit, eigenen Denkschablonen. Nicht im Konsens, sondern in der Freiheit, diesen Konsens immer wieder infrage zu stellen, liegt der normative Kern einer Demokratie. Streit ist systemrelevant.
Zu guter Letzt: Man möchte wohl, aber kann (und muss!) nicht – das wissen wir alle – mit jedem streiten. Fanatiker, Extremisten und Populisten hören ohnehin nicht gern zu. Sie interessieren sich nicht für die Meinungen anderer. Bewegen sich lieber in ihren abgeschotteten Echoräumen. Sie scheuen den Dialog. Sie sind Autisten. Man braucht nicht die Mühsal des Streitens auf sich zu nehmen, wenn keinerlei Dialog- und Kompromissbereitschaft bei den Beteiligten vorhanden ist. Mit Menschen zu diskutieren, die das Recht auf eine eigene Meinung mit dem Recht auf eigene Fakten verwechseln, macht die Angelegenheit eher mühsam und unergiebig.
Nicht alles, was sich als Toleranz ausgibt, genügt ihren Ansprüchen. Toleranz ist insofern eine besonders anspruchsvolle Haltung, da sie leicht zur Legitimation von Gleichgültigkeit werden kann. Toleranz beginnt mit der Wahrnehmung des Anderen, der anderen Überzeugungen, der anderen Interessen, der anderen Auffassungen und Meinungen. Eine Toleranz, die nur das eigene gesellschaftliche und politische Gesichtsfeld respektiert, ist wertlos und öde. Intoleranz und Denken im Gleichschritt – nichts ist schlimmer und wirkt demokratiefeindlicher.
Und kultiviertes, produktives, emphatisches Streiten? Es will gelernt, geübt und gepflegt werden. Demokratie ist eine Zumutung, lautete der erste Satz dieses Textes. Wir sollten darin ein Zukunftsversprechen sehen.
(August, 2022)
»Verquere« Freiheitskämpfer, besorgte Demokraten
Eine Eskalation mit Ansage: Es war im März 2020, da hatte eine Initiative »Querdenken 351« in Dresden zu einer Demonstration aufgerufen, und obwohl die Behörden aus Infektionsschutzgründen alle Kundgebungen untersagten, waren mehr als tausend Menschen gekommen. In Pulks liefen jeweils mehrere hundert Leute, die keinen Mund-Nasen-Schutz trugen und keinerlei Abstand einhielten, durch die Innenstadt. Sie schwenkten unterschiedlichste Fahnen, sangen und bildeten Polonaise-Schlangen. Der Polizei, die mit Unterstützung aus anderen Bundesländern sowie schwerem Gerät, darunter mehreren Wasserwerfern, angerückt war, gelang es nicht, das Treiben zu verhindern. Es blieb nicht bei verbalem Radau. Es kam zu Handgreiflichkeiten, Verletzungen, Verhaftungen. Und das nicht nur in Dresden, auch in anderen Städten gingen damals Menschen auf die Straße: »gegen Corona für die Freiheit«.
Acht Monate später, am 7. November, versammelten sich über 30.000 selbsternannte Querdenker aus der gesamten Republik in Leipzig, um das Ende der Pandemie auszurufen oder vielmehr zu fordern. Esoteriker marschieren neben Hooligans, Regenbogenfahnen flattern neben Reichkriegsflaggen. Ohne Maske, ohne Abstand, weder zum Nachbarn noch zu den Hunderten Nazis des rechtsextremen Netzwerks »Blood and Honour«. Hier trifft sich eine neue deutsche Volksgemeinschaft, die sonst kein Elend und keine Armut auf der Welt auf die Straße treibt, die sich aber nun unterdrückt fühlt und zum Widerstand aufruft. Gegen die »Merkel-Diktatur«, gegen Bill Gates, George Soros und die »Verschwörungen reicher Pädophiler«, die im Hintergrund angeblich die Fäden zögen. Neben rechtsradikalen Plakaten und antisemitischen Spruchbändern sind Leute zu sehen, die sich als KZ-Häftlinge kostümieren, um sich als die wahren Erben, als Kämpfer der Freiheit gegen »Diktatur und Faschismus« auszugeben. Sie skandieren: »Nie wieder!« und »Wehret den Anfängen!« So zieht die bunte Querfront-Polonaise, vollends von jeder Rationalität befreit, unter den Rufen von »Wir sind frei, Corona ist vorbei!« durch das Zentrum der Stadt. Ein Volksfest des kollektiven Wahns.
Eine Woche später treibt es die verqueren Freiheitskämpfer wieder auf die Straße, diesmal in Hannover. Eine junge, ebenso naive wie narzisstische Jana aus Kassel vergleicht sich auf der Bühne mit der von den Nazis ermordeten Sophie Scholl. »Ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten hier aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlungen anmelde«, ruft sie mit brüchiger Stimme. Sie will niemals aufgeben, sich für »Freiheit, Frieden, Liebe und Gerechtigkeit« einzusetzen. Beifall und Jubel aus dem Publikum. Der New York Times ist das sogar einen Beitrag wert. Im Artikel heißt es, ihre Rede sei das »jüngste Beispiel« von Anti-Corona-Demonstranten und Verschwörungserzählern, die ihren Protest mit der Unterdrückung und Ermordung der Juden durch die Nazis gleichsetzten. Erwähnung findet auch eine Elfjährige, die sich bei einer Querdenker-Sause am Mikrophon mit Anne Frank verglich, weil sie ihren Geburtstag aus Angst vor den Nachbarn angeblich hatte geheim halten müssen. Man fühlt sich in Zeiten zurückversetzt, als sich der nazikontaminierte Hitler-Durchschnittsdeutsche selbst gern als Nazigegner und Widerstandskämpfer eingestuft sehen wollte. Es scheint, dass in Pandemie-Zeiten viele Menschen sich selbst den Status eines Widerstandkämpfers wie einen Orden anheften. Die Folge davon: »Außer in Zeiten der Entnazifizierungs-Verhöre gab es noch niemals so viel Widerstandskämpfer wie in den letzten Jahren«, wie Karl-Markus Gauß in der Süddeutschen Zeitung konstatiert.
Eine bizarre Wahrnehmung der Wirklichkeit. Bislang galt Geschichtsklitterung in der bundesrepublikanischen Nachkriegsrealität als Terrain rechtsradikaler Wirrköpfe und Ewig-Gestriger. Dann kam die AfD. Mit ihrem Einzug in Landesparlamente und den Bundestag bekam das Rechts-Milieu eine parlamentarische, öffentlichkeitswirksame Bühne. Was folgte, waren kalkulierte Tabubrüche und gezielte Provokationen, etwa Björn Höckes Gerede von einer »erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad« oder Alexanders Gaulands »Vogelschiss«-Verharmlosung der Nazidiktatur. Historische Demenz, Ignoranz oder böse Absicht? In jedem Fall eine trübe Melange aus allem. Die AfD findet nicht nur ihre Wähler – vor allem im Osten der Republik –, sondern kann sich auch über flächendeckende Zustimmung jenseits von Wahlen freuen. Auch wenn der Verfassungsschutz Teile der Partei mittlerweile unter Beobachtung stellt, finden viele Deutsche diese Partei nicht gefährlich und unappetitlich, sondern fühlen sich von deren »Lautsprechern« politisch angemessen vertreten. Ein irritierender Befund.
Was geht da vor, wenn sich ältere Ewig-Gestrige und Verblödet-Heutige – beide frei von historischer Bildung – als Retter der Demokratie aufspielen? Natürlich verharmlosen sie alle auf grässliche und beschämende den Nationalsozialismus. Sie heften sich Judensterne an ihre modischen Anoraks auf denen »Ungeimpft« oder »Jesund« steht. Dauerempörte »Kämpfer der Freiheit« beanspruchen, Opfer zu sein. Sie fühlen sich vom Staat getäuscht, reglementiert, verfolgt. Dabei haben sie mit keinerlei staatlicher Repression zu rechnen. Die einzige, schwer erträgliche Gängelung: Den genehmigten Demonstrationsweg durch die Innenstadt müssen sie einhalten, Ein-Meter-Abstand plus Masken. Ächtung droht in allenfalls in milder Dosierung. Tuchfühlung mit der Staatsmacht gibt es lediglich, wenn ein Mob im Kampf gegen die Corona-Diktatur am Rande einer Demonstration versucht, ins Berliner Reichstagsgebäude einzudringen. Doch das gelang nur bis zur Aufgangstreppe, dann drängten Polizisten die militanten Wirrköpfe zurück. Der Wutmensch ist der politische Phänotyp der Stunde. Seine politische Chiffre reicht von links bis rechts, von esoterisch bis vollends wirr. So wie der Fußball-Hooligan sich nicht primär für das Fußballmatch interessiert, so interessiert den Polit-Hooligan nicht so sehr die politische Debatte. Seine Wut speist sich aus einer Wirklichkeitsverleugnung, konserviert und aktiviert in kollektiven Echoräumen.
In den düsteren Zeiten der Pandemie scheint bei vielen Demonstranten einiges verloren gegangen zu sein: erst die Vorsicht, dann die Vernunft – schließlich auch das Vertrauen in die Politik. Sie misstrauen einem Staat, von dem sie behaupten, er werde als Nächstes eine »Corona-Diktatur« errichten, angeführt von der »Putschistin« Angela Merkel und dem »Obristen« Olaf Scholz. Wo Misstrauen im Überfluss produziert wird, grassiert rasch der Verdacht, die ganze Existenz staatlicher Institutionen könne am Ende vielleicht nur eine gigantische Täuschung sein, hinter der sich finstere Eliten verbergen. Eine extreme Ausformung, die in den psychopathologischen Bereich geht, erleben wir in »Bewegungen« wie dem durchgeknallten »Q-Anon«-Glauben, wonach gewaltige und geheime Drahtzieher unter der Oberfläche der Gesellschaft ein verbrecherisches Regime führen. Das wiederum treibt Verwirrte, die alle möglichen Beschwernisse und Unglücke des Lebens stets irgendwelchen organisierten Mächten zuschreiben möchten, auf die Straße. Sie wähnen sich moralisch absolut »auf der richtigen Seite«.