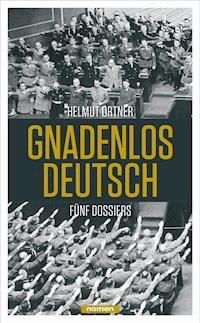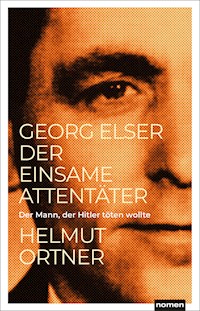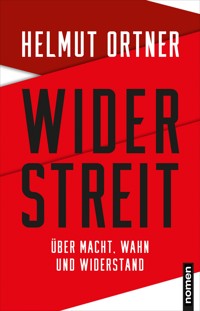Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Faust
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Buch gegen das Vergessen Selbst der bedeutendste Kurzkommentar zum Grundgesetz wurde von einem wichtigen Nazi-Juristen mitverfasst. Eine echte Entnazifizierung hat es nie gegeben. Ortners Recherchen sind erhellend – und empörend. Deutschland in den Nachkriegsjahren – ein "entnazifiziertes" Volk müht sich, das zu vergessen, was es verschwieg: seine Bereitschaft zur Teilnahme an einem System der Barbarei. Geschichtsverleugnung und Geschichtsumdeutung hatten Hochkonjunktur. So verloren sich der Schrecken und die Einzigartigkeit:Der nationalsozialistische Wahn wurde zur austauschbaren Metapher des Bösen, persönliche Schuld relativiert. Die Befreiung der Deutschen von ihrer Vergangenheit gehört zur Gründungsgeschichte der Bundesrepublik. Das Geflecht der kollektiven Lebenslüge in der Adenauer-Republik: Verdrängen, Vergessen, Verleugnen. Helmut Ortners Dreizehn Erkundungen sind eine erhellende Synthese aus Erinnerung, Erkenntnis und Erzählung – mal analytisch, mal essayistisch, mal dokumentarisch. "Hellsichtige, politische Essays" Focus
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Auflage 2022
© Edition Faust, Frankfurt am Main 2022
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Kopien, Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
www.editionfaust.de
Lektorat: Regine L. Strotbek, Frankfurt
Satz: Uwe Adam, Adam-Grafik, Freigericht
ISBN 978-3-949774-04-1
eISBN 978-3-949774-08-9
Helmut Ortner
VOLK IM WAHN
Hitlers Deutsche oder Die Gegenwart der Vergangenheit
Dreizehn Erkundungen
»Der deutsche Täter war kein besonderer Deutscher.Was wir hier über seine Moral zu sagen haben,trifft nicht auf ihn speziell,sondern auf Deutschland insgesamt zu.«Raul Hilberg
»Es gibt kein Recht zu gehorchen.«Hannah Arendt
»Nein, das vergangene Geschehenist keineswegs abwesend in der Gegenwart,nur weil es vergangen ist.«Alfred Grosser
INHALT
Prolog | Die Gegenwart der Vergangenheit
1 | Die zweite Karriere des Roland Freisler
2 | »Aus Gründen der Abschreckung …«
3 | Der Mann am Fallbeil
4 | »Mein geliebter Führer!«
5 | Allein gegen Hitler
6 | Keine Stunde null
7 | Ein ehrenwerter Herr
8 | Mein Nachbar, der KZ-Mörder
9 | Ein furchtbarer Jurist
10 | Auschwitz in Detmold
11 | Verkannte Helden
12 | Entnazifizierte Juristen
13 | Er ist immer noch da! Popstar Hitler
Anmerkungen und Quellen
Literatur
Abdrucknachweise
Dank
PROLOG
DIE GEGENWART DER VERGANGENHEIT
Herbst 2021. In zahlreichen deutschen Großstädten versammeln sich selbsternannte »Querdenker«, um das Ende der Corona-Pandemie auszurufen beziehungsweise zu fordern. Esoteriker marschieren neben Hooligans, Regenbogenfahnen flattern neben Reichskriegsflaggen. »Wir sind das Volk«, rufen sie, alle ohne Maske, ohne Abstand – weder zum Nachbarn noch zu den Hunderten von Alt- und Jungnazis, die unter Parolen und Flaggen von »Pegida«, des »Dritten Wegs« und der AfD mitmarschieren. Eine neue deutsche Volksfront trifft sich hier, die sonst kein Elend und keine Armut auf der Welt auf die Straße treibt, die sich aber nun unterdrückt fühlt und zum Widerstand aufruft. Gegen die »Merkel-Diktatur«, gegen Bill Gates, George Soros und allerlei finstre Verschwörungen reicher Pädophiler, die im Hintergrund angeblich die Fäden ziehen.
Neben rechtsradikalen Plakaten und antisemitischen Spruchbändern sind Leute zu sehen, die sich als KZ-Häftlinge kostümieren, um sich als die wahren Erben, als Kämpfer gegen »Diktatur und Faschismus« auszugeben. Manche haben sich gelbe Sterne an ihre modischen Anoraks geheftet, auf denen Ungeimpft oder Jesund steht. Selbsternannte »Kämpfer der Freiheit« beanspruchen, Opfer zu sein. Sie fühlen sich vom Staat reglementiert und verfolgt. Dabei haben sie mit keinerlei staatlicher Repression zu rechnen. Sie skandieren »Nie wieder!« und »Wehret den Anfängen!«. Volksfeste des kollektiven Wahns.
In Hannover vergleicht sich eine junge Frau auf einem »Widerstandsfestival« mit der von den Nazis ermordeten Sophie Scholl. »Ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten hier aktiv im Widerstand bin«, verkündet sie unter dem Beifall der Querdenker-Gemeinde. Das war sogar der New York Times einen Beitrag wert. Im Artikel hieß es, die Rede dieser Frau sei das jüngste Beispiel von Anti-Corona-Demonstranten und Verschwörungserzählern, die ihren Protest mit der Unterdrückung und Ermordung der Juden durch die Nazis gleichsetzten. Man fühlte sich in Zeiten zurückversetzt, als sich der nazikontaminierte Hitler-Durchschnittsdeutsche gerne selbst als Regimegegner und Widerstandskämpfer eingestuft sehen wollte. Nun wollten allerlei querdenkende Menschen sich selbst den Status eines Widerstandskämpfers anheften. Eine bizarre Wahrnehmung der Wirklichkeit. Auf grässliche und beschämende Weise wird der Nationalsozialismus verharmlost.
Bei einer Veranstaltung zum 20. Juli erinnert Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in der Gedenkstätte Berlin-Plötzensee an das Attentat auf Hitler. Wehrmachtsoffizier Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Mitstreiter hatten versucht, den Diktator mit einem Bombenattentat zu töten und das NS-Regime zu stürzen. Die Widerstandskämpfer scheiterten und wurden hingerichtet. Der SPD-Politiker hat nun, 77 Jahre nach dem Attentat, eine wichtige Botschaft: »Der Missbrauch des Widerstands gehört längst zum geschmack- und geschichtslosen Narrativ eines bestimmten politischen Milieus in Deutschland.«
Nicht allein verschwörungsbewegte Querdenker sind damit gemeint. Spätestens seit dem Einzug in Landesparlamente und den Bundestag hat das Rechtsmilieu eine parlamentarische Bühne und ein öffentlichkeitswirksames Podium, auf dem kalkulierte Tabubrüche und gezielte Provokationen – etwa Björn Höckes Gerede von einer »erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad« oder Alexander Gaulands »Vogelschiss«-Verharmlosung der Nazi-Diktatur – regelmäßig und absichtsvoll erfolgen. Im November 2021 beendet Höcke eine Wahlkampfrede mit den Worten: »Alles für Deutschland.« Weil es aber strafbar ist, diese Formulierung im Rahmen einer Rede auf einer Versammlung zu verwenden, da es sich hierbei um eine Losung der NS-Organisation SA handelt, hebt der Thüringer Justizausschuss die Immunität des AfD-Fraktionschefs auf. Hintergrund ist ein Begehren der Staatsanwaltschaft Halle aus dem Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt. Der dortige Grünen-Vorsitzende Sebastian Striegel hat Strafanzeige gegen den AfD-Mann erstattet. Der reagiert darauf bei Facebook wie folgt: »Dass mich ein antideutscher Grüner wegen dieser Passage angezeigt hat, verwundert mich nicht – der Selbsthass treibt wundersame Blüten.« Die Wortkonstruktion »antideutsch« gehört wie die Verwendung des Begriffs »Volkswiderstand« zum rhetorischen Arsenal der Rechten: gegen die »Impfdiktatur«, gegen die »Lügenpresse«, gegen die »Altparteien«, gegen das »System« – vor allem aber: »für Deutschland!«.
Was geht da vor, wenn sich Ewig-Gestrige und Verblendet-Heutige – beide frei von jeder historischen Bildung – als Demokratieretter und Widerstandskämpfer aufspielen? Historische Demenz, Ignoranz oder böse Absicht? Wohl eine trübe Melange aus allem.
Ortswechsel – ebenfalls im Herbst 2021: In Brandenburg an der Havel schleppt sich ein bald hundertjähriger Greis, mühsam gestützt auf seinen Rollator, durch die Flure des Gerichtsgebäudes. Eine mitleiderregende Szene. Seinen Kopf will er hinter einer blauen Mappe verstecken. Dann endlich, nach vielen anstrengenden Minuten, setzt er sich – und schweigt. Der Prozess beginnt mit Verzögerung. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Beihilfe zum grausamen und heimtückischen Mord in 3.518 Fällen zwischen 1942 und 1945 im Konzentrationslager Sachsenhausen vor. Seinen Dienst tat er, damals als Zwanzigjähriger, beim SS-Wachbataillon. Heute ist der Mann einhundert Jahre alt. Sein Verteidiger wiederholt ihm flüsternd einige Ausführungen des Staatsanwalts. Geplant sind 22 Verhandlungstage, die sich bis Anfang 2023 hinziehen werden. Verhandelt wird nur zwei Stunden am Tag. Der gesundheitliche Zustand des Angeklagten ist fragil. Es soll dennoch zügig vorangehen.
Der hundertjährige Josef S. ist nicht der einzige betagte Angeklagte, der von seiner Vergangenheit am Lebensende eingeholt wird. Im letzten Sommer stand der 93-jährige ehemalige Wachmann Bruno Dey in Hamburg vor Gericht und wurde der Beihilfe zum Mord in 5.232 Fällen für schuldig befunden, weil er von August 1944 bis April 1945 SS-Wachmann in Stutthof gewesen war. Er erhielt wegen seines Alters zur Tatzeit eine Jugendstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Vor wenigen Wochen sollte beim Landgericht Itzehoe gegen Irmgard F. verhandelt werden, 96 Jahre alt und einst Sekretärin des Lagerkommandanten, ebenfalls im Konzentrationslager Stutthof. Sie ist der Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen angeklagt. Laut Anklage soll sie zwischen Juni 1943 und April 1945 bei der systematischen Tötung von Gefangenen Hilfe geleistet haben. Die alte Frau war vor Prozessbeginn mit einem Taxi aus dem Pflegeheim geflohen, ehe sie von der Polizei in Haft genommen wurde. Jetzt saß sie – schützend mit Tuch und Schal verhüllt – auf der Anklagebank.
Der Prozess gegen Irmgard F. war nur ein weiterer Prozess gegen KZ-Bedienstete, in dem es nicht darum ging, der Angeklagten vorzuwerfen, selbst gemordet oder Morde befohlen zu haben, sondern darum, dass sie durch ihre Arbeit im Lager dazu beigetragen habe, die Mordmaschine in Gang zu halten. Eine Reihe weiterer Verfahren bei den Staatsanwaltschaften in Erfurt, Hamburg, Weiden sowie bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle steht an. Die Vorwürfe lauten jeweils auf Beihilfe zum Mord in einer Vielzahl von Fällen.
Diese Prozesse sind Beleg einer skandalösen Verspätung. Die Frage drängt sich auf: Wie lange soll man die Unterlassungen und Versäumnisse noch nachholen? Jahrzehntelang waren Verfahren nicht eröffnet oder beinahe routinemäßig eingestellt worden. Bestraft werden sollte nur, wer einer Beteiligung an ganz konkreten Morden überführt wurde. Es fehlte durchweg an gesetzgeberischen Signalen. Es fehlte das »Wollen«, NS-Täter, als diese noch keine Greise waren, vor Gericht zu bringen. Persönliche Schuld verschwand so im Dickicht von Beweisakten, Gutachten und Verteidigerstrategien.
Erst nach dem Urteil gegen John Demjanjuk, einen Wachmann, der als »ukrainischer Hilfswilliger« im Vernichtungslager Sobibór tätig war und 2011 in München verurteilt wurde, ist die Justiz nach jahrzehntelanger Untätigkeit wieder aktiv geworden. Wer als kleines Rädchen beim großen Massenmorden der Nazis dabei war, der kann seither auch ohne konkreten Tatverdacht wegen Beihilfe zum Mord angeklagt werden. Mord verjährt nicht.
Ein Hundertjähriger auf der Anklagebank? Können er und die anderen greisen Täter und Täterinnen begreifen, was sie an Schuld auf sich luden, als sie als junge Menschen bereit waren zur Teilnahme an einem Jahrhundertverbrechen? Kann die Justiz nach Jahrzehnten diese Verbrechen noch sühnen? Kann ein Gericht jemanden angemessen bestrafen für die Beteiligung an einem kollektiven System der Barbarei – dafür, am »reibungslosen Ablauf der Tötungsaktionen« teilgenommen zu haben? Vor allem aber: Kann den Opfern und ihren Hinterbliebenen überhaupt Gerechtigkeit, späte Wiedergutmachung widerfahren? Sind diese viel zu späten Anklagen und Prozesse tatsächlich mehr einer moralischen Symbolik als juristischer Rechtsstaatlichkeit geschuldet?
Der Berliner Journalist Ronen Steinke plädiert dafür, auch nach Jahrzehnten die Anklagen strafrechtlich zu verfolgen. »Es bedeutet nicht Härte, wenn man heute die grundlegendste rechtsstaatliche Regel, dass dieses Verbrechen mit der höchsten Strafe geahndet wird, mit vielen Jahren Verspätung doch noch ernst genommen sehen möchte«, so Steinke in einem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung (vom 16. November 2021). Dieser Argumentation hatte die langjährige Spiegel-Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen zuvor in der Weltwoche (vom 20. Oktober 2021) vehement widersprochen: Den Stutthof-Prozess lehne sie entschieden ab. An einer Sekretärin nachzuholen, was über Jahrzehnte vertuscht wurde, ähnele eher einer Selbstanklage der Justiz als ernstzunehmender Strafverfolgung.
Keine Frage: Die Nichtverfolgung von NS-Verbrechen ist beschämend, eine skandalöse Verweigerung von Strafverfolgung, eine konsequente Strafvereitelung im Amt. Dafür gehörte die Justiz auf die Anklagebank. Einige Zahlen: In den drei Westzonen und der Bundesrepublik wurde von 1945 bis 2005 insgesamt gegen 172.294 Personen wegen strafbarer Handlungen während der NS-Zeit ermittelt. Angesichts der monströsen Verbrechen und der Zahl der daran Beteiligten ist dies nur ein winziger Teil. Das hatte seine Gründe: Im Justizapparat saßen anfangs dieselben Leute wie einst in der NS-Zeit. Viele machten sich nur mit Widerwillen an die Arbeit. Auch politisch wurde auf eine Beendigung der Verfahren gedrängt, dafür sorgten schon zahllose Amnestiegesetze.
Zu Anklagen kam es letztlich gerade einmal in 16.740 Fällen – und nur 14.693 Beschuldigte mussten sich tatsächlich vor Gericht verantworten. Verurteilt wurden schließlich nicht mehr als 6.656 Personen, für 5.184 Angeklagte endete das Verfahren mit Freispruch, oft aus Mangel an Beweisen. Die meisten Verurteilungen – rund sechzig Prozent – beinhalteten geringe Haftstrafen von bis zu einem Jahr. Ganze neun Prozent aller Haftstrafen waren höher als fünf Jahre – vor dem Hintergrund eines der größten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte eine empörende Bilanz.
Kann persönliche Schuld verjähren? Nein, sagt Alfred Grosser, denn »das vergangene Geschehen ist keineswegs abwesend in der Gegenwart, nur weil es vergangen ist«. Der Respekt vor den Hinterbliebenen verpflichtet uns, die Schuld und die Schuldigen zu benennen, solange es noch möglich ist. Die Verbrechen von damals sind zu gewaltig, um heute zu sagen: Jetzt soll endlich einmal Schluss sein. Wann aber ist die Vergangenheit wirklich vergangen?
Ob es denn »notwendig« sei, heute noch über die nationalsozialistische Vergangenheit zu schreiben, wurde ich in den zurückliegenden Jahren immer wieder gefragt. Von Bekannten, die der Meinung sind, diese Vergangenheit sei inzwischen tatsächlich vergangen. Von Freunden, die argumentieren, auch eine so belastende Geschichte wie die unsere dürfe einmal zu Ende sein. Ich wies sie darauf hin, dass die meisten Deutschen – und es handelt sich hierbei keineswegs vor allem um die ältere Generation – noch immer nicht wahrhaben wollen, was ihre Väter und Großväter zwischen 1933 und 1945 angerichtet und zugelassen haben. Und ich versuchte an Beispielen zu zeigen, welche kollektiven und individuellen Anstrengungen unternommen – und unterlassen! – wurden, um der belasteten Geschichte zu entkommen. Dafür erntete ich häufig Unverständnis samt den bekannten Rechtfertigungen: Nicht alle seien Nazis gewesen, nicht alle hätten Schuld auf sich geladen, nicht allein die Deutschen Verbrechen begangen.
Die eingeübte Tonalität des Schlussstrichdenkens. Sicher: Am Tag null nach Hitler gab es auch hierzulande Menschen, die Scham und Trauer empfanden über das, was in den Jahren zuvor geschehen war. Doch Tatsache ist, dass schon damals weit mehr Menschen, gerade der Katastrophe entkommen, das Erlebte und Geschehene verdrängten, statt es im Bewusstsein der Verantwortung als eigene Geschichte anzunehmen. Ein Volk auf der Flucht vor der eigenen Vergangenheit. Damals – und heute?
Will die Nachkriegsgeneration, der ich angehöre und die, um den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl zu zitieren, mit »der Gnade der späten Geburt« gesegnet ist, nun endlich einen Schlussstrich unter eine belastete Vergangenheit ziehen? Ist sie, die politisch und moralisch schuldlose Generation, nun endgültig entlassen aus der Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur und ihrem Erbe? Oder beginnt nicht die Verantwortung nachfolgender Generationen bei der Frage, ob sie sich erinnern wollen?
Die Befreiung der Deutschen von ihrer Vergangenheit gehört zur Gründungsgeschichte der Bundesrepublik, sie begleitet die Anfangsjahre der Nachkriegszeit. Erst die politische Zäsur der 1960er Jahre sorgte für einen Paradigmenwechsel. Die Zeit war reif für neue Fragen hinsichtlich alter Wirklichkeiten: Anerkennen die Deutschen nun, was sie zwischen 1933 und 1945 angerichtet haben? Sind sie bereit, ein klares Bewusstsein dafür zu entwickeln, was geschehen war und wer dafür Verantwortung trug? War es nur eine verbrecherische Führungselite (in einer im Ganzen doch anständig gebliebenen Nation) oder gar allein Hitler, der große, »dämonische« Verführer? Dieser Mythologie, den Legenden von der sauberen Wehrmacht, vom »Nichtwissen« und »Nicht-dabei-gewesen-Sein«, wollten gern viele glauben. Geschichtsverleugnung und Geschichtsumdeutung hatten Hochkonjunktur – und alle beteiligten sich daran. So verloren sich der Schrecken und die Einzigartigkeit, die der Zivilisationsbruch des Holocaust und der Vernichtungskriege bedeuten, im kollektiven Verdrängen und Vergessen. Der nationalsozialistische Wahn wurde zur austauschbaren Metapher für das Böse, persönliche Schuld relativiert. An Hitler waren vor allem Hitler und »die anderen« schuld. Dominiert wurde die Nachkriegszeit von einem »kommunikativen Beschweigen« (Hermann Lübbe) der Schuldgefühle. Zu fest – und zu bequem – war die Sichtweise von einer skrupellosen Machtelite und einem angeblich verführten Volk etabliert. Hitlers Deutsche exkulpierten sich selbst.
Im Jahr 1948 wurde das Waschmittel Persil mit einer Zeichentrickreklame, in der ein Marine-Matrose schmutzige Pinguinbäuche wieder strahlend rein wäscht, beworben. Immer mehr Pinguine springen daraufhin an Bord und rufen im Chor »Persil – Persil – Persil!«. Dabei recken sie die Flügel wie weit ausgestreckte Arme. Mit stolzgeschwellter Brust defilieren sie schließlich in Reih und Glied an Land, zu Marschmusik singend: »Ja, unsere weiße Weste verdanken wir Persil!« Ein kleiner Reklamefilm als Beweis, dass die Deutschen ihren Humor nicht verloren oder aber bereits wiedergefunden hatten – und eine Metapher, die veranschaulicht, wie das Adenauer’sche Persilscheinwesen funktionierte.
Wenige Jahre nach Kriegsende war aus einem Volk von Jublern und Mitläufern ein Volk von Reinwäschern und Reingewaschenen geworden. Die Täter fühlten sich frei von Schuld und vom Schicksal entschuldigt, und die Mehrzahl der Deutschen tat es ihnen gleich. Empfanden sie, die Opfer und Täter zugleich waren und so viel Leid über andere Völker gebracht hatten, nicht so etwas wie Scham? Oder nahmen sie sich nur auf der Verliererseite wahr? Ein »entnazifiziertes« Volk mühte sich, das zu vergessen, was es verschwieg: seine Bereitschaft zur Teilnahme an einem System der Barbarei. Das Geflecht der Lebenslüge vieler Deutschen in der Adenauer-Republik bestand aus Verdrängen, Vergessen, Verleugnen.
Die meisten Deutschen wollten vom Holocaust, dem nationalsozialistischen Völkermord an mehr als sechs Millionen europäischen Juden, von der »Aktion T4«, der tausendfachen Ermordung Behinderter und »unwerten Lebens«, von den Massenerschießungen der Einsatzgruppen, die hinter den einmarschierenden deutschen Truppen für die »völkische« Flurbereinigung mordeten, also von Kriegsverbrechen, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, von schuldhaften Täterbiographien, kurz: vom moralischen und zivilisatorischen Desaster Hitler-Deutschlands, nichts mehr wissen. Aus der Politik gab es hierzu keine zwingenden Gesetzesvorgaben. Unter diesem Eindruck zeigte vor allem die Justiz nur wenig Neigung, ehemalige NS-Täter zur Verantwortung zu ziehen, zumal dort bekanntlich eine besonders starke personelle Kontinuität aus der NS-Zeit anzutreffen war. Die Bereitschaft, in NS-Strafsachen zu ermitteln und zu handeln, ging nahezu gegen null.
Nicht anders war es in der damaligen sowjetischen Besatzungszone, der späteren DDR. Dort wurde die nationalsozialistische Vergangenheit per Parteibeschluss doktrinär entsorgt. Zum Gründungsmythos des Arbeiter- und Bauernstaates gehörte der verordnete »Antifaschismus«. Noch lebende »Faschisten« wurden der Parteilogik gemäß allesamt im Westen geortet – oder auf dem stillen Dienstweg lautlos integriert und politisch exkulpiert. So konnten auch in der DDR ehemalige NS-Parteigänger und Funktionseliten wieder Karriere machen. Voraussetzung war nun eine robuste antiwestliche, sozialistische Grundeinstellung.
Auf den folgenden Seiten geht es um Täter, Komplizen und Zuschauer. Um Fanatiker, Mitläufer, Wegseher, Denunzianten, Karrieristen und Opportunisten – kurzum: um Hitlers Deutsche. Es geht um Schuld und Sühne, um Versagen und Feigheit.
Wo es Täter gibt, gibt es Opfer. Wo es viele Täter gibt, gibt es viele Opfer. Die Aufsätze und Texte in diesem Band befassen sich immer auch mit deren Lebensgeschichten und Schicksalen, mit deren Mut, Verzweiflung und Widerstand. Ein umfangreiches Kapitel dokumentiert exemplarische Todesurteile gegen Nazi-Gegner. Urteile als stumme Zeugen einer gnadenlosen Justiz.
Dreizehn »Erkundungen«, selektiv und doch exemplarisch. Bei den Recherchen habe ich mit vielen – vielleicht den letzten – Zeitzeugen gesprochen. Mit Menschen, die vor dem Volksgerichtshof standen, zum Tode verurteilt waren und allein deshalb überlebten, weil das Kriegsende der Vollstreckung zuvorkam. Mit Menschen, die als Richter Nazi-Gesetze anwandten, erbarmungslose Urteile sprachen, nicht selten mit tödlichen Konsequenzen für die Verurteilten. Mit ehemaligen KZ-Wächtern und Parteifunktionären, die – so mein Eindruck – nicht selten mit dieser Vergangenheit trotzdem gut leben konnten. Sie sahen sich oftmals als Opfer einer »schicksalhaften Zeit«. Eine nur schwer erträgliche Selbstgefälligkeit.
Mit der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs und dem Holocaust begingen die Nazis beispiellose Verbrechen. Das Bekenntnis »Nie wieder«, das die nachfolgende Generation moralisch dazu anhält, »Lehren« aus der NS-Diktatur zu ziehen und dafür zu sorgen, dass sich diese Menschheitskatastrophe nie mehr wiederholt, galt in der Nachkriegszeit lange als Mahnung. Es hat auch in der Gegenwart Gültigkeit.
»Im Umgang mit dem Nationalsozialismus haben die Deutschen manches geleistet, sie sind aber auch vielen Illusionen erlegen. Heute droht eine Vergangenheit, die umso häufiger beschworen wird, je weniger man von ihr weiß, den Blick auf die Gegenwart zu verstellen«, konstatiert Per Leo.
Im Hinblick auf die neue Leichtfertigkeit sind die nachfolgenden »Erkundungen« für die Gegenwart gedacht: Gegen das Vergessen! Denn nicht das Vergessen, sondern die Erinnerung macht uns frei.
Helmut Ortner
im Frühjahr 2022
1
DIE ZWEITE KARRIERE DES ROLAND FREISLER
Freitag, 17. November 1944. Ein geschlossener Kastenwagen bringt die 21-jährige Margot von Schade gegen zehn Uhr morgens vom Berliner Untersuchungsgefängnis Moabit hinüber in die Bellevuestraße – zum Volksgerichtshof. Schweigend sitzt sie zwei Frauen gegenüber: der 23 Jahre alten Barbara Sensfuß und der vierzigjährigen Käthe Törber. Für alle lautet die Anklage auf »Wehrkraftzersetzung«. In wenigen Stunden beginnt die Gerichtsverhandlung. Was hat man mit ihnen vor? Was erwartet sie? Am Vormittag erst hatte man Margot von Schade und den beiden anderen Frauen mitgeteilt, dass an diesem Tag der Prozess stattfinden würde. Jetzt, auf der Fahrt durch die Berliner Straßen, die sie nur skizzenhaft über dem Rücken des Fahrers durch die Frontscheibe wahrnimmt, fühlt sie sich elend. Und allein. Sie denkt an ihre Familie: die Mutter, den Stiefvater, die Schwester. Wo sind sie jetzt? Sie hat Angst.
Eine Stunde später: ein großer Saal, die Wände kalkweiß. Vor dem Richtertisch drei Stühle – die Stühle für die Angeklagten. Daneben, links und rechts aufgereiht, uniformierte Wachbeamte. Sie wirken einschüchternd: »Hier gibt es kein Entrinnen« spricht aus ihren Gesichtern. An der Stirnseite des Saals, unübersehbar – von der Decke bis zum Boden – eine blutrote Hakenkreuzfahne. Davor, auf einem schmalen Sockel, die Bronzebüste Hitlers.
Margot von Schade starrt wie hypnotisiert auf das riesige rote Tuch. Es wirkt bedrohlich auf sie. Sie blickt kurz in die Zuschauerbänke.
Eine anonyme Masse. Braune und schwarze Uniformen. Sie nimmt dumpfes Stimmengemurmel wahr. Alles bleibt schemenhaft, unwirklich. »Aufstehen« – der militärische Kommandoton eines der Wachbeamten durchdringt den Gerichtssaal. Schlagartig herrscht Ruhe. Die Tür an der Seite des Richtertischs geht auf. Das Gericht tritt ein. Rote Roben, rote Baretts, graue und schwarze Uniformen – die Beisitzer. Vorneweg der Vorsitzende: Freisler. Sie schaut ihm direkt ins Gesicht. Ihre Blicke treffen sich für einen Moment. Er sieht kurz auf seine Armbanduhr. Die Verhandlung beginnt.
Margot von Schade verfolgt das Tribunal wie in Trance. Später, sie weiß nicht mehr, wie viel Zeit mittlerweile verstrichen ist, schreckt sie hoch.
»Angeklagte Schade! Aufstehen!« Freislers schneidende Stimme ist unüberhörbar. Punkt für Punkt verliest er die Anklage. Nein, er liest nicht – es erhebt sich ein einziges Gebrüll. Nach dem »gemeinen und hinterhältigen Attentat vom 20. Juli auf unseren Führer«, führt er voller Pathos und mit theatralischem Gestus aus, habe sich die Angeklagte öffentlich zersetzend geäußert. Nachdem die Sondermeldung über »die wundersame Errettung des Führers« über den Rundfunk verbreitet worden sei, habe sie abfällig bemerkt: »Pech gehabt …« Damit nicht genug. Die »verbrecherischen Offiziere, die den Anschlag ausführten«, seien, so habe die Angeklagte öffentlich behauptet, »nicht feige gewesen, sondern hätten im Gegenteil Mut gezeigt«. Ein Raunen des Entsetzens geht durch die Zuschauerreihen. Es schwillt an, als Freisler mit vor Empörung bebender Stimme ein Wort aus der Anklageschrift zitiert, das jedem strammen Nationalsozialisten geradezu als Ausbund der Verkommenheit erscheinen muss: »Scheiß Gefreiter« habe dieses verkommene Mädchen den Führer tituliert – »unglaublich«! Freisler gerät außer sich.
Sein fanatischer Blick ist auf Margot von Schade gerichtet. Sie schaut zu Boden. Wie soll sie gegen diesen geifernden Monolog ankommen, wie sich Gehör verschaffen? Wie verteidigen? Schafft sie es einmal, die Worttiraden Freislers zu durchbrechen, wird sie nach wenigen Sätzen barsch zurechtgewiesen. Gibt es denn hier im Saal niemanden, der mir hilft? Wo ist denn meine Verteidigerin? Margot von Schade fühlt sich ohnmächtig. Ausgeliefert. Allein gelassen.
Schon vorhin, bei der Vernehmung der beiden Mitangeklagten, die hier aber als Belastungszeuginnen gegen sie auftraten, hatte sie so viel sagen wollen. Erzählen, wie es wirklich war. Schildern, was tatsächlich geschah, damals, nach dieser Rundfunkmeldung am 20. Juli. Doch Freisler hatte ihr das Wort entzogen. Da saßen nur wenige Schritte von ihr entfernt die beiden Frauen, die einst ihre Vertrauten waren und die nun alle Schuld auf sie abwälzten. Sie wollten ihre Haut retten, sonst nichts. Margot von Schade spürte, dass bei diesem Tribunal jede Denunziation willkommen war. Es sollte ein Lehrstück sein für alle Zuschauer im Saal, damit sie sehen und erleben konnten, wie es jemandem ergeht, der sich außerhalb der »Volksgemeinschaft« stellt. Wie im Zeitalter der Hexenverfolgung, dachte sie. Und ich bin hier die Hexe. Freigegeben zum Verbrennen …
Irgendwann, sie war längst müde geworden und konnte diesem makabren Schauspiel nicht mehr folgen, vernahm sie die monotone Stimme ihrer Verteidigerin. Ihr Schlussplädoyer klang routiniert, gleichgültig. Aber war es überhaupt »ihre« Verteidigerin? Nein, ihr Vertrauen hatte diese Frau nicht. Wie auch? Gerade einmal – und nur wenige Minuten lang – hatten sie vor diesem Prozess in der Haftanstalt miteinander gesprochen. Diese Anwältin wusste nichts von ihr, wollte nichts von ihr wissen. Für sie war es ein »Fall« wie viele andere, den sie routiniert und verfahrensgemäß erledigte, ein Aktenvorgang. Nichts sonst. Als Pflichtverteidigerin war sie vom Gericht engagiert worden. Und sie tat hier ihre Pflicht, wie man es von ihr erwartete.
Jetzt, wo das kalte Tribunal dem Ende zugeht, spürt Margot von Schade, wie sehr sie in Gefahr ist. In den vergangenen Stunden musste sie erleben, wie ihre beiden Mitangeklagten vom Gericht als »verführte«, aber »im Kern« doch redliche Volksgenossinnen behandelt wurden; wie deren Verteidiger entlastende Argumente vortrugen, ja sogar Freisler verständnisvolle Worte für das Verhalten der beiden fand.
Ganz anders bei ihr. Von Beginn an schlug ihr die gereizte Ablehnung Freislers entgegen. Warum nur? Weil sie adliger Herkunft war? War nach dem 20. Juli jeder Mensch, der in seinem Namen ein »von« trug, bereits ein Mitverschwörer von Stauffenbergs? Traf sie die ganze Härte Freislers, weil sie in ihren Antworten jene Einsicht vermissen ließ, die er von ihr reumütig erwartete?
Gedanken wie diese gingen ihr durch den Kopf. Hatte nicht Freisler vorhin mit zynischer Attitüde gesagt: »Das ist die Familie, die Umgebung, der die Angeklagte entstammt«? Hatte er nicht mit gespielter Entrüstung gegeifert: »Sage mir, mit wem du verkehrst, und ich sage dir, wer du bist.« Alles war gegen sie verwendet worden, selbst der Brief, den ihre Schwester Gisela ihr in die Zelle geschickt hatte und der selbstverständlich von den Beamten abgefangen und sogleich zum Belastungsmaterial genommen worden war. In diesem Brief hatte Gisela von einer geselligen Runde berichtet … getanzt hätten sie, getrunken … Freisler sah darin nur einmal mehr den Beweis für eine dekadente familiäre Herkunft, die alles war, nur nicht so, wie sie in diesen schweren Zeiten einem guten Deutschen anstand. Diese junge Margot von Schade, diese aufmüpfige Göre, die sich erdreistet hatte, den Führer in »schamlosester Weise öffentlich zu beleidigen«, die durch ihre zersetzenden Äußerungen das Misslingen des Attentats sogar bedauerte – an dieser niederträchtigen Person musste ein abschreckendes Exempel statuiert werden.
Das Gericht zog sich zur Beratung zurück. Ist nicht alles schon längst entschieden? Bedrückt, eigenartig erregt sitzt Margot von Schade auf ihrem Stuhl. Die Zeit scheint stehenzubleiben. Sie fühlt sich wie in einem Vakuum.
Irgendwann, Margot von Schade hat jedes Zeitgefühl verloren, betreten Richter und Beisitzer wieder den Saal. Die Urteilsverkündung. Freislers schneidende Stimme ist unüberhörbar:
»Angeklagte Sensfuß – Aufstehen! Freispruch! Angeklagte Törber – Aufstehen! Freispruch!«
Hoffnung keimt in ihr auf. Wenn die beiden Mitangeklagten freigesprochen werden, kann eigentlich auch ich mit einer Gefängnisstrafe davonkommen …
»Angeklagte von Schade – Aufstehen!«
Ihre Augen schauen nach vorn: rote Robe, rote Fahne … die Büste des Führers … »Wegen Wehrkraftzersetzung, Feindbegünstigung, defätistischer Äußerung und Landesverrat verurteile ich Sie zum Tode!«
Todesurteil? Für mich? Das kann nicht sein. Ich bin keine Kriminelle, keine Mörderin.
Todesurteil? … Während Freisler die Begründung des Urteils verliest, bemüht sie sich, die ungeheure Tragweite des Richterspruchs in ihrem Bewusstsein zu verarbeiten. Todesstrafe? Soll es plötzlich zu Ende sein? Wegen leichtfertiger Sprüche in einer geselligen Runde? Die beiden Bekannten waren doch auch dabei, haben gelacht, Späße gemacht.
Warum werden sie freigesprochen? Warum soll ich getötet werden? Todesstrafe für mich? Unmöglich! Sie sucht das Gesicht ihres Stiefvaters. Sie weiß, dass er unter den Zuschauern ist. Ist es wahr? Stimmt es? Soll ich, muss ich sterben? Soll dieser 17. November wirklich mein Schicksalstag sein? Wartet nur noch das Fallbeil auf mich?
Margot von Schade, die heute Margot Diestel heißt, hat überlebt. Das vorzeitige Ende des »Tausendjährigen Reichs« hat ihr das Leben gerettet. Zur Hinrichtung war es infolge des russischen Vormarsches nicht mehr gekommen. Als Todeskandidatin hatte sie die Luftangriffe in ihrer Gefängniszelle, die qualvolle Verlegung von Berlin in das Gefängnis im sächsischen Stolpen überstanden, dorthin, wo ein mutiger Wachbeamter in den letzten Kriegstagen den Befehl verweigerte, die Insassen vor dem Eintreffen des herannahenden Feindes zu erschießen. Stattdessen stellte er – die russischen Truppen standen bereits unmittelbar vor der Stadt – Entlassungsscheine aus: »Margot von Schade wird mit dem heutigen Tage entlassen.« Stempel, Unterschrift, Datum. Es war der 3. Mai 1945. Vier Tage später unterzeichnete Generaloberst Jodl in der westfranzösischen Stadt Reims die deutsche Kapitulation. Der Krieg war zu Ende.
Viele Jahre später begann Margot von Schade – eine der wenigen Davongekommenen – ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben. Ihre Jugend, die Denunziation, die Verhaftung, das Todesurteil am Volksgerichtshof, den zermürbenden Leidensweg durch die Gefängnisse, die ständige Todesangst – davon wollte sie eigentlich nur ihren Enkelkindern erzählen. Sie sollten erfahren, was sich zugetragen hatte in Deutschland.
Margot Diestel sieht sich rückblickend nicht als Widerstandskämpferin – nein, das war sie nicht. Aber sie hat schon in jungen Jahren erkannt, was die Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland und der Welt anrichtete. »Als einundzwanzigjähriges Mädchen in der dennoch friedlichen Stadt Demmin, manche Dinge wissend, viele ahnend, angefüllt mit Ekel gegen dieses verbrecherische System und so versehen mit einem frechen Mundwerk. So als lebten wir im tiefsten Frieden, als gäbe es keine Denunziation, keine Gestapo und keine Konzentrationslager – so rieb ich jedem meine Meinung unter die Nase«, erinnert sie sich. Ihre Unbekümmertheit sollte ihr beinahe das Leben kosten – im Namen des Deutschen Volkes. Die Urteilsbegründung, ein Dokument einer Terrorjustiz:
IM NAMEN DES DEUTSCHEN VOLKES!
In der Strafsache gegen die Bereiterin Margot von Schade aus Demmin, geboren am 27. März 1923 in Burg Zievrich (Krs. Bergheim a. d. Erft), wegen Wehrkraftzersetzung hat der Volksgerichtshof, 1. Senat, auf die am 30. Oktober 1944 eingegangene Anklage des Herrn Oberreichsanwalts in der Hauptverhandlung vom 17. November 1944, an welcher teilgenommen haben:
als Richter: Präsident des Volksgerichtshofs Dr. Freisler,
Vorsitzer Landgerichtsdirektor Dr. Schlemann,
SA-Brigadeführer Hauer,
NSKK-Obergruppenführer Regierungsdirektor Offermann,
Stellvertretender Gauleiter Simon,
als Vertreter des Oberreichsanwalts: Landgerichtsrat von
Zeschau
für Recht erkannt:
Margot von Schade hat die Meuchelmörder vom 20. Juli verherrlicht, das Misslingen des Mordanschlages auf unseren Führer bedauert, unseren Führer aufs Niedrigste verächtlich zu machen gesucht und in schamloser Selbsterniedrigung mit einem Russen sich »politisch« unterhalten.
Für immer ehrlos wird sie damit mit dem Tode bestraft.
Gründe:
So gibt sie zu, dass sie sich zum Attentat geäußert habe: »Pech gehabt!«, Pech gehabt nämlich, dass der Mordanschlag nicht glückte!!!
Das allein streicht sie aus unserer Mitte aus. Denn wir wollen nichts, gar nichts mehr gemein haben mit jemandem, der mit den Verrätern an Volk, Führer und Reich, die uns durch ihren Verrat unmittelbar in Schande und Tod geschickt hätten, wenn sie Erfolg gehabt hätten, sich solidarisch erklärt.
Margot von Schade hat aber, und das mag als Vervollständigung des Bildes ihrer Verworfenheit festgestellt werden, diese ihre gemeinen Äußerungen auf der Grundlage einer durch und durch verräterischen, ehrlosen Grundeinstellung getan.
Kein Wunder, dass sie, wie sie selbst zugibt, als sie und ihre Kameradinnen zum Gemeinschaftsempfang der Führeransprache gingen, das mit den Worten mitteilte:
»Herr Hitler spricht!« Der Zorn und die Scham muss doch jedem darüber hoch kommen, dass ein deutsches Mädchen sich, im Jahre 1944, so ausdrückt.
Wer in so schamloser Selbsterniedrigung als Deutsche derartige Gespräche mit einem Bolschewisten führt, wer derartig den gemeinsten Verrat unserer Geschichte verherrlicht, wer so unseren Führer verächtlich zu machen sucht – der beschmutzt dadurch unser ganzes Volk. Wir wollen mit jemandem, der mit der Treue seine Ehre, seine ganze Persönlichkeit derart atomisiert, für immer zerstört hat, aus Gründen der Sauberkeit nichts mehr zu tun haben. Wer so um sich Zersetzung verbreitet (§ 5 KSSVO), wer sich so zum Handlanger unserer Kriegsfeinde bei deren Bemühungen, in unserer Mitte Zersetzungsfermente zu entdecken, macht (§ 91 b StGB.), der muss aber auch mit dem Tode büßen, weil wir die Festigkeit der Haltung unserer Heimat, überhaupt unseres um sein Leben schwer ringenden Volkes unter allen Umständen schützen müssen.
Weil Margot von Schade verurteilt ist, muss sie auch die Kosten tragen.
gez.: Dr. Freisler, Dr. Schlemann
Über ein halbes Jahrhundert später. Steinhorst, ein Dorf in der Nähe von Hamburg. Ich sitze der Frau gegenüber, die damals in Berlin von Freisler zum Tode verurteilt worden war.
Wie fühlt sie sich heute beim Lesen ihres eigenen Todesurteils? Spürt sie Wut, hat sie Rachegefühle? »Nein«, schüttelt Margot Diestel den Kopf, »nur Lähmung und Enttäuschung. Fast alle Richter des Volksgerichtshofes kamen ja nach dem Krieg wieder in Amt und Würden. Keiner wurde zur Verantwortung gezogen oder verurteilt, und das ist deprimierend.«
Sie hat recht. Außer ein paar lästigen, aber ohnmächtigen Mahnern drängte im Nachkriegsdeutschland niemand darauf, sich mit den Mordtaten und Unrechtsurteilen der NS-Justiz auseinanderzusetzen. Am wenigsten die Justiz selbst.
Nur ab und an gab es Juristen, die sich nicht an den Korpsgeist hielten. Der ehemalige Berliner Justizsenator Gerhard Meyer gehörte zu dieser seltenen Spezies. In seiner Amtszeit wurde ein später (und letzter) Versuch justitiabler Vergangenheitsbewältigung im Oktober 1979 durch den Generalstaatsanwalt beim Kammergericht Berlin unternommen. Gegen 74 noch lebende ehemalige Angehörige des Volksgerichtshofs, darunter elf Richter, 48 Staatsanwälte und fünfzehn ehrenamtliche Richter, wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Doch schon zu Beginn war klar: Es ging nicht um die Feststellung, dass fast alle der am Volksgerichtshof erlassenen Todesurteile nichts mit unabhängiger Rechtsprechung zu tun hatten, sondern darum, dass sie schlicht nur eines waren: Verbrechen.
Sieben Jahre später, im Oktober 1986, wurden die Ermittlungen gegen die Juristen des Nazi-Todestribunals endgültig eingestellt. Damit stand fest, dass alle 5.243 Todesurteile, die Hitlers Volksgerichtshofrichter gefällt hatten, ungesühnt bleiben.
Meyers Nachfolger, der CDU-Mann Rupert Scholz, hielt die Tatsache, dass es kein Verfahren gegen diese ehemaligen Richter geben werde, für »nicht befriedigend und sehr bedauerlich für jeden, der an Gerechtigkeit glaubt«. Schöne, beruhigende Worte für etwas, was eine deutsche Schändlichkeit ist, an der Politik und Justiz gleichermaßen beteiligt waren.
Der Volksgerichtshof – eine gnadenlose Todesmaschinerie der Nazis, eine Waffe bei der Verfolgung der Gegner des totalitären Systems. Von 1942 bis 1945 fällten die fanatischen Richter im Durchschnitt