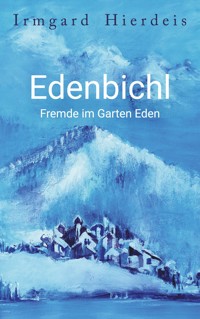
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Einwohner der Marktgemeinde Edenbichl sind stolz auf ihre schöne Landschaft: ein See vor der Haustüre, die Berge in Sichtnähe. Daß sie ihre Idylle mit zugezogenen "Preißn" und neuerdings mit jugendlichen Eritreern teilen müssen, gefällt den meisten Eingeborenen nicht. Besonders die "Stammtischler" geraten, wenn sie einige Biere intus haben, in verbale Ausfälle gegen die Flüchtlinge; schließlich waren sie vehement dagegen, daß die Gemeinde sieben unbegleitete Jugendliche in einem ehemaligen Gasthaus unterbringt. Die Ehrenamtlichen, die sich um die Asylanten kümmern, erhalten anonyme Briefe mit Beschimpfungen und Drohungen. Die Probleme eskalieren, als einer der fremden Teenager schwer verletzt in einem Gebüsch aufgefunden wird. Auf der Suche nach dem oder den Verdächtigen schießen wilde Vermutungen ins Kraut. Zu einer Festnahme der Schuldigen kommt es jedoch nicht. Ein Fahndungserfolg oder gar eine Verurteilung wird längere Zeit durch die persönliche Verstrickung und Eigenmächtigkeit des Ortspolizisten verhindert; ihm erscheint es wichtiger, den Delinquenten eine persönlich verordnete Buße aufzuerlegen, als gesetzestreu zu handeln. Wie sich die Täter als Wohltäter aufspielen und ihre wahren Motive verschleiern, wie die Polizei durch Untätigkeit und Vorurteile sich lähmt, wie das Schicksal des Opfers eine späte Genugtuung erfährt - das wird am Ende durch die Unbelehrbarkeit der Delinquenten und die späte Einsicht eines vordergründig barmherzigen Polizisten offenbar. Wer Heimat nicht als Privileg, sondern als ein Menschenrecht versteht, wird dieses Buch mit Teilnahme und Interesse lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
für Peter und Laurence
Zur AutorinIrmgard Hierdeis studierte Philosophie, Pädagogik, Germanistik und Romanistik, arbeitete als Gymnasiallehrerin und Herausgeberin einer Literaturzeitschrift. Neben wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema „Mädchenbildung“ und einer kommentierten Übersetzung der Werke von Poullain de la Barre veröffentlicht die Autorin seit 1983 Gedichtbände, Erzählungen und Romane. Dafür wurde sie mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Sie lebt am oberbayerischen Ammersee.
Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wären rein zufällig.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
1
Über den dichtgedrängten Dächern breitete sich das Abendrot aus. Es war kalt geworden, überraschend, denn noch am Heiligen Abend hatten alle vergeblich auf Schnee gewartet, auf einen Winteranblick, ohne den der Heilige Abend nicht wirklich heilig war.
Ein profanes Grün in den Gärten, karibisches, buntes Leuchten in den Hecken.
Und dann, kurz vor Silvester, doch noch Schnee! Warum nicht gleich? Warum jetzt erst, wo die Weihnachtsstimmung schon beim Teufel war, man schon überlegte, wie man den nadelnden Baum bald wieder loswerden könnte.
Besser jetzt als gar nicht, kommentierten die positiv Denkenden.
Also zogen die Kinder ihre Schianzüge an und werkelten mit der dünnen Schneeschicht, bis ein gebrechliches Schneemännchen im Garten stand.
Ella Hofmann sah aus dem Fenster, beäugte die zwei Töchter ihrer Nachbarn gegenüber, die den Rasen nach Schneeresten absuchten. Ein dürres Gestell hatten sie bereits direkt hinter der Gartentüre plaziert, mit einem Gebiß aus Kieseln und einer Karottennase. Es sah ihrem Nachbarn auf der anderen Seite, dem zahnlosen Huberbauern, ähnlich. Daß es noch solche Mundhöhlen gab, im 21. Jahrhundert, wo doch jeder krankenversichert war und sich neue Zähne auf Kosten der Kasse machen lassen konnte. Nicht so der Huberbauer, der alte Meckerer. Lieber brockte er sich Brot in den Kaffee, matschte die Kartoffeln zu Brei und mümmelte Hackfleischsoße, als daß er zum Zahnarzt gegangen wäre.
Wenn er den Mund aufmachte und seine dunkle Höhle präsentierte, dann stieß er Laute aus, die bedrohlich wirkten, weil sie zu seinem zornigen Gesicht paßten. Aber auch das harmloseste Wetter kommentierte er »grantig«, eine angeborene Eigentümlichkeit des bayerischen Charakters, die zu einem gestandenen Mannsbild ganz einfach dazugehörte. So wurde das meist freundliche und zähnebleckende Lächeln der Parteikandidaten auf den Wahlplakaten eher negativ bewertet.
Der hat’s nötig, so zu grinsen, der Depp! Warum sollte man so einen harmlosen Abgeordneten wählen? Ja, früher, als der Erhard mit Zigarre im schiefen Maul oder der Adenauer ernst vor seinen Rosen stand! Das waren noch wählbare Mannsbilder! Und gar der streitbare FJS! Wenn der auf einem Plakat gegrinst hätte! Mit der Faust auf den Biertisch hauen, das war nach Huberbauers Geschmack.
Ich mag gar nimmer wählen gehen, nuschelte er, es gibt keine echten Mannsbilder mehr! Und dann lassen sie sich auch noch von einem Ostweib rumkommandieren! Na, mia gangst, i need!
Wenn er sich so am Gartenzaun verbreitete, gesellten sich manchmal zufällig vorbeikommende Spaziergänger dazu, nickten ernst, gaben zustimmende Kommentare, die dann zunehmend in die Flüchtlingsfrage mündeten und sich über das Häuflein Afrikaner ereiferten, die man in einem baufälligen Gasthaus untergebracht hatte.
Ha, braucha mia de Eritreer bei uns da? Braucha ma dee?
Geh ma weida mit denen Nega, is ja scho wie im Urwald, wenn man einkaufen geht. Wenn das der Franz Josef noch erlebt hätte! Der hätt sie alle heimgegeigt!
Lebhaftes Nicken des Huberbauern und der Spaziergänger.
Ja, nix ist mehr wie früher!
Ella hörte von ihrer Terrasse aus zu. Sie hatte keinen Ehrgeiz, sich an den Klagen zu beteiligen. Es wäre ohnehin sinnlos gewesen, war sie doch eine der »Neig’schmeckten«, der nicht im Ort und nicht einmal in Oberbayern Geborenen, und also zählte sie nicht, mochte sie hier auch zwanzig und mehr Jahre wohnen, das spielte keine Rolle.
Auch daß sie Dialektforscherin war, mit Spezialgebiet: Vermischung des Schwäbischen mit dem Oberbayerischen, war für die Nachbarn völlig bedeutungslos. Schließlich beherrschten sie den Dialekt schon, und die arme Irre katalogisierte ihre Wörter, Sprichwörter, Redewendungen und Schimpfwörter – wozu?
Braucha mia dees?
Das war nichts anderes als akademischer Schnickschnack, oder wie es auf Bayerisch hieß, Krampf, den die Steuerzahler finanzierten.
Braucha mia a solchene Krampfhenna?
Wenn schon studiert, dann sollten sie in die Schule gehen und den Kindern Rechnen und Rechtschreiben beibringen! Aber dazu sind sie sich zu gut! Sie fuhren hin und wieder – aber nicht jeden Tag wie andere, ordentliche Arbeiter – nach München oder nach Augsburg an die Uni. Und was machten sie da? Hockten wahrscheinlich in den mit Steuergeldern beheizten Bibliotheken und jubelten, wenn sie wieder einen bodenständigen Ausdruck in einem alten Schmöker ausgegraben hatten.
Und gar der Ehemann dieser Ella! Was der machte! Ein Nestbeschmutzer! Der grub noch Übleres aus als seine Dialekt-Frau. Aufs Dritte Reich hatte der sich spezialisiert! Nach Verbrechen der eigenen Landsleute grundelte der! Verbieten sollte man das! Von Steuergeldern! Der lebte von Steuergeldern, unterrichtete sogar an der Uni. Was der den Studenten wohl erzählen mochte über ihre Groß-und Urgroßväter? Kein Wunder, daß die Jugend jeden Respekt vor ihren Ahnen und Eltern verlor.
Unser Vater, hörte man jetzt die Helga Rutzbichler, war bei der Wehrmacht, da hat er nach Rußland müssen und sich den Arsch abfrieren. Und dann, als er endlich aus der Gefangenschaft heimkam, ja der Adenauer, den sollt man heiligsprechen! – da kamen die Nestbeschmutzer daher und machten Ausstellungen mit Bildern, wo Soldaten angeblich Zivilisten umgebracht haben.
Jeder weiß doch, wie man solche Fotomontagen herstellen kann, erklärte ihre Freundin Hildegard Töpfert, die sich als selbsternannte Deutschlehrerin um einen Afghanischen Familienvater verdient machte, indem sie ihm die Hausaufgaben für den Sprachkurs schrieb.
Die versammelten Spaziergänger steckten die Köpfe zusammen.
Plötzlich sollen die Vaterlandsverteidiger alle als Mörder dastehen, ereiferte sich Erwin Prinzpuchler, ehrenamtlicher Pfarrhelfer und vertraut mit allen Interna des Ortes.
Und da sind wir wieder bei dem Herrn Professor, der sich an solchen Ausstellungen beteiligt hat und Ansprachen hält bei der Eröffnung.
Daß er sich nicht schämt. Wo war denn sein eigener Vater oder Großvater in Krieg? Da sollte man vielleicht auch mal nachforschen. Und dann steht er vielleicht auch als Mördersohn da, der Klugscheißer, meldete sich der Huberbauer wieder.
Haben die eigentlich Kinder? fragte Melanie Druckseder, dritte Vorsitzende des Hausfrauenvereins, von ihrem Mann Melanche genannt, weil sie aus der Pfalz stammte und stolz war auf ihre Herkunft aus einer Weingegend, im Gegensatz zu den Bierdimpfeln, die in Oberbayern den Ton angaben.
Doch, wußte der Nachbar von oberhalb, der Eberhard Gronseider, seines Zeichens pensionierter Finanzbeamter, einen Sohn haben sie, der war die letzten zwei Jahre im Weilheimer Gymnasium, vorher war er im Internat, irgendwo in England.
Die können sich so was leisten, so die neidige Helga.
Und wo ist er jetzt? fragte Hildegard
Angeblich in Amerika, wo er studiert., wußte der Eberhard.
Billig ist das nicht, stänkerte Helga wieder.
Was die mit ihrem Geschreibsel verdienen mögen. Den ganzen Tag am Schreibtisch, meins wär das nicht, sagte Melanie – und man glaubte es ihr.
Aber es bringt was, scheint’s, kommentierte Helga.
Erst vor ein paar Wochen war ein Bild von ihr in der Zeitung, und das neue Buch von ihr, ein Schimpfwörter-Beitrag irgendwo, wußte Eberhard.
Wie, irgendwo, wollte der Huberbauer wissen.
Halt nicht in Bayern, so Helga.
Daß die Preißn sich lustig machen über uns, das sieht ihr ähnlich, mischte sich jetzt der Michael Glaubitzer ein, der bisher nur zugehört hatte. Er wählte bisher, zusammen mit 12 Freunden aus dem Kriegerverein, zuverlässig die Bauernpartei.
Aber zum Einkaufen fahren sie nicht in die Stadt, jeden zweiten Tag fahren sie zum Gärtner, jedenfalls im Sommer, erzählte die aufmerksame Nachbarin Ingrid Rubenbauer, Mutter der beiden Töchter, von denen noch die Rede sein wird.
Die fressen halt Grünzeug, wählen wahrscheinlich auch die Grünen, vermutete Hildegard.
Die Grünen machen unsere Landwirtschaft kaputt, nuschelte der Huberbauer.
Was die sich einbilden!
Volkes oder Druckseder Erichs Stimme.
Selber nicht eine Kuh vom Ochsen unterscheiden können, aber groß das Maul aufreißen!
Dies die Stimme der Bauernpartei.
Das können sie, die Preißn, vermeldete Helga.
Aber die sind gar keine Preißn. Sie kommt aus Cham, ziemlich weit hinten, heute Oberpfalz, und er, mit seinem sanften G’schau, der ist ein Vilshofner, jedes a ist bei ihm ein o, da orgelt er im Maul sein niederbayerisches Gebräu rum, berichtete Ingrid, die Nachbarin von gegenüber.
Wenn er überhaupt was sagt, sagte Melanie.
Stimmt. So ein stiller, grad recht für so ein grobmäuliges Bayerwaldweib. Nicht einmal Vorhänge kann sie nähen, meldete sich Nachbar Huberbauer wieder zu Wort.
Hat aber auch wieder sein Gutes! Ingrid lächelte fein.
Jetzt lachten alle.
Sie haben von den Schnüffeleien der beiden Nachbarstöchter gehört.
Verena und Carmen, so die Namen der Rubenbauer-Zwillinge aus dem Nachbarhaus gegenüber, hatten eine lukrative Einnahmequelle für sich entdeckt.
Ihr Kinderzimmer ging auf die Straße hinaus und gewährte, besonders im Herbst und Winter, wenn die Bäume kahl wurden, ungehindert Einblick auf und in das Nachbarhaus, in dem Ella und Max wohnten. Daß es keine Stores vor ihrem großen Wohnzimmerfenster gab, war allgemein bekannt.
Die hocken da wie in Holland! Melanie, die zur Tulpenblüte mal mit dem Omnibus in der Nähe von Amsterdam war, wußte das. Dort gibt’s auch jeden Abend freie Sicht auf die Familien beim Essen; sie haben das Licht an und die Vorhänge offen. Wahrscheinlich haben die zwei das in Holland gesehen, und weil es praktisch ist und man keine Vorhänge nähen muß, machen sie es halt auch so.
Irgendwie schamlos, kommentierte Vater Rubenbauer, als seine Frau ihm die Nachbarn zeigte, die da im vollen Licht ihrer Lampe Zeitung lasen.
Die Zwillinge hatten sich längst das alte Fernrohr vom Opa aus der Dachbodentruhe geholt, lupften ihre Stores ein bißchen zur Seite, gerade so weit, daß man die Mündung des Rohrs durchstecken konnte, und dann glotzten sie gierig auf ihre beiden Nachbarn, die hin und wieder zur Kaffeetasse griffen und dann wieder die Zeitung vor sich ausbreiteten.
Da! schrie auf einmal Verena. Da! Jetzt puhlt sie in ihren Zähnen! Ekelhaft! Schau selber!
Carmen nahm das Fernrohr in die Hand und zielte auf Ellas Mund.
Pfui Teufel, so sind sie, die so vornehm tun, ahmte sie ihren Papa nach. Keinen Anstand!
Laß mich jetzt wieder! Vielleicht sehen wir den Alten noch beim Nasebohren!
Aber soviel sie auch glotzten an diesem Sonntagvormittag, sie sahen nur noch, wie beide (auch der Mann, dieses Weichei), den Tisch abräumten, das Tischtuch ausschüttelten und dann aus dem Wohnzimmer verschwanden.
Verena und Carmen wußten, daß die beiden sich jetzt an ihre Computer setzten, denn im ersten Stock war ihr gemeinsames Arbeitszimmer. Das hatten sie vom Huberbauer, der von seinem Schlafzimmerfenster aus direkt in das Arbeitszimmer sehen konnte. Aber anscheinend hatte er nichts Berichtenswertes entdeckt. Verena und Carmen überlegten, wie sie es anstellen könnten, in Huberbauers Schlafzimmer zu kommen.
Aber sie hatten eine andere Idee.
2
Eberhard Gronseider wachte aus seinem Mittagsschlaf auf. Sein Herz klopfte, er merkte, wie ihm der Speichel aus dem Mund troff, er sah einen nassen Fleck auf dem Kissen, und sein Hemdkragen fühlte sich feucht an.
Sein ganzer Körper vibrierte unter einem unsichtbaren Stromstoß. Mühsam versuchte er seinen Oberkörper aufzurichten. Er hatte Mühe, seine Zähne auseinander zu bringen. Seine Lippen fühlten sich geschwollen an.
War das so ein Schlaganfall, der seinen Vater halbseitig gelähmt hatte? Der jetzt nur noch lallte und keinen Satz mehr zustande brachte. Der im Pflegeheim vor sich hin dämmerte und seinen Sohn kaum noch erkannte, wenn der am Sonntagnachmittag nach ihm schaute.
Vater unser, der du bist im Himmel! Eberhard fiel nur dieser Satz ein, der ihm mühelos gelang. Nein, kein Schlaganfall. Er war noch einmal davongekommen. Aber mit dem Herz stimmte etwas nicht, das hämmerte immer noch.
Es war Zeit, sich endlich aus dem Mittagsschlaf zu befreien. Vielleicht war das doch nicht so gesund, wie sein Hausarzt, der Doktor Thomas Reindl, ihm versprochen hatte.
So ein Nickerchen schadet bestimmt nicht, im Gegenteil. Man wacht dann erholt auf und bewerkstelligt den Rest des Tages mit mehr Energie.
Was sollte er, der Pensionist, mit Energie? Wo doch die Nachmittage sich dehnten, so daß er vor Verzweiflung sogar schon einen Brief an seine Schwester in Frankreich aufgesetzt hatte. Aber das Kuvert lag noch unbeschriftet auf seinem immer aufgeräumten und weitgehend leeren Schreibtisch. Auch das war neu seit seiner Pensionierung. Früher hatte er regelmäßig Unerledigtes aus dem Büro mit nach Hause gebracht, schon um nicht am Abend mit Inge ihre Lieblingsschlagersendungen anschauen zu müssen. Was die für einen Musikgeschmack hatte! Wieso hatte er das nicht früher bemerkt? Mit 25 Jahren war man halt noch blöd, ein halbes Kind, sah die schönen, blonden Locken, das ausgeschnittene T-Shirt, die engen Jeans. Und freute sich, daß alle Äußerungen mit einem lachenden Kommentar veredelt wurden, mit dem Zusatz: Mei, bist du lustig! Und so g’scheit!
Und jetzt saß er seit 40 Jahren einsam in seinem Arbeitszimmer, das er sogar von der Steuer absetzen konnte, als er noch im Dienst war. Nicht einmal das war noch möglich. Eine teure Musikanlage versüßte ihm die Stunden.
Wozu denn das noch? Inges Protest.
Er gab ihr nicht mal Antwort, kaufte sich gleichzeitig Sonderangebote klassischer Musik dazu, und jetzt hatte er, wohlgeordnet nach Komponisten, eine beträchtliche CD-Sammlung.
Er kam sich gebildet und bedeutend vor, wenn er die Zeitung zur Hand nahm und dazu Vivaldi hörte.
Auch ein neues Schlafsofa hatte er sich gekauft. Inge schaute griesgrämig, wenn sie alle heiligen Zeiten einmal sein Zimmer betrat. Aber meistens hatte er seine Ruhe. Sie war mit allerhand Ehrenämtern beschäftigt und hatte, weil sie seit ihrer Geburt in Edenbichl lebte, Verwandte und Schulfreundinnen in reicher Anzahl. Er hatte »eingeheiratet«, in ein früheres Bauernhaus mit beträchtlichem Grundbesitz. Längst war das Haus modernisiert, sogar mit einer Solaranlage auf dem neuen Dach. Ihre beiden Söhne arbeiteten in Frankfurt, inzwischen waren sie steinreich geworden, weil sie spekuliert und gewonnen hatten. Sie hatten sich ein Haus in Bad Homburg gekauft, lebten zufrieden in zwei Stockwerken und fuhren nur noch selten in die Bankerstadt, weil sie das meiste zu Hause von ihren Computern aus erledigten. Immer noch waren sie unverheiratet, und, wenn man ihren lockeren Äußerungen glaubte, wollten sie das auch weiterhin bleiben.
Aber brav kamen sie an Weihnachten nach Hause und brachten aus den Feinkostgeschäften alle möglichen Leckereien mit, die es im sparsamen Haushalt von Inge und Eberhard das ganze Jahr über nie gab. Inge konnte sich nicht abgewöhnen, ihnen ständig in den Ohren zu liegen, daß es jetzt wirklich an der Zeit wäre zu heiraten. Beide waren lieb zur Mama, küßten sie auf die Wange und stimmten oberflächlich zu. Ja, Mami, das kommt schon noch, gut Ding, weißt schon! Und dann lachten sie zusammen.
Er verstand gut, warum die beiden mit ihrem Single-Dasein zufrieden waren. Schließlich versuchte er nach Jahren der erzwungenen Gemeinsamkeiten jetzt endlich in der Pension auch so eine Art Single-Leben in seinem behaglich eingerichteten Zimmer.
Aber so, wie er sich jetzt fühlte nach dem abrupten Ende des Mittagsschlafs, so konnte es nicht bleiben. Er mußte gleich einen Termin bei Dr. Reindl machen, möglichst ohne daß Inge davon etwas mitbekam; sonst hieß es gleich wieder: das liegt an dem Bier, das du jeden Abend trinkst, ich sag’s dir ja immer wieder, aber du hörst nicht auf mich. Und so weiter. Er kannte die Litanei schon auswendig.
Inzwischen war es 16 Uhr, da konnte er noch anrufen. Die Sprechstundenhilfe gab ihm gleich für den nächsten Vormittag einen Termin. Er freute sich, weil er Privatpatient war. Da ging das alles ohne längere Warterei.
Als er sich bequem in seinem Schreibtischsessel niederließ, war schon fast wieder alles wie früher. Er schob eine CD mit einem Mozart-Klavierkonzert ein und nahm sich den Wirtschaftsteil der Zeitung vor. Nach dem Abendessen wollte er heute mal wieder zum Stammtisch gehen und seine Kumpel vom Männergesangsverein treffen. Seit seiner letzten Bronchitis war sein Baß brüchig geworden, und er ging nicht mehr zu den Chorproben.
Er hatte gerade einmal die Überschriften gelesen, da läutete das Telefon. Auf seinem Schreibtisch stand der Nebenapparat, und man brauchte nur auf ein Knöpfchen zu drücken, dann konnte man mithören, was vom Wohnzimmer aus gesprochen wurde. Er drückte das Knöpfchen.
Was er allerdings zu hören bekam, ließ ihn erbleichen.
3
Hildegard Töpfert kam von einem Spaziergang mit ihrem Dackel nach Hause. Sie wischte dem Hund sorgfältig die Pfoten ab Es gab ja immer noch Umweltsünder, die Salz streuten vor ihren Häusern. Ihren dunkelbraunen Mantel hängte sie in die Garderobe, den selbstgestrickten Schal legte sie sorgfältig zusammen und verstaute ihn in der ersten Kommodenschublade.
So, sagte sie freundlich zu ihrem Waldi, jetzt koch ich mir erst mal einen Tee und mach es mir mit dem Bistumsblatt gemütlich. Der Hund folgte ihr ins Wohnzimmer, wo er gleich mit aufs Sofa sprang. Der Wasserkessel brummte, draußen war es bereits dämmerig, und die Dampfheizung verbreitete eine angenehme Wärme.
Ach, haben wir’s gut!
Waldi sah verständig zu ihr auf. Auch ihm ging es gut neben seinem Frauchen.
Hildegard goß heißes Wasser auf ihren Teebeutel, verrührte zwei Stück Zucker und gab einen Teelöffel Rum dazu. Jetzt war der Tee genau so, wie sie ihn mochte und wie Heiner, ihr verstorbener Mann, es mißbilligt hätte. Alkohol schon am Nachmittag! Ja, dachte sie, er war schon streng mit mir, halt typisch Lehrer. Drei Jahre war er jetzt schon tot.
Ihr ging es gut, das durfte sie nicht laut sagen. Von einer Witwe wurde erwartet, daß sie trauerte, möglichst lange dunkle Kleider trug und jeden Tag auf dem Friedhof nach dem rechten sah. Das alles hatte sie brav erledigt. Aber jetzt würde sie mehr an sich denken. Obwohl, da war noch dieser Afghane, für den sie, wie ausgemacht, regelmäßig die Deutschhausaufgaben erledigte, die er beim Sprachkurs in der Kreisstadt vorweisen mußte. Der selbst ernannte Flüchtlingsbetreuer, ein pensionierter Kollege ihres Mannes, hatte sie vor ein paar Monaten für diese Aufgabe gewonnen:
Wir müssen ihm helfen, sonst bekommt er keine Aufenthaltsgenehmigung.
Hildegard fragte sich, ob die Lehrer des Afghanen nicht eine gewisse Diskrepanz zwischen seinem mangelhaften Deutsch und den fehlerlosen Hausaufgaben bemerkten. Oder war das Ganze nur ein gut gespieltes Theater, bei dem jeder wußte, was da vor sich ging?
Ihr konnte es egal sein. Heiner hätte so etwas nie und nimmer gemacht, da war sie sich sicher. Hausaufgaben für einen Faulpelz? Das hätte er mit Entrüstung abgelehnt. Vielleicht hatte sie sich gerade deswegen dafür engagiert.
Sie nippte von ihrem Tee mit Rum.
Im Bistumsblatt gab es weiter keine Neuigkeiten, die sie interessiert hätten. Sie warf es in den Papierkorb. Am liebsten hätte sie es abbestellt. Aber das wäre schon fast gleichbedeutend mit dem Kirchenaustritt. Die katholische Presse mußte man als guter Katholik unterstützen, sie mochte so banal sein wie sie wollte. Ihre Tochter dachte da anders.
Habe ich da was falsch gemacht mit der religiösen Erziehung? Oder war das jetzt einfach der Geist der Zeit, einer Zeit, in der die Kirche immer weniger zu melden hatte?
Wo blieb Renate denn überhaupt? Hätte sie nicht schon längst zu Hause sein müssen? Ihre Tochter hatte sich für den Beruf des Vaters entschieden, sie war Lehrerin in der Nachbargemeinde.
Der Nachmittagsunterricht war doch längst vorbei. Ob sie wieder mit Kollegen ausging? Es waren hauptsächlich Kolleginnen, bis auf den Rektor. Der war leider nicht verheiratet, so daß Hildegard immer im Alarmzustand war, Renate könnte sich in ihn verlieben. Dann würde sie ausziehen, und Hildegard müßte allein leben. Davor hatte sie Angst. Sie war jetzt auch schon über Sechzig, da konnte alles mögliche passieren. Wozu hatte man eine Tochter, wenn sie einen dann doch im Stich ließ?
Einen Sohn hatte sie zwar auch, aber der zählte irgendwie nicht. Außerdem lebte er ein paar hundert Kilometer von ihr entfernt, weit im Norden und mit Dingen beschäftigt, die sie nicht verstand. Was auch sollte sie sich unter einem Programmierer vorstellen? Aber er verdiente gut, hatte sich eine Eigentumswohnung gekauft und kam nur sporadisch heim, das letzte Mal zu ihrem Geburtstag im Juli. An Weihnachten war er auf Barbados, sie fragte gar nicht mehr, mit wem. Nie erzählte er von Freundinnen, auch seiner Schwester nicht. Er wußte, daß sie alles irgendwann mit der Mutter besprach, und von den Ermahnungen, doch bald eine Familie zu gründen, hatte er genug.
Um auf andere Gedanken zu kommen, schaltete sie den Fernsehapparat an. Eine aufgedonnerte, offenbar amerikanische Schauspielerin erzählte gerade ihren lauschenden Freundinnen von ihrem letzten Rendezvous, das hieß heutzutage Date.
So ein Quatsch. Sie schaltete den Apparat wieder aus und griff in den Korb, der neben dem Sofa stand. Bis Renate heimkam und sie das Abendessen für sie beide machte, würde sie noch ein paar Runden stricken. Warme Wollsocken, schon vorsorglich für einen nächsten Geburtstag gedacht. Vielleicht würde sie Inge damit überraschen; die hatte offenbar vergessen, wie man Stricknadeln überhaupt hielt. Dabei hatten sie doch die gleiche Handarbeitslehrerin, eine stille und geduldige Klosterfrau. Hildegard war, zusammen mit den meisten Mädchen ihres Jahrgangs, bei Klosterfrauen in die Schule gegangen, eine solide Mittelschulausbildung, sogar mit Hauswirtschaft und Kochen. Das hielt man früher für die beste Heiratsempfehlung.
Und heute?
Da wollten sogar die Mädchen Singles bleiben, keine Kinder, keine Verpflichtungen, keine Verantwortung. Unwillkürlich schüttelte Hildegard den Kopf. Sie verstand das nicht. Mit Freuden hatte sie ihre Bürostelle aufgegeben, als Heiner sie heiratete. Wie viel schöner und befriedigender war es, in einer eigenen Küche schalten und walten zu können, zu bestimmen, was die Familie zu essen bekam und welche Vorhänge sie auswählte. Sie kochte mit Leidenschaft, und die Familie war die ganze Schulzeit der Kinder über immer vollständig beim Essen zusammengesessen. Sicher hatte das auch damit zu tun, daß ihnen schmeckte, was Hildegard auf den Tisch brachte.
Und jetzt war es Zeit, daß sie in die Küche ging und das Abendessen für Renate und sich machte.
Als sie die Salatsoße anrührte, ging die Haustüre.
Hallo, Mama!
Renate brachte die kalte Winterluft mit in die Küche.
Es hat heute etwas länger gedauert, wir hatten noch Konferenz wegen eines Schülers, der straffällig geworden ist.
Was hat er denn verbrochen?
Er hat offenbar große Mengen Computerzubehör geklaut. Der Ladenbesitzer hat ihn erwischt und festgehalten, bis die Polizei kam. Dann mußten sie ihn aber laufen lassen, fester Wohnsitz und minderjährig, das übliche.
Renate sah ihrer Mutter über die Schulter.
Hm, Tomatensalat! Sehr fein! Ich zieh mich nur schnell um, dann bin ich gleich wieder da.
Renate nahm zwei Treppen auf einmal, ging ins Bad und dann in ihr Zimmer, das sie bewohnte, seit die Eltern das Haus gebaut hatten; da war sie drei Jahre alt, und ihr Bruder Gerhard fünf. Renate schlüpfte in ihren Jogginganzug und in die gefütterten Hausschuhe und lief die Treppe abwärts.
Ich decke schon mal den Tisch!
Hildegard schnipselte gerade abschließend Petersilie auf den fertigen Salat. Wurst und Käse kamen auf den Glasteller, das Körnerbrot auf das Olivenholztablett, ein Weihnachtsgeschenk des Feinkosthändlers, bei dem sie vor den Feiertagen eingekauft hatte.
Das hat aber heute lange gedauert, bemerkte Hildegard, als sie den Salat auf den Tisch stellte. Vier Stunden für ein aufmüpfiges Bürscherl, alle Achtung.
Na ja, meinte Renate, wir sind hinterher noch auf ein Bier ins Baderstüberl.
Das ganze Lehrerkollegium? wollte Hildegard wissen.
Ach, Mama, jetzt frag doch nicht so unschuldig. Weißt es eh schon.
Was soll ich wissen?
Hat nicht Tante Inge am Telefon letzthin davon geratscht? Daß sich der neue Rektor für mich interessiert.
Aha, tut er das denn?
Renate nahm sich bedächtig von dem Salat.
Ja, das tut er.
Und du? Interessierst dich auch für ihn? Das nennt man jetzt offenbar sich interessieren. Bei uns damals hieß das anders.
Wie denn, Mama?
Verliebt, verlobt, verheiratet.
Renate lachte.
Davon ist noch lange nicht die Rede.
Und wovon ist dann die Rede?
Also, wörtlich kann ich dir das nicht wiedergeben.
Lieber schriftlich, stichelte Hildegard.
Mama! Jetzt laß mich doch in Ruhe! Ich hab mit meinem Chef ein Bier getrunken, mehr war da nicht. Und jetzt guten Appetit!
Was nicht ist, meinte Hildegard vielsagend, kann ja noch werden.
Renate machte kurz den Mund auf, schluckte dann aber, kaute ihren Tomatensalat und nahm sich ein Vollkornbrot.
Sehr fein, der Salat, lobte sie. Hast ihn wieder mit Senf angemacht, nicht wahr? Wie im Grand Hotel schmeckt das!
Hildegard nickte zufrieden. Das war ein Friedensangebot. Auch sie kaute bedächtig und brachte das Gespräch auf Inges Nachbarn, die zwei sogenannten Wissenschaftler.
Die haben angeblich einen Sohn, der in Amerika studiert.
Ja, und?
Na, ja, das kostet doch enorm viel Geld.
Vielleicht hat er ein Stipendium.
Diese Leute haben Beziehungen nach überall hin. Und dann wohnen sie hier im schönsten Teil von Oberbayern.
Wir wohnen ja auch hier, entgegnete Renate. Was habt ihr nur immer mit den beiden? Sie tun uns nichts, also laßt sie in Frieden. Als wenn wir hier nicht in der EU wären, da kann sich jeder Rumäne bei uns niederlassen.
Das wäre ja noch schöner.
Liest du eigentlich keine Zeitung, Mama? Es gibt keine Grenzen mehr in der EU, da kann jeder wohnen, wo er mag.
Das fehlte grade noch, daß wir hier eine neue Rumänensiedlung bauen müßten! Die sollen daheim bleiben.
Aber wenn wir Leute brauchen, die unsere Alten betreuen, dann dürfen sie schon kommen, die vielen Polinnen, die auch hier im Ort arbeiten. Denk an die alte Rutzenbichlerin. Die Helga ist heilfroh über die Agata aus Krakau, sonst müßte sie ihre Schwiegermutter selber pflegen.
Das ging ja früher schon nicht gut.
Siehst du, und jetzt leben sie so ziemlich im Frieden.
Übrigens, du wirst es nicht glauben, der Professor Doktor sowieso wühlt neuerdings im Ortsarchiv, das sie im Rathaus eingerichtet haben. Man kann sich vorstellen, wonach er da gräbt. Er ist ja angeblich Spezialist für Nestbeschmutzung.
Wie du daherredest, Mama! Sollen wir so viele Jahre nach dem Krieg immer weiter schweigen zu allem, was früher bei uns passierte? Dann sind wir auch nicht besser als die Engländer, über die du immer schimpfst, daß sie für ihre Sünden in den Kolonien bezahlen sollen.
Wir haben genug bezahlt, alle greifen nur immer Deutschland ins Portemonnaie, weil sie wissen, daß die Deutschen wegen ihrem schlechten Gewissen immer zahlen.
Daran kann ich nur erkennen, daß wir was aus der Geschichte gelernt haben. Übrigens, morgen bin ich zum Mittagessen nicht daheim, weil ein Besuch im ehemaligen KZ in Dachau mit der Oberstufe geplant ist.
Das auch noch, seufzte Hildegard und fing an, den Tisch abzuräumen. Als sie gerade spülen wollte, läutete das Telefon. Mit nassen Fingern griff sie nach dem Apparat, um nach ein paar Sekunden des Zuhörens aufs Sofa zu sinken.
Nein, das gibt’s doch nicht, das glaub ich nicht!
Was ist denn passiert, rief Renate von oben.
Du wirst es nicht glauben!
4
Florian Meier saß beim Abendessen, zu dem zwei Flaschen Bier gehörten. Er goß sich gerade die zweite Halbe ein und biß in sein Leberkäsbrot. Anna schob ihm das Glas mit den sauren Gurken zu.
Er war zufrieden.
Hier bei ihm daheim und auch im ganzen Ort, da war die Welt noch in Ordnung, da sorgten die Ehefrauen dafür, daß im Haushalt alles lief und die Kinder gehorchten. Seine Kinder waren schon seit Jahren selbständig, lebten aber, wie es sich gehörte, in der näheren Umgebung. Die Lisa hatte in eine florierende Metzgerei mit Gastwirtschaft eingeheiratet, Josef betrieb die elterliche Tischlerei am Ort und würde kommendes Jahr heiraten, und der Kleinste, Annas Liebling, das Jaköble, studierte auf Pfarrer in München.
Er dachte an die Flüchtlinge und überlegte, ob das noch stimmte mit der Ordnung.
Was überlegst du denn, fragte Anna.
Was mit den Flüchtlingen mal wird.
Arme Schlucker, und noch so jung.
Ich hab ihnen mein altes Fahrrad gebracht, sagte Florian. Da sollen sie ruhig ein bißchen rumbasteln. Daß man es ihnen so schwer macht zu arbeiten, versteht keiner. Sollen sie doch froh sein, wenn die nicht so faul rumsitzen. Zum Beispiel die alte Kraus Mathilde, die nach ihrer Hüftoperation nur noch hinkt, die hat sich vorigen Monat erbarmt und einem von den Schwarzen, der bei ihr um Arbeit angefragt hat, den Rasenmäher in die Hand gedrückt. Der hat den großen Garten gemäht, und sie hat ihm 20 Euro gegeben, beide waren zufrieden. Nicht aber ihr Nachbar, der Erwin Prinzpuchler, der alte G’schaftler. Selber hat er bloß ein Handtuch von Garten, und da schielt er neidisch auf die Mathilde. Und da hat er sie angezeigt, nur weil sie barmherzig war und dem Schwarzen was zum Verdienen gegeben hat. Prompt kam die Polizei und hat die Alte verwarnt. Normalerweise müßte sie sogar Strafe zahlen, aber weil die Mathilde so laut geschrien und geweint hat, daß die Nachbarn zusammengelaufen sind und sich vor den zwei Polizisten aufgebaut haben, sagten die dann, wir wollen Gnade vor Recht ergehen lassen. Der Polizeiinspektor oder was er ist, war ja ein Schulkamerad vom Kraus Erwin, dem Sohn von der Mathilde. Das wäre dann schon doppelt peinlich. So kam sich der Heckenbichler Toni human und edel vor, und er stieg mit seinem Kollegen wieder in sein geputztes Polizeiauto.
Die arme Mathilde wollte doch nur helfen, stimmte Anna bei.
Sie hat sich immer noch nicht von dem Polizeibesuch erholt, giftet mächtig auf den Nachbarn, der sie angezeigt hat und versteht die Welt nicht mehr. Ihren Nachbarn, den ehemaligen Polier, als Neonazi ortsbekannt, verstand sie überhaupt nicht. Er hatte sein Haus anderthalb Meter zu hoch gebaut und dafür an die Gemeinde zehntausend Euro Strafe bezahlt, aber ihre Sicht auf den See war deswegen für immer verstellt.
Ich als Witwe, jammerte sie.
Mit Geld kann der jedes Gesetz aushebeln, dieser Militarist mit seinem Bürstenschnitt!
Übrigens redet ihre Freundin Milli jetzt auf sie ein, daß sie den Erwin ihrerseits anzeigen soll. Angeblich stimmt etwas nicht mit der Gartengrenze.
Hoffentlich macht sie das nicht, den Rechtsanwälten ist die nicht gewachsen.
Die Milli hat eine Nichte, die Rechtsanwaltsgehilfin ist, und die hat ihr das vorgeschlagen. Schließlich läßt der Erwin die Zweige seiner Hecke in Mathildes Grundstück reinhängen.
Da könnte man fast alle Gartenbesitzer anzeigen, das ist doch lächerlich, meint Anna.
Warten wir’s ab, sagte Florian und biß in eine saure Gurke.
Da läutete die Hausglocke.
Die beiden sahen sich an.
Wer kann das denn jetzt noch sein, fragte Anna.
Du bleib sitzen. Ich schau gleich mal, wer vor der Tür steht.
Mach vorher noch die Kette vor, rief ihm Anna nach.
Aber es war nur Lisa, die weinend mit ihrem kleinen Andreas im Wickelkissen vor ihnen stand.
Jetzt setz dich erst mal hin, trink einen Schluck Bier!
Nein, Papa, ich bring nichts runter.
Sag endlich, was passiert ist, befahl Anna.
Schau her, schluchzte sie, schau auf meine Wange, eine Watschn hat er mir gegeben, der Brutalo.
Meinst jetzt den Sepp, Deinen Mann?
Ja, wen sonst?
Und warum, fragte Anna.
Wegen gar nichts, wegen nichts regt der sich so auf. Schlägt seine Frau, das hätte ich nie von ihm gedacht. Ich laß mich scheiden!
Also, jetzt hock dich erst mal hin, da, trink einen Schluck Bier. Und jetzt erzähl ganz in Ruhe. Weckst mir ja den Andreas noch auf. Ein Wunder, daß der überhaupt noch schläft. Komm her, ich leg ihn einstweilen aufs Sofa.
Also, um was habt ihr euch gestritten?
Um den Etritreer, der immer mit dem Radl rumkurvt.
Mein ehemaliges Fahrrad, erklärte Florian.
Ja, von mir aus, mit deinem Radl. Dann steigt er ab, kommt in den Laden und fragt: »Du Arbeit?«
Und ich denke, daß die Kati Wirnhir krank geworden ist, die sonst bei uns immer putzt, und sag: Ja, Arbeit, komm rein.
Ich hab ihm den Putzeimer in die Hand gedrückt, auf den Boden im hinteren Laden gedeutet und ihm gezeigt, wo er putzen soll.
Die Melanie kommt derweil in den Laden, kauft ihren Aufschnitt und ihr Geschnetzeltes, und als sie die Tür hinter sich zumacht, erscheint der Sepp in seiner blutigen Schürze.
Auch sein Gesicht war geschwollen rot und er schreit mich gleich an, was mir einfällt, einen Schwarzen anzustellen, ob ich denn nicht weiß, daß das verboten ist und daß wir deswegen alle ins Gefängnis kommen können und sie den Laden zumachen und wir arbeitslos auf der Straße stehen.
Wie blöd bist du eigentlich, hat er gebrüllt und mir ins Gesicht gehauen. Ich hab’s nicht glauben können. Immer weiter hat er geschrien und den armen Schwarzen beim Krawattl gepackt und zur Tür raus befördert. So eine Gemeinheit. Der kann ja gar nichts dafür.
Da bin ich aus dem Laden in die Wohnung, hab den Andreas genommen und bin zu euch gefahren. Jetzt kann er sehen, wo er bleibt, der Sepp, er hat ja niemanden, der jetzt im Laden steht. Wahrscheinlich wird er seine Mutter anflehen, aber auf die ist kein Verlaß, die gibt falsch raus und schneidet sich in den Finger. Recht geschieht’s ihm.
Florian und Anna hörten schweigend zu.
Anna strich ihrer Tochter über die Haare und meinte, es wird ja nicht so heiß gegessen wie gekocht wird. Wie ich den Sepp kenne, tut’s ihm sicher schon leid.
Also, ich finde schon, das hätte er nicht tun dürfen, seine eigene Frau schlagen. Da hab ich kein Verständnis dafür, aber auch schon gar keins. Florians Kommentar
Komm, Lisa, nimm dir auch ein Brot und tu dir anständig Leberkäs drauf. Du hast ja sicher noch nichts gegessen, sagte Anna und stellte einen Teller und ein Glas vor sie hin.
Lisa sah von einem zum andern.





























