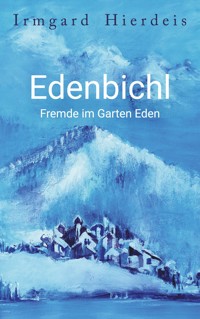Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Roman "Sonntagskind" gibt Einblick in das Leben der "einfachen Leute" im Habsburgischen Böhmen des endenden 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts. Anhand des Schicksals der ältesten Tochter eines Schusters erfährt man über den Alltag von Frauen und Mädchen, über ihre verhinderte Bildung und Berufstätigkeit, über ihre Abhängigkeit von männlicher Macht und geltendem Gesetz. In Unwissenheit über die politischen Verhältnisse, die ihr Leben bestimmen, heiratet Franziska einen entfernten Verwandten, mit dem zusammen sie eine Bäckerei betreibt. Während des Ersten Weltkriegs werden Mann und Sohn eingezogen. Der Zweite Weltkrieg vertreibt sie aus ihrer Heimat. In einem Gegenentwurf wird der Lebenslauf ihrer Cousine geschildert, die in Wien lebt und von den modernen Errungenschaften der Epoche mehr profitiert als Franziska in der böhmischen Provinz. Im ersten Nachkriegsjahr treffen sich die beiden nunmehr alt gewordenen Frauen und erinnern sich an ihr vergangenes Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Sebastian Johannes Antonia
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
1
Oft geht ein Wind, aus dem Böhmischen her, Und der Winter ist lang, Und der Sommer ist schwer vom Grün und vom Gold, das wipfelab rollt.
Der Winter ist seine Domäne. Im Herbst faucht er sich Energie an. Ist er das himmlische Kind? Er ist der kleine Eros, dem es gefällt, kindischen Unsinn zu treiben und Katastrophen anzuzetteln.
Er ist in Böhmen daheim.
An diesem Samstag zerrt er an den Dachschindeln, verbündet sich mit Eisregen und biegt in die kleinen Gassen ein, wo er die Blätter vom Vorherbst aufwirbelt und die Kälte durch die Ritzen treibt. Auf dem Marktplatz ist es menschenleer.
Über den verlassenen Platz pfeift der Wind, es ist ein gewalttätiger Wind, der sich Kraft geholt hat im Elbsandsteingebirge; und jetzt rast er vom Schloßberg und vom Rosenberg herunter. Der Schnee, den er mitbringt, legt sich auf die Eisschicht.
Oder läuft da ein hartnäckiger Mensch, von dem man sagen könnte: Der liegt an wie der böhmische Wind? Wer kurz vorher noch heimeilte und Schutz suchte in einem Hauseingang, duckte sich, wie er das gelernt hatte in Jahrhunderten der Leibeigenschaft. Seit hundert Jahren hat man sie offiziell abgeschafft; aber wie lange braucht eine Verordnung, bis sie sich in die Gehirne der Menschen eingegraben hat?
Es ist Ende Februar, und Kamnitz ist ein unwirtlicher, kalter Ort, in dem sich die Menschen in ihren Häusern verstecken. Der Qualm, der aus den Schornsteinen quillt, hüllt die Stadt in braunen Nebel.
Eine kümmerliche Jahreszeit, der Winter noch lange nicht vorbei, und die Kälte frißt sich in jeden Gedanken.
Der Meister sitzt in der dämmrigen Werkstatt, zusammen mit zwei Lehrlingen und einem Gesellen. Aus der Schlafstube schreit es, schon seit dem frühen Nachmittag. Sie halten einen Moment inne, und das laute Jammern der Frau verursacht ihnen Gänsehaut.
Der Meister versucht, gleichmütig zu bleiben, starrt auf die Schuhsohle, die er bearbeitet, dann steht er auf und zündet die Karbidlampe an. Beim ersten Aufleuchten sagen alle: »Guten Abend!«, wie sie es gelernt haben. Sie schauen verstohlen zum Herd, wo die alte Hebamme Töpfe mit heißem Wasser beaufsichtigt. Sie ist die einzige, die ruhig bleibt, ungerührt. Hunderte von Kindern hat sie entbunden, hat gesehen wie sie sterben und wie die jungen Mütter im Fieber dahinsiechen. Die Schreie der Frau nebenan klingen gesund, bald wird es soweit sein. Die Nacht wird es wohl noch dauern. Sie hat Zeit. Dann geht sie langsam ins Schlafzimmer, und während sie die Türe öffnet, dringen die Schreie ungefiltert in die Werkstatt.
Der Meister drischt weiter seine Nägel in die Sohlen, schaut kurz auf in das Entsetzen der Jungen. Er sagt nichts. Er hat Angst, es ist sein erstes Kind. In seiner Hosentasche faßt er schnell nach dem Rosenkranz. Glaubt er an Magie? An Gott? Wenn sonst nichts hilft, dann geht auch er in die Messe, opfert der Madonna in der Kapelle ein paar Heller, um sich Gnade zu sichern.
Sein Neffe Anton, der bleiche und aufgeschossene Lehrling, der im Dachstübchen wohnt, steht auf und geht über den Hof auf den Abort. Die andern sehen ihm nach, wie er hinter dem Türchen verschwindet. Sie beneiden ihn um den Augenblick der Ruhe.
Den ganzen Samstag lang hält das Schreien an, auch noch, als der Meister seine Gesellen und den Lehrling frühzeitig heimschickt.
Er wirft einen ängstlichen Blick in die Schlafstube. Anna, die Schwester der Frau, sitzt am Bett und hält ihre Hand.
Mariechen, es wird schon, ich sag’s dir. Schau mich an, drei Kinder hab ich schon geboren. Es geht vorbei, glaub mir.
In der Nacht richtet sich der Meister auf dem Sofa in der Wohnstube ein Bett. Zwei Decken, das reicht, der Ofen ist noch warm. Einen Spalt ist die Tür zur Schlafstube offen. Seine Frau jammert leise, dann ist es still.
Er wacht von einem Schrei auf.
In der Stube dampft es. Zwei Wasserkessel brodeln. Die Schwägerin trägt einen Kessel in die Schlafstube.
Auf einmal ist es still.
Sonntagsstille, bis die Glocken der Pfarrkirche läuten.
Das Geläut vermischt sich mit heiseren Schreien.
Die Tür geht weit auf. Er steht in seinen zerknitterten Schlafsachen da und schaut auf die Hebamme, die ihm sein erstes Kind, ein weißes Bündel, in die Arme drückt.
Festhalten!
Durch den Türspalt ein Blick auf die Frau. Sie liegt bleich da, die Augen geschlossen. Das Kind bewegt den Mund, hat die Augen halb offen.
Na, du Sonntagskind, lacht die Hebamme.
Was? will der Vater fragen.
Was es ist? Ein Mädchen.
Aha, ock a Mejdl.
Sein Blick geht weg vom Babygesicht.
Sie werden ihn hänseln. Hat er keinen Sohn zustande gebracht! Das kleine Gesicht interessiert ihn nicht mehr.
Da! Die Hebamme übernimmt.
Gesund ist sie! sagt sie zum Trost. Der Vater holt schon den Überzieher vom Haken. Er wird in die Messe gehen und dann ins Wirtshaus. Heute wird er seine Freunde aushalten müssen, egal, ob Mädchen oder Junge.
Bevor er geht, wirft er noch einen Blick auf die Wöchnerin; das Kind liegt jetzt in der Wiege. Beide schlafen. Morgen wird er dem Lehrling und den Gesellen ein Bier spendieren, damit sie auf das Wohl des Sonntagskinds, der kleinen Franziska, trinken.
Draußen scheint die Sonne. Im Morgenlicht, das auch die grauen Fassaden verherrlicht, geht der Schuhmachermeister hinauf in die Pfarrkirche zur Frühmesse. Er ist ein stattlicher, noch junger Mann, mit dunkelbraunen Locken. Seine Augen hält er öfter gesenkt, als es zu einem forschen Kerl passen würde. Am Abend liest er Geschichten und Artikel aus der Gartenlaube, die er abonniert hat. Manches versteht er nicht, und dann wälzt er die Gedanken hin und her, während er Leder zuschneidet oder Sohlen beschlägt. Wenn er beim Essen nicht mit ihr redet, frägt ihn seine Frau, worüber er denn traurig ist. Nein, nicht traurig, das würde er nicht zugeben. Ein Mann muß mutig in die Zukunft schauen, er trägt Verantwortung. Ich denke nach, antwortet er dann, löffelt seine Gerstensuppe und ißt Bratkartoffeln mit Fleischwurst.
Mariechen, seine Frau, die jetzt daheim mit ihrer kleinen Tochter schläft, schweigt dann. Eine Frau, so hat man ihr gesagt, soll nicht neugierig sein. Die Männer brauchst du nicht zu verstehen, hat die Mutter gesagt, das geht nicht. Gehorchen sollst du, jedenfalls nach außen. Laß ihn merken, daß er der Herr ist, und gib ihm immer das größte Stück Fleisch oder Wurst; daran sieht er, daß du ihn respektierst.
Während er den kurzen Weg zu Sankt Jakob hinauf geht, überlegt er, was er in der letzten Woche über Darwin gelesen hat. Wie geht das mit der Bibel zusammen, wenn wir von Affen abstammen? Sie schreiben darüber wie über eine bewiesene Tatsache. Aber von der Kanzel wird das Gegenteil verkündet. Gott hat uns aus Lehm erschaffen. Wie sollte das gehen? Aber Gott ist allmächtig, er kann alles, also auch einem Lehmklumpen Leben einhauchen. Unter Gott hat er sich noch nie etwas vorstellen können. Der liebe Gott. Das kann auf keinen Fall stimmen. Sein Vater, der an Lungensucht ganz fürchterlich erstickt ist. Ein guter Vater, der ihn selten geschlagen hat, der ihm alles beigebracht hat, was er jetzt zu seinem Lebensunterhalt braucht. Und dann so ein Ende. Als der Vater tot war, legte sich die Mutter ins Bett und wollte nicht mehr aufstehen. Aber sie hat sich wieder besonnen und lebt immer noch, sogar in der Nähe. Sie wird gebraucht werden zum Kinderhüten.
In dem Kirchenraum fühlt er sich immer eingeschüchtert. Die vielen Gemälde an den Wänden und an der Decke! Das viele Gold an den Seitenaltären. Die weißen, gestärkten Spitzenaltartücher. Die großen, weißen Kerzen in den Silberleuchtern. Die bestickten Ornate der Priester. Der Weihrauchduft! Wein aus einem goldenen Kelch. Und Latein, die Geheimsprache Gottes.
Die Meßdiener murmeln ihr Introibo, die Gemeinde schweigt und läßt sich von den Sätzen, die keiner versteht, einlullen. Man schaut entweder in sein Gebetbuch oder betrachtet die frommen Bilder mit den Heiligengeschichten.
Er steht auf, kniet nieder, setzt sich während der Predigt. In eigene Gedanken über das Baby versunken, merkt er erst auf, als er einen Namen hört, von dem er gelesen hat. Darwin!
Der Priester hat einen roten Kopf, so regt er sich auf.
Die neueste Erfindung des Antichrist: Wir sollen alle von Affen abstammen! Wie kann man nur so Gottes Schöpfung verunglimpfen! Sich an Ihm und seinem Meisterwerk, dem Menschen, versündigen. Was für eine infame Lüge, nicht aus dem Himmel, nicht von der Erde stammt sie ab, sondern sie wurde erzeugt und geboren in der Hölle. Gleich wie nun Satan und Gott sich gegenüberstehen und nie mehr eine beiderseitige Annäherung möglich ist, so steht auch die Lüge und Gott sich gegenüber, weil die Lüge das Kind des Teufels ist. Jeder, der die Lüge liebt, stellt sich auf die Seite des Erzfeindes und ist somit ein Gegner Gottes. Durch die Lüge prägt sich der Mensch gleichsam das Bildnis des Satans ein, nachdem er das Ebenbild Gottes vernichtet hat. Und wer Lügen verbreitet, noch dazu unter dem Deckmantel einer fragwürdigen Wissenschaft, der trägt das Bild des Teufels in sich. Hütet euch vor den falschen Propheten!
Mit Sicherheit hat der Herr Pfarrer auch den Artikel in der Gartenlaube gelesen. Aber war da nicht die Rede gewesen von wissenschaftlicher Erkenntnis, gar von Beweisen? Er nimmt sich vor, den Text noch einmal zu lesen. Der Pfarrer hat studiert, muß eigentlich auch Bescheid wissen. Wer hat da recht? Natürlich haben alle von der Erschaffung der Welt in sieben Tagen gelesen. Aber das war doch eher eine Geschichte. Muß man das glauben? Auch wenn es der Wissenschaft widerspricht? Wie war das mit Galilei? Hatte man den nicht auch verdammt, weil er einen Beweis erbracht hatte, daß die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt? Hatte die Kirche das eigentlich irgendwann einmal zugegeben? Daß sie sich getäuscht hatte? Konnte die Kirche sich so grundsätzlich täuschen? Wie war es dann mit den vielen anderen Behauptungen, die man glauben sollte, ohne daß man einen Beweis dafür hatte?
Wehe den Ungläubigen! wettert der Pfarrer auf der Kanzel weiter. Gott wird sie ausspucken aus seinem Munde. Wer behauptet, das Ebenbild Gottes stamme vom Affen ab, der versündigt sich nicht nur an Gott, sondern an der gesamten Menschheit. In der Hölle werden diese Verführer auf ewig leiden. Auf ewig!
Franz, allein in seiner Bank, erschauert. Auch er wäre einer dieser Ungläubigen, die den Artikel gelesen haben und seine Aussagen für wahrscheinlich hielten. Auf einem Jahrmarkt hatte er einmal einen Schimpansen gesehen, der seltsam menschlich wirkte in seinem ganzen Verhalten: wie der Tierpfleger ihm eine Banane außerhalb des Käfigs hinlegte und der Affe dann mit einem Stöckchen, das im Käfig lag, nach der Banane fischte. Alle hatten gelacht und sich über den schlauen Affen gefreut. Wie alt mußte ein Kind werden, damit es ähnlich handelte? Noch dazu, wenn man eingesperrt in einem Käfig saß. Auch dann noch so viel Energie bewahren, daß man nicht resignierte und einfach dasaß und hungerte?
Über seine Gedanken hinweg predigt der Pfarrer immer lauter.
Nicht nur auf den Hund gekommen ist die menschliche Gesellschaft, sondern auf den Affen! Wo bleibt da die unsterbliche Seele, hat vielleicht auch ein Affe eine Seele? Nein und wieder nein! Es steht ausdrücklich in der Bibel, daß Gott den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen hat und nicht nach dem Bild eines Affen. Wer die Wahrheit der Bibel zwar erkennt, aber sie verleugnet, der sündigt wider den heiligen Geist. Liebe Pfarrkinder, bittet den heiligen Geist, daß ihr euch dieser Sünde niemals schuldig macht! Amen.
Franz versucht, den Pfarrer und seine Predigt weit weg zu schieben. Manchmal ist die Wirklichkeit, wie wahrscheinlich auch die Wahrheit, nur in großem Abstand erträglich. Bist du in der Wahrheit? in der Gnade? dem Zustand der Seligkeit? Er weiß keine Antwort auf diese Fragen, und vielleicht gibt es gar keine Antwort darauf, weil niemand von sich oder anderen mit Sicherheit sagen kann, was der andere denkt oder fühlt. Er horcht in sich, was in ihm vorgeht. Freude über das gesunde Kind? Dankbarkeit, daß die Frau lebt? Er sollte ein Dankgebet sprechen und nicht über Fragen grübeln, die Gescheitere als er offenbar auch noch nicht gelöst haben.
Beim abschließenden Segen bekreuzigt er sich. Draußen stehen schon ein paar Nachbarn, neugierige Leute, die ihn mit Fragen bestürmen. Beide gesund! Da mußt du einen ausgeben!
Er bleibt länger, als er vorhatte, bestellt sich noch ein Gulasch mit einem Kanten Brot dazu. Hoffentlich hat die Hebamme aufgeräumt und die Wasserbottiche für die Wäsche genutzt. Es wäre schade um das viele heiße Wasser.
Durch die engen Gassen entflieht er, den Mantelkragen hochgeschlagen, mit einem Gefühl wie über den Wolken, schwebend und doch voller Angst.
Im Hause ist es still.
Er sucht die Hebamme, schaut ins Schlafzimmer. Da liegt seine Frau schlafend, die kleine Franziska neben ihr im Wickelkissen. Leise schließt er die Türe. Auch er ist müde und legt sich auf das schwarze Ledersofa, stellt einen Stuhl für seine Beine daneben.
Eine Weile noch rumoren die Drohungen der Predigt in ihm, dann denkt er an die Gesellschaft im Wirtshaus, die ihm halbherzig gratuliert hat, an die Wirtin, die ihn tröstet:
Wirst sehen, es ist gut, wenn das älteste ein Mädchen ist, da hast du für die andern gleich ein Kindermädchen.
Am Abend wird er zu seiner Verwandtschaft gehen, seine Mutter bitten, daß sie die kommende Woche bei ihm bleibt. Er schläft ein. Von einem Knall wacht er auf. Er hat den Stuhl umgeworfen. Er lauscht zum Schlafzimmer hin. Alles ist ruhig. Am besten, er macht sich gleich auf zu seiner Mutter und der Schwester.
Sie haben schon auf ihn gewartet. Die Stube, in der er seine Kindheit verbracht hat, ist warm und ordentlich aufgeräumt. Sie füllt das ganze Erdgeschoß, ist Küche, Wohnzimmer, Eßzimmer und Kinderzimmer. Mutter und Therese sitzen am großen Tisch und lesen sich aus der Gartenlaube vor.
Ob sie wohl auch den Artikel über die Abstammung des Menschen vom Affen gelesen haben? Er sollte sie warnen. Aber da sieht er, daß die Schwester eine offenbar lustige Geschichte vorliest: »Schnell gefreit« liest er und ist beruhigt.
Wir haben’s schon erfahren, sagt die Mutter und steht auf. Ein gesundes Mädchen. Wie geht’s Mariechen? Ihr nennt sie Franziska, nach dir, das ist gut. Hat’s lang gedauert?
Ja, sagt Franz, seit gestern. Aber sie ist ein Sonntagskind.
Ich hab noch Beerenwein, darauf trinken wir!
Die Schwester holt Gläser, sie gießt den hellroten Wein ein.
Jetzt holt die Mutter den Floslkuchen, den sie am Morgen gebacken hat. Einige Stücke sind schon abgeschnitten.
Die Nachbarin war hier. Da hab ich den Kuchen anschneiden müssen.
Wie steht’s mit der Hebamme? Ist die noch da?
Ich hab sie nirgendwo gesehen.
Was, sie hat die Wöchnerin und das Kind allein gelassen? Und du bist auch nicht daheim? Wird Zeit, daß du gehst und nach ihr schaust.
Ja, Mutter. Ich wollte dich bitten, ob du mitkommst und die nächste Woche noch bei uns bleibst.
Hab’s mir schon gedacht, lächelt die Mutter und geht zum Haken, wo ihr Grimmermantel hängt.
Pack mir den Rest vom Kuchen ein, Therese. Mariechen wird Hunger haben, denke ich.
Morgen komm ich vorbei und schau mir die kleine Franziska mal genauer an, verspricht Therese und widmet sich gleich wieder ihrer Geschichte. Schnell gefreit, so ein Witz. In Kamnitz geht das langsam, sehr langsam. Sie ist noch nicht einmal verlobt und schon 21. Höchste Eisenbahn, sagen sie neuerdings. Und: Zeig mal deine Aussteuer-Truhe her. Lieber nicht so schnell, denkt sie. Am Ende liege ich dann allein mit einem Baby im Schlafzimmer. Das hat noch Zeit! Und sie vertieft sich wieder in die Geschichte vom Geheimrat Wesendorf, dessen verwöhntes Töchterchen einem Herrn von Sandow versprochen ist.
2
Der Glaube ist zum Ruhen gut, doch bringt er nichts von der Stelle; der Zweifel in ehrlicher Männerfaust, der sprengt die Pforten der Hölle.
Der nächste Tag ist im Kalender des Schuhmachermeisters dick angestrichen. Sein Patenonkel Albin hat Namenstag. Diesem Onkel, dem jüngsten Bruder seines verstorbenen Vaters, hat er viel zu verdanken. Ein Stadtschreiber, die rechte Hand des Bürgermeisters! Sobald er die Arbeiten an seine Gesellen und Lehrlinge vergeben hat, wird er sich aufmachen zum Gratulieren.
Leises Wimmern lenkt ihn von seinen Gedanken ab. Er liegt noch auf dem unbequemen Sofa, weil seine Mutter neben der Wöchnerin schläft. Aber offenbar sind sie jetzt aufgewacht.
Er wäscht sich am Küchenstein und zieht das Sonntagsgewand vom Vortag noch einmal an. Schließlich wird er gleich zu seinem Onkel gehen, wird in der Stadt vielen Bekannten begegnen, denen er von der kleinen Franziska erzählen muß.
Durch einen Schlitz in der Türe späht er ins Schlafzimmer. Seine Frau stillt die Kleine. Da will er nicht stören.
Komm ruhig rein, hört er seine Mutter. Komm und schau dir deine Tochter mal bei Tageslicht an!
Franz macht die Türe ganz auf, und sein erster Blick geht zu seiner Frau, die gesund und rosig ihr Kind im Arm hält. Sie lächelt ihn an. Was für ein Glück habe ich, denkt er, diese sanftmütige Frau, die nie widerspricht und ihn jeden Tag bedient, als wäre er Fürst Kinski. Und was für schöne Haare sie hat! Diese hellbraunen Locken! Und die blauen Augen, die ihn anstrahlen. Gemessen schreitet er auf das Bett zu. Er hat ja noch seinen Sonntagsstaat an, in dem man sich würdig benehmen muß.
Ach Franz, flüstert seine Frau, wie schön du wieder aussiehst!
Er steht verlegen da und weiß nicht, was er erwidern soll. Noch nie hat er von irgend einer Frau gehört, daß sie den eigenen Mann schön findet und es ihm sagt. Sie liebt ihn wirklich. Und das, nachdem sie zwei Tage lang gelitten hat, bis endlich ihr Kind zur Welt kam.
Und jetzt schau dir mal deine Tochter an! Sie hat deine Augen! Da! Du darfst sie ruhig mal auf den Arm nehmen.
Und sie reicht ihm das dick eingefatschte Baby.
Seine Mutter und seine Frau beobachten ihn, wie er vorsichtig die Lippen auf Franziskas Stirn drückt.
Sieh doch nur, sie hat dich angelächelt! Seine Mutter klatscht in die Hände! Ein gescheites Mädl, kennt seinen Vater!
Noch im Nachthemd schlurft die Mutter zum Herd, macht Feuer und setzt Wasser für den Haferbrei auf.
Behutsam legt Franz seine Tochter wieder neben seine Frau.
Bleib noch ein bißchen! Es dauert ja noch, bis der Brei fertig ist.
Franz setzt sich an den Bettrand. Er hält die Hand seiner Frau und streichelt sie.
War es schlimm?
Sie strahlt ihn an.
Ach, schon vergessen.
Gehst noch zu Albin, gell? Kannst ihm gleich was Schönes erzählen. Nimm ein Stück vom Floslkuchen mit, den mag er doch so gerne. Und lad ihn für nächste Woche zum Sonntagsessen ein, damit er sich die Kleine anschaut. Kannst ihm ja schon mal beschreiben, wie sie aussieht, deine erste Tochter: genau wie du, genau so schön!
Ach, Mariechen, sagt er verlegen, stimmt nur zur Hälfte. Sie hat deine schönen Locken!
Noch eine Weile bleibt er sitzen, ganz versunken in seine neue Familie. Sie soll es gut haben, seine kleine Franziska, nimmt er sich vor. Zuhause will er sie behalten, bis er einen anständigen Mann für sie gefunden hat. Sie soll nicht in der Fremde Geld verdienen müssen, wo man kein Auge mehr auf sie hat. Für einen Grundstock der Aussteuer wird sicher Onkel Albin mit sorgen, da ist Franz sicher.
Komm essen, ruft seine Mutter.
Franz beugt sich über seine Frau. Ein vorsichtiger Kuß auf den Mund.
Schlaf noch ein bißchen, sagt er leise.
Neben der Schüssel mit dem Haferbrei steht eine große Kaffeetasse mit blauen Streifen, aus der es dampft.
Auf den Brei hat die Mutter einen Löffel Honig geträufelt. Der Kaffee ist Zichorie, etwas anderes trinkt hier niemand. Franz trinkt ihn ohne Zucker und ohne Milch.
Auf dem Herd rührt seine Mutter immer noch im Haferbrei, den sie ein bißchen mit Wasser verdünnt hat, damit er für die Lehrlinge reicht. Als Franz sich von seiner Mutter verabschiedet, drückt sie ihm noch ein eingewickeltes Stück Floslkuchen in die Hand. Da kommen auch schon die Lehrlinge, Franz verteilt die Arbeit für die nächsten Stunden und bricht dann auf in die Stadt, ins Rathaus, zu seinem Onkel.
Dieser erste März riecht schon nach Frühling. Es ist, als hätte sich gestern mit Sturm und Schnee der Winter verabschiedet. Jetzt scheint die Sonne, und auch Franz fühlt sich froh und unternehmungslustig, wie er die Kapellengasse hinunter geht, bei ein paar Nachbarn stehen bleibt und ihre neugierigen Fragen nach seinem ersten Kind beantwortet. Friseur Friedrich stürzt auf ihn zu und beglückwünscht ihn, aus dem Hutgeschäft tritt Frau Schulze, lächelt ihn an und drückt mit beiden Händen seine Rechte.
Vor allen zieht er seinen Hut, schreitet dann langsam die breite Treppe im Rathaus hinauf. Am Vorzimmer zum Bürgermeister klopft er an.
Onkel Albin macht die Türe auf, als hätte er ihn bereits erwartet.
Herzlichen Glückwunsch zum Namenstag!
Die beiden schütteln sich die Hände, Albin zieht seinen Neffen an sich und umarmt ihn leicht. Das ist sonst nicht üblich. Aber der Onkel strahlt über das ganze Gesicht.
Ein Stück Floslkuchen hast du mir mitgebracht! Den hat sicher deine Mutter zur Feier des Tages gebacken. Jetzt erzähl aber, wie es unserem Mariechen geht und deiner Kleinen! Ich habe ja gestern schon gehört davon, du weißt, wie sich Neuigkeiten hier verbreiten.
Albin bietet Franz einen Stuhl an und rückt nahe zu ihm hin. Wie die beiden sich so gegenüber sitzen, könnte man sie für Vater und Sohn halten. Auch Albin hat immer noch seine dunkelbraunen Locken, kein bißchen grau an den Schläfen. Dabei ist er schon fast sechzig Jahre, doppelt so alt wie Franz, den er bei der Taufe übers Becken gehalten hat. Er gilt als Respektsperson im Ort, trägt jeden Tag einen dunklen Anzug mit Vatermörder, diesen hohen, gestärkten und am Hals einschneidenden Kragen. Er hat nie geheiratet, eine Nachbarin putzt, wäscht und bügelt für ihn, und am Abend stellt sie ihm Brot und Wurst hin. Das Mittagessen nimmt er, manchmal allein, manchmal mit anderen städtischen Angestellten, in der »Sonne« ein, dem einzigen Hotel am Marktplatz. Wenn er bei seinen Verwandten zum Essen eingeladen ist, macht er sich gerne über die Mahlzeiten im Hotel lustig und imitiert den dortigen Kellner mit seinen Wienerischen Komplimenten. Man ist zwar habsburgisch in Böhmen, aber weit weg von den eleganten Wienern, deren gekünstelte Ausdrucksweise man zwar bestaunt, aber insgeheim belächelt.
Franz beschreibt seinem Onkel, wie die kleine Franziska aussieht.
Ganz der Papa, freut sich Albin.
Und wie geht’s der jungen Mutter?
Gut hat sie’s überstanden, sie lädt dich für den kommenden Sonntag zum Mittagessen ein, das hat sie mir extra aufgetragen.
Das Gesicht des Onkels strahlt. Er greift gewohnheitsmäßig mit dem linken Zeigefinger zwischen Kragen und Hals.
Sei froh, sagt er, daß du nicht jeden Tag diese gestärkte Folter ertragen mußt. Und dein eigener Herr bist du auch! Brauchst niemandem nach dem Mund reden, mußt nicht deine Meinung verstecken, wenn die hohen Herren über den Zigarren ihre althergebrachten Ansichten zum besten geben. Was die sich gestern wieder ereifert haben. Wahrscheinlich lag es auch am Bier, das sie an Sonntagen immer in sich reinschütten. Es ging um die Predigt.
Ach, sagt Franz, der Artikel über den Affen!
Genau der! Dabei, sagt er flüsternd, wenn man die meisten anschaut, ist diese Theorie gar nicht so abwegig. Und nur weil die Pfaffen wieder dagegen wettern, meinen die hohen Herren, sie müßten um der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung gleich zustimmen. Ihnen zufolge ist der Mensch eben kein Fortschrittsaffe!
Ich habe auch in dem Artikel gelesen, sagt Franz. Sie haben anscheinend Beweise dafür in der Wissenschaft.
Weißt du was, und der Onkel neigt sich verschwörerisch zu ihm hin, darüber reden wir am Sonntag, wenn wir unter uns sind. Die Türen haben zwar dicke Polster, aber ich weiß, daß sie auch Ohren haben.
Franz lächelt ihn unsicher an. Wovor fürchtet sich sein Onkel? Mit dem Bürgermeister verbindet ihn doch sogar eine Art Freundschaft, sie treffen sich in der »Sonne«, sie fahren gemeinsam einmal im Jahr nach Wien, und beide sind nicht verheiratet, der Bürgermeister, weil seine Frau vor drei Jahren gestorben ist, und der Onkel, weil er nie geheiratet hat.
Dann bis zum Sonntag!
Franz steht auf, gibt Albin die Hand und wendet sich zum Gehen.
Grüß mir dein Mariechen, ruft ihm der Onkel zu.
Nachdenklich geht Franz den Weg zurück zu seiner Werkstatt und Wohnung. Er nimmt sich vor, am Abend noch einmal in diesem Artikel zu lesen, der den Pfarrer so in Rage gebracht hat, und über den sein Onkel so vorsichtig andeutend geredet hat, als fürchte er sich, dazu eine eigene Meinung zu äußern. Dabei kennt er Albin als einen Lästerer, dessen bissige Ironie selbst vor dem Kaiser nicht halt macht. Was haben sie gelacht, als die Geschichte mit der langjährigen Geliebten ruchbar wurde. Die allerkatholischste Majestät und dann sowas! Weil es den berüchtigten Paragraphen der Majestätsbeleidigung gab, waren auch die Journalisten vorsichtig mit Karikaturen. Umso häufiger macht man sich über die Wiener Doppelmoral lustig, wenn man unter sich ist. Franz muß immer noch schmunzeln, wenn er daran denkt, wie Albin Kaiser Franz Joseph imitiert hat, als der zur Hintertreppe schlich und mit seinem Degengriff unversehens sich im Geländer verhakte, so daß ein Diener ihn befreien mußte. Ob man wohl im Rathaus ähnliche Witze über den höchsten Dienstherrn riß?
Franz zieht sich, als er zu Hause ist, seinen Sonntagsstaat aus, hängt den Anzug an die frische Luft und bindet sich die Schürze um die Alltagshose. Zum Mittagessen spendiert er den Gesellen ein Glas Bier, und den Lehrling läßt er eine Stunde früher gehen.
Seine Mutter steht am Herd und kocht eine Einbrennsuppe. Sie füllt einen Teller und schnipselt Petersilie hinein.
Hat Mariechen schon gegessen?
Nein, sie hat vorhin noch geschlafen. Aber weck sie ruhig, sonst kann sie in der Nacht nicht mehr schlafen. Die Kleine war die ganze Zeit still, ist dann auch wieder eingeschlafen. Da, nimm den Teller noch mit, ich hab ein Ei drin verquirlt. Sie muß ja bald wieder zu Kräften kommen.
Franz setzt sich mit dem Suppenteller an den Bettrand. Seine Frau ist wach und lächelt ihn an.
Danke, ich hab jetzt allmählich wirklich Hunger.
Für dich ist ein Ei drin, versuch mal.
Er hält ihr einen Löffel hin, sie schlürft vorsichtig.
Hm, sehr gut. Die Mutter ist immer noch so tüchtig. Du mußt ihr was Schönes schenken, zum Dank.
Zuerst schenke ich dir was, schau mal! Franz zieht eine Schachtel Konfekt aus der Schürzentasche. Die hab ich heute früh bei Liebisch gekauft.
O, wie lieb von dir! So was Teures! Das gibt’s am Sonntag zur Nachspeise!
Nein, Mariechen, das ist nur für dich!
Aber du mußt auch mithalten! Und der Mutter gibst du auch ein Praliné.
Vorher ißt du aber brav deine Suppe!
Franz richtet ihr die Kissen, sie sitzt und ißt bedächtig. Er holt seinen Suppenteller und setzt sich wieder an ihr Bett. Schweigend löffeln sie beide, bis ihre Teller leer sind. Dann greift Mariechen zur Pralinenschachtel, löst langsam das Band und macht den goldverzierten Deckel auf.
Wie das schon riecht!
Sie bietet Franz davon an, aber er schüttelt den Kopf.
Zuerst du!
Vorsichtig nimmt sie eine kandierte Ananas und schiebt sie in den Mund.
Franz greift nach einer dunklen Schokoladenpraline.
Schweigend genießen sie die ungewohnte Süße.
Die kleine Franziska ist aufgewacht und wimmert ein bißchen vor sich hin.
Hast auch Hunger?
Franz geht auf Zehenspitzen hinaus und läßt seine stillende Frau allein.
3
Im Süden steht der Schloßberg da, der Wartenbergersitz einst war. Heut’ nur noch alte Mauerreste, die instig stolze Ritterfeste.
Als Onkel Albin am Sonntag zum Mittagessen erwartet wird, haben sich die jungen Eltern schon daran gewöhnt, daß die Wiege neben ihrem Ehebett steht und tagsüber Franziska in einem Korb liegt, den ihre Mutter überall hin mitnehmen kann. Wenn das Hämmern und Klopfen im großen Zimmer gar zu laut wird, nimmt Mariechen das Baby und verschwindet im Schlafzimmer. Dort hat sie Flick- und Bügelwäsche gestapelt und macht sich an die Arbeit, wenn die kleine Franziska wach ist und ihr mit den Augen folgt.
Was für ein braves und stilles Kind, lobt die Großmutter. Da war dein Vater anders, schrie und zeterte auch die halbe Nacht. Halt ein Junge!
Sie lacht dazu, freut sich, so ein vitales Bürschchen großgezogen zu haben. Und jetzt ist sie froh, so eine ruhige Enkeltochter zu haben.
Mit der wirst du mal keine Schwierigkeiten haben, prophezeit sie ihrer Schwiegertochter. Die wird dir mal gut folgen.
Das ist wichtig, daß die Mädchen beizeiten folgen lernen. Daraus wird ihr künftiges Leben bestehen. Wenn sie das können, werden sie es mal leicht haben. Gehorcht wird zu Hause, in der Schule, im Dienst, in der Ehe. Den Kopf neigen und die Augen senken! Das wird von Müttergeneration zu Tochtergeneration weitergegeben. Muck nicht auf, das bekommt dir schlecht, du ziehst ohnehin den Kürzeren, ob du parierst oder nicht. Tust du nicht gleich, was befohlen wird, mußt du es später trotzdem tun. Deswegen mach keine Zicken, mach dich klein, mach dich dümmer als du bist. Das ist Teil des Erfolgsrezepts für glückliche Frauen.
Auch an diesem Sonntagmittag liegt die kleine Franziska still in ihrem Körbchen und verfolgt aufmerksam, was um sie herum geschieht.
Die Großmutter steht am Herd, hat ihre geblümte Sonntagsschürze umgebunden und rührt in der Soßenkasserole. Hin und wieder kostet sie davon, streut noch eine Prise Salz hinein, reibt ein bißchen Muskat dazu und schöpft Schmetn von der Milch ab, damit die Tunke dicker wird, ohne daß man Mehl zufügt wie an Werktagen.
Als sie zufrieden ist mit der Konsistenz, stellt sie den Soßentopf nach hinten auf den Herd und holt die bereits schwimmenden Knödel nach vorne. Sie sollen nur heiß gehalten werden, aber nicht mehr kochen. Dann öffnet sie die Backröhre, um den Braten zu kontrollieren. Er ruht auf einem Bett von Karotten und Zwiebeln.
Mariechen steht am Tisch und kontrolliert, ob die Gedecke richtig platziert sind. Sie hat aus ihrer Aussteuertruhe heute das weiße Damasttischtuch mit den Monogramm-bestickten Servietten geholt und es auf dem groben Tisch ausgebreitet. Gleich sieht das ganze Zimmer hell und festlich aus. Darauf das Sonntagsgeschirr mit dem Goldrand, das sie von ihrer Patin als Hochzeitsgeschenk erhalten hat. Eigentlich gehörte ein Silberbesteck dazu, denkt sie, als sie Löffel, Messer und Gabeln rings um die Teller legt. Sie hat aber nur das Werktagsbesteck mit den schwarzen Holzgriffen, das aus dem Haushalt ihrer Eltern stammt. Ihr Bruder hat es ihr nach dem Tod der Mutter überlassen, zusammen mit vier Bettbezügen und dem Geschirr für die Wochentage. Alles übrige, auch das Haus, hat er geerbt.
Ihn und seine Frau, eine reiche Bauerstochter aus Philippsdorf, haben sie nicht eingeladen. Wenn er durch das Städtchen promeniert, gibt er sich ganz als der neue Fabrikbesitzer, zwirbelt seinen Schnurrbart hoch und hebt majestätisch den Hut, wenn er auf Bekannte trifft. Er hat mit seinem und dem Erbe seiner Frau eine kleine Zwirnerei gegründet und verdient anscheinend so viel, daß er es sich leisten kann, jeden Sonntag mit Frau und drei Kindern im Hotel »Sonne« zu speisen.
Wahrscheinlich werden sie nach dem Essen kurz vorbeikommen und ein Geschenk für das Baby mitbringen. Sie bleiben nie lange, setzen sich aber, um dem Haus nicht die Ruhe zu nehmen, wie es heißt. Dorothea, die teuer ausstaffierte Schwägerin, behält dabei stets ihren Hut auf, damit alle ihn gebührend bewundern. Sie kauft ihre Garderobe in Tetschen, fährt viermal im Jahr zu ihrem Lieblingsgeschäft, das einem Cousin von ihr gehört. Er bezieht seine Kleider direkt aus Prag, und nur die feinsten Damen aus der guten Gesellschaft kaufen bei ihm.
Nach solchen Verwandtschaftsbesuchen sagt Franz jedesmal zu seiner Frau, ach, Mariechen, wie hübsch du aussiehst neben diesem Pfau.
Aber das karierte Rüschenkleid sah schon elegant aus, in das Korsett hat sie sich bestimmt monatelang hineingehungert, erwidert seine Frau. Na, ja, der Hut mit den grünen Federn, da geb ich dir recht, das war einfach zu viel. Sie hat ihn nicht mal abgenommen beim Kaffeetrinken, hat gedacht, sie wär im Kaffeehaus. Da sitzen angeblich auch die Damen und behalten ihre Hüte auf. Als ob sie in Wien wär!
Unwillkürlich sieht Marie an sich herunter. Sie hat heute ihr altes Sonntagskleid an, das neuerdings spannt um Brust und Taille. Auch der Bauch steht noch etwas vor, aber die Falten kaschieren das. Und sie wird ihre weiße Schürze anbehalten beim Essen, weil sie den kostbaren dunkelblauen Taft keinesfalls bekleckern will. Die Schwiegermutter wird es ihr überlassen zu servieren, das macht sie immer so. Damit zeigt sie, daß sie zwar hilft im Haushalt, ihre Schwiegertochter aber die richtige Hausherrin ist. Was andere junge Frauen dagegen alles über die Herrschsucht der Alten erzählen! Kaum ist so eine Schwiegermutter im Haus, schon übernimmt sie das Regiment, und die Junge muß spuren und gehorchen. Das war bei ihr von Anfang an ganz anders. Schließlich hat man sie ausdrücklich mit ihrem Zukünftigen bekannt gemacht, und die beiden jungen Leute sahen sich dann auch jeden Sonntagnachmittag zur gemeinsamen Kaffeestunde. Marie kennt die Familie, seit sie auf der Welt ist, sie ist die Schulfreundin von Therese, und die Eltern sind Nachbarn. Anständige Familie, gehorsame Tochter! So lautete das allgemeine Urteil über sie, nicht nur von der zukünftigen Schwiegermutter. Aber das mußte man dem Sohn Franz gar nicht erst erzählen.
Unter den Augen beider Elternpaare haben sie sich verlobt, und als Franz mit Onkel Albins Hilfe seine Werkstatt eingerichtet hatte, haben sie geheiratet. Ein halbes Jahr nach der Hochzeit sterben kurz hintereinander Maries Eltern, und vor drei Monaten der Schwiegervater. Franz hat das väterliche Haus geerbt, zieht aber mit seiner Frau nicht ein, sondern läßt Mutter und Schwester in ihrer altgewohnten Umgebung wohnen. Für das kleine Haus mit Werkstatt und Wohnung, in der die junge Familie wohnt, hat Albin eine Vorauszahlung geleistet. Jeden Monat gehen Zins und Abzahlung gleich an die Bank.
Albins Besuche steigern jedesmal die Festlichkeit des Sonntags. Meist kommt er geradewegs aus dem Hochamt und macht sich einen Spaß daraus, die salbungsvolle Suada des Dechanten zu imitieren.
So poltert er ins Haus, geradewegs auf Mariechen zu, verneigt sich mit einem Bückling vor ihr und überreicht ihr ein rosa Päckchen mit Goldband.
Untertänigster Diener, meine Gnädigste, flötet er auf Wienerisch, und Glückwunsch! Weiter marschiert er zur Wiege, wo ihn zwei Augen aufmerksam betrachten. Er streichelt die Wange der kleinen Franziska, und sie lächelt ihn an.
Charmant, charmant, ruft er den Eltern zu und legt einen Umschlag auf das weiße Spitzenkissen.
Aber Onkel Albin, du sollst doch nicht …
Franz drückt ihm die Hand.
Was ich alles nicht soll! Wenn ich mich danach richten würde!
Albin lacht laut:
Allein die Predigt heute!
Mit gefalteten Händen stellt er sich vor den Tisch, neigt den Kopf im Gebetswinkel und imitiert den Tenor von Hochwürden:
Oh ihr Gottfürchtigen, wehe euch, keine Ebenbilder Gottes dürft ihr mehr sein, sondern Nachkommen behaarter Affen ohne Hirn und Glauben!
Aber, sagt er zu Franz gewandt, ich habe hier ein paar Zeilen aus der Gartenlaube, die noch weiter gehen als der letzte Artikel. Und er liest Franz in der hinteren Ecke des Zimmers vor: …dass die niederen Menschenracen den höheren Affenarten weit ähnlicher sind, als diese den niederen, ihnen zunächst stehenden Affenarten. Der Missionar Morlang, welcher ohne allen Erfolg viele Jahre hindurch die affenartigen Negerstämme am oberen Nil zu cultivieren suchte, schreibt, daß unter solchen Wilden jede Mission durchaus nutzlos sei, sie stünden weit unter den unvernünftigen Thieren, denn diese letzteren legten doch wenigstens Zeichen der Zuneigung gegen Diejenigen an den Tag, die freundlich gegen sie sind, während jene viehischen Eingeborenen allen Gefühlen der Dankbarkeit völlig unzugänglich seien.
Und so spricht ein Missionar, ein Priester?
Was? ruft die Großmutter. Affen? Schon wieder Affen? Was für ein Affentheater, diese Predigten. Ich hab den Dechant vorige Woche schon zum gleichen Thema gehört. Aber was er dauernd mit seinen Affen hat, da wird doch keiner klug draus.
Er versteht es selber nicht, sagt Albin, und alle lachen.
Anschließend liest er noch aus einem Artikel vor:
… Besser, sich von einem unvernünftigen Tiere zu dem über seine Abkunft philosophierenden Menschen aufgestiegen zu wissen, als sich von dem göttergleichen Adam zu einem abergläubischen Fetischanbeter herabzuwürdigen. Weit entfernt, daß die sich vorbereitende Weltanschauung den Menschen vertieren und edleren Neigungen abhold machen könnte, wird sie alle in ihm schlummernden Keime zu entfalten streben, denn ein Fortschreiten zum Vollkommeneren ist ja ihr Grundgedanke …
Darauf sagt erst mal niemand etwas.
Nur Mariechen ruft:
Jetzt aber bitte Platz nehmen, sonst wird die Suppe noch kalt.
Und sie geht zum Herd, gießt die Suppe vom Kochtopf in die Schüssel mit Goldrand und platziert sie in der Mitte.
Albin rückt seinen Stuhl zurecht, lehnt sich behaglich zurück.
Wie gemütlich es wieder bei euch ist! Und der Tisch so schön gedeckt! Und wie das wieder duftet!
Großmutter hat sich extra Markknochen beim Fleischer bestellt, sie in reichlich Zwiebeln und Knoblauch geröstet und dann mit Wasser und Sellerie aufgekocht, bevor sie später kleine Klößchen aus Mark, Ei und Semmelbröseln rollt.
Andächtiges Schweigen am Tisch. Alle genießen die kräftige Suppe, Franz brockt noch Brot hinein.
Albin ist als erster fertig.
Noch einen Schöpfer? Mariechen steht auf und gießt noch Suppe in Albins Teller.
Nirgendwo auf der Welt gibt’s so eine wunderbare Suppe, schwärmt Albin, nicht mal im Hotel Sacher in Wien.
Wann warst du denn das letzte Mal dort?
Laß mich überlegen. So ungefähr vor einem halben Jahr, im Gefolge des Allerhöchsten, um nicht zu sagen, des Allerwertesten.
Alle lachen, weil sie Albins Bezeichnungen für den Bürgermeister schon kennen.
Er hat sich mal wieder feiern lassen, und, ich verrate euch ein Geheimnis, demnächst wird er geadelt, das habe ich mitgehört. Seine Verrrdiienstö um das Allgemaiinwoohl sind extra-ördinäärr!
Sie wissen, worauf er anspielt.
Da werden wir demnächst einen Edlen von und zu Hasel als Bürgermeister haben, vermutet Franz.
Ich hab nichts gesagt! Albin hebt beide Arme. Ich bin unschuldig! Ich heiße Hase! Ich weiß von nichts!
Unter dem allgemeinen Gelächter räumt Mariechen Suppenschüssel und -teller ab, holt den Braten, häuft die Kartoffeln in eine Schüssel und gießt die Soße in ein Kännchen.
So, seid ihr fertig für den Braten?
Franz schneidet den Braten, Mariechen teilt die Kartoffeln aus und gießt Soße darüber.
Ach, wie das wieder schmeckt! ruft Albin anerkennend. Mariechen, auf dein Wohl!
Nein, nein, sagt sie, die Ehre gebührt der frisch gebackenen Großmutter! Sie hat alles gekocht, ich habe nur assistiert.
Dann also auf beide Damen, und meinen herzlichen Dank!
Zum Nachtisch gibt es Kirschkompott, das sie aus dem Keller geholt haben.
Nachdem das Geschirr abgeräumt ist und im großen Wasch-Schaff verstaut, greift Mariechen nach dem rosa eingewickelten Päckchen.
Jetzt muß ich doch nachschauen, was du mir geschenkt hast.
Sie glättet das Papier, weil sie es wieder verwenden will, und sie rollt die goldene Schleife auf, die sie glatt bügeln wird. Vorsichtig öffnet sie den Deckel.
Schau doch, Franz, das ist genau das Glas, das ich in der Auslage bei Hegenbarth in der Oberen Straße gesehen habe! Unsere Kapelle, so fein ziseliert, ach, wunderbar! Das stelle ich gleich auf die Kommode im Schlafzimmer, da hab ich es immer vor mir, gleich wenn ich aufwache.
Sie drückt Albin einen Kuß auf die Wange. Vielen Dank!
So, jetzt setze ich das Kaffeewasser auf, denn gleich gibt’s Floslkuchen!
Albin rückt seinen Stuhl näher an Franz.
Du hast ja auch den Artikel in der Gartenlaube gelesen. Was hältst du von der ganzen Affentheorie?
Was da geschrieben wird, kommt mir ziemlich revolutionär vor. Sonst würden sich die Pfarrer nicht so drüber aufregen. Es hieß da so ungefähr, daß die Kirche uns das Denken verboten hat, aber daß sie auf Dauer nicht gegen die Natur anpredigen kann.
Ich sag’s dir, antwortet Albin, dieser Darwin wird die Welt verändern.
Wenn der Mensch das Ergebnis eines Naturgesetzes ist, wo bleibt da die Geschichte aus der Bibel? Von der werden sie sich genau so verabschieden müssen wie von der Sonne, die sich um die Erde dreht. Man geht ja sogar noch weiter in dem Artikel und relativiert die Bibel, indem aufgezeigt wird, daß eine Reihe anderer Religionen ziemlich ähnliche Erklärungen zur Erschaffung der Welt, der Entstehung des Bösen und ihrer Erlösung davon anbieten. Da, hör mal zu:
Alle sogenannten Sonnenkämpfer gelten als Jungfrauensöhne, mehr als einen von ihnen läßt die Mathe von einem durch den bösen Feind veranstalteten allgemeinen Kindermord wunderbar errettet werden; die meisten werden vom Teufel versucht, fallen dann einem Verrathe zum Opfer, erstehen aber auf und fahren in den Himmel.
Sie schreiben, diese Messiassagen ähneln sich in allen Einzelheiten.
Und was ist dann mit der Bibel? Alles nur Geschichten wie so viele andere? Franz schüttelt den Kopf.
Wäre halt eine schöne Vorstellung, als Ebenbild Gottes herumzulaufen. So aber sieht es die Wissenschaft nicht. Wie wir vom Affen zum Menschen gekommen sind? Es heißt, die intelligenten Affen haben so lange geübt, bis sie endlich den aufrechten Gang gelernt haben. Und was ist mit den unintelligenten?
Die kannst du auf dem Jahrmarkt bestaunen, sagt Albin.
Mariechen kommt mit der Kaffeekanne, ihre Schwiegermutter trägt ein großes Holzbrett herein und stellt den Kuchen auf den Tisch.
Schluß jetzt mit den Affen, sagt sie, schneidet den Kuchen an und legt das erste Stück auf Albins Teller.
Seien wir froh, schon Menschen zu sein, lacht Albin, denn Affen können keine Kuchen backen!
4
Im Winde wehn die Lindenzweige, von roten Knospen übersäumt; die Wiegen sind’s, worin der Frühling die schlimme Winterzeit verträumt.
Wie die Zeit vergeht!
Der Kreisel notwendiger Verrichtungen: die Asche auskehren, Spreißel schnitzen, Feuer machen, immer wieder aufs Neue, um die Kälte zu vertreiben. Mariechen holt sich einen Hocker, bläst in die kleine Flamme, hofft, daß sie aufs Holz übergreifen wird. Eisblumen am Fenster, wie im tiefsten Winter. Dabei sind seit voriger Woche schon Schneeglöckchen zu sehen im Vorgarten. Das soll Frühling sein?
Jeder Morgen fängt an mit neuem Einheizen, mit dem Aufsetzen des Haferbreis, den sie am Abend eingeweicht hat, damit er schneller gar wird: Hafermus gibt starken Fuß! Hoch oben auf dem Küchenregal die kostbare Zuckerdose, aus der sie einen Löffel auf dem heißen Brei verstreut, zusammen mit einem Blümchen Butter, das in die Mitte kommt. Wenn das Wasser endlich kocht, ist auch der Kaffee schnell fertig, zum Zichorie eine Prise echtes Kaffeepulver, das letzthin Albin mitgebracht hat. Brot hat sie vorgestern gebacken, einen großen Laib, den der Bäcker mit in den Ofen geschoben hat. Ein paar zermahlene Sonnenblumenkerne mitgemischt, so liebt es Franz. Ein Brot, das man so nirgendwo kaufen kann. Ribislmarmelade gibt’s dazu, auch die hat sie im Vorjahr selbst eingekocht.
Was sie fürs zweite Frühstück braucht, holt sie, wenn die Kleine frisch gewickelt und die Wäsche eingeweicht ist. Speck und eingelegte Bohnen hat sie dafür vorgesehen.
Zum Mittagessen wird sie zuerst eine dicke Gerstensuppe kochen, beim Fleischer Kochfleisch besorgen, dazu ein paar Innereien, woraus sie am nächsten Tag Kuttelfleisch in saurer Soße machen wird. Das Suppenfleisch mit einer Krensoße wird am Mittag den Lehrling, die Gesellen und den Meister satt machen. Dazu gibt es Kartoffeln aus der Schale, weil die, wie Albin letzthin gelesen hat, gesünder sind als die vorher geschälten. Klingt einsichtig, denn die Schalen der gekochten Kartoffeln gehen leichter ab, und es bleibt mehr von der Kartoffel erhalten.
Fürs Abendessen will sie noch Heringslake kaufen, um die Kartoffeln darin zu schwenken, dazu Sauerkraut und Buchweizengrütze.
Gedankenlos legt sie ein Messer auf den Holztisch, die Schneide nach oben; gleich erschrickt sie, dreht das Messer um. Sie will nicht sündigen und dafür verantwortlich sein, daß die armen Seelen barfuß auf der Schneide gehen müssen. Sie schaut auf ihr Kind, das in einem Korb am Boden liegt. Nur nicht über das Körbchen gehen oder gar springen, denn dann wächst das Baby nicht mehr. Oder gar die leere Wiege bewegen, dann würde das Kind sterben! Hat sie auch am Palmsonntag drei Kätzchen von den geweihten Palmzweigen verschluckt, damit sie kein Halsweh bekommt, und sich gegen Fieber geschützt mit drei zerkauten Kornblumen? Und den Spruch gegen Augenkrankheiten aufgesagt am 24. Juni: Johannisfeuer, guck, guck, Stärk mir meine Augen, stärk mir meine Augenlider, daß ich dich auf’s Jahr seh wieder!
Warum fallen ihr die alten Sprüche jetzt ein? Aberglaube ist das, nicht mehr dran denken. Aber wieso wiederholt man dann diese Sätze immer wieder und gibt sie an die nächste Generation weiter? Das sind die Einflüsterungen des Teufels, sagt der Pfarrer, schieb diesen Unsinn nach hinten, denk einfach nicht mehr daran. Aber die Angst, in dem Aberglauben könnte doch ein bißchen Wahrheit stecken, diese Angst ist stärker als die Angst vor der Sünde, deren Schändlichkeit im Beichtspiegel ausführlich behandelt wird.
Sie erinnert sich an die letzte Predigt:
Die Sünde des Aberglaubens ist es, da man den Geschöpfen oder Dingen eine Kraft oder Wirkung zuschreibt, die man von denselben gar aus keinem vernünftigen Grunde erwarten kann. Hier will ich euch, meine lieben Pfarrkinder, besonders ermahnet haben, daß ihr nicht leichtgläubig seid, und dasjenige, was euch, euren Kindern, Viehe oder Feldgewächsen Widriges oder Schädliches begegnet, nicht gleich als Zauberkunst ansehet.
Entschlossen wischt sie sich über die Stirn. Weg damit! Und sie schabt weiter an den Karotten.
Ihre Tage verschwimmen, und schließlich erwecken die immer gleichen Handgriffe und Tätigkeiten den Eindruck, sie glichen sich wie ein Ei dem anderen. Die Kleine schreit, sie wird gestillt, sie schreit, man wechselt die Windeln, die schmutzigen Windeln werden eingeweicht, im Hof steht der Bottich mit der Seifenlauge. Ist es zu kalt, trägt sie die Wäsche in den Keller. Einmal pro Woche wird dort der Ofen eingeheizt, Waschbrett und Wurzelbürste bearbeiten die nasse Wäsche, rot geschwollen sind die Hände dann. Brettsteif gefroren im Winter die Laken, die sie von der Leine im Garten nimmt. Die Schwiegermutter kommt, bleibt oben beim Kind, wenn sie einkaufen geht und kocht.
Es dampft beim Bügeln, das schwere Eisen immer wieder und wieder auf den heißen Ofen gestellt, warten, währenddessen schnell Zwiebeln schneiden. Wie gerne würde sie sich zwischendurch einen Augenblick hinsetzen, mit der kleinen Franziska spielen, ihr Gesichtchen streicheln. So weiche Wangen! Ihr Kind. Es ist ihr Kind, und doch, je öfter sie ihr in die Augen sieht, desto fremder wird es ihr. Meine Tochter? Wer begreift das schon, plötzlich ein neuer Mensch.
Die Gedanken kreiseln, die Arbeiten sind eingeschliffen, tun sich fast von selber. Sie holt Kartoffeln aus dem Keller, Möhren aus der Sandmiete. Vermischt Kartoffelgulasch mit dem Paprikapulver, das Albin aus Wien mitgebracht hat.
Die Sonntage mit Albin sind immer schön. Miteinander spazieren sie, wenn es nicht regnet, hinauf zum Höllegrund, weiter zum Brüderaltar, die Männer voraus, sie mit dem Kinderwagen, der Großmutter und manchmal Therese hinterdrein.
Franz ist immer unruhig nach solchen Besuchen. Was sie auch immer miteinander debattieren!
Therese erzählt von einem Artikel in der Gartenlaube, der allerhand Ratschläge für die Erhaltung gesunder Haut erteilt hat. Demnach soll man sich das Gesicht mit Milch und Zitronensaft waschen, Malvenblätter abkochen und sich mit dem Sud waschen und keinesfalls violette Schleier in der Sonne tragen.
Mariechen lacht.
Ich und ein violetter Schleier! Die Zitronen, wenn es an Weihnachten welche gibt, verwende ich lieber zum Backen. Und mit Milch sich waschen! Das grenzt ja schon an Frevel. Milch ist zum Trinken für die Kinder.
Therese hat alles schon ausprobiert. Aber ihre Haut ist auch nicht jünger geworden. Die Schwiegermutter schweigt vor sich hin. Diese jungen Frauen! Hatten sie solche Gesprächsthemen zu ihrer Zeit? Sie kann sich nicht erinnern. Eine Geschichte fällt ihr ein, da badete die Prinzessin in Eselsmilch. Ob sie das bei den Karschs und Kinskys immer noch so machen? Genug Geld dafür haben sie sicher. Wenn man sie mal in der Kutsche vorbeifahren sieht, geben die Vorhänge den Blick auf die Gesichter nicht frei. Es hat keinen Sinn, an die hohen Herrschaften zu denken, die leben in einer anderen Welt, wo man wahrscheinlich jeden Tag von Goldrandtellern speist und nur einen Teil dessen aufißt, was die Köchinnen zubereitet und die Dienerinnen serviert haben.
Was redet Albin da? Die alte Geschichte erzählt er in den Kinderwagen hinein, von der Schloßbergruine, vom bösen Schloßherrn, der seine Untertanen quälte und mißhandelte und dafür nach seinem Tod kopflos umhergeistert und harmlose Wanderer erschreckt. Dazu schneidet er Grimassen und brüllt huuh huuh!, so daß die Kleine vor Vergnügen strampelt und gurrend lacht.
Franz steht daneben und staunt. Sein seriöser Onkel! Und macht solche Sperfenkel mit der Kleinen! Auch die drei Frauen haben ihren Spaß mit Albins Geschichten. Zu Hause zieht er eine Zeitung aus der Manteltasche und liest vor, was von der Weltausstellung von vor zwei Jahren in Wien berichtet wird:
Märtyrer der Weltausstellung.
Der Aufseher in der Weltausstellung ist das unglücklichste Geschöpf, welches sich überhaupt denken läßt auf dieser Jammererde. Man stelle sich ein in eine groteske, nach russischer Form justierte Uniform gestecktes Wesen vor und man denke sich die Verpflichtung, wochen- und monatelang Acht haben zu müssen auf die Dinge, die kein Mensch zu stehlen gedenkt und die von selber unmöglich fortlaufen können.
Sie haben sich gebogen vor Lachen, als Albin diesen Märtyrer auch noch anschaulich dargestellt hat, wie er habtacht neben dem Ofen steht und mit hervorquellenden Augen das unbewegliche Objekt bewacht.
Bei all dem denkt Mariechen, daß Franz auch ein guter Stadtschreiber geworden wäre, so gescheit wie er ist. Aber es mußte ein Handwerk sein, etwas mit goldenem Boden. Schuhe brauchen die Menschen immer, hieß es.
Wer hätte damals gedacht, daß es einmal Schuhfabriken geben würde, mit Maschinen und ungelernten Arbeitern, und auf einmal ein Paar Schuhe nur noch die Hälfte von dem kostet, was ein Schuster verlangt.
Ich bin doch kein Flickschuster, protestiert Franz, wenn er immer öfter Reparaturen machen muß. Sich Stiefel und Schuhe anmessen zu lassen, dazu finden sich immer weniger Kunden bereit. In Zukunft werden sich nur noch die Reichen handgearbeitete Schuhe leisten können. Aber wie viele Reiche gibt es schon in Kamnitz? Und sind die Reichen nicht immer die geizigsten, wenn es darum geht, im Kleinen zu sparen?
Bei ihnen wird im Kleinen und im Großen gespart. Die Reste des Sonntagsbratens werden gestreckt bis zum Dienstag, es gibt Kartoffeln mit Fleischfasern, es gibt Graupen, die in der verdünnten Soße gekocht werden. Jeden Tag überlegt Marie, wie sie die Überbleibsel des vergangenen Tages weiter verwenden kann. In die Knödel kommt ein Nest mit gerösteten Brotstücken, damit das Fleisch nicht vermißt wird. In die Einbrenne einen Hauch der gepreßten Brühe, die es neuerdings beim Kolonialwarenhändler gibt. Sie kocht Türkenbrei aus Maismehl, dicke Linsensuppen und Erbsenpüree, sie bäckt Kartoffelbrötchen zur Rübensuppe. Während sie nachdenkt über Einkaufen und Kochen, flickt sie die Strümpfe von Franz, bessert ihre Sonntagsbluse aus, deren eine Naht geplatzt ist. So vergehen die Tage, denkt sie, so vergeht mein Leben.
Aber geht es den Männern besser?
Anstatt Suppe zu kochen, lernen sie, wie man Sohlen befestigt, wie man die Oberteile von Damen- oder Herrenschuhen zuschneidet, wie man die Brandsohle einklebt. Die ganze Lehrzeit über lernen sie immer wieder das gleiche, und sie brauchen dazu länger, als eine Frau braucht, um zu lernen, wie man Kartoffeln schält oder einen Braten zubereitet. Und was dann?
Die Männer tun auch ihr ganzes Leben nichts anderes, als was sie in ihrer Lehr- und Gesellenzeit geübt haben, Tag für Tag.
Aus seiner Schulzeit hat Franz ein Gedicht in regelmäßiger deutscher Schrift zu Papier gebracht, es später gerahmt und neben seinem Arbeitsplatz aufgehängt:
Auch zwei Schuhe trägt ein Jeder, Und die Schuhe sind von Leder, Und das Leder kommt vom Rind, Merk dir das, mein liebes Kind. Will das Kindchen Schuhe haben, Muß solch armes Thier erst sterben,Und dann wird das Fell zum Gerben In die Erde erst vergraben; Lohe braucht man auch dazu Ohne Loh’ gibt’s keine Schuh! So! Nun ist das Leder weich! Flugs kommt auch der Schuster gleich, Nimmt das Maaß, und früh und spat Näht er nun mit Pech und Draht! Soll das Kindchen spielen, laufen, Muß Mama die Schuhe kaufen, Und was thut das Kind dabei? Reißt die Schuhe schnell entzwei!
Möchte sie mit Franz tauschen?
Erbsen pflanzen, Salat ernten, Brot backen, Wäsche waschen, mit der Kleinen in den Ort fahren, um Mehl und Zucker zu kaufen – das ist, denkt Mariechen, abwechslungsreicher, als von früh bis spät immer wieder die gleichen Sohlen zuzuschneiden, freundlich zu den Kunden zu sein und ihnen kostspielige Schuhe einzureden, die sie dann monatelang nicht bezahlen.
Nein, sie ist zufrieden, so wie es ist.
Was hat Albin am Sonntag noch erzählt? Von einer Frau, einer Engländerin oder Amerikanerin, die Mathematik studiert hat, vor 25 Jahren ist sie gestorben. Marie hat Mühe, dieses fremde Wort zu buchstabieren. Was mag diese Frau genau gemacht haben? Albin meint, sie rechnete besser als die meisten Männer. Eine Rechenmaschine hat sie offenbar entworfen. Marie denkt, so eine Maschine könnte sie auch gebrauchen. Das Zusammenzählen und Malnehmen hat ihr immer schon Schwierigkeiten gemacht. Wenn von so einer Frau in den Zeitschriften berichtet wird, die Albin liest, dann kann man sicher sein, daß sie entweder aus dem Adel stammt oder von reichen Eltern, die sich Hauslehrer leisten können. Albin hat vorgeschlagen, das nächste Kind, das Marie erwartet, nach dieser klugen Frau zu benennen, nämlich Ada. Aber was sollte das bedeuten? Daß man hoffte, dieses Mädchen würde einmal nach Prag oder Wien gehen und an der Rechenmaschine der verstorbenen Ada weiterbasteln?
Marie lächelt vor sich hin. So ein Unsinn. Manchmal hat der Onkel schon verquere Ideen. Nach ihrer Mutter oder ihrem Vater wird sie das nächste Kind nennen, Ida oder Friedrich. Vielleicht hat Albin seinen Vorschlag auch gar nicht ernst gemeint, er macht ja manchmal Witze, die sie nicht versteht. Dann grinst er schelmisch und zwinkert ihr zu, damit sie trotzdem lacht. Auch über diese Ada aus London hat er am Ende noch so eine Bemerkung gemacht, über die auch Franz lachte. Es ging offenbar um den losen Lebenswandel der adligen Rechnerin, und Albin scherzte, dieses weibliche Genie habe auch sonst nichts anbrennen lassen. Beinahe hätte sie gefragt: Was anbrennen? Die hat doch sicher nicht in der Küche herumgebrutzelt, wenn sie so reich war. Gerade noch hat sie sich diese Bemerkung verkniffen, da lachten die beiden Männer schon aus vollem Halse. So ungefähr reimt sie sich zusammen, was mit diesem Ausdruck gemeint war. Die Reichen! Für die gelten offenbar andere Gesetze. Da werden Ehen geschieden, sogar vom Papst. Und Könige oder Kaiser gehen morganatische Ehen ein, und das ist nichts anderes als Vielweiberei. Wenn ein normaler Mann so etwas tat, mußte er aus der Kleinstadt wegziehen, irgendwohin, wo ihn keiner kannte.
Marie denkt an den Schuster, der ihnen die Werkstatt verkauft hat, ziemlich billig, weil er gezwungen war, sich woanders Arbeit zu suchen, nachdem er seine Frau für eine durchreisende Tänzerin verlassen hatte. Was mag aus ihm geworden sein? Ob er in Dresden oder in Prag oder gar in Wien mit seiner neuen Frau neu angefangen hat?
Die verlassene Schustersfrau lebt seither bei ihrer Tochter, einer Freundin von Therese. Am Rande hat Mariechen mitgekriegt, was dort jeden Tag los ist. Die Alte soll im Haus herumschreien und auch in der Nacht keine Ruhe geben. Sie haben zwar ein Beruhigungspulver von Doktor Reindl, das hat aber bisher auch nicht geholfen, die Schustersgattin still zu halten. Was für ein Unglück! Da brennt der ungetreue Mann mit einer Jüngeren durch, und seine Frau verliert darüber den Verstand.
Wäre Franz auch fähig, sie zu betrügen? Nein und wieder nein. Vielleicht ein bißchen zu viel politisiert er mit seinem gescheiten Onkel; meist diskutieren sie leise, sie versteht ohnehin nicht, worüber sie sich so aufregen. Die Predigten des Pfarrers sind die Aufhänger für lange Gespräche.
In die Messe kommt Mariechen nur selten, die Kleine kann man noch nicht allein lassen. So weiß sie auch nicht genau, wogegen der Dechant wieder von der Kanzel gewettert hat. Manchmal, denkt sie, ist es gut, wenn man nicht alles versteht. Ihre Großmutter hat das auch gesagt, als sie schwerhörig wurde. In letzter Zeit ging es ständig um die Affenfrage. Die Menschen sollen vom Affen abstammen. So eine verrückte Idee! Mariechen kennt ihre Großeltern, sogar an ihre Urgroßmutter kann sie sich noch erinnern, die im langen, schwarzen Kleid neben dem Ofen saß. Ein Affe war die ganz bestimmt nicht. Also, worüber sich derart aufregen?
Wahrscheinlich liegt es daran, daß die Männer Feierabend haben. Da werden Artikel gelesen, zieht man Zeitungen heran und streitet darüber. Dafür hat sie keine Zeit. Bis spät in die Nacht legt sie Wäsche zusammen, flickt Hosen und Strümpfe. Feierabend ist nur etwas für Männer. Die disputieren dann, anstatt Strümpfe zu stricken. Sie kritisieren die Predigten, daß es schon fast sündhaft ist. Mariechen sagt das nicht laut, weil sie im Grund keine Ahnung hat von all dem, was die Männer so in Rage bringt.
So lange sie hinterher friedlich lachend auseinander gehen, hat sie nichts dagegen. Es ist wie Kartenspielen, denkt sie, nur ohne Karten.
5
Wastl, Wastl, Leinwandkastl, auf der golden Wiesn steht a golden Pferd. Brantwein, Zucker drein, was die Kua am Löffl scheißt, des g’hört dein.
Die Welt ist eine Schusterwerkstatt und steht in einem Teil der Welt, der einige Male zwischen den Nationen hin und her geschoben wird – aber das ist anno 1875 noch Zukunftsmusik.
Goethe ist gerade mal 43 Jahre tot, aber 1875 ist keine Goethezeit mehr. Die Romantiker sind literarisch am Ruder, schwärmen von der Natur, als wäre sie ein beseeltes Wesen.
Albin liest den Nachruf auf den Dichter Mörike aus der Gartenlaube vor, dazu sein Lieblingsgedicht :
Herr, schicke, was du willt, Ein Liebes oder Leides; Ich bin vergnügt, daß Beides Aus Deinen Händen quillt.
Wollest mit Freuden Und wollest mit Leiden Mich nicht überschütten! Doch in der Mitten Liegt holdes Bescheiden.
Mariechen muß weinen, weil es auch ihr Gedicht ist. Sie will zufrieden und bescheiden leben und hofft, daß ihr schlimme Schicksalsschläge erspart bleiben. Von den Freuden erwartet sie nicht, sie würden so gehäuft auftreten, daß sie überschüttet damit würde. Ihr reicht es, wenn alle gesund bleiben und aus den Kindern mal was Ordentliches wird. Wie ihre Eltern und Schwiegereltern strebt sie nicht nach »Höherem«, wie so manche Personen in den Romanen und in den Fortsetzungsgeschichten der Gartenlaube:
Der Prinz erhob sich. ›Irma‹, rief er in einem Ton, der ihr mehr sagte als hundert Worte; halb wandte er sich zum Gehen, dann stürzte er zurück zu der blassen Frau, die nicht abwehrend ihm ihre weißen Hände entgegenstreckte, die es duldete, daß er ihr Gesicht mit leidenschaftlichen Küssen bedeckte, die einen Moment fühlte, daß es noch ein Glück für sie in der Welt gebe – in diesen Armen, die sie mit Glut und Liebe an’s Herz eines edlen Mannes drückten. Und sie schlürfte selig unter Thränen den einen Tropfen dieses Glücks.
Wenn Albin solche Romanausschnitte vorliest, handeln sie nicht von Leuten mit abgearbeiteten Händen und Schwielen an den Füßen, weil sie schon als Kinder die meiste Zeit barfuß gelaufen sind. Da ist die Rede von gebildeten Damen in kostbaren Roben, die in ihren Salons mit den reichen Herren über Kunst und Politik reden, aber dabei immer höflich und auch unterwürfig bleiben. Diese Geschichten fließen durch sie durch, sie hinterlassen ein Gefühl der Fremdheit. Mit ihrem Leben als Hausfrau, Mutter und Schustersgattin haben sie nichts zu tun.
Wer zum Schuster geht und sich ein Paar neue Schuhe anmessen läßt, braucht Geduld. Jeder Schuh ist langwierige Handarbeit, es wird genagelt und gehämmert, und der Glückliche, der solche Schuhe bezahlen kann, pflegt und salbt sie mit größerem Eifer als den eigenen Körper. Sie müssen lange halten und haben ihrerseits ein hartes Leben, treffen sie doch hauptsächlich auf unbefestigte Straßen und Schotterwege.
Es pocht und poltert in den Ohren der kleinen Franziska, wenn man sie von der Schlafstube ins große Zimmer trägt. Helle Funken fliegen, wenn die Nägel auf metallische Schuhspitzen prallen. Mit der einsetzenden Dämmerung hört das Hämmern langsam auf. Wenn abends gekehrt wird, bildet sich Staubnebel, und die Welt versinkt allmählich im Dunkel. Es ist sinnlos, gegen das Nichts anzuschreien.