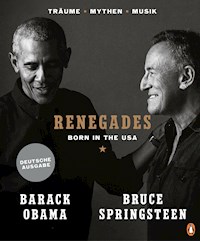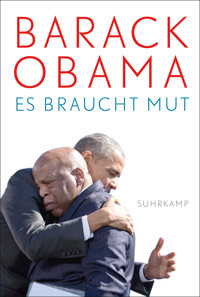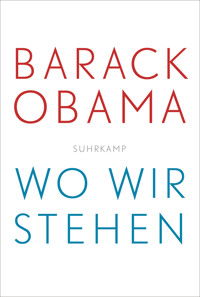Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Seit Barack Obama für das Amt des US-Präsidenten kandidiert hat, begeistert er die Menschen: Er verkörpert die weltweite Sehnsucht nach einer Politik des Friedens und der Menschlichkeit. Aufgewachsen unter ärmlichen Verhältnissen in Hawaii und Indonesien, musste Barack nach seiner Rückkehr in die USA erleben, wie er wegen seiner Hautfarbe diskriminiert wurde. Dies weckte seinen Ehrgeiz, der ihm zunächst eine glänzende juristische Laufbahn eröffnete und dann seinen furiosen Aufstieg als Politiker der Demokraten begründete. Wer nun seine Familiengeschichte liest, spürt, dass in ihm auch ein begnadeter Erzähler steckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 681
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barack Obama
Ein amerikanischer Traum
Die Geschichte meiner Familie
Aus dem Amerikanischen
von Matthias Fienbork
Carl Hanser Verlag
Titel der Originalausgabe:
Dreams from My Father
A Story of Race and Inheritance
Three Rivers Press, New York 2004
Ursprünglich als Hardcover-Ausgabe erschienen
1995 bei Times Books, Random House, Inc.
ISBN 978-3-446-23367-6
© 1995, 2004 by Barack Obama
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München 2008
Satz: Fotosatz Amann, Aichstetten
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt Electronic Publishing GmbH,
Hamburg
www.hanser.de
Denn wir sind Gäste und Fremdlinge vor dir,
wie alle unsre Väter.
1. Chron 29,15
Vorwort zur Neuausgabe von 2004
Fast zehn Jahre sind seit dem Erscheinen dieses Buches vergangen. Dass ich es geschrieben habe, ging – wie damals in der Einleitung erwähnt – auf ein Angebot zurück, das mir während meines Studiums gemacht wurde, nach meiner Wahl zum ersten afroamerikanischen Präsidenten der Harvard Law Review. Diese Berufung sorgte für ein gewisses Aufsehen. Ein Verleger zahlte mir einen Vorschuss, und ich machte mich an die Arbeit, überzeugt, anhand der Geschichte meiner Familie einen Beitrag zum Verständnis der Rassenprobleme in unserem Land und der Identitätsbrüche leisten zu können, der Ungleichzeitigkeiten und kulturellen Differenzen, die für moderne Gesellschaften so charakteristisch sind.
Als das Buch erschien, war ich, wie die meisten Jungautoren, voller Hoffnung und Zweifel – Hoffnung, es könne ungeahnten Erfolg haben, Zweifel an mir selbst, nichts Wesentliches gesagt zu haben. Die Wahrheit lag irgendwo in der Mitte. Das Buch wurde wohlwollend besprochen, und zu den Lesungen, die der Verlag organisierte, kamen tatsächlich Leute. Die Verkaufszahlen waren nicht überwältigend. Und nach ein paar Monaten kehrte ich in meinen Alltag zurück, überzeugt, dass meine Schriftstellerkarriere kurzlebig sein würde, aber froh, die Sache mehr oder weniger würdevoll überstanden zu haben.
In den nächsten zehn Jahren blieb mir kaum Zeit zum Nachdenken. 1992 war ich in einem Projekt zur Registrierung von Wählern engagiert, ich begann als Bürgerrechtsanwalt zu arbeiten und unterrichtete an der Universität von Chicago Verfassungsrecht. Meine Frau und ich kauften ein Haus, bekamen zwei reizende, gesunde und lebhafte Töchter und mussten Geld verdienen. Als 1996 im Parlament von Illinois ein Sitz frei wurde, drängten mich einige Freunde zu kandidieren. Ich errang das Mandat. Mir war schon klar, dass die Politik in den Bundesstaaten längst nicht so aufregend ist wie in Washington. Man steht nicht im Scheinwerferlicht, beschäftigt sich mit Themen, die für einige Leute wichtig, für den Mann auf der Straße aber ziemlich uninteressant sind (Zulassungsbestimmungen für Wohnmobile etwa oder Abschreibung bei landwirtschaftlichen Maschinen). Doch ich fand die Arbeit befriedigend, vor allem, weil hier in überschaubarer Zeit konkrete Ergebnisse möglich sind – beispielsweise die Einbeziehung armer Kinder in die Krankenversicherung oder eine Gesetzesreform, die verhindern soll, dass Unschuldige in die Todeszelle wandern. Und auch, weil man im Parlament eines großen industriell geprägten Bundesstaats tagtäglich im Gespräch mit den Menschen ist: mit der schwarzen Mutter aus dem Slumviertel und dem Farmer, dem Investmentbanker und dem ungelernten Arbeiter – sie alle wollen ihr Anliegen vorbringen, gehört werden.
Vor einigen Monaten wurde ich von der Demokratischen Partei als Repräsentant des Staates Illinois für den US-Senat nominiert. Es war eine hart umkämpfte Entscheidung in einem Feld mit vielen finanziell abgesicherten, fähigen und prominenten Kandidaten; ich selbst, ein Schwarzer mit einem merkwürdigen Namen, ohne organisatorischen Rückhalt und Vermögen, war als Außenseiter angetreten. Und als ich dann die Mehrheit errang, mit den Stimmen weißer und schwarzer Wähler aus den Vorstädten und den innerstädtischen Vierteln von Chicago, fiel die Reaktion ähnlich aus wie bei meiner Wahl zum Präsidenten der Law Review. Mainstream-Kommentatoren äußerten sich überrascht und mit der ehrlichen Hoffnung, dass mein Sieg einen spürbaren Wandel in unserer Rassenpolitik signalisiere. Die schwarzen Wähler empfanden Stolz auf das, was ich erreicht hatte, auch wenn sich in diesen Stolz Frustration mischte, weil wir – fünfzig Jahre nach dem Verfahren Brown vs. Board of Education und vierzig Jahre nach Verabschiedung des neuen Wahlrechts – noch immer die Chance feiern (nur die Chance, denn es stehen schwere Wahlen an), dass ich der einzige Afroamerikaner im Senat (und erst der dritte in seiner Geschichte) werden könnte. Meine Familie, meine Freunde und ich registrierten das große Interesse mit Verwunderung, waren uns immer der Kluft zwischen dem Medienhype und der banalen Alltagsrealität bewusst.
So wie jenes Interesse vor zehn Jahren meinen Verleger aufmerksam gemacht hatte, so hat der abermalige Medienrummel zu einer Neuauflage geführt. Zum ersten Mal seit Jahren habe ich das Buch wieder in die Hand genommen und einige Kapitel gelesen, weil ich sehen wollte, ob sich meine Stimme im Laufe der Zeit verändert hat. Ich muss gestehen, dass ich immer wieder zusammenzuckte – bei einer ungeschickten Formulierung, einer unverständlichen Aussage, einem larmoyanten oder allzu kalkuliert eingesetzten Gefühl. Weil ich den knappen Ausdruck zu schätzen gelernt habe, würde ich das Buch am liebsten um fünfzig Seiten kürzen. Ich kann aber nicht ernsthaft behaupten, dass die Stimme in diesem Buch nicht mir gehört, ich die Geschichte heute ganz anders erzählen würde als vor zehn Jahren, auch wenn bestimmte Passagen sich als politisch unbequem erwiesen haben und Wasser auf die Mühlen von Kommentatoren und politischen Gegnern sind.
Deutlich verändert hat sich natürlich der Kontext, in dem das Buch heute gelesen wird. Entstanden war es vor dem Hintergrund von Silicon Valley und dem Börsenboom, zu einer Zeit, als die Berliner Mauer fiel, Mandela langsam, unsicheren Schritts das Gefängnis verließ und Staatspräsident wurde, die Osloer Friedensvereinbarung unterzeichnet wurde. Die kulturpolitischen Auseinandersetzungen hierzulande – um Waffenbesitz und Abtreibung und Rap-Musik – wurden so heftig geführt, weil Bill Clintons Dritter Weg (ein reduzierter Wohlfahrtsstaat ohne große Ambitionen, aber auch ohne scharfe Kanten) einem allgemeinen Grundkonsens entsprach, dem selbst George W. Bush, der »Konservative mit Herz«, zustimmen musste. Außenpolitisch war vom Ende der Geschichte die Rede, vom Sieg des Kapitalismus und der Demokratie, vom globalisierten ökonomischen Wettstreit, der an die Stelle von Krieg und alten Rivalitäten treten würde.
Und dann, am 11. September 2001, zerbrach die Welt.
Ich will gar nicht erst versuchen, diesen Tag und die folgenden Tage zu beschreiben – die Flugzeuge, die gespenstisch in Stahl und Glas rasten, die zeitlupenhaft einstürzenden Türme, die aschgrauen Gestalten in den Straßen, den Schmerz und die Angst. Und ich will auch nicht so tun, als könnte ich den abgrundtiefen Nihilismus verstehen, der die Terroristen und ihre Gesinnungsgenossen antrieb und noch heute antreibt. Meine Empathie versagt angesichts des ausdruckslosen Blicks all jener, die eine sinnlose Befriedigung darin finden, unschuldige Menschen zu töten.
Ich weiß nur, dass sich an diesem Tag die Geschichte mit Macht zurückmeldete. Und dass, wie Faulkner schon sagte, die Vergangenheit nicht tot, nicht einmal vergangen ist. Diese kollektive Geschichte, diese Vergangenheit, berührt unmittelbar meine eigene. Nicht nur, weil die unheimlich präzisen Anschläge von al-Qaida mir vertraute Orte trafen – Nairobi, Bali, Manhattan; nicht nur, weil sich überege Republikaner seit dem 11. September über meinen Namen lustig machen. Sondern auch, weil der Grundkonflikt – zwischen Reich und Arm, zwischen Moderne und Tradition, zwischen jenen, die die anstrengende, konfliktträchtige Unterschiedlichkeit der Menschen akzeptieren und doch auf gemeinsamen, verbindlichen Werten bestehen, und jenen, die, unter welcher Flagge, Parole oder heiligen Schrift auch immer, eine verkürzte Eindeutigkeit suchen, die Gewalt gegenüber dem Anderen rechtfertigt – weil dieser Grundkonflikt auch in meinem Buch anklingt.
Ich kenne die Verzweiflung und die Unruhe der Ohnmächtigen: ich habe gesehen, wie sie das Leben der Kinder auf den Straßen von Djakarta, Nairobi und in der Chicagoer South Side beeinflusst, wie schmal der Grat zwischen Demütigung und grenzenloser Wut ist, wie schnell aus Hoffnungslosigkeit Gewalt wird. Ich weiß, dass die Antwort der Mächtigen auf diese Unruhe – schwankend zwischen träger Selbstzufriedenheit und, sobald die Unruhe eine gewisse Grenze überschreitet, gedankenloser Anwendung von Gewalt, längeren Gefängnisstrafen und noch ausgeklügelteren Waffen – nichts ausrichtet. Ich weiß, dass unversöhnliches und fundamentalistisches Denken uns alle ins Verderben stürzt.
Und so verband sich mein Versuch, diesen Konflikt zu verstehen und meinen Platz darin zu finden, mit der gesellschaftlichen Debatte, in der ich mich engagiere, einer Debatte, die auf Jahre hinaus unser Leben und das unserer Kinder prägen wird.
Was das politisch heißt, wäre Thema für ein anderes Buch. Ich möchte statt dessen mit einer sehr persönlichen Bemerkung schließen. Die meisten Menschen, die in diesem Buch vorkommen, sind – mal mehr, mal weniger – Teil meines Lebens.
Einen ganz besonderen Platz nimmt aber meine Mutter ein, die kurz nach Erscheinen dieses Buches an Krebs starb.
Sie hatte in den vorangegangenen zehn Jahren all das getan, was ihr am Herzen lag. Sie reiste, arbeitete in entlegenen Dörfern Asiens und Afrikas, half den Frauen, eine Nähmaschine oder eine Milchkuh zu kaufen oder eine Ausbildung zu beginnen, die ihnen wirtschaftliche Unabhängigkeit bringen würde. Sie schloss Freundschaften mit Menschen aus allen Schichten, unternahm lange Wanderungen, betrachtete den Mond und stöberte auf den Märkten von Delhi oder Marrakesch nach irgendeiner Kleinigkeit, einem Schal oder einer Figur, die ihr gefiel. Sie schrieb Berichte, las Romane, ging ihren Kindern auf die Nerven und träumte von Enkelkindern.
Wir sahen uns oft, hatten eine gute Beziehung. Sie las das Manuskript dieses Buches, korrigierte mich, wenn ich etwas falsch verstanden hatte, äußerte sich nicht zu meinen Beschreibungen ihrer Person, war aber sofort bereit, die weniger schmeichelhaften Facetten im Charakter meines Vaters zu verteidigen oder zu erklären. Sie trug ihre Krankheit mit Würde und Heiterkeit und half meiner Schwester und mir weiterzuleben – trotz unserer Ängste, unseres Nicht-wahrhaben-Wollens, unseres plötzlichen Schmerzes.
Vielleicht, denke ich manchmal, hätte ich ein anderes Buch geschrieben, wenn ich gewusst hätte, dass sie ihre Krankheit nicht besiegen würde – weniger eine Auseinandersetzung mit dem abwesenden Vater, eher ein Loblied auf die Mutter, die in meinem Leben die einzige Konstante war. In meinen Töchtern sehe ich sie jeden Tag, ihre Freude, ihre Fähigkeit zu staunen. Ich will gar nicht versuchen zu beschreiben, wie sehr ich ihren Tod noch immer betrauere. Sie war der freundlichste, großzügigste Mensch, dem ich je begegnet bin – ihr verdanke ich das Gute in mir.
Einleitung
Geplant war ursprünglich ein ganz anderes Buch. Das Angebot, es zu schreiben, erhielt ich während meines Studiums, nach meiner Wahl zum ersten schwarzen Präsidenten der Harvard Law Review, einer außerhalb von Fachkreisen weitgehend unbekannten juristischen Fachzeitschrift. Meine Ernennung sorgte für ein gewisses Aufsehen. Es erschienen mehrere Zeitungsartikel, die weniger von meinen bescheidenen Leistungen zeugten als von der besonderen Stellung, die die Harvard Law School in der amerikanischen Mythologie einnimmt, und zugleich vom Hunger Amerikas auf optimistische Signale von der Rassenfront, denen zu entnehmen wäre, dass letztlich doch Fortschritte erzielt worden sind. Einige Verleger riefen mich an, und weil ich mir einbildete, etwas über die aktuelle Rassenpolitik zu sagen zu haben, erklärte ich mich bereit, nach dem Abschlussexamen ein Jahr freizunehmen und meine Gedanken zu Papier zu bringen.
Mit geradezu erschreckendem Selbstbewusstsein ging ich daran, den Inhalt des Buches zu entwerfen. Rassengleichheit und die begrenzten Möglichkeiten, sie auf juristischem Weg durchzusetzen, die Bedeutung von Solidarität und die Aktivierung des öffentlichen Lebens durch engagierte Arbeit an der Basis, affirmative action und Afrozentrismus – die Liste der Themen nahm eine ganze Seite ein. Ich würde natürlich auch persönliche Erlebnisse einbeziehen und die Quellen wiederholt auftretender Gefühle analysieren. Alles in allem würde es aber eine intellektuelle Reise sein, mit Landkarten und Rastzeiten und einem strikten Fahrplan – der erste Teil sollte im März fertig sein, der zweite im August...
Doch als ich dann tatsächlich mit dem Schreiben begann, stellte ich fest, dass sich meine Gedanken in eine völlig andere Richtung bewegten. Erinnerungen an frühe Sehnsüchte stiegen in mir hoch, ferne Stimmen erklangen, wurden leise und wieder lauter. Ich entsann mich der Geschichten, die meine Mutter und ihre Eltern mir als Kind erzählt hatten, Geschichten, mit der eine Familie sich selbst zu erklären versuchte. Ich erinnerte mich an mein erstes Jahr in Chicago, an die Stadtteilarbeit, an mein unsicheres Erwachsenwerden. Ich hörte meine Großmutter, die unter einem Mangobaum saß, meiner Schwester das Haar flocht und mir von meinem Vater erzählte, den ich nicht kannte.
Angesichts dieser Flut von Erinnerungen schienen all meine wohldurchdachten Theorien irrelevant und übereilt. Immer noch wehrte ich mich gegen den Gedanken, meine Vergangenheit in Buchform offenzulegen. Es wäre mir unangenehm gewesen, und ich hätte mich auch ein wenig geschämt. Nicht, weil diese Vergangenheit sonderlich schmerzhaft oder schwierig war, sondern weil sie jene Teile von mir berührte, die sich dem Bewusstsein entziehen und – zumindest an der Oberfläche – dem Leben widersprechen, das ich heute führe. Ich bin jetzt dreiunddreißig, arbeite als sozial und politisch engagierter Anwalt in Chicago, einer Stadt, die mit ihren Rassenwunden lebt und stolz ist auf ihre Unsentimentalität. Wenn ich kein Zyniker geworden bin, so halte ich mich doch für einen Realisten, der sich keinen allzu großen Erwartungen hingibt.
Und doch fällt mir beim Nachdenken über meine Familie vor allem meine – selbst für ein Kind unvorstellbare – Arglosigkeit auf. Der sechsjährige Cousin meiner Frau hat diese Unschuld schon verloren: Vor einigen Wochen erzählte er seinen Eltern, dass einige seiner Mitschüler wegen seiner Hautfarbe nicht mit ihm spielen wollten. Seine Eltern, in Chicago und Gary geboren und aufgewachsen, haben ihre Unschuld natürlich schon längst verloren, und wenn sie auch keineswegs verbittert sind – sie sind stark und stolz und energisch wie alle Eltern, die ich kenne –, so hört man in ihren Stimmen doch den Schmerz, wenn sie von ihren Zweifeln berichten, ob es richtig war, aus der Innenstadt in eine mehrheitlich weiße Vorstadtsiedlung zu ziehen, weil sie ihren Sohn davor bewahren wollten, in Bandenkriege hineinzugeraten und eine mangelhaft ausgestattete Schule besuchen zu müssen.
Sie wissen zu viel, wir alle haben zu viel gesehen, als dass wir die kurze Ehe meiner Eltern – ein Schwarzer und eine Weiße, ein Afrikaner und eine Amerikanerin – einfach so akzeptieren könnten. Manchen Leuten fällt es schwer, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Wenn Leute, die mich nicht gut kennen, seien es Schwarze oder Weiße, von meinem Hintergrund erfahren (meist ist es eine Entdeckung, denn ich habe schon mit zwölf oder dreizehn Jahren aufgehört, auf die Hautfarbe meiner Mutter hinzuweisen, weil ich ahnte, dass ich mich damit bei Weißen einschmeicheln würde), dann erlebe ich den kurzen Moment, in dem sie ihren Blick neu fokussieren, in meinen Augen nach einem Zeichen suchen. Sie wissen nicht mehr, wer ich bin. Insgeheim stellen sie sich vielleicht meine Zerrissenheit vor, das gemischte Blut, das gespenstische Bild des tragischen Mulatten, der in zwei Welten gefangen ist. Und wenn ich erklären sollte, dass die Tragik nicht meine sei, jedenfalls nicht meine allein, sondern die aller, der Söhne und Töchter von Plymouth Rock und Ellis Island, der Kinder Afrikas, des sechsjährigen Cousins meiner Frau und seiner weißen Klassenkameraden, und sie sich also nicht den Kopf zu zerbrechen brauchten, was mich belastet (in den Abendnachrichten kann das jeder sehen), und dass, wenn wir zumindest dies akzeptieren könnten, der tragische Kreislauf vielleicht unterbrochen würde..., nun ja, das klingt unglaublich naiv, es klingt nach enttäuschten Hoffnungen, wie bei jenen Kommunisten, die in Universitätsstädten ihre Blätter verkaufen. Schlimmer noch: Es klingt, als wollte ich vor mir selbst davonlaufen.
Ich kann niemandem verübeln, wenn er misstrauisch ist. Ich habe schon früh gelernt, meiner Kindheit zu misstrauen und den Geschichten, die sie geprägt haben. Erst viele Jahre später, nachdem ich am Grab meines Vaters gesessen und mit ihm durch die rote afrikanische Erde gesprochen habe, wurde mir klar, welche Bedeutung diese frühen Geschichten für mich hatten. Genauer gesagt: Erst da begriff ich, dass ich viel zu lange versucht hatte, diese Geschichten neu zu schreiben, Lücken zu füllen, unschöne Details zu retuschieren, persönliche Entscheidungen vor den blinden Gang der Weltgeschichte zu projizieren – alles in der Hoffnung, ein Stückchen Wahrheit auszugraben, das meinen ungeborenen Kindern sicheren Halt geben könnte.
Obwohl ich mich keiner allzu kritischen Prüfung aussetzen wollte und immer wieder versucht war, die ganze Sache hinzuwerfen, wird in dem vorliegenden Buch eine persönliche, innere Reise beschrieben – die Suche eines Jungen nach seinem Vater und damit auch nach einem überzeugenden Lebensinhalt für ihn, den schwarzen Amerikaner. Es ist also eine Autobiographie entstanden, obwohl ich dieses Wort immer vermieden habe, wenn mich in den zurückliegenden drei Jahren jemand fragte, worum es in diesem Buch geht. Eine Autobiographie verspricht bemerkenswerte Leistungen, Begegnungen mit Berühmtheiten, Teilnahme an wichtigen Ereignissen. Nichts von alldem in meinem Buch. Eine Autobiographie impliziert zumindest eine Art Bilanz, die bei jemandem meines Alters, der seinen Platz in der Welt erst noch zu erobern hat, reichlich übertrieben anmutet. Ich kann nicht einmal meine persönlichen Erfahrungen als repräsentativ für die Erfahrungen der schwarzen Amerikaner hinstellen (»Schließlich stammen Sie nicht aus einer unterprivilegierten Familie«, erklärte mir ein New Yorker Verleger); tatsächlich geht es in meinem Buch auch um diese spezielle Erkenntnis – dass ich mich zu meinen schwarzen Brüdern und Schwestern, ob in Amerika oder Afrika, bekennen und für ein gemeinsames Ziel eintreten kann, ohne mich als Sprecher unserer vielfältigen Kämpfe ausgeben zu müssen.
Und in jeder autobiographischen Arbeit lauern schließlich Gefahren: die Versuchung, Ereignisse in einem für den Autor günstigen Licht darzustellen, die Bedeutung der eigenen Erlebnisse zu überschätzen, die selektive Erinnerung. Bei jungen Leuten, denen die Weisheit des Alters fehlt und die Distanz, die vor gewissen Eitelkeiten schützt, sind solche Gefahren besonders groß. Ich kann nicht sagen, dass ich all diese Klippen erfolgreich umschifft habe. Ein Großteil dieses Buches stützt sich auf zeitgenössische Zeitschriften und auf die Erzählungen meiner Familie, doch die Dialoge geben nur annähernd wieder, was tatsächlich gesagt oder mir berichtet wurde. Einige Figuren setzen sich aus mehreren mir bekannten Menschen zusammen, und manche Ereignisse haben ihre eigene Chronologie. Mit Ausnahme meiner Familie und einer Handvoll öffentlicher Personen erscheinen die meisten Figuren unter anderem Namen.
Welches Etikett man diesem Buch auch geben mag – Autobiographie, Erinnerungen, Familiengeschichte oder dergleichen mehr –, ich habe mich bemüht, einen Teil meines Lebens wahrheitsgemäß aufzuschreiben. Wenn ich ins Stolpern kam, stand mir meine Agentin Jane Dystel treu und unbeirrt zur Seite. Mein Dank geht ebenso an meinen Lektor Henry Ferris, der mich mit sanfter, aber fester Hand leitete, an Ruth Fecych und ihre Mitarbeiter bei Times Books, die das Buch aufmerksam durch seine verschiedenen Stadien begleiteten, an Robert Fisher und andere Freunde, die das Manuskript bereitwillig lasen, und meine wunderbare Frau Michelle, die mich mit ihrem Witz und ihrer Offenheit immer wieder ermuntert hat.
Doch es sind vor allem meine Familienangehörigen – meine Mutter, meine Großeltern, meine Geschwister, über die ganze Welt verstreut –, denen ich Dank schulde und denen dieses Buch gewidmet ist. Ohne ihre beständige Liebe und Unterstützung, ohne ihre Bereitschaft, mich ihr Lied singen zu lassen und dabei manch falschen Ton zu ertragen, hätte ich dieses Buch nie beenden können. Wenn schon nichts anderes, dann möge es deutlich machen, wie sehr ich sie liebe und respektiere.
Erster Teil
Kindheit
1
Einige Monate nach meinem einundzwanzigsten Geburtstag erhielt ich die Nachricht von einer mir unbekannten Anruferin. Ich lebte damals in New York, in der Vierundneunzigsten Straße, zwischen Second und First Avenue, in jenem namenlosen, nicht fest umrissenen Grenzbezirk zwischen East Harlem und dem übrigen Manhattan. Es war eine wenig einladende Gegend, trist und öde, mit langen Reihen rußschwarzer Hausaufgänge, die fast den ganzen Tag tiefe Schatten warfen. Die Wohnung selbst war klein und schief, die Heizung unzuverlässig und die Hausklingel kaputt, so dass Besucher von der nahe gelegenen Tankstelle aus anrufen mussten, wo nachts ein schwarzer Dobermann von der Größe eines Wolfs mit einer leeren Bierflasche im Maul herumstreifte und Wache hielt.
Für mich war das alles nicht wichtig, denn ich bekam nicht oft Besuch. Ich war ungeduldig in jener Zeit, dachte nur an meine Arbeit und unrealisierte Vorhaben und betrachtete andere Leute als unnötige Ablenkung. Nicht, dass mir Gesellschaft unangenehm gewesen wäre. Mit den puertorikanischen Nachbarn wechselte ich freundliche Worte auf Spanisch, und wenn ich von der Universität kam, sprach ich mit den Jungs, die im Sommer die ganze Zeit vor dem Haus hockten, über die New York Knicks oder die Schüsse, die sie in der Nacht zuvor gehört hatten. Bei schönem Wetter saßen mein Mitbewohner und ich draußen auf der Feuerleiter, rauchten und sahen zu, wie sich die Abenddämmerung blau über die Stadt legte, oder beobachteten die Weißen aus den besseren Vierteln, die ihre Hunde bei uns spazieren führten und sie auf unseren Gehsteigen ihr Geschäft machen ließen – »Haut ab, ihr Idioten!« rief mein Mitbewohner dann mit eindrucksvoll zorniger Stimme, und wir lachten über Herrchen und Hund, die wütend und mit arroganter Miene der Aufforderung nachkamen.
Solche Momente genoss ich, aber nur kurz. Wenn unsere Gespräche abschweiften oder Privates berührten, fand ich rasch einen Grund, mich zurückzuziehen. Ich hatte mich in meinem Alleinsein gut eingerichtet, dort fühlte ich mich sicher.
Mein Nachbar war ein alter Mann, dem es vielleicht ähnlich ging. Er lebte allein, eine hagere, gebeugte Gestalt, und wenn er die Wohnung verließ, was selten genug passierte, trug er einen schweren schwarzen Mantel und einen zerknautschten Filzhut. Manchmal begegneten wir uns, wenn er vom Einkaufen zurückkam, und dann bot ich an, ihm seine Tüten hinaufzutragen. Er sah mich an, zuckte mit den Schultern, wir stiegen hinauf und machten dabei auf jedem Absatz halt, damit er verschnaufen konnte. Wenn wir dann vor seiner Wohnung angelangt waren, setzte ich die Tüten vorsichtig ab, und er nickte mir nur wortlos zu, bevor er eintrat und hinter sich verriegelte. Wir wechselten kein einziges Wort, und kein einziges Mal bedankte er sich bei mir.
Das Schweigen des Alten beeindruckte mich. Ich empfand eine Art Geistesverwandtschaft zwischen uns. Irgendwann entdeckte ihn mein Mitbewohner auf dem Treppenabsatz im zweiten Stock, die Augen weit aufgerissen, die Beine angezogen wie ein kleines Kind, starr. Leute kamen herbei, Frauen bekreuzigten sich, Kinder flüsterten aufgeregt. Schließlich wurde der Tote von einer Ambulanz abgeholt, und die Polizisten öffneten die Wohnung. Das Apartment war sauber, beinahe leer – ein Stuhl, ein Schreibtisch, auf dem Kaminsims ein verblichenes Foto einer Frau mit dichten Augenbrauen und einem feinen Lächeln. Jemand öffnete den Kühlschrank und fand darin, versteckt hinter Mayonnaise- und Gurkengläsern, an die tausend Dollar in kleinen Scheinen, in altes Zeitungspapier gewickelt.
Die Einsamkeit dieser Szene berührte mich, und für einen kurzen Moment wünschte ich, der alte Mann hätte mir seinen Namen gesagt. Doch gleich darauf bedauerte ich meinen Wunsch und die Trauer. Es schien, als wäre eine Übereinkunft zwischen uns gebrochen – als flüsterte der Alte in diesem kahlen Zimmer eine unbekannte Geschichte, als erzählte er mir Dinge, die ich lieber nicht hören wollte.
Etwa einen Monat später, an einem kalten Novembermorgen mit einer schwachen Sonne hinter einem dünnen Wolkenvorhang, kam der Anruf. Ich war gerade dabei, Frühstück zu machen, auf dem Herd stand Kaffee, und in der Pfanne brutzelten zwei Eier, als mein Mitbewohner mir das Telefon reichte. In der Leitung rauschte es stark.
»Barry? Barry, bist du’s?«
»Ja... Wer spricht da?«
»Barry, hier ist deine Tante Jane in Nairobi. Kannst du mich hören?«
»Wie bitte, wer ist da?«
»Tante Jane. Hör zu, Barry, dein Vater ist gestorben. Er hatte einen Verkehrsunfall. Hallo? Kannst du mich hören? Dein Vater ist gestorben, Barry, ruf bitte deinen Onkel in Boston an und richte es ihm aus. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, Barry, ich versuch’s später noch einmal.«
Das war alles. Sie hatte aufgelegt. Ich setzte mich auf das Sofa, von der Küche her roch es nach angebrannten Spiegeleiern, ich starrte auf die Risse in der Wand, versuchte, mir über meinen Verlust klar zu werden.
Mein Vater war ein Mythos für mich, übergroß und irreal. 1963 war er aus Hawaii weggegangen, als ich zwei war, so dass ich ihn nur von den Geschichten her kannte, die meine Mutter und meine Großeltern mir erzählten. Sie alle hatten ihre Lieblingsgeschichten, jede bruchlos, durch wiederholten Gebrauch geglättet. Ich weiß noch, wie Gramps, mein Großvater, sich nach dem Abendessen mit einem Whiskey in seinem alten Sessel zurücklehnt, mit dem Zellophanpapier der Zigarettenschachtel die Zähne reinigt und erzählt, wie mein Vater wegen seiner Pfeife fast einen anderen Mann vom Aussichtspunkt in Pali in die Tiefe gestürzt hätte.
»Deine Mutter und dein Vater hatten beschlossen, mit diesem Freund von ihm eine Besichtigungstour über die Insel zu machen. Also fuhren sie hinauf zur Aussichtsplattform, wahrscheinlich fuhr dein Vater die ganze Zeit auf der falschen Straßenseite...«
»Dein Vater war ein furchtbarer Autofahrer«, erklärt meine Mutter. »Er fuhr immer auf der linken Seite, wie das bei den Engländern üblich ist, und wenn man etwas sagte, stöhnte er nur über die dummen amerikanischen Vorschriften.«
»Also, dieses Mal kamen sie unversehrt an, sie stiegen aus und gingen zum Geländer und bewunderten die Aussicht. Und Barack rauchte seine Pfeife, die ich ihm zum Geburtstag geschenkt hatte, und zeigte damit auf die Sehenswürdigkeiten, wie ein Kapitän...«
»Dein Vater war wirklich stolz auf diese Pfeife«, ruft meine Mutter dazwischen. »Die ganze Nacht hat er geraucht, wenn er über seinen Büchern saß, und manchmal...«
»Ann, willst du die Geschichte erzählen, oder darf ich weitermachen?«
»Entschuldige, Dad. Erzähl weiter.«
»Also, dieser arme Kerl – auch ein afrikanischer Student, nicht? Frisch eingetroffen. Der Arme war wohl ganz beeindruckt, wie Barack seine Pfeife hielt, denn er fragte ihn, ob er mal probieren dürfe. Dein Dad überlegt kurz und willigt dann ein, aber kaum hat der Bursche den ersten Zug gemacht, fängt er so fürchterlich zu husten an, dass ihm die Pfeife entgleitet und über das Geländer fliegt, dreißig Meter in die Tiefe.«
Gramps nimmt wieder einen Schluck aus der Flasche. »Nun ja, dein Vater war so höflich, zu warten, bis der andere aufhörte zu husten, bevor er ihn aufforderte, über das Geländer zu steigen und ihm die Pfeife wiederzubringen. Der Mann guckte hinunter, es ging steil hinunter, und sagte, er werde ihm eine andere Pfeife kaufen...«
»Sehr vernünftig«, ruft Toot aus der Küche. (Meine Großmutter heißt bei uns Tutu oder kurz Toot, das ist Hawaiisch für »Großmutter«, da sie bei meiner Geburt fand, dass sie für die Anrede »Granny« noch viel zu jung sei.) Gramps schaut irritiert, beschließt aber, den Zwischenruf zu ignorieren.
» – Barack wollte aber unbedingt seine Pfeife wieder haben, denn es war ein unersetzliches Geschenk. Also wirft der Bursche noch einmal einen Blick in die Tiefe und schüttelt wieder den Kopf, und in diesem Moment packt dein Vater ihn am Schlafittchen, hebt ihn hoch und macht Anstalten, ihn über das Absperrgeländer zu halten!«
Gramps lacht und haut sich auf die Schenkel. Ich stelle mir vor, wie ich zu meinem Vater aufschaue, eine dunkle Gestalt vor einer hellen Sonne, während der Missetäter aufgeregt mit den Armen wedelt. Eine erschreckende Form von Gerechtigkeit.
»Er hat ihn nicht wirklich über das Geländer gehalten, Dad«, wirft meine Mutter ein und sieht mich besorgt an, während Gramps wieder einen Schluck aus der Flasche nimmt und sich vorbeugt.
»Die Leute guckten schon, und deine Mutter flehte Barack an, aufzuhören. Baracks Freund dachte vermutlich, sein letztes Stündlein habe geschlagen. Na jedenfalls, nach einer Weile setzte dein Vater ihn wieder ab, tätschelte ihn auf den Rücken und schlug seelenruhig vor, irgendwo ein Bier zu trinken. Und weißt du was, während der ganzen Fahrt tut dein Vater, als wäre nichts passiert. Deine Mutter war natürlich noch furchtbar aufgeregt, als sie nach Hause kamen. Genau genommen hat sie überhaupt nicht mit ihm gesprochen. Und er hat auch nicht gerade zu einer Entspannung beigetragen, denn als deine Mutter uns von dem Vorfall erzählen wollte, schüttelte er bloß den Kopf und lachte. ›Reg dich nicht auf, Anna‹, sagte er mit seinem tiefen Bariton und in seinem britischen Englisch.« Gramps imitiert den Tonfall. »›Reg dich nicht auf, Anna‹, sagte er. ›Ich wollte dem Kerl nur eine Lektion erteilen, wie man mit dem Eigentum anderer Leute umgeht.‹«
Gramps lacht wieder, bis er husten muss. Großmutter murmelt, es sei ja wohl ganz gut, dass mein Vater begriffen habe, dass die Pfeife nur aus Versehen in die Tiefe gefallen sei, denn wer weiß, was sonst noch passiert wäre, und meine Mutter verdreht die Augen und meint, das sei doch alles übertrieben.
»Dein Vater ist manchmal ein bisschen dominant«, sagt meine Mutter und lächelt. »Aber im Grunde ist er ein anständiger Mensch. Manchmal macht ihn das dann so kompromisslos.«
Sie hatte ein sympathischeres Bild von meinem Vater. Sie erzählte, wie er in seiner Lieblingskluft – Jeans und altes buntes Hemd – zu seiner Phi-Beta-Kappa-Zeremonie erschien. »Niemand hatte ihm gesagt, dass es eine große Sache war. Er kam also in den Saal, und alle anderen standen im Smoking herum. Das war das einzige Mal, dass ich ihn verlegen gesehen habe.«
Und Gramps, auf einmal nachdenklich, nickte. »Weißt du, Bar«, sagte er, »dein Vater konnte mit praktisch jeder Situation umgehen, deswegen war er so beliebt. Erinnert ihr euch noch an seinen Auftritt beim Internationalen Musikfestival? Er wollte ein paar afrikanische Lieder singen, aber als er dann eintraf, sah er, dass es eine richtig große Veranstaltung war, die Frau, die vor ihm gesungen hatte, war eine halbprofessionelle Sängerin, eine Hawaiianerin mit einer richtigen Band. Jeder andere hätte in dieser Situation gesagt, bedaure, war ein Missverständnis. Nicht so Barack. Er stand auf und fing an, vor diesen vielen Zuschauern zu singen – das ist kein Kinderspiel, ich schwör’s dir –, und er war auch nicht besonders toll, aber er war so selbstsicher, dass er genauso beklatscht wurde wie die anderen.«
Großvater stand kopfschüttelnd auf und schaltete den Fernseher ein. »Eines kannst du von deinem Dad lernen«, sagte er. »Selbstvertrauen. Das Geheimnis erfolgreicher Menschen.«
So gingen alle Geschichten – gedrängt, apokryph, an einem Abend rasch hintereinander erzählt, um dann wieder in der Versenkung zu verschwinden, monatelang, manchmal jahrelang. Wie die wenigen Fotos von meinem Vater, die es noch im Haus gab, alte Schwarzweißporträts, auf die ich stieß, wenn ich auf der Suche nach Weihnachtsschmuck oder einer alten Taucherbrille sämtliche Schubladen durchstöberte. Meine Erinnerung setzt an dem Punkt ein, als meine Mutter bereits eine Beziehung mit dem Mann eingegangen war, der dann ihr zweiter Mann wurde, und ich ahnte, auch ohne Erklärung, warum diese Fotos weggepackt werden mussten. Aber hin und wieder saß ich mit ihr auf dem Fußboden, in der Hand das alte Album, das nach Staub und Mottenpulver roch, und betrachtete die Aufnahmen meines Vaters – das dunkle lachende Gesicht, die hohe Stirn und die starke Brille, die ihn älter machte –, während sich die Ereignisse seines Lebens zu einer Geschichte fügten.
Ich erfuhr, dass er Afrikaner war, Kenianer vom Stamm der Luo, geboren in Alego am Viktoria-See. Alego war ein armes Dorf, aber der Vater meines Vaters, mein zweiter Großvater Hussein Onyango Obama, war ein angesehener Bauer, Medizinmann und Heiler, der zu den Stammesältesten gehörte. Mein Vater hütete als Kind Ziegen und ging in eine von den Briten errichtete Schule, wo er sich als vielversprechender Schüler erwies. Mit einem Stipendium konnte er in Nairobi studieren, und kurz vor der Unabhängigkeit Kenias erhielt er ein Stipendium zum Besuch einer amerikanischen Universität. Er gehörte zu jener ersten großen Welle von Afrikanern, die hinausgeschickt wurden, um im Westen zu studieren und später ein neues, modernes Afrika mit aufzubauen.
1959, mit dreiundzwanzig, kam er als erster afrikanischer Student an die Universität von Hawaii. Er studierte Wirtschaftswissenschaften, sehr konzentriert, und machte nach drei Jahren seinen Abschluss als Jahrgangsbester. Er hatte zahllose Freunde und half, den Internationalen Studentenverband zu organisieren, dessen erster Präsident er wurde. In einem Russisch-Kurs begegnete er einem schüchternen Mädchen, einer erst achtzehnjährigen Amerikanerin, und die beiden verliebten sich. Die Eltern des Mädchens waren erst skeptisch, ließen sich dann aber von seinem Charme und seiner Intelligenz erobern; das junge Paar heiratete, ein Sohn wurde geboren, der den Namen des Vaters bekam. Der Vater erhielt ein neues Stipendium – diesmal ein Promotionsstipendium für Harvard –, aber das Geld reichte nicht, um die Familie mitnehmen zu können. Es folgte eine Trennung, und schließlich kehrte er nach Afrika zurück, um sein Versprechen gegenüber dem Kontinent einzulösen. Mutter und Sohn blieben in Amerika, aber die Liebe blieb, trotz der großen Entfernung...
Hier endete das Album, und zufrieden lief ich wieder los, eingehüllt in eine Geschichte, die mich in den Mittelpunkt einer großen, geordneten Welt stellte. Selbst die verkürzte Version, die mir von meiner Mutter und den Großeltern präsentiert wurde, enthielt vieles, was ich nicht verstand. Aber nur selten fragte ich nach Einzelheiten, die mir geholfen hätten, Ausdrücke wie »seinen Doktor machen« oder »Kolonialismus« zu verstehen oder Alego auf einer Landkarte zu finden. Der Lebensweg meines Vaters spielte sich auf dem gleichen Terrain ab wie das Buch, das meine Mutter mir einmal geschenkt hatte, Origins, eine Sammlung von Schöpfungsmythen aus der ganzen Welt, biblische Geschichten über den Baum der Erkenntnis, Sagen von Prometheus und dem Geschenk des Feuers, hinduistische Legenden von der Schildkröte, die durch das All fliegt und auf ihrem Rücken die Welt trägt. Später, als ich den schmaleren Pfad zum Glück kennengelernt hatte, den Fernsehen und Kino boten, beschäftigten mich Fragen wie: Wer trug die Schildkröte? Warum ließ ein allmächtiger Gott zu, dass eine Schlange so viel Unheil anrichtet? Warum kommt mein Vater nicht zurück? Doch mit fünf oder sechs konnte ich diese Mysterien umstandslos annehmen, jede Geschichte in sich geschlossen und wahr, und mich in friedliche Träume entführen lassen.
Dass mein Vater anders aussah als die Menschen in meiner Umgebung – er schwarz wie Pech, meine Mutter weiß wie Milch –, machte sich in meinem Bewusstsein nicht bemerkbar.
Ich erinnere mich überhaupt nur an eine einzige Geschichte, in der es explizit um die Hautfarbe ging. Als ich älter war, wurde sie mir öfters erzählt, als enthielte sie eine Moral, die das Leben meines Vaters kennzeichne. Dieser Geschichte zufolge hatte sich mein Vater, nach langen Stunden des Studierens, in einer Bar in Waikiki mit meinem Großvater und anderen Freunden getroffen. Alle waren bester Laune, man aß und trank, jemand spielte Gitarre, als plötzlich ein Weißer – so laut, dass es jeder hören konnte – dem Barmann zurief, er wolle nicht neben einem »Nigger« sitzen. Alles schwieg, die Leute sahen meinen Vater an, erwarteten einen Kampf. Mein Vater stand auf, ging zu dem Mann und hielt ihm einen freundlichen Vortrag über die Dummheit der Bigotterie, über die Verheißungen des amerikanischen Traums und die universalen Menschenrechte. »Als Barack fertig war, fühlte sich dieser Mann so schlecht, dass er in die Tasche griff und deinem Vater auf der Stelle hundert Dollar schenkte«, sagte Gramps. »Er hat alle Getränke bezahlt – und deinem Vater die restliche Monatsmiete.«
Als Teenager bezweifelte ich den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte und legte sie und all die anderen beiseite. Doch viele Jahre später rief mich ein japanischstämmiger Amerikaner an, der mir berichtete, er habe mit meinem Vater auf Hawaii studiert und unterrichte inzwischen an einer Universität im Mittleren Westen. Er war sehr höflich und ein bisschen verlegen ob seines spontanen Anrufs. Er erzählte, dass er ein Interview mit mir gelesen habe und sich bei dem Namen meines Vaters an die damalige Zeit erinnert habe. Im Laufe unseres Gesprächs wiederholte er ebenjene Geschichte, die mein Großvater mir erzählt hatte, von dem Weißen, der sein schlechtes Gewissen dadurch beruhigen wollte, dass er meinem Vater Geld schenkte. »Das werde ich nie vergessen«, sagte der Anrufer, und in seiner Stimme lag derselbe Tonfall, den ich so viele Jahre zuvor bei Großvater gehört hatte – eine Mischung aus Staunen und Hoffnung.
Miscegenation [Rassenmischung]. Ein hässliches, buckliges Wort, das monströse Folgen andeutet und, wie antebellum oder octoroon, an ferne Zeiten erinnert, an eine andere Welt, an Pferdepeitschen und Flammen, tote Magnolien und verfallene Landhäuser. Aber erst 1967 – dem Jahr, in dem ich sechs wurde und Jimi Hendrix in Monterey auftrat, drei Jahre nach der Verleihung des Friedensnobelpreises an Martin Luther King, in einer Zeit, in der Amerika mit wachsendem Unverständnis auf die Forderung der Schwarzen nach Gleichberechtigung reagierte, wo das Problem der Diskriminierung doch gelöst schien –, erst 1967 stellte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten fest, dass das im Staat Virginia geltende Verbot der Rassenmischung gegen die Verfassung verstoße. 1960, in dem Jahr, in dem meine Eltern heirateten, war miscegenation in mehr als der Hälfte aller Bundesstaaten ein Straftatbestand. In weiten Teilen des Südens hätte mein Vater am nächsten Baum aufgeknüpft werden können, nur weil er meine Mutter falsch ansah; in den fortschrittlichsten Städten des Nordens hätten die feindseligen Blicke, das Getuschel Frauen wie meine Mutter dazu getrieben, in einer düsteren Gasse eine Abtreibung vornehmen zu lassen – oder sie zumindest in ein abgelegenes Kloster geführt, das für eine Adoption sorgen konnte. Allein schon die Vorstellung von den beiden als Paar hätte als pervers und schmutzig gegolten, ein Vorwurf an die Adresse der Handvoll Liberalen, die für die Bürgerrechte eintraten.
Klar – aber wärst du einverstanden, wenn deine Tochter einen Schwarzen heiratet?
Dass meine Großeltern diese Frage, wenn auch zögernd, mit Ja beantwortet haben, ist mir bis heute ein Rätsel. Vor ihrem familiären Hintergrund war eine solche Reaktion nicht zu erwarten – unter ihren Vorfahren waren keine Neuengland-Transzendentalisten oder glutäugigen Sozialisten. Sicher, Kansas hatte im Bürgerkrieg auf der Seite der Unionisten gestanden; Gramps erzählte gern von den leidenschaftlichen Abolitionisten, die sich unter verschiedenen Zweigen der Familie befanden. Wenn man Toot fragte, pflegte sie ihr Profil zu zeigen, so dass man ihre Hakennase sah, die sie – neben ihren tiefschwarzen Augen – als Beweis für Cherokee-Blut präsentierte.
Doch es war eine alte, sepiagetönte Fotografie auf dem Bücherregal, die am deutlichsten von ihren Wurzeln sprach. Sie zeigte Toots Großeltern schottisch-englischer Herkunft, vor einem schlichten Haus stehend, ernst, einfach gekleidet und mit zusammengekniffenen Augen über das flirrend heiße, weite Land vor ihnen schauend. Ihre Gesichter waren die der ärmeren Cousins der angelsächsisch-weißen Linie, in ihren Augen sah man Wahrheiten, die ich später als Fakten zu lernen hatte: dass Kansas der Union erst nach einem heftigen Vorboten des Bürgerkriegs beigetreten war, jener Schlacht, in der John Brown erstmals gekämpft hatte; dass einer meiner Ururgroßväter, Christopher Columbus Clark, ein dekorierter Unionssoldat war, während seine Schwiegermutter eine Cousine von Jefferson Davis gewesen sein soll, dem Präsidenten der Konföderierten; dass ein anderer entfernter Vorfahr ein richtiger Cherokee war, aber Toots Mutter schämte sich dieses Ahnen. Sie erblasste jedes Mal, wenn jemand auf das Thema zu sprechen kam, und hoffte, das Geheimnis mit ins Grab zu nehmen.
Das war die Welt, in der meine Großeltern aufgewachsen waren, eine ländliche Welt, in der Anstand und Durchhaltewillen und Pioniergeist einhergingen mit Konformismus und Misstrauen und dem Potential zu gnadenloser Brutalität. Sie waren weniger als zwanzig Meilen voneinander entfernt groß geworden – Großmutter in Augusta, Großvater in El Dorado, zwei Städten, viel zu klein, als dass sie auf einer Straßenkarte in Fettschrift eingezeichnet wären –, und wenn sie mir von ihrer Kindheit erzählten, entstand das klassische Bild eines Provinzamerikas während der Depressionsjahre in all seinem unschuldigen Glanz – die Paraden am 4. Juli, das Freiluftkino, Glühwürmchen und der Geschmack von reifen Tomaten, süß wie Äpfel; Sand- und Hagelstürme und in der Schule die Bauernjungen, die zu Winterbeginn in die wollene Unterwäsche eingenäht wurden und bald wie die Schweine zu stinken begannen.
Selbst das Trauma der Wirtschaftskrise mit zahlungsunfähigen Banken und Bauern bekam im Webstuhl der großelterlichen Erinnerungen etwas Romantisches, jene Zeit, in der die Not, die große Gleichmacherin, die Menschen einander nahebrachte. Man musste genau hinhören, um die subtilen Hierarchien und die unausgesprochenen Codes zu erkennen, die ihr frühes Leben geprägt hatten, die Unterschiede zwischen Menschen, die kein Land besaßen und in einer gottverlassenen Gegend lebten. Es hatte mit Ansehen zu tun (es gab angesehene und weniger angesehene Leute), und obschon man nicht reich sein musste, um angesehen zu sein, musste man sehr viel mehr arbeiten, wenn man nicht reich war.
Toots Familie war angesehen. Ihr Vater hatte die ganze Wirtschaftskrise hindurch einen festen Job als Grundstücksverwalter bei Standard Oil. Ihre Mutter arbeitete als Lehrerin, bis die Kinder kamen. Die Familie hatte ein sauberes, ordentliches Haus. Bücher wurden bei einem Versand bestellt, man las die Bibel, aber im Allgemeinen mied man die Gesellschaft der Revivalisten und zog eine geradlinige Form des Methodismus vor, die die Vernunft über das Gefühl erhob und über beide die Abstinenz.
Das Ansehen meines Großvaters war ein wenig lädiert. Niemand wusste, warum – die Großeltern, die ihn und den älteren Bruder erzogen hatten, waren arme, aber anständige, gottesfürchtige Baptisten, die sich als Arbeiter auf den Ölfeldern rings um Wichita durchschlugen. Doch irgendwie hatte sich Gramps als ein wenig wild entpuppt. Nachbarn verwiesen auf den Selbstmord seiner Mutter; immerhin hatte er als Achtjähriger die Leiche entdeckt. Andere, weniger mitfühlende Seelen, schüttelten einfach den Kopf. Der Junge kommt nach dem Vater, sagten sie, diesem Schürzenjäger, dem wahren Grund für das bedauernswerte Ende der Mutter.
Wie dem auch sei, Gramps’ Ruf war offenbar nicht unverdient. Mit fünfzehn war er von der Schule geflogen, weil er einem Lehrer ins Gesicht geboxt hatte. In den anschließenden drei Jahren schlug er sich mit Gelegenheitsjobs durch, fuhr per Güterzug nach Chicago, dann nach Kalifornien, dann wieder zurück. Schnapsbrennen, Karten und Frauen – das war seine Welt. Er gab gern damit an, dass er sich in Wichita auskannte, wohin seine und Toots Familie gezogen waren, und Toot widerspricht ihm nicht. Toots Eltern glaubten jedenfalls, was über den jungen Mann erzählt wurde, und missbilligten die sich anbahnende Beziehung zwischen den beiden. Als Toot ihren Freund zum ersten Mal nach Hause brachte, um ihn ihren Eltern vorzustellen, warf ihr Vater nur einen Blick auf Gramps’ schwarzes, zurückgekämmtes Haar und sein ewiges Grinsen und fällte dann sein gnadenloses Urteil:
»Er sieht aus wie ein Itaker.«
Meine Großmutter ließ das kalt. Für sie, die gerade die High School beendet und Anstand und Ehrbarkeit satt hatte, muss mein Großvater eine faszinierende Erscheinung gewesen sein. Manchmal stelle ich mir die beiden in sämtlichen amerikanischen Städten ihrer Zeit vor, ihn in weiten Hosen und blütenweißem Unterhemd, den Filzhut im Nacken, sie das smarte Mädchen, mit zu viel knalligem Lippenstift, blond gefärbten Haaren und Beinen, die so hübsch sind, dass sie im lokalen Kaufhaus Reklame für Nylonstrümpfe machen könnte. Er bietet ihr eine Zigarette an und erzählt von den großen Städten, dem endlosen Highway, seiner bevorstehenden Flucht aus dieser öden Provinz, wo man unter großen Plänen einen Job als Manager der Bankfiliale versteht und unter Freizeitvergnügen ein Ice-Cream Soda und eine Sonntagsmatinee, wo Angst und Phantasielosigkeit alle Träume ersticken, so dass man schon an seinem Geburtstag weiß, wo man sterben und wer einen begraben wird. Er selbst wolle nicht so enden, versichert mein Großvater; er habe Träume, er habe Pläne, er wolle meine Großmutter mit jener Unternehmungslust anstecken, die ihre Vorfahren so viele Jahre zuvor dazu gebracht hatte, den Atlantik zu überqueren und durch einen halben Kontinent zu ziehen.
Kurz vor Pearl Harbor brennen sie durch, Großvater meldet sich zur Armee. Und nun spult sich die Geschichte in meiner Vorstellung so rasend schnell ab wie einer dieser alten Stummfilme, in denen die Blätter eines Wandkalenders wie von unsichtbarer Hand immer schneller abgerissen werden, immer neue Schlagzeilen, Hitler und Churchill und Roosevelt und die Invasion in der Normandie, begleitet vom Dröhnen der Bombenflugzeuge, von der Stimme Edward R. Murrows und der BBC. Ich bin dabei, als meine Mutter auf dem Militärstützpunkt geboren wird, wo Gramps stationiert ist; meine Großmutter Rosie arbeitet in einer Flugzeugfabrik am Fließband; Gramps rückt als Angehöriger von Pattons Armee durch Frankreich vor.
Er kehrte aus dem Krieg zurück, ohne je in richtige Kämpfe verwickelt gewesen zu sein, die Familie zog nach Kalifornien, wo Gramps sich dank GI-Bill in Berkeley einschrieb. Doch der Hörsaal reichte ihm nicht, sein Ehrgeiz, seine Rastlosigkeit waren zu groß, also zog die Familie wieder weiter, erst nach Kansas, dann durch mehrere texanische Städte und schließlich nach Seattle, wo meine Mutter die High School abschloss. Gramps arbeitete als Möbelvertreter, man kaufte ein Haus, fand Bridge-Partner. Sie freuten sich über den schulischen Erfolg meiner Mutter, aber als ihr schon frühzeitig ein Studienplatz an der University of Chicago angeboten wurde, verbat Gramps ihr, nach Chicago zu gehen, weil sie noch zu jung sei, ein eigenständiges Leben zu führen.
Und hier hätte die Geschichte enden können – ein Haus, eine Familie, eine ehrbare Existenz. Doch irgendetwas muss meinen Großvater noch immer umgetrieben haben. Ich stelle mir vor, wie er am Ozean steht, vorzeitig ergraut, der große schlaksige Mann nun schon etwas kräftiger, und hinausschaut bis an den fernen Horizont, in der Nase der Geruch von Ölbohrtürmen und Maiskolben und jenem anstrengenden Leben, das er weit hinter sich gelassen glaubte. Als der Manager der Möbelfabrik einmal erwähnte, dass man in Honolulu einen neuen Laden eröffnen wolle, man verspreche sich glänzende Geschäfte dort, sobald Hawaii ein Bundesstaat sei – da überredete Gramps seine Frau noch am selben Tag, das Haus zu verkaufen, alles wieder zusammenzupacken und zum letzten Mal auf die Reise zu gehen, nach Westen, der untergehenden Sonne entgegen...
So war er, mein Großvater, immer suchte er nach einem neuen Anfang, immer floh er vor dem Gewohnten. Als sie auf Hawaii eintrafen, dürfte sein Charakter voll ausgebildet gewesen sein – die Großzügigkeit und der Wunsch, anderen zu gefallen, die eigentümliche Mischung aus Offenheit und Spießigkeit, diese Direktheit, die dafür sorgte, dass er taktlos und zugleich verletzbar sein konnte. Er war ein richtiger Amerikaner, ein typischer Vertreter seiner Generation, die für Freiheit und Eigenständigkeit und Offenheit eintrat, ohne immer zu wissen, welchen Preis sie dafür zu zahlen hatte, und deren Begeisterung zur Niedertracht des McCarthyismus wie zu den Heldentaten des Zweiten Weltkriegs führen konnte. Männer, die wegen ihrer tiefen Naivität gefährlich und zugleich vielversprechend waren; Männer, die am Ende enttäuscht sein mussten.
Bis 1960 war mein Großvater noch nicht auf die Probe gestellt worden. Die Enttäuschungen kamen später, und auch dann nur langsam, ohne die Heftigkeit, die ihn vielleicht verändert hätte. Insgeheim hielt er sich für einen Freigeist, für einen Bohemien. Er schrieb gelegentlich Gedichte, hörte Jazz, zählte eine Reihe von Juden, die er im Möbelgeschäft kennengelernt hatte, zu seinen engsten Freunden. Seine einzige Unternehmung auf religiösem Terrain bestand darin, mit seiner Familie den lokalen Unitariern beizutreten; ihm gefiel, dass die Unitarier auf die Lehren aller großen Religionen zurückgriffen. (»Man bekommt quasi fünf Religionen zum Preis von einer«, sagte er.) Toot brachte ihn schließlich von seinen religiösen Ansichten ab (»Ich bitte dich, Stanley, Religion und Glaube ist doch kein Supermarkt!«), aber wenn sie von Natur aus skeptischer war und viele der recht ungewöhnlichen Auffassungen meines Großvaters nicht teilte, so kam es doch, weil sie alles selbständig durchdenken musste, im Allgemeinen zu einer Art Verständigung zwischen ihnen.
Irgendwie waren sie liberal, auch wenn ihre Ansichten nicht zu einer festen Ideologie verschmolzen. Auch darin waren sie typische Amerikaner. Als meine Mutter eines Tages nach Hause kam und berichtete, sie habe an der Universität einen afrikanischen Studenten namens Barack kennengelernt, beschlossen sie spontan, ihn zum Essen einzuladen. Der arme Kerl, so weit von zu Hause entfernt, ist doch bestimmt einsam, dachte Gramps vermutlich. Und Toot dachte, ich werd ihn mir lieber mal anschauen. Als mein Vater dann vor der Tür stand, wird Gramps sofort gedacht haben, wie sehr er Nat King Cole ähnelte, zu dessen Fans er sich zählte. Ich stelle mir vor, wie er meinen Vater fragt, ob er singen könne, und gar nicht das versteinerte Gesicht meiner Mutter sieht. Wahrscheinlich erzählt er gerade einen Witz oder erklärt Toot, wie man die Steaks zubereitet, und sieht deswegen nicht, wie meine Mutter die sehnige Hand ihres Freundes drückt. Toot sieht es, aber sie ist so höflich, sich auf die Lippen zu beißen und den Nachtisch zu bringen; sie spürt, dass es falsch wäre, eine Szene zu machen. Am Ende des Abends werden beide sagen, wie intelligent der junge Mann doch sei, wie höflich, diese gelassenen Handbewegungen, die Beine vornehm übereinandergeschlagen – und der Akzent!
Aber sollte ihre Tochter so jemanden heiraten?
Noch wissen wir es nicht; bislang gibt die Geschichte nicht genug her. Tatsache ist, dass Großvater und Großmutter, wie die meisten weißen Amerikaner jener Zeit, nie über Schwarze nachgedacht hatten. Die Diskriminierung von Schwarzen hatte nach Kansas gefunden, als meine Großeltern noch lange nicht geboren waren, aber zumindest in der Gegend von Wichita zeigte sie sich eher indirekt, in der gehobeneren Variante, ohne die brutale Gewalt, die im tiefen Süden grassierte. Die gleichen unausgesprochenen Codes, die das Leben der Weißen bestimmten, beschränkten den Kontakt zu Schwarzen auf ein Minimum; wenn im Kansas der Erinnerungen meiner Großeltern überhaupt Schwarze erscheinen, dann in verschwommenen Bildern – schwarze Männer, die auf der Suche nach Arbeit manchmal auf den Ölfeldern auftauchen, schwarze Frauen, die sich als Wäscherinnen oder Putzfrauen in den Häusern der Weißen verdingen. Es gibt Schwarze, aber sie sind nicht wirklich anwesend, wie Sam der Klavierspieler oder Beulah das Hausmädchen oder Amos und Andy im Radio – schemenhafte, stumme Gestalten, die weder heftige Reaktionen hervorrufen noch Angst machen.
Erst als meine Familie nach dem Krieg nach Texas zog, drang die Rassenfrage in ihr Leben ein. In der ersten Arbeitswoche erhielt Gramps freundliche Ratschläge von seinen Arbeitskollegen, wie er sich gegenüber schwarzen und mexikanischen Kunden benehmen solle. »Wenn Farbige sich Ware ansehen wollen, dann müssen sie nach Feierabend kommen und sich selbst um den Transport kümmern.« Toot machte später in der Bank, in der sie arbeitete, die Bekanntschaft des Hausmeisters, eines hochgewachsenen und würdevollen schwarzen Kriegsveteranen, an den sie sich nur als Mr. Reed erinnert. Während die beiden eines Tages in der Eingangshalle miteinander plauderten, kam eine Sekretärin herbeigelaufen und zischte Toot zu, dass sie einen »Nigger« niemals, unter keinen Umständen, mit »Mister« anreden dürfe. Wenig später fand sie Mr. Reed in einer Ecke des Gebäudes, still vor sich hin weinend. Auf ihre Frage, was los sei, richtete er sich auf, wischte sich die Tränen ab und antwortete mit einer Gegenfrage:
»Was haben wir getan, dass man uns so gemein behandelt?«
Meine Großmutter wusste an jenem Tag keine Antwort darauf, aber die Frage ließ sie nicht mehr los, und manchmal diskutierte sie darüber mit Gramps, wenn meine Mutter zu Bett gegangen war. Sie beschlossen, dass Toot den Mann auch weiterhin als Mr. Reed anreden würde, obwohl sie, in einer Mischung aus Erleichterung und Kummer, die Distanz verstand, die der Hausmeister nun wahrte, wenn sie einander begegneten. Gramps ging dazu über, die Einladungen seiner Arbeitskollegen zu einem Bier abzulehnen, mit dem Hinweis, dass er nach Hause müsse, seine Frau warte. Die beiden zogen sich zurück, verunsichert und irgendwie hilflos, als wären sie fremd in der Stadt.
Unter dieser Atmosphäre litt vor allem meine Mutter. Sie war elf oder zwölf, ein Einzelkind, das sich gerade von einer schweren Asthmaerkrankung zu erholen begann. Durch Krankheit und viele Ortswechsel war sie eine Außenseiterin geworden – fröhlich und umgänglich, aber meist vergrub sie sich in ein Buch oder unternahm allein Spaziergänge –, und Toot befürchtete, dass sich die Eigenheiten ihrer Tochter durch den letzten Umzug noch verstärkt hatten. An ihrer neuen Schule fand meine Mutter kaum Freunde. Wegen ihres Namens Stanley Ann (eine von Gramps’ spinnerten Ideen: er hatte sich einen Sohn gewünscht) wurde sie gehänselt. Stanley Steamer sagten sie zu ihr. Stan the Man. Wenn Toot von der Arbeit nach Hause kam, fand sie ihre Tochter meistens allein vor dem Haus, auf der Veranda, mit den Beinen baumelnd, oder auf dem Rasen liegend, zurückgezogen in ihrer eigenen Welt.
Bis auf einen Tag. Ein heißer, windstiller Tag, eine Horde von Kindern hatte sich vor dem Gartenzaun versammelt. Toot trat näher, hörte unschönes Lachen, sah von Empörung und Abscheu verzerrte Gesichter. Hohe Kinderstimmen riefen abwechselnd: »Niggerfreundin!«
»Drecksyankee!«
»Niggerfreundin!«
Als sie Toot erblickten, liefen sie auseinander, aber vorher warf ein Junge noch einen Stein über den Zaun. Toot verfolgte die Flugbahn des Geschosses, es landete an einem Baumstamm. Und dort sah sie auch den Grund für die ganze Aufregung: ihre Tochter und ein etwa gleichaltriges schwarzes Mädchen, die nebeneinander bäuchlings und mit hochgerutschtem Rocksaum im Gras lagen, die Zehen in die Erde gebohrt, die Köpfe in die Hände gestützt, vor sich ein Buch. Von weitem machten die beiden einen ganz entspannten Eindruck. Erst als Toot das Gatter öffnete und näher trat, sah sie, dass das schwarze Mädchen zitterte und ihrer Tochter Tränen in den Augen standen. Die beiden lagen unbeweglich da, wie gelähmt vor Angst, bis Toot sich schließlich hinunterbeugte und ihnen die Hand auf den Kopf legte.
»Wenn ihr beiden spielen wollt«, sagte sie, »dann geht um Himmels willen ins Haus. Los, rein mit euch.« Sie zog ihre Tochter hoch und streckte die Hand nach dem anderen Mädchen aus, doch in diesem Moment war das Mädchen schon aufgesprungen und rannte mit langen spindeldürren Beinen die Straße entlang.
Gramps war außer sich, als er von diesem Vorfall hörte. Er befragte seine Tochter, notierte Namen. Am nächsten Vormittag nahm er frei, um mit dem Schuldirektor zu sprechen. Er rief die Eltern eines der Kinder an, um ihnen seine Meinung zu sagen. Und von jedem Erwachsenen, mit dem er sprach, bekam er die gleiche Antwort:
»Sie reden am besten mit ihrer Tochter, Mr. Dunham. In unserer Stadt spielen weiße Mädchen nicht mit Farbigen.«
Schwer zu sagen, welches Gewicht diesen Episoden zukommt, welche Versprechungen gegeben oder gebrochen wurden oder ob sie nur im Licht späterer Ereignisse herausragen. Sooft Gramps mit mir darüber sprach, erklärte er, dass die Familie auch deswegen Texas verlassen habe, weil man mit diesem Rassismus nicht einverstanden gewesen sei. Toot war vorsichtiger. Als wir einmal allein waren, sagte sie, sie sei nur deswegen weggezogen, weil Gramps beruflich keinen großen Erfolg hatte und ein Freund in Seattle ihm etwas Besseres versprochen hatte. Der Begriff Rassismus habe damals nicht einmal zu ihrem Wortschatz gehört. »Dein Großvater und ich fanden einfach, dass wir die Menschen anständig behandeln müssen. Das ist alles.«
So ist sie, meine Großmutter, von gesundem Menschenverstand, misstrauisch gegenüber allzu dick aufgetragenen Gefühlen oder pompösen Bekenntnissen. Weshalb ich dazu neige, ihren Darstellungen zu glauben. Es entspricht dem, was ich über meinen Großvater weiß und über seine Neigung, die Geschichte so umzuschreiben, dass sie in sein Selbstbild passte.
Und doch kann ich seine Erinnerungen nicht nur als Angeberei, als weißen Revisionismus abtun. Weil ich weiß, wie sehr er an seine Fiktionen glaubte, wie sehr er sie verwirklicht sehen wollte, auch wenn er nicht immer wusste, wie das zu erreichen war. Nach Texas wurden Schwarze vermutlich Bestandteil dieser Fiktionen, dieser Geschichte, die sich bis in seine Träume niederschlug. Die Lebensbedingungen der Schwarzen, ihr Leid, ihre Wunden, verschmolzen mit den seinen; der abwesende Vater und die Andeutung eines Skandals, eine Mutter, die weggegangen war, die Grausamkeit anderer Kinder, die Erkenntnis, dass er nicht blond war, dass er »wie ein Itaker« aussah. Der Rassismus, sagte ihm sein Gefühl, war Teil dieser Vergangenheit, war Teil von Konvention und Ehrbarkeit und Status, auch das Grinsen, das Geflüster und der Klatsch, die ihn zum Außenseiter gemacht hatten.
Ich glaube, diese Empfindungen sind nicht unwichtig; viele Weiße aus der Generation meiner Großeltern gingen einen anderen Weg, in Richtung Mob. Und obgleich das Verhältnis zu seiner Tochter schon schwierig war, als sie auf Hawaii ankamen – meine Mutter konnte ihm seine Launen und seine Wutausbrüche nie ganz nachsehen und schämte sich seiner ungehobelten Art –, so war es dieses Bedürfnis, die Vergangenheit auszulöschen, und diese Überzeugung, sich eine völlig neue Welt erschaffen zu können, die sich als sein wahres Vermächtnis erweisen sollten. Ob es Gramps bewusst war oder nicht, der Anblick seiner Tochter mit einem schwarzen Mann stieß in seinem tiefsten Innern ein Fenster auf.
Nicht, dass er ihre Entscheidung deswegen leichter akzeptiert hätte. Wie und wann die Hochzeit stattfand, ist nicht ganz klar, ich hatte nie so recht den Mut, Einzelheiten nachzugehen. Es gibt keine Unterlagen, die auf eine richtige Hochzeit mit Torte, Eheringen und kirchlicher Trauung hinweisen. Keiner der Familienangehörigen nahm teil, es ist nicht einmal klar, ob die Leute in Kansas informiert waren. Nur eine kleine zivile Zeremonie vor dem Standesbeamten. So fragil, so zufällig erscheint das Ganze im Nachhinein. Und vielleicht wollten meine Großeltern es auch so haben, eine Versuchung, die vorübergeht, es ist nur eine Frage der Zeit, solange man sich nichts anmerken lässt und nichts Drastisches unternimmt.
Wenn ja, dann unterschätzten sie nicht nur die stille Entschlossenheit meiner Mutter, sondern auch ihre eigenen Gefühle. Erst kam das Baby, gut sieben Pfund, ausgestattet mit zehn Zehen und zehn Fingern, hungrig. Was zum Teufel sollten sie machen?
Doch Zeit und Ort trugen dazu bei, potentielles Unglück in etwas Erträgliches, ja in eine Quelle von Stolz zu verwandeln. Gramps trank ein paar Bier mit seinem Schwiegersohn und hörte ihn über Politik oder Wirtschaft reden, über ferne Orte wie Whitehall oder den Kreml und wie er sich die Zukunft vorstellte. Er fing nun an, aufmerksamer die Zeitung zu lesen. Er las von den neuen Integrationisten in Amerika, fand, dass die Welt kleiner wurde, Einstellungen sich änderten. Tatsächlich nahm die Familie aus Wichita einen der vorderen Plätze in Kennedys New Frontier und in Martin Luther Kings großem Traum ein. Wie konnte Amerika Männer ins All schicken und gleichzeitig seine schwarzen Bürger in Fesseln halten? Zu meinen frühesten Erinnerungen gehört das Bild, wie ich, auf Großvaters Schultern sitzend, die Rückkehr von Apollo-Astronauten auf dem Luftwaffenstützpunkt Hickam beobachte. Die Raumfahrer waren durch das Fenster der Isolationskammer kaum zu sehen. Gramps hat aber immer wieder geschworen, dass einer der Astronauten nur mir zugewinkt und ich zurückgewinkt habe. Auch das gehörte zu der Geschichte, die er sich zurechtlegte. Mit seinem schwarzen Schwiegersohn und seinem braunen Enkel war er im Zeitalter der Raumfahrt angekommen...
Und konnte es einen besseren Hafen als den neuen Bundesstaat Hawaii geben, um von dort aus zu diesem Abenteuer aufzubrechen? Noch heute, nachdem sich die Bevölkerung vervierfacht hat, es in Waikiki nur so wimmelt von Fast-Food-Restaurants und Sexshops und Bauträgern, die gnadenlos den letzten Winkel des grünen Berglandes erobern, noch heute erinnere ich mich an die ersten Schritte, die ich als Kind hier machte, und bin noch immer überwältigt von der Schönheit der Inseln. Die blaue Weite des Pazifik. Die moosbedeckten Felsen und das kühle Rauschen der Manoa Falls, die Blüten und der hohe Himmel, erfüllt vom Gesang unsichtbarer Vögel. Die donnernde Brandung am North Shore, die Wogen, die sich wie in Zeitlupe am Strand brechen. Die Schatten der Felsen von Pali, die süße, wohlriechende Luft.
Hawaii! Meine Familie, die 1959 dort ankam, muss den Eindruck gewonnen haben, als hätte die Natur, des Kriegs und der Aggression überdrüssig, diese grünen Felsen in den Ozean geworfen, damit sie von Pionieren aus der ganzen Welt mit sonnengebräunten Kindern bevölkert werden konnten. Die hässliche Unterwerfung der Ureinwohner durch Vertragsbruch und schlimme, von den Missionaren mitgebrachte Krankheiten; die Aufteilung des fruchtbaren vulkanischen Bodens durch amerikanische Unternehmen, die dort Zuckerrohr und Ananas anbauten; das Pachtsystem, das dafür sorgte, dass japanische, chinesische und philippinische Einwanderer von früh bis spät auf diesen Feldern schuften mussten; die Internierung japanischstämmiger Amerikaner während des Kriegs – all das war jüngste Geschichte. Und doch war dies, als wir dort eintrafen, aus der kollektiven Erinnerung verschwunden wie morgendlicher Nebel, den die Sonne vertreibt. Es gab zu viele Rassen, und die Machtverhältnisse unter ihnen waren viel zu diffus, als dass das rigide Kastensystem des amerikanischen Festlands dort eingeführt werden konnte, und es gab so wenig Schwarze, dass noch die leidenschaftlichsten Fürsprecher der Rassentrennung dort Ferien machen konnten in dem Bewusstsein, das Miteinander der Rassen wirke sich nicht auf die etablierte Ordnung daheim aus.
So entstand die Legende von Hawaii als dem wahren Schmelztiegel, einem Experiment in Sachen Rassenharmonie. Meine Großeltern – besonders Gramps, der als Möbelverkäufer mit den unterschiedlichsten Menschen zusammenkam – verschrieben sich diesem toleranten Miteinander. Ein altes Exemplar von Dale Carnegies Wie man Freunde gewinnt. Die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden steht noch heute in Gramps’ Bücherregal. Und er entwickelte diesen unbeschwerten Plauderton, den er im Umgang mit Kunden wohl für besonders sinnvoll hielt. Wildfremden Leuten zeigte er Fotos von seiner Familie und erzählte aus seinem Leben. Er schüttelte dem Postboten die Hand, und den Kellnerinnen im Restaurant erzählte er zweideutige Witze.