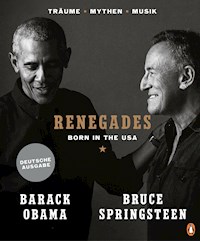21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein fesselnder und zutiefst persönlicher Bericht darüber, wie Geschichte geschrieben wird – von dem US-Präsidenten, der uns inspirierte, an die Kraft der Demokratie zu glauben
In diesem mit Spannung erwarteten ersten Band seiner Präsidentschaftserinnerungen erzählt Barack Obama die Geschichte seiner unwahrscheinlichen Odyssee vom jungen Mann auf der Suche nach seiner Identität bis hin zum führenden Politiker der freien Welt. In erstaunlich persönlichen Worten beschreibt er seinen politischen Werdegang wie auch die wegweisenden Momente der ersten Amtszeit seiner historischen Präsidentschaft – einer Zeit dramatischer Veränderungen und Turbulenzen.
Obama nimmt die Leser und Leserinnen mit auf eine faszinierende Reise von seinem frühesten politischen Erwachen über den ausschlaggebenden Sieg in den Vorwahlen von Iowa, der die Kraft basisdemokratischer Bewegungen verdeutlichte, hin zur entscheidenden Nacht des 4. Novembers 2008, als er zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde und als erster Afroamerikaner das höchste Staatsamt antreten sollte.
Sein Rückblick auf seine Präsidentschaft bietet eine einzigartige Reflexion über Ausmaß und Grenzen präsidialer Macht und liefert zugleich außergewöhnliche Einblicke in die Dynamik US-amerikanischer Politik und internationaler Diplomatie. Wir begleiten Obama ins Oval Office und in den Situation Room des Weißen Hauses sowie nach Moskau, Kairo, Peking und an viele Orte mehr. Er teilt seine Gedanken über seine Regierungsbildung, das Ringen mit der globalen Finanzkrise, seine Bemühungen, Wladimir Putin einzuschätzen, die Bewältigung scheinbar unüberwindlicher Hindernisse auf dem Weg zur Verabschiedung einer Gesundheitsreform. Er beschreibt, wie er mit US-Generälen über die amerikanische Strategie in Afghanistan aneinandergerät, die Wall Street reformiert, wie er auf das verheerende Leck der Bohrplattform Deepwater Horizon reagiert und die Operation „Neptune’s Spear“ autorisiert, die zum Tode Osama bin Ladens führt.
»Ein verheißenes Land« ist ungewöhnlich intim und introspektiv – die Geschichte eines einzelnen Mannes, der eine Wette mit der Geschichte eingeht, eines community organizer, dessen Ideale auf der Weltbühne auf die Probe gestellt werden. Obama berichtet offen vom Balanceakt, als Schwarzer Amerikaner für das Amt zu kandidieren und damit die Erwartungen einer Generation zu schultern, die Mut aus der Botschaft von „Hoffnung und Wandel“ gewinnt, und was es bedeutet, die moralische Herausforderung anzunehmen, Entscheidungen von großer Tragweite zu treffen. Er spricht freimütig über die Kräfte, die sich ihm im In- und Ausland entgegenstellten, gibt ehrlich Auskunft darüber, wie das Leben im Weißen Haus seine Frau und seine Töchter prägte, und scheut sich nicht, Selbstzweifel und Enttäuschungen offenzulegen. Und doch verliert er nie den Glauben daran, dass innerhalb des großen, andauernden amerikanischen Experiments Fortschritt stets möglich ist.
In diesem wunderbar geschriebenen und eindrücklichen Buch bringt Barack Obama seine Überzeugung zum Ausdruck, dass Demokratie kein Geschenk des Himmels ist, sondern auf Empathie und gegenseitigem Verständnis gründet und Tag für Tag gemeinsam geschaffen werden muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1636
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ein fesselnder und zutiefst persönlicher Bericht darüber, wie Geschichte geschrieben wird – von dem US-Präsidenten, der uns inspirierte, an die Kraft der Demokratie zu glauben
In diesem mitreißenden, mit Spannung erwarteten ersten Band seiner Präsidentschaftserinnerungen erzählt Barack Obama die Geschichte seiner unwahrscheinlichen Odyssee vom jungen Mann auf der Suche nach seiner Identität bis hin zum führenden Politiker der freien Welt. In erstaunlich persönlichen Worten beschreibt er seinen politischen Werdegang wie auch die wegweisenden Momente der ersten Amtszeit seiner historischen Präsidentschaft – einer Zeit dramatischer Veränderungen und Turbulenzen.
Obama nimmt die Leser und Leserinnen mit auf eine faszinierende Reise von seinem frühesten politischen Erwachen über den ausschlaggebenden Sieg in den Vorwahlen von Iowa, der die Kraft basisdemokratischer Bewegungen verdeutlichte, hin zur entscheidenden Nacht des 4. Novembers 2008, als er zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde und als erster Afroamerikaner das höchste Staatsamt antreten sollte.
Sein Rückblick auf die Präsidentschaft bietet eine einzigartige Reflexion über Ausmaß und Grenzen präsidialer Macht und liefert zugleich außergewöhnliche Einblicke in die Dynamik US-amerikanischer Politik und internationaler Diplomatie. Wir begleiten Obama ins Oval Office und in den Situation Room des Weißen Hauses sowie nach Moskau, Kairo, Peking und an viele Orte mehr. Er teilt seine Gedanken über seine Regierungsbildung, das Ringen mit der globalen Finanzkrise, seine Bemühungen, Wladimir Putin einzuschätzen, die Bewältigung scheinbar unüberwindlicher Hindernisse auf dem Weg zur Verabschiedung einer Gesundheitsreform. Er beschreibt, wie er mit US-Generälen über die amerikanische Strategie in Afghanistan aneinandergerät, die Wall Street reformiert, wie er auf das verheerende Leck der Bohrplattform Deepwater Horizon reagiert und die Operation »Neptune’s Spear« autorisiert, die zum Tod Osama bin Ladens führt.
Ein verheißenes Land ist ungewöhnlich intim und introspektiv – die Geschichte eines einzelnen Mannes, der eine Wette mit der Geschichte eingeht, eines »Community Organizer«, dessen Ideale auf der Weltbühne auf die Probe gestellt werden. Obama berichtet offen vom Balanceakt, als Schwarzer Amerikaner für das Amt zu kandidieren und damit die Erwartungen einer Generation zu schultern, die Mut aus der Botschaft von »Hoffnung und Wandel« gewinnt, und was es bedeutet, die moralische Herausforderung anzunehmen, Entscheidungen von großer Tragweite zu treffen. Er spricht freimütig über die Kräfte, die sich ihm im In- und Ausland entgegenstellten, gibt ehrlich Auskunft darüber, wie das Leben im Weißen Haus seine Frau und seine Töchter prägte, und scheut sich nicht, Selbstzweifel und Enttäuschungen offenzulegen. Und doch verliert er nie den Glauben daran, dass innerhalb des großen, andauernden amerikanischen Experiments Fortschritt stets möglich ist.
In diesem wunderbar geschriebenen und eindrücklichen Buch bringt Barack Obama seine Überzeugung zum Ausdruck, dass Demokratie kein Geschenk des Himmels ist, sondern auf Empathie und gegenseitigem Verständnis gründet und Tag für Tag gemeinsam geschaffen werden muss.
Barack Obama war der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er wurde im November 2008 in das Amt gewählt, das er für zwei Amtszeiten innehatte. Er ist Autor zweier internationaler Bestseller, Ein amerikanischer Traum: Die Geschichte meiner Familie und Hoffnung wagen: Gedanken zur Rückbesinnung auf den American Dream. 2009 wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Er lebt mit seiner Frau Michelle in Washington, D. C. Sie haben zwei Töchter, Malia und Sasha.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
Barack Obama
EIN VERHEISSENES LAND
Aus dem amerikanischen Englisch von Sylvia Bieker, Harriet Fricke, Stephan Gebauer, Stephan Kleiner, Elke Link, Thorsten Schmidt und Henriette Zeltner-Shane
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel A Promised Land bei Crown, einem Verlag von Penguin Random House LLC, New York. Die Übertragung der Gedichtzeilen von Robert Frost auf Seite 7 besorgte Jürgen Brôcan. Der Brief von Nicole Brandon auf Seite 381 wurde aus Gründen der Klarheit im Wortlaut leicht geändert und gekürzt. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2020 Barack Obama Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Mitarbeit an der Redaktion: Christina Kruschwitz Bildbearbeitung: Helio Repro GmbH, München Covergestaltung: Jorge Schmidt nach einem Design von Christopher Brand Coverabbildungen: Pari Ducovic (Vorderseite), Dan Winters (Rückseite) Satz: Andrea Mogwitz nach einem Design von Elizabeth Rendfleisch
FürMichelle – meine Liebe und Partnerin fürs Leben
und
fürMalia und Sasha – deren Strahlen alles heller macht
O, fly and never tire,
Fly and never tire,
Fly and never tire,
There’s a great camp-meeting in the Promised Land.
Oh, flieg, ohne je zu ermatten,
Flieg, ohne je zu ermatten,
Flieg, ohne je zu ermatten,
Im Verheißenen Land findet ein großes Camp Meeting statt.
Auseinem afroamerikanischen Spiritual
Don’t discount our powers;
We have made a pass
At the infinite.
Unterschätzt nicht unsere Kräfte;
Wir haben uns genähert
Der Unendlichkeit.
RobertFrost, »Kitty Hawk«
INHALT
VORWORT
TEIL 1|DIE WETTE
TEIL 2|YES WE CAN
TEIL 3|RENEGADE
TEIL 4|DER GUTE KAMPF
TEIL 5|DIE WELT, WIE SIE IST
TEIL 6|IM FASS
TEIL 7|AUF DEM HOCHSEIL
DANK
REGISTER
VORWORT
Ich begann dieses Buch kurz nach dem Ende meiner Präsidentschaft zu schreiben – nachdem Michelle und ich ein letztes Mal die Air Force One bestiegen hatten und in einen lang aufgeschobenen Urlaub im Westen gereist waren. Die Stimmung an Bord war bittersüß. Wir waren beide körperlich wie emotional ausgelaugt. Nicht nur von den Anstrengungen der vergangenen acht Jahre, sondern auch von den unerwarteten Resultaten einer Wahl, durch die jemand zu meinem Nachfolger bestimmt worden war, der in allem das exakte Gegenteil von dem verkörperte, wofür wir standen. Trotzdem, nachdem wir unseren Teil getan hatten, um den Stab übergeben zu können, erfüllte es uns mit Zufriedenheit, zu wissen, dass wir unser Bestes gegeben hatten. Und egal, wie oft ich als Präsident versagt hatte, welche Projekte ich hatte verwirklichen wollen, bei denen ich aber gescheitert war – das Land stand jetzt besser da als zu Beginn meiner Amtszeit. Einen Monat lang schliefen Michelle und ich aus, aßen geruhsam zu Abend, unternahmen lange Spaziergänge, schwammen im Meer, zogen Bilanz, frischten unsere Freundschaft auf, entdeckten unsere Liebe neu und planten einen weniger ereignisreichen, aber hoffentlich nicht weniger erfüllenden zweiten Akt. Als ich bereit war, wieder an die Arbeit zu gehen, und mich mit Stift und gelbem Block hinsetzte, da hatte ich schon einen klaren Entwurf des Buchs im Kopf. (Ich schreibe Dinge immer noch gern mit der Hand auf, weil ich finde, dass ein Computer selbst meinen gröbsten Skizzen zu viel Glanz und halb garen Gedanken den Anschein von Ordnung verleiht.)
Zuallererst hoffte ich, eine ehrliche Darstellung meiner Zeit im Amt zu liefern – nicht bloß ein historisches Protokoll der Schlüsselereignisse während meiner Amtszeit und der wichtigen Personen, mit denen ich zu tun hatte. Mir ging es auch um einen Bericht über einige der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Gegenströmungen, die dazu beitrugen, den Herausforderungen, vor denen meine Regierung stand, Gestalt zu geben, und ich wollte die Entscheidungen beschreiben, die mein Team und ich als Reaktion darauf getroffen haben. Wo es möglich war, wollte ich den Lesern einen Eindruck davon vermitteln, wie es sich anfühlt, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Ich wollte den Vorhang ein Stückchen zur Seite ziehen und die Leute daran erinnern, dass aller Macht und allem Pomp zum Trotz die Präsidentschaft auch nur ein Job ist und unsere Bundesregierung ein menschliches Unterfangen wie viele andere und dass die Frauen und Männer, die im Weißen Haus arbeiten, die gleiche tägliche Mischung aus Zufriedenheit, Enttäuschung, Reibereien im Büro, Fehlschlägen und kleinen Triumphen erleben wie der Rest ihrer Mitbürger. Und schließlich wollte ich eine persönliche Geschichte erzählen, die junge Menschen vielleicht dazu inspiriert, ein Berufsleben im Dienst der Allgemeinheit zu erwägen: wie meine Karriere in der Politik eigentlich damit begann, dass ich nach einem Platz suchte, an dem ich dazugehörte, nach einem Weg, mir die verschiedenen Stränge meiner bunt gemischten Herkunft zu erklären, und wie ich letztlich erst in der Lage war, eine Gemeinschaft und Sinn in meinem Leben zu finden, indem ich mich einer Sache verschrieb, die größer war als ich selbst.
Ich hatte mir ausgerechnet, dass ich all das auf etwa fünfhundert Seiten schaffen könnte. Ich nahm an, innerhalb eines Jahres damit fertig zu sein.
Man kann wohl sagen, dass der Schreibprozess nicht ganz nach Plan verlief. Meinen besten Absichten zum Trotz wuchs das Buch in die Länge und in die Tiefe – das war der Grund, warum ich mich letztlich entschloss, zwei Bände daraus zu machen. Mir ist schmerzlich bewusst, dass ein begabterer Autor einen Weg gefunden hätte, dieselbe Geschichte kürzer zu erzählen. (Schließlich befand sich mein persönliches Arbeitszimmer im Weißen Haus direkt neben dem Lincoln Bedroom, wo eine signierte Fassung der 272 Wörter langen Gettysburg Address von Abraham Lincoln hinter Glas ausgestellt ist.) Doch jedes Mal, wenn ich mich zum Schreiben hinsetzte, schien mein Kopf sich gegen einen schlichten, linearen Bericht zu wehren, gleichviel, ob ich die frühen Phasen meines Wahlkampfs, den Umgang meiner Regierung mit der Finanzkrise, Verhandlungen mit den Russen über die Kontrolle von Atomwaffen schildern oder die Kräfte erklären wollte, die zum Arabischen Frühling geführt hatten. Oft fühlte ich mich verpflichtet, den Kontext zu den Entscheidungen zu liefern, die ich und andere getroffen hatten, und ich wollte diesen Hintergrund nicht in Fuß- oder Endnoten verbannen (die ich hasse). Ich stellte fest, dass sich meine Motive nicht immer erklären ließen, indem ich mich schlicht auf eine Fülle von Wirtschaftsdaten berief oder ein vollständiges Briefing im Oval Office wiedergab. Denn diese Motive waren möglicherweise von der Unterhaltung mit einem Fremden während des Wahlkampfs geprägt worden oder vom Besuch in einem Militärkrankenhaus oder von einer Lektion, die meine Mutter mich in der Kindheit gelehrt hatte. Immer wieder spülten meine Erinnerungen scheinbar beiläufige Details nach oben (die Suche nach einem verschwiegenen Ort für eine Abendzigarette; mein Team und ich lachend beim Kartenspielen an Bord der Air Force One). Solche Einzelheiten fingen meine gelebte Erfahrung während der acht Jahre, die ich im Weißen Haus verbrachte, auf eine Weise ein, die ein offizieller Bericht nie vermitteln könnte.
Was ich überhaupt nicht vorhersah, abgesehen von der Mühe, Worte zu Papier zu bringen, war, was sich in den dreieinhalb Jahren seit jenem letzten Flug mit der Air Force One ereignen würde. Während ich hier sitze, befindet das Land sich nach wie vor im Griff einer globalen Pandemie und der damit einhergehenden Wirtschaftskrise; mehr als 178 000 Amerikaner sind gestorben, Firmen und Geschäfte geschlossen, Millionen von Menschen arbeitslos. Im ganzen Land sind Leute aus allen Schichten auf die Straße gegangen, um gegen den Tod unbewaffneter Schwarzer Männer und Frauen durch Polizisten zu protestieren. Und die vielleicht größte Sorge von allen: Unsere Demokratie scheint am Rand einer Krise zu taumeln – einer Krise, die ihren Ursprung in der fundamentalen Auseinandersetzung zwischen zwei widerstreitenden Visionen davon hat, was Amerika ist und was es sein sollte. Eine Krise, die das Gemeinwesen gespalten, wütend und misstrauisch gemacht hat und die eine anhaltende Verletzung institutioneller Normen, verfahrensrechtlicher Absicherungen und grundlegender Übereinkünfte ermöglichte, die sowohl Republikaner als auch Demokraten einst für selbstverständlich hielten.
Diese Auseinandersetzung ist natürlich nicht neu. In vielerlei Hinsicht hat sie die kollektive amerikanische Erfahrung sogar definiert. Sie ist eingebettet in die Gründungsdokumente, die gleichzeitig proklamieren konnten, dass alle Menschen gleich sind und ein Sklave doch nur drei Fünftel eines Menschen zählt. Sie findet ihren Ausdruck in unseren frühesten Gerichtsurteilen, wenn zum Beispiel der vorsitzende Richter des Obersten Gerichtshofs amerikanischen Ureinwohnern unverblümt erklärt, dass das Recht ihres Stammes, Eigentum zu übertragen, nicht vollstreckbar ist – mit der Begründung, dass das Gericht des Eroberers keine Befugnis habe, die berechtigten Ansprüche des Eroberten anzuerkennen. Es ist eine Auseinandersetzung, die schon auf den Schlachtfeldern von Gettysburg und Appomattox ausgetragen wurde, aber auch in den Sälen des Kongresses, auf einer Brücke in Selma ebenso wie in den Weinbergen von Kalifornien oder den Straßen von New York. Es waren nicht nur Soldaten, die in dieser Auseinandersetzung kämpften, sondern weit häufiger Gewerkschaftsmitglieder, Frauenrechtlerinnen, Schlafwagenschaffner, Studentenführer, Wellen von Einwanderern und LGBTQ-Aktivisten, bewaffnet mit nichts als Schildern, Flugblättern oder auch nur einem Paar fester Schuhe. Den Kern dieses lang währenden Kampfes bildet eine schlichte Frage: Haben wir ein Interesse daran, die amerikanische Realität mit den Idealen des Landes in Einklang zu bringen? Und wenn ja, glauben wir tatsächlich, dass unsere Vorstellung von Selbstregierung und individueller Freiheit, von Chancengleichheit und Gleichheit vor dem Gesetz für jedermann gilt? Oder haben wir uns nicht vielmehr durch die Praxis, wenn nicht gar kraft Gesetz, gebunden, diese Dinge einer kleinen Gruppe Privilegierter vorzubehalten?
Ich verstehe, dass es diejenigen gibt, die glauben, es sei an der Zeit, den Mythos zu entsorgen. Weil ein Blick in die amerikanische Geschichte und schon ein flüchtiger Blick auf die Schlagzeilen von heute zeigen, dass die Ideale dieser Nation schon immer an zweiter Stelle standen. Hinter Eroberung und Unterdrückung, einem rassistischen Kastensystem und Raubtierkapitalismus. Diese Menschen sind der Ansicht, dass all jene, die etwas anderes behaupten, sich der Komplizenschaft in einem von Beginn an manipulierten Spiel schuldig machen. Ich gestehe, dass es im Verlauf der Arbeit an diesem Buch Momente gab, in denen ich mich im Rückblick auf meine Präsidentschaft und alles, was seither passiert war, fragen musste, ob ich mich zu sehr gemäßigt habe, wenn ich aussprach, was ich als Wahrheit ansah. Ob ich in Worten und Taten zu viel Vorsicht an den Tag legte, weil ich glaubte, der Appell an die von Lincoln so genannten besseren Engel unserer Natur würde mir eher ermöglichen, uns in Richtung eines Amerika zu führen, das uns verheißen worden ist.
Ich weiß es nicht. Mit Gewissheit kann ich jedoch sagen, dass ich noch nicht bereit bin, die Möglichkeit von Amerika aufzugeben – nicht nur um künftiger Generationen von Amerikanern willen, sondern um der gesamten Menschheit willen. Denn ich bin überzeugt, dass die Pandemie, die wir derzeit durchleben, einerseits eine Manifestation und andererseits lediglich eine Unterbrechung des unaufhaltsamen Marschs in Richtung einer vernetzten Welt ist, in der Menschen und Gesellschaften zwangsläufig kollidieren. In dieser Welt – mit globalen Lieferketten, verzögerungsfreiem Kapitaltransfer, sozialen Medien, transnationalen Terrorismusnetzwerken, Klimawandel, Massenmigration und ständig wachsender Komplexität – werden wir lernen, zusammenzuleben, miteinander zu kooperieren und die Würde des jeweils anderen anzuerkennen, weil wir sonst untergehen. Und so beobachtet die Welt Amerika – die einzige Großmacht der Geschichte, die von Menschen aus allen Winkeln der Erde aufgebaut wurde und in der jede Hautfarbe, jeder Glaube und jede Lebensart vertreten ist –, um zu sehen, ob unser Demokratieexperiment funktionieren kann. Um zu sehen, ob wir zu etwas imstande sind, das noch keiner Nation je gelungen ist. Um zu sehen, ob wir tatsächlich der Bedeutung unseres Credos gerecht werden.
Das Urteil steht noch aus. Wenn dieser erste Band erscheint, wird eine amerikanische Wahl bereits stattgefunden haben. Und auch wenn ich glaube, dass noch nie so viel auf dem Spiel stand, weiß ich doch, dass keine einzelne Wahl die Sache besiegeln wird. Wenn ich hoffnungsvoll bleibe, dann deshalb, weil ich gelernt habe, an meine Mitbürger zu glauben, insbesondere an diejenigen der nächsten Generation. Die Überzeugung vom gleichen Wert aller Menschen scheint ihre zweite Natur zu sein. Und sie beharren darauf, die Prinzipien zu verwirklichen, von denen ihre Eltern und Lehrer ihnen zwar gesagt haben, dass sie wahr sind, an die meine Generation aber vielleicht nie so richtig geglaubt hat. Dieses Buch richtet sich vor allem an diese jungen Leute – als eine Einladung, die Welt noch einmal zu erneuern und durch harte Arbeit, Entschlossenheit und eine große Portion Fantasie ein Amerika zustande zu bringen, das endlich allem entspricht, was wir als Bestes in uns tragen.
August2020
TEIL 1
DIE WETTE
KAPITEL 1
Von allen Räumen und Sälen und Gärten, die zum Weißen Haus gehören, hat mir der westliche Säulengang am besten gefallen.
Acht Jahre lang hat der kurze Fußweg durch die frische Luft von unserer Wohnung ins Büro und wieder zurück meinen Tag eingerahmt. Dort spürte ich jeden Morgen die erste Böe des Winterwinds oder das erste Pulsieren der Sommerhitze, dort sammelte ich meine Gedanken, ging im Kopf die Termine des Tages durch, legte mir überzeugende Argumente für skeptische Kongressmitglieder oder besorgte Wähler zurecht oder rüstete mich für die eine folgenschwere Entscheidung oder die andere sich anbahnende Krise.
In der Frühzeit des Weißen Hauses passten die Amtszimmer und der Wohnbereich der First Family noch unter ein Dach, und der westliche Säulengang war eigentlich nur der Weg zum Pferdestall. Doch als Teddy Roosevelt das Amt antrat, entschied er, dass ein Gebäude nicht genug Platz bot für einen modernen Mitarbeiterstab, sechs stürmische Kinder und seine eigene geistige Gesundheit. Er ließ ein Gebäude bauen, aus dem der West Wing mitsamt dem Oval Office entstand, und im Verlauf der nächsten Jahrzehnte nahm der westliche Säulengang unter den verschiedenen Präsidenten allmählich seine jetzige Form an: eine Einfassung des Rosengartens im Norden und Westen – die dicke Mauer auf der Nordseite stumm und schmucklos bis auf die hohen halbmondförmigen Fenster; auf der Westseite die herrschaftlichen weißen Säulen, wie eine Ehrengarde, die für eine sichere Passage sorgt.
Meistens gehe ich langsam – es ist ein hawaiianisches Schlendern, wie Michelle sagt, gelegentlich mit einem Anflug von Ungeduld. Doch im Säulengang ging ich anders, weil ich mir der Geschichte bewusst war, die dort gemacht worden war, und meiner Amtsvorgänger. Meine Schritte wurden länger, forscher und fanden ein Echo in den Tritten der Personenschützer, die mir mit Abstand folgten. Beim Erreichen der Rampe am Ende des Gangs (ein Vermächtnis von Franklin Delano Roosevelt und seinem Rollstuhl – ich stelle ihn mir lächelnd vor, die Zigarettenspitze fest zwischen den Zähnen, während er sich abmüht, die Steigung hinaufzurollen) winkte ich der uniformierten Wache hinter der Glastür zu. Manchmal musste die Wache eine überraschte Besuchergruppe zurückhalten. Wenn ich Zeit hatte, schüttelte ich ein paar Hände und fragte die Menschen, woher sie kamen. Meistens aber bog ich gleich nach links ab, folgte der Wand des Cabinet Room und trat durch den Seiteneingang beim Oval Office, wo ich meinen Mitarbeiterstab begrüßte, mir meinen Terminkalender und eine Tasse Tee schnappte und mit der täglichen Arbeit begann.
Mehrmals in der Woche sah ich, wenn ich in den Säulengang hinaustrat, die vom National Park Service angestellten Gärtner im Rosengarten arbeiten. Die meisten waren schon etwas älter, alle trugen grüne Uniformen, dazu im Sommer Hüte zum Schutz vor der Sonne und im Winter dicke Mäntel gegen die Kälte. Wenn ich es nicht eilig hatte, plauderte ich mit ihnen, lobte die neuen Pflanzen oder erkundigte mich nach den Sturmschäden der letzten Nacht, und sie erklärten mir mit stillem Stolz ihre Arbeit. Viele Worte machten die Männer nicht, auch untereinander tauschten sie meist nicht mehr als eine Geste oder ein Nicken, jeder war auf seine Aufgabe konzentriert, aber alle bewegten sich mit der gleichen Anmut. Einer der ältesten, Ed Thomas, ein großer, drahtiger Schwarzer mit eingefallenen Wangen, war schon seit vierzig Jahren für das Weiße Haus tätig. Bei unserer ersten Begegnung zog er ein Tuch aus der hinteren Hosentasche und wischte sich die Hände ab, bevor er mir die rechte reichte. In seiner dick geäderten, schwieligen Pranke verlor sich meine Hand. Ich fragte ihn, wie lange er noch im Weißen Haus bleiben wolle, bevor er in den Ruhestand gehe.
»Das weiß ich noch nicht, Mr President«, sagte er. »Ich arbeite gern. Nur werden die Gelenke ein bisschen steif. Aber ich denke, ich bleibe so lange, wie Sie hier sind – und sorge dafür, dass der Garten schön aussieht.«
Und wie schön der Garten aussah! Die Schatten spendenden Magnolien, die in jeder Ecke emporragten, die dichten, üppig grünen Hecken, die gestutzten Apfelbäume. Und die Blumen, die ein paar Meilen entfernt in Gewächshäusern gezüchtet wurden und für eine beständige Explosion von Farben sorgten – Rot und Gelb, Rosa und Violett. Im Frühling drängten sich die Tulpen, ihre Köpfe in Richtung Sonne erhoben, im Sommer Vanilleblumen, Geranien und Lilien, im Herbst Chrysanthemen, Astern und Wildblumen. Und immer ein paar Rosen, hauptsächlich rote, aber gelegentlich auch gelbe oder weiße, allesamt in voller Blüte.
Wenn ich durch den Säulengang ging oder im Oval Office aus dem Fenster schaute, sah ich das Werk der im Freien arbeitenden Männer und Frauen. Sie erinnerten mich an das kleine Gemälde von Norman Rockwell, das ich über der Büste von Martin Luther King und neben einem Porträt von George Washington an der Wand hängen hatte: fünf winzig kleine Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, Männer in Arbeitskleidung, die mit Seilen abgesichert vor einem strahlend blauen Himmel die Fackel der Freiheitsstatue polieren. Die Männer auf dem Gemälde, die Gärtner vor dem Fenster – in meiner Vorstellung waren sie Hüter, stille Priester eines ehrwürdigen Ordens. Und ich nahm mir vor, ebenso hart zu arbeiten und meinen Job mit ebensolcher Sorgfalt zu erledigen wie diese Menschen.
Im Lauf der Zeit haben sich etliche Erinnerungen mit meinem Weg durch den Säulengang verbunden. Zum einen fanden dort natürlich große öffentliche Ereignisse statt – die Ansprachen vor einer Phalanx aus Kameras, die Pressekonferenzen mit ausländischen Staatsgästen. Aber dort erlebte ich auch sehr private Momente – Malia und Sasha, die bei einem nachmittäglichen Überraschungsbesuch ein Wettrennen veranstalteten, unsere Hunde Bo und Sunny, die durch den tiefen Schnee gelaufen waren und mich mit weißen Kinnbärten begrüßten. Wenn wir uns an einem klaren Herbsttag einen Football zuwarfen, oder wenn ich einen Mitarbeiter tröstete, der einen persönlichen Verlust erlitten hatte.
Diese Bilder tauchten oft vor meinem geistigen Auge auf und unterbrachen mich in meiner Arbeit. Sie erinnerten mich daran, wie schnell die Zeit vergeht, und weckten in mir das Verlangen, die Uhr zurückzudrehen und noch einmal neu anzufangen. Auf meinem Weg morgens war das nicht möglich, denn der Zeitpfeil zeigte dann nur nach vorne; die Aufgaben des Tages warteten auf mich, ich musste mich auf das konzentrieren, was vor mir lag.
Abends war es anders. Auf dem Rückweg in unsere Wohnung, die volle Aktentasche unter dem Arm, zwang ich mich dazu, langsamer zu gehen und gelegentlich sogar stehen zu bleiben. Dann atmete ich die vom Geruch der Erde und des Rasens und dem Duft der Blüten reiche Luft ein und lauschte dem Wind oder dem prasselnden Regen. Manchmal betrachtete ich auch die beleuchteten Säulen und den majestätischen Bau des Weißen Hauses mit der hell angestrahlten Flagge oben auf dem Dach, oder ich schaute in Richtung Washington Monument, das in der Ferne in den schwarzen Himmel ragte, und sah darüber hin und wieder den Mond und die Sterne oder das blinkende Licht eines Flugzeugs.
In solchen Momenten dachte ich mit Staunen an den merkwürdigen Weg – und die Idee – zurück, die mich hierhergeführt hatten.
Ich stamme nicht aus einer politisch aktiven Familie. Meine Großeltern mütterlicherseits kamen aus dem Mittleren Westen und waren Nachfahren schottischer und irischer Einwanderer. Für Menschen, die im Kansas der Depressionszeit geboren wurden, waren sie erstaunlich liberal eingestellt, auch verfolgten sie aufmerksam die Nachrichten. »Das gehört dazu, wenn man ein gut informierter Bürger sein will«, sagte meine Großmutter, die wir Toot nannten (Kurzform von Tutu, dem hawaiianischen Wort für Grandma), wenn sie mich morgens über den Rand ihres Honolulu Advertiser anschaute. Doch sie und mein Großvater hingen weder einer bestimmten politischen Ideologie noch einer Partei an, sondern ließen sich von dem leiten, was sie als gesunden Menschenverstand ansahen. Sie machten sich Gedanken über ihre Arbeit – meine Großmutter war stellvertretende Direktorin der Treuhandgeschäfte einer kleinen Bank, mein Großvater Vertreter für Lebensversicherungen – und darüber, wie sie ihre Rechnungen und die kleinen Annehmlichkeiten des Lebens bezahlen sollten.
Außerdem lebten sie auf Oahu, wo die Uhren ohnehin anders gingen. Nach vielen Jahren in so unterschiedlichen Gegenden wie Oklahoma, Texas und Washington State waren sie 1960 nach Hawaii gezogen, das im Jahr zuvor zum Bundesstaat geworden war. Nun lag ein ganzer Ozean zwischen ihnen und den Unruhen und Protesten und was sonst noch passierte. Ich kann mich nur an eine politische Diskussion erinnern, die meine Großeltern in meiner Kindheit geführt haben, es ging um eine Strandbar: Der Bürgermeister von Honolulu hatte Gramps’ Lieblingskneipe abreißen lassen, weil die Strandpromenade am hinteren Ende von Waikiki aufgehübscht werden sollte.
Gramps hat ihm das nie verziehen.
Meine Mutter Ann Dunham war anders, sie hatte feste Überzeugungen. Als einziges Kind meiner Großeltern rebellierte sie schon in der Highschool gegen die Konventionen. Sie las die Bücher der Beatniks und französischen Existenzialisten und unternahm mit einer Freundin eine mehrtägige Spritztour nach San Francisco, ohne jemandem vorher Bescheid zu geben. In meiner Kindheit erzählte sie mir von den Protestmärschen der Bürgerrechtler, von der Katastrophe, in die der Vietnamkrieg zwangsläufig führen musste, von der Frauenbewegung (ein Ja zur Lohngleichheit, aber kein Eifer, sich nicht mehr die Beine zu rasieren) und vom Krieg gegen die Armut. Als wir zu meinem Stiefvater nach Indonesien zogen, erklärte sie mir, dass staatliche Korruption eine Sünde sei (»Das ist nichts anderes als Diebstahl, Barry«), auch wenn sich offensichtlich alle daran beteiligten. In dem Sommer, als ich zwölf wurde und wir einen Monat lang durch die Vereinigten Staaten reisten, beharrte sie darauf, sich mit mir jeden Abend im Fernsehen die Watergate-Anhörungen anzuschauen, und kommentierte das Geschehen gleich mit (»Was soll man von einem McCarthyisten auch anderes erwarten?«).
Sie konzentrierte sich nicht nur auf die großen Themen. Nachdem sie einmal herausgefunden hatte, dass ich mit anderen in der Schule einen Jungen gehänselt hatte, hielt sie mir einen Vortrag.
»Weißt du, Barry«, sagte sie (so nannten sie und meine Großeltern mich, meistens abgekürzt zu »Bar«, das sie wie »Bear« aussprachen), »es gibt auf der Welt Leute, die denken nur an sich selbst. Solange sie bekommen, was sie wollen, sind ihnen alle anderen Menschen egal. Und sie machen andere schlecht, weil sie sich dann stark und besser fühlen.
Und dann gibt es Menschen, die tun das Gegenteil, die können sich vorstellen, wie andere sich fühlen, und achten darauf, dass sie nichts machen, was anderen wehtut.
Und?«, fragte sie dann und sah mir in die Augen. »Was für ein Mensch möchtest du sein?«
Ich fühlte mich richtig mies. Und wie von meiner Mutter beabsichtigt, ließ mich die Frage sehr lange nicht mehr los.
In den Augen meiner Mutter bot die Welt reichlich Gelegenheit für Moralunterricht. An einer politischen Kampagne war sie, soweit ich weiß, jedoch nie aktiv beteiligt. Wie meine Großeltern hegte auch sie Misstrauen gegenüber Parteiprogrammen, Doktrinen und absoluten Wahrheiten und zog es vor, ihren Wertvorstellungen im Kleinen Ausdruck zu verleihen. »Die Welt ist kompliziert, Bar. Das macht sie so interessant.« Bestürzt über den Krieg in Südostasien, verbrachte sie den Großteil ihres Lebens in dieser Gegend, befasste sich dort intensiv mit den Sprachen und Kulturen und half, Kleinkreditprogramme für arme Menschen aufzubauen, lange bevor die Vergabe von Mikrokrediten in der internationalen Entwicklungshilfe zum Trend wurde. Entsetzt über den Rassismus, heiratete sie gleich zweimal in ihrem Leben einen Mann mit anderer Hautfarbe und empfand für die beiden Kinder aus diesen Ehen eine schier unerschöpfliche Liebe. Wütend über die den Frauen auferlegten gesellschaftlichen Zwänge, ließ sie sich von beiden Männern scheiden, als sie sich von ihnen eingeengt und enttäuscht fühlte, schlug eine selbst gewählte berufliche Laufbahn ein, erzog ihre Kinder nach ihren eigenen Vorstellungen von Anständigkeit und tat im Großen und Ganzen immer nur das, was ihr Spaß machte.
In der Welt meiner Mutter war das Private tatsächlich politisch – obwohl sie mit diesem Slogan sicherlich nichts hätte anfangen können.
Das soll nicht heißen, dass sie für ihren Sohn keine ehrgeizigen Ziele hatte. Trotz der finanziellen Belastung schickten sie und meine Großeltern mich auf die Punahou School, die beste Privatschule auf Hawaii. Auf den Gedanken, ich könnte nicht aufs College gehen, wäre niemand in meiner Familie gekommen. Aber dass ich einmal ein großes öffentliches Amt bekleiden würde, hätte keiner von ihnen erwartet. Meine Mutter hätte sich vielleicht vorgestellt, ich würde später eine philanthropische Institution wie die Ford-Stiftung leiten. Und meinen Großeltern hätte es gefallen, wenn ich Richter geworden wäre oder ein cleverer Strafverteidiger wie Perry Mason.
»Der Junge könnte sein vorlautes Mundwerk doch für was Sinnvolles einsetzen«, sagte Gramps gerne.
Da ich meinen Vater nicht kannte, übte er auch keinen großen Einfluss auf mich aus. So viel hatte ich mitbekommen, dass er eine Zeit lang für die kenianische Regierung gearbeitet hatte, und als ich zehn war, besuchte er uns einen Monat lang in Honolulu. Es war das erste und letzte Mal, dass ich ihn sah; danach schickte er mir nur hin und wieder einen Brief, verfasst auf dünnem blauem Luftpostpapier mit vorgedruckten Adresszeilen, damit man es zusammenfalten und ohne Umschlag verschicken konnte. »Wie mir Deine Mutter geschrieben hat, überlegst Du, Architektur zu studieren«, stand in einem seiner Briefe. »Das ist ein sehr nützlicher Beruf, noch dazu kann man ihn überall auf der Welt ausüben.«
Richtig weiter half mir das auch nicht.
Und die Welt außerhalb meiner Familie? In meiner Teenagerzeit sah sicher kein Mensch in mir den angehenden Staatschef, sondern eher einen lustlosen Schüler, einen leidenschaftlichen Basketballer mit bescheidenem Talent und einen unermüdlichen Partygänger. Ich saß nicht in der Studentenvertretung, tat mich bei den Pfadfindern nicht hervor, absolvierte kein Praktikum im Büro unseres Kongressabgeordneten. Während der Highschool redeten meine Freunde und ich eigentlich nur über Sport, Mädchen, Musik und darüber, wie und wo wir uns betrinken wollten.
Drei von ihnen – Bobby Titcomb, Greg Orme und Mike Ramos – zählen noch immer zu meinen besten Freunden. Selbst heute lachen wir manchmal stundenlang über Geschichten aus unserer vergeudeten Jugend. Bei meinen Wahlkämpfen haben sie mich mit einer Loyalität unterstützt, für die ich ihnen immer dankbar sein werde. Sie wurden so gut darin, meine Leistungen zu verteidigen, wie sonst nur die Leute von MSNBC.
Während meiner Präsidentschaft gab es allerdings auch Momente – nachdem sie zum Beispiel gesehen hatten, wie ich vor einer großen Menschenmenge eine Rede hielt oder junge Marines bei der Besichtigung eines Stützpunktes zackig vor mir salutierten –, in denen mir ihr verblüffter Gesichtsausdruck verriet, wie schwer es ihnen fiel, den ergrauenden Mann mit Anzug und Krawatte mit dem wilden, unreifen Kerl, den sie früher gekannt hatten, in Einklang zu bringen.
DerTyp?, haben sie vermutlich gedacht. Wie zum Geier hat der das bloß geschafft?
Hätten meine Freunde mich jemals direkt gefragt, wäre mir darauf wahrscheinlich keine gute Antwort eingefallen.
Ich weiß noch, dass ich bereits in der Highschool anfing, Fragen zu stellen – wieso war mein Vater abwesend, wieso hatte meine Mutter diese und nicht jene Entscheidung getroffen, und wieso lebte ich überhaupt an einem Ort, wo nur wenige Menschen so aussahen wie ich? Viele Fragen kreisten um das Thema Hautfarbe: Warum spielten Schwarze in der Profiliga Basketball, aber arbeiteten dort nicht als Trainer? Was meinte das Mädchen aus meiner Schule, als es sagte, es empfinde mich gar nicht als Schwarz? Warum war jeder Schwarze in Actionfilmen ein messerschwingender Irrer, mit Ausnahme vielleicht des einen – der Sidekick natürlich –, der am Ende immer getötet wurde?
Aber die Hautfarbe war nicht das Einzige, was mich beschäftigte. Da war auch noch die soziale Frage. In Indonesien hatte ich die weite Kluft zwischen den reichen Eliten und den verarmten Massen mit eigenen Augen gesehen. Ich fing an, die Spannungen zwischen den Stämmen im Heimatland meines Vaters wahrzunehmen, den Hass, der zwischen Menschen herrschen konnte, selbst wenn sie sich äußerlich gleichen mochten. Ich wurde täglich Zeuge des so beengt wirkenden Lebens meiner Großeltern, der Enttäuschungen, über die sie sich mit Fernsehen, Alkohol und hin und wieder einem neuen Haushaltsgerät oder Auto hinweghalfen. Ich merkte, dass meine Mutter für ihre intellektuelle Freiheit mit chronischen finanziellen Problemen und einem bisweilen chaotischen Privatleben bezahlte, und ich entwickelte ein Gespür für die wenig subtilen Hierarchien zwischen meinen Klassenkameraden auf der Privatschule, die sich hauptsächlich danach richteten, wie viel Geld ihre Eltern hatten. Und ganz gleich, was meine Mutter auch behauptete, die Drangsalierer, Betrüger und Großtuer standen offensichtlich immer ziemlich gut da, während die Menschen, die sie für gut und anständig hielt, eigentlich fast immer über den Tisch gezogen wurden.
Ich war innerlich zerrissen. Manchmal hatte ich das Gefühl, als wäre ich wegen meiner ungewöhnlichen Herkunft und der Welten, zwischen denen ich den Spagat versuchte, überall und nirgends richtig zu Hause, als bestünde ich aus nicht zueinanderpassenden Teilen, wie ein Schnabeltier oder irgendein Fantasiewesen, das nur in einem fragilen Lebensraum eine Chance hat und nie weiß, wohin es eigentlich gehört. Und aus irgendeinem Grund war mir klar, dass mich, sofern es mir nicht gelang, mein Leben richtig zusammenzufügen und irgendwo festen Grund zu finden, ein einsames Leben erwartete.
Geredet habe ich darüber mit niemandem, weder mit meinen Freunden noch mit meiner Familie. Ich wollte ihre Gefühle nicht verletzen, wollte nicht noch mehr auffallen, als ich es ohnehin schon tat. Zuflucht fand ich in Büchern. Die Liebe zum Lesen verdanke ich meiner Mutter, sie legte die Saat schon in meiner frühen Kindheit. Es war ihr üblicher Rat, wenn ich über Langeweile klagte oder sie nicht das Geld hatte, um mich in Indonesien auf die internationale Schule zu schicken, oder ich sie zur Arbeit begleiten musste, weil sie keinen Babysitter hatte.
Liesein Buch, sagte sie dann. Und danach kannst du mir erzählen, was du daraus gelernt hast.
Als meine Mutter ihre Arbeit in Indonesien wieder aufnahm und sie sich dazu noch um meine kleine Schwester Maya kümmerte, lebte ich ein paar Jahre lang bei meinen Großeltern auf Hawaii. Da meine Mutter mich nicht mehr unermüdlich zum Lernen antrieb, verschlechterten sich meine Schulnoten. Aber in der zehnten Klasse änderte sich das. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich mit meinen Großeltern einmal einen Basar in der Central Union Church am Ende unserer Straße besuchte und dort eine Kiste mit gebrauchten Büchern entdeckte. Aus irgendeinem Grund zog ich ein paar von ihnen heraus, die mich ansprachen oder mir bekannt vorkamen – Bücher von Ralph Ellison und Langston Hughes, Robert Penn Warren und Dostojewski, D. H. Lawrence und Ralph Waldo Emerson. Gramps, der mit dem Kauf gebrauchter Golfschläger liebäugelte, schaute mich verwundert an, als ich mit meiner Bücherkiste ankam.
»Willst du eine Bücherei aufmachen?«
Meine Großmutter, die sich über mein plötzlich erwachtes Interesse an Literatur freute, brachte ihn mit einem »Sch!« zum Schweigen. Praktisch veranlagt, wie sie war, riet sie mir allerdings, erst die Hausaufgaben zu machen, bevor ich mich in Verbrechen und Strafe vertiefte.
Tatsächlich las ich sämtliche Bücher, manchmal spät abends, wenn ich nach dem Basketballtraining und einem Sixpack Bier mit meinen Freunden nach Hause kam, manchmal samstagnachmittags, wenn ich nach einer Runde Bodysurfen in Gramps altem Ford Granada saß, ein Handtuch um die Hüften, damit die Polsterung nicht nass wurde. Sobald ich die erste Kiste mit Büchern durchhatte, klapperte ich auf der Suche nach neuem Lesestoff weitere Basare ab. Vieles verstand ich nicht auf Anhieb, und ich gewöhnte es mir an, unverständliche Wörter einzukringeln, um sie später im Wörterbuch nachzuschlagen. Mit der korrekten Aussprache nahm ich es nicht so genau – noch bis Mitte zwanzig konnte ich einige Wörter nicht aussprechen, deren Bedeutung mir wohlvertraut war. Nach einem bestimmten System oder Muster ging ich dabei nicht vor. Ich war eher wie ein junger Tüftler, der in der Garage seiner Eltern Kathodenstrahlröhren, lose Drähte und Schrauben zusammensucht und gar nicht weiß, was er damit anfangen soll, aber überzeugt ist, sie würden sich als nützlich erweisen, sobald sich ihm seine eigentliche Berufung offenbare.
Mein Interesse an Büchern erklärt vermutlich, warum ich nicht nur die Highschool überstand, sondern 1979 beim Eintritt ins Occidental College über ein zwar dünnes, aber einigermaßen passables Politikwissen verfügte und ein paar halb gare Ansichten entwickelt hatte, die ich bei nächtlichen Diskussionsrunden im Studentenwohnheim zum Besten gab.
Im Rückblick muss ich peinlicherweise feststellen, dass der Grad meiner intellektuellen Neugier in den ersten zwei Jahren auf dem College im Grunde nur mein Interesse an verschiedenen Frauen widerspiegelte: Marx und Marcuse, damit ich ein paar Sätze mit der langbeinigen Sozialistin aus meinem Wohnheim wechseln konnte; Fanon und Gwendolyn Brooks für die zarthäutige Soziologiestudentin, die mich dann keines weiteren Blickes würdigte; Foucault und Woolf für die ätherische, meist schwarz gekleidete Bisexuelle. Als Strategie zum Aufreißen von Mädchen erwies sich mein Pseudointellektualismus jedoch meist als nutzlos; ich musste mich mit einer Reihe herzlicher, aber keuscher Freundschaften begnügen.
Trotzdem führten meine sprunghaften Bemühungen zu einem Ergebnis: In meinem Kopf formte sich langsam eine Art Weltbild. Unterstützung erhielt ich dabei von einer Handvoll Professoren, die sich weder an meinen unbeständigen Lerngewohnheiten noch an meiner jugendlichen Überheblichkeit störten. Eine noch größere Hilfe waren ein paar ältere Kommilitonen – Schwarze aus den ärmeren Stadtvierteln, Weiße, die aus einer Kleinstadt stammten und sich bis zum College durchgebissen hatten, Latino-Kids der ersten Generation, internationale Studenten aus Pakistan, Indien oder einem afrikanischen Land, das ins Chaos abzugleiten drohte. Sie wussten, was ihnen wichtig war; wenn sie im Seminar etwas sagten, dann basierten ihre Ansichten auf Erfahrungen in echten Gemeinschaften und echten Kämpfen. Auf mein Viertel haben die Haushaltskürzungen enorme Auswirkungen. Bevor ihr euch über AffirmativeActionaufregt, erzähle ich euch erst mal was über meine Schule. Der erste Verfassungszusatz ist eine prima Sache, aber warum sagt dieUS-Regierung nie etwas zu den politischen Gefangenen in meinem Land?
Die beiden Jahre auf dem Occidental College markierten den Beginn meines politischen Erwachens. Das soll nicht heißen, dass ich damals an Politik glaubte. Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen machten die meisten Politiker auf mich einen eher halbseidenen Eindruck: die Föhnfrisuren, das schmierige Grinsen, die Plattitüden und das Eigenlob, wenn sie in einer Fernsehsendung saßen, während sie sich hinter verschlossener Tür bei großen Unternehmen und anderen betuchten Interessengruppen einzuschmeicheln versuchten. Für mich waren sie nur Selbstdarsteller in einem abgekarteten Spiel, und mit dieser Welt wollte ich nichts zu tun haben.
Was mich packte, war breiter wirksam und unkonventioneller – keine politischen Kampagnen, sondern soziale Bewegungen, bei denen sich Bürger zusammentaten, etwas zu verändern. Ich beschäftigte mich intensiv mit Frauenrechtlerinnen und frühen Arbeiterorganisationen, mit Gandhi und Lech Wałesa und dem African National Congress. Am meisten inspirierten mich die jungen Anführer und Anführerinnen der Bürgerrechtsbewegung – nicht nur Martin Luther King, auch John Lewis und Bob Moses, Fannie Lou Hamer und Diane Nash. In ihren heldenhaften Aktionen – sie waren von Tür zu Tür gegangen, um neue Wähler zu registrieren, hatten Sitzstreiks in Restaurants veranstaltet und waren zu Freiheitsliedern marschiert – sah ich eine Möglichkeit, die Werte, die mir meine Mutter mit auf den Weg gegeben hatte, praktisch umzusetzen. Sie zeigten mir, dass man sich politische Macht erkämpfen konnte, wenn man Menschen ermutigte, statt sie herunterzumachen. So sah für mich echte, aktive Demokratie aus: Sie war kein Geschenk von oben, keine Aufteilung der Beute zwischen Interessengruppen, sondern etwas, das man sich durch gemeinsame Arbeit selbst verdiente. Das Ergebnis war nicht nur ein Wandel der materiellen Verhältnisse, die Menschen und ihre Communitys erhielten auch ein Gefühl von Würde, und es entstand Zusammenhalt zwischen Menschen, die bis dahin wenig miteinander zu tun gehabt hatten.
Das, sagte ich mir, war ein Ideal, dem es nachzueifern lohnte. Nach dem zweiten Studienjahr schrieb ich mich an der Columbia University ein, um noch einmal neu anzufangen. In den drei Jahren in New York verkroch ich mich in eine Reihe schäbiger Wohnungen und führte, fern von alten Freunden und schlechten Angewohnheiten, das Leben eines Mönchs. Ich las, schrieb, führte Tagebuch, verzichtete auf Collegepartys und oft sogar auf eine warme Mahlzeit. Ich verlor mich in meinen Gedanken, beschäftigte mich mit Fragen, die immer neue aufzuwerfen schienen. Warum hatten einige Bewegungen Erfolg gehabt, während andere gescheitert waren? War es ein Zeichen für Erfolg, wenn einzelne Anliegen einer Bewegung von der etablierten Politik aufgegriffen wurden, oder nur ein Zeichen dafür, dass andere sie für sich vereinnahmt hatten? Wann war ein Kompromiss tragfähig, wann stellte er einen Ausverkauf dar, und woran ließ sich der Unterschied erkennen?
Wie ernst ich damals war, wie verbissen und humorlos! Wenn ich mir heute die alten Tagebucheinträge anschaue, empfinde ich große Sympathie für diesen jungen Mann, der sich so sehr danach sehnte, die Welt zu verändern und Teil einer großen, idealistischen Sache zu werden – obwohl es ganz so aussah, als gäbe es diese Sache gar nicht mehr. Denn dies war das Amerika der frühen Achtzigerjahre. Die sozialen Bewegungen der letzten Jahrzehnte hatten ihren Schwung verloren. Ein neuer Konservativismus war auf dem Vormarsch. Ronald Reagan war Präsident, die Wirtschaft steckte in einer Rezession, und der Kalte Krieg war auf dem Höhepunkt.
Wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich diesem jungen Mann dringend raten, die Bücher für einen Augenblick zur Seite zu legen, das Fenster zu öffnen und frische Luft hereinzulassen (damals rauchte ich wie ein Schlot). Ich würde ihn dazu ermutigen, eine Pause zu machen, sich mit Leuten zu treffen und all das zu genießen, was das Leben für Menschen in ihren Zwanzigern bereithält. Meine paar New Yorker Freunde gaben mir ähnliche Ratschläge.
»Du musst lockerer werden, Barack.«
»Du musst mal Sex haben.«
»Du bist so ein Idealist. Das ist toll, aber ich weiß nicht, ob das, was du sagst, überhaupt möglich ist.«
Ich hörte nicht auf sie, aus Angst, sie könnten womöglich recht haben. Denn was immer ich in diesen einsamen Stunden auch ausbrütete, welche Visionen für eine bessere Welt ich im Treibhaus meines jugendlichen Kopfes sprießen ließ – nichts davon hätte auch nur die Belastungsprobe einer freundschaftlichen Unterhaltung überstanden. Im grauen Winterlicht Manhattans, umgeben vom Zynismus jener Zeit, wirkten meine Ideen, laut ausgesprochen im Seminar oder beim Kaffee mit Freunden, auf andere fantastisch und weit hergeholt. Das war selbst mir klar. Und womöglich rettete mich diese Erkenntnis davor, noch vor meinem zweiundzwanzigsten Geburtstag zum kompletten Spinner zu verkommen. Im Prinzip wusste ich, wie absurd meine Vorstellungen waren und wie weit meine hehren Ziele und mein tatsächliches Leben auseinanderklafften. Ich war eine Art junger Walter Mitty, ein Don Quijote ohne Sancho Panza.
Auch das lässt sich aus den Tagebucheinträgen von damals herauslesen, die eine ziemlich genaue Chronik meiner Unzulänglichkeiten liefern. Statt aktiv zu werden, betrieb ich Nabelschau. Ich war zurückhaltend, wenn nicht sogar schüchtern, was womöglich von meiner Kindheit auf Hawaii und in Indonesien herrührte, vielleicht aber auch an einer tiefen Verunsicherung lag. An der Angst, zurückgewiesen zu werden oder dumm dazustehen. Vielleicht war es auch schlicht und ergreifend Trägheit.
Meine Schwächen versuchte ich mir mit einem strengen Programm zur Selbstoptimierung auszutreiben, das ich bis heute nicht ganz aufgegeben habe. (Michelle und die Mädchen ziehen mich gern damit auf, dass ich nicht einmal in einen Swimmingpool steigen oder ins Meer gehen kann, ohne Bahnen zu schwimmen. »Warum watest du nicht einfach?«, fragen sie mich dann lachend. »Das macht Spaß. Hier guck … so geht das.«) Ich erstellte To-do-Listen. Ich fing an, Sport zu treiben, joggte um das Reservoir im Central Park oder am Ufer des East River entlang und aß Dosenthunfisch und hart gekochte Eier für den nötigen Proteinschub. Und ich warf alles Überflüssige weg – wer braucht schon mehr als fünf Hemden?
Auf welchen großen Wettbewerb bereitete ich mich vor? Das wusste ich nicht, nur, dass ich noch nicht bereit dafür war. Meine Unsicherheit, meine Selbstzweifel hielten mich davon ab, mich vorschnell mit einfachen Antworten zufriedenzugeben. Ich gewöhnte es mir an, die eigene Meinung immer wieder zu hinterfragen. Letztlich kam mir das zugute, weil es mich davor bewahrte, für andere unausstehlich zu werden, und weil es mich gegen die revolutionären Phrasen impfte, auf die viele Linke zu Beginn der Ära Reagan zurückgriffen.
Das galt insbesondere für die Auseinandersetzung mit dem Thema Hautfarbe. Rassistische Beleidigungen hatte ich selbst oft hinnehmen müssen, und wenn ich durch Harlem oder bestimmte Teile der Bronx ging, nahm ich überall die Nachwirkungen der Sklaverei und der Jim-Crow-Gesetze wahr. Aufgrund meiner eigenen Biografie betrachtete ich mich allerdings nicht vorschnell als Opfer, und ich sträubte mich gegen die Denkweise einiger Schwarzer Bekannter, dass alle Weißen hoffnungslos rassistisch seien.
Meine Überzeugung, dass Rassismus nicht zwangsläufig ist, erklärt vielleicht auch, warum ich die Idee hinter Amerika jederzeit verteidigte: das, was dieses Land ausmachte, und das, was aus ihm werden konnte.
Meine Mutter und meine Großeltern sind keine lautstarken Patrioten gewesen. Den Treueschwur in der Schule aufsagen, am 4. Juli Fähnchen schwenken – das galt bei uns zu Hause als schönes Ritual, nicht als heilige Pflicht (ihre Einstellung zu Ostern und Weihnachten sah ähnlich aus). Sogar Gramps’ Einsatz im Zweiten Weltkrieg wurde heruntergespielt; er erzählte mir häufiger von den Verpflegungsrationen – »Widerlich!« – als von der Ehre, in Pattons Armee mitmarschiert zu sein.
Und doch waren der Stolz, Amerikaner zu sein, und der Gedanke, dass Amerika das beste Land der Welt sei, immer fest in uns allen verankert. Als junger Mann ärgerte ich mich über Bücher, die die Vorstellung von der Einzigartigkeit Amerikas als überholt abtaten, und stritt mich stundenlang mit Freunden, die darauf beharrten, dass die amerikanische Hegemonie die Wurzel weltweiter Unterdrückung sei. Ich hatte in einem anderen Land gelebt; ich wusste zu viel. Dass Amerika häufig nicht an seine Ideale heranreichte, gab ich gern zu. Die in der Schule unterrichtete Version der amerikanischen Geschichte, in der die Sklaverei beschönigt und die Massaker an den amerikanischen Ureinwohnern kaum erwähnt wurden – die habe ich niemals verteidigt. Die unüberlegte Ausübung militärischer Macht, die Habgier multinationaler Konzerne – jaja, das wusste ich auch alles.
Aber die Idee von Amerika, das Versprechen von Amerika: daran hielt ich mit einer Hartnäckigkeit fest, die mich selbst überraschte. »Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind« – das war mein Amerika. Das Amerika, über das Tocqueville geschrieben hatte; das Land von Whitman und Thoreau, in dem kein Mensch unter oder über dem anderen stand; das Amerika der Pioniere, die auf der Suche nach einem besseren Leben gen Westen zogen; das Amerika der Immigranten, die angetrieben von Freiheitssehnsucht auf Ellis Island landeten.
Es war das Amerika von Thomas Edison, von den Gebrüdern Wright, die Träumen Flügel verliehen, von Jackie Robinson, der die nächste Home Base eroberte. Von Chuck Berry und Bob Dylan, von Billie Holiday im Village Vanguard und Johnny Cash im Folsom State Prison – von all den Außenseitern, die sich das, was andere übersehen oder weggeworfen hatten, genommen und daraus etwas Schönes und Neuartiges geschaffen hatten.
Es war das Amerika von Lincoln in Gettysburg, von Jane Addams, die im Hull House in Chicago unermüdlich Nachbarschaftshilfe leistete, von erschöpften GIs in der Normandie, von Martin Luther King, der sich und anderen auf der National Mall Mut machte.
Es war die Verfassung der Vereinigten Staaten mit ihren zehn Zusatzartikeln, ersonnen von brillanten, wenn auch nicht unfehlbaren Denkern, die sich von Vernunft leiten ließen und ein politisches System erdachten, das so widerstands- wie wandlungsfähig ist.
Ein Amerika, das mich erklären konnte.
»Träum weiter, Barack«, so endete fast jedes Wortgefecht mit meinen Collegefreunden, während mir irgendein selbstgefälliger Idiot eine Zeitung vor die Füße warf, deren Schlagzeile die US-Invasion in Grenada, Kürzungen beim Schulessen oder irgendeine andere entmutigende Nachricht verkündete. »Sorry, aber das ist dein Amerika.«
So stand es also um mich, als ich 1983 den Abschluss an der Columbia machte: große Ideen, aber keine Vorstellung, wohin damit. Es gab keine Bewegung, keinen selbstlosen Anführer, denen ich mich hätte anschließen können. Das Einzige, was einigermaßen an meine Vorstellungen heranreichte, war das sogenannte »Community Organizing« – Stadtteilarbeit, Graswurzelarbeit, die Menschen an einen Tisch brachte, um lokale Probleme zu lösen. Nachdem ich mich in New York in einigen schlecht passenden Jobs versucht hatte, hörte ich von einer freien Stelle in Chicago: Es ging darum, mit Kirchen zusammenzuarbeiten, um Stabilität in Gemeinden zu bringen, die unter der Schließung der Stahlwerke litten. Nicht aufsehenerregend, aber immerhin ein Anfang.
Meine Jahre als Community Organizer in Chicago habe ich bereits in einem anderen Buch geschildert. In dem hauptsächlich von Schwarzen Arbeitern bewohnten Viertel, in dem ich tätig war, konnten wir nur kleine, flüchtige Siege erringen; meine Organisation war zu klein und hatte zu wenig Möglichkeiten, um es mit dem Wandel aufzunehmen, der Chicago und andere Städte des Landes erschütterte – der Niedergang des produzierenden Gewerbes, die Flucht der weißen Mittelschicht in die Vorstädte, die wachsende Ausgrenzung einer größer werdenden, nicht organisierten Unterschicht und die von Mitgliedern einer neuen Bildungsklasse vorangetriebene Gentrifizierung des städtischen Raums.
Doch so gering mein Einfluss in Chicago auch war, auf mein Leben wirkte sich die Stadt enorm aus.
Zunächst einmal sorgte sie dafür, dass ich meinen geistigen Käfig verließ. Statt nur Theorien aufzustellen, hörte ich den Leuten zu, um herauszufinden, was ihnen wichtig war. Ich musste Fremde bitten, sich mit mir und anderen zusammenzutun, um ganz praktische Arbeiten zu erledigen – einen Park aufräumen, Asbest aus Sozialwohnungskomplexen entfernen, ein Nachmittagsprogramm für Schulkinder auf den Weg bringen. Ich erlebte Niederlagen und lernte, mich zusammenzureißen, um für diejenigen einzutreten, die ihr Vertrauen in mich gesetzt hatten. Und ich kassierte so viele Abfuhren und Beleidigungen, dass ich irgendwann die Furcht vor ihnen verlor.
Anders gesagt: Ich wurde erwachsen – und fand meinen Sinn für Humor wieder.
Die Männer und Frauen, mit denen ich zusammenarbeitete, wuchsen mir schnell ans Herz: die alleinerziehende Mutter aus dem heruntergekommenen Wohnblock, die es irgendwie schaffte, ihren vier Kindern einen Collegeabschluss zu ermöglichen; der irische Priester, der die Türen seiner Kirche jeden Abend öffnete, damit die Kids aus seiner Gemeinde eine Alternative zu den Gangs hatten; der entlassene Stahlarbeiter, der wieder die Schulbank drückte, um sich zum Sozialarbeiter ausbilden zu lassen. Ihre Geschichten von Entbehrungen und ihre bescheidenen Siege bewiesen mir immer wieder aufs Neue, wie grundanständig die meisten Menschen sind. Dank ihnen erkannte ich, was Bürger bewirken können, wenn sie Politiker und Institutionen zur Verantwortung ziehen, und sei es nur, dass an einer verkehrsreichen Straßenkreuzung ein Stoppschild aufgestellt wird oder in einem Viertel mehr Polizeistreifen eingesetzt werden. Und mir entging nicht, dass die Menschen sich etwas gerader aufrichteten und sich selbst anders wahrnahmen, sobald ihnen klar wurde, dass ihre Stimmen Gewicht hatten.
Ihnen verdanke ich es, dass ich eine Antwort auf die Frage nach meiner ethnischen Identität fand. Denn es zeigte sich, dass es nicht nur einen Weg gab, Schwarz zu sein; entscheidender war, dass man versuchte, ein guter Mensch zu sein.
Dank ihnen entdeckte ich eine Gemeinschaft des Glaubens – man durfte zweifeln und bezweifeln und trotzdem nach etwas suchen, das über das Hier und Jetzt hinausging.
Und weil ich in den Kellerräumen der Kirchen und auf den Veranden der kleinen Häuser von denselben Werten – Ehrlichkeit, harte Arbeit und Empathie – hörte, die mir meine Mutter und meine Großeltern eingeimpft hatten, begann ich, daran zu glauben, dass es etwas gibt, das alle Menschen verbindet.
Manchmal frage ich mich, was aus mir geworden wäre, wenn ich bei irgendeiner Art von Stadtteilarbeit geblieben wäre. Wie viele der Lokalhelden, die ich im Lauf der Jahre kennengelernt habe, hätte vielleicht auch ich eine gemeinnützige Einrichtung aufgebaut, die hätte helfen können, ein Stadtviertel wieder in Schuss zu bringen. Fest verankert in einer Gemeinschaft, hätte ich mit Spendengeldern und der nötigen Vorstellungskraft vielleicht nicht die Welt verändert, aber doch immerhin diesen einen Ort oder diese eine Gruppe von Kids, und meine Arbeit hätte sich positiv auf das Leben von Nachbarn und Freunden ausgewirkt.
Aber ich bin nicht in Chicago geblieben. Ich schrieb mich an der Harvard Law School ein. Und an dieser Stelle wird die Geschichte für mich selbst ein wenig fragwürdig, denn meine Beweggründe lassen sich verschieden auslegen.
Aus meiner damaligen Sicht – und bis heute hat sich daran eigentlich nichts geändert – gab ich meinen Job als Community Organizer auf, weil mir die Arbeit als zu langsam und zu eingeschränkt in ihren Möglichkeiten erschien; sie eignete sich nicht, um die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, denen ich helfen wollte. Ein Berufsbildungszentrum konnte die Tausende von Arbeitsplätzen, die in der Stahlindustrie verloren gegangen waren, nicht ersetzen. Ein Nachmittagsangebot für Kinder konnte weder die chronische Unterfinanzierung der Schulen abfedern noch wettmachen, dass einige Kinder bei ihren Großeltern aufwuchsen, weil beide Elternteile eine Gefängnisstrafe verbüßten. Noch dazu stießen wir bei jedem Vorhaben auf irgendjemanden – einen Politiker, einen Bürokraten oder einen fernen Geschäftsführer –, der eigentlich die Macht besessen hätte, Dinge zu verbessern, aber nichts dergleichen tat. Und wenn uns doch einmal einer entgegenkam, dann reichten seine Zugeständnisse oft nicht aus oder kamen viel zu spät. Was wir brauchten, war die Macht, Gelder zu verteilen und politische Entscheidungen mitzugestalten, aber diese Macht lag in den Händen von anderen.
Mir wurde außerdem bewusst, dass es nur zwei Jahre vor meiner Ankunft in Chicago eine Bewegung des sozialen und politischen Wandels gegeben hatte – deren tiefgreifende Bedeutung ich aber leider nicht richtig gewürdigt hatte, weil sie nicht im Einklang mit meinen Theorien stand. Es war die Initiative, Harold Washington zum ersten Schwarzen Bürgermeister der Stadt zu wählen.
Die Bewegung war scheinbar aus dem Nichts entstanden und war der Inbegriff einer politischen Graswurzelkampagne. Eine kleine Gruppe Schwarzer Aktivisten und Geschäftsleute, die die chronische Voreingenommenheit und die Ungerechtigkeiten in der von Rassentrennung bis heute am stärksten betroffenen Großstadt Amerikas nicht länger hinnehmen wollte, hatte es geschafft, eine Rekordzahl von neuen Wählern zu registrieren, und einen rundlichen Kongressabgeordneten mit erstaunlicher Begabung, aber ohne großen Ehrgeiz ins Rennen um das Bürgermeisteramt geschickt.
Am Anfang glaubte niemand, dass er eine Chance habe, selbst Harold war skeptisch. Der Wahlkampf, der größtenteils von unerfahrenen Freiwilligen geführt wurde, setzte in erster Linie auf Mundpropaganda. Aber dann geschah das Unerwartete. Menschen, die sich nie mit Politik beschäftigt und zum Teil noch nie gewählt hatten, wurden vom Schwung der Bewegung erfasst. Plötzlich sah man sogar Rentner und Schüler mit dem blauen Wahlkampfbutton herumlaufen. Der kollektive Widerwille gegen die fortwährenden Diskriminierungen und Demütigungen – all die willkürlichen Verkehrskontrollen und die Secondhandschulbücher; all die Male, die Schwarze an einer Sporthalle im Park District auf der North Side vorbeigekommen waren und sich gefragt hatten, warum das Gebäude so viel besser in Schuss war als das in ihrem Viertel; all die Male, die Schwarze bei einer Beförderung übergangen worden waren oder von der Bank kein Darlehen erhalten hatten –, das alles zusammen entfachte nun einen Wirbelsturm, der die bisherige Stadtregierung kippte.
Bei meiner Ankunft in Chicago hatte Harold etwa die Hälfte seiner ersten Legislaturperiode hinter sich gebracht. Der Stadtrat, der jede Entscheidung des früheren Bürgermeisters Richard J. Daley quasi durchgewinkt hatte, hatte sich in der Hautfarbe entsprechende Lager aufgespalten, und die weiße Mehrheit blockierte sämtliche Reformen, die Harold seinen Wählern versprochen hatte. Er versuchte, die weißen Stadträte zu umschmeicheln und zu einem Kompromiss zu bewegen, aber sie ließen nicht mit sich reden. Die Auseinandersetzungen waren zwar ein fesselndes Spektakel, ließen Harold aber wenig Spielraum, um seine Wahlversprechen einzulösen. Am Ende war eine Neuziehung der bisher zuungunsten der Schwarzen Bevölkerung festgelegten Wahlbezirksgrenzen durch ein Bundesgericht nötig, ehe Harold die Mehrheit hinter sich bringen und die festgefahrene Situation überwinden konnte. Doch bevor es ihm schließlich gelang, die versprochenen Reformen umzusetzen, erlitt er einen Herzinfarkt und starb. Richard M. Daley, ein Spross der alten Clique, eroberte schließlich den Thron seines Vaters zurück.
Weit entfernt vom Zentrum des Geschehens, beobachtete ich die dramatischen Entwicklungen und versuchte, daraus meine Lehren zu ziehen. Ich sah, dass die gewaltige Energie der Bewegung ohne Struktur, Organisation und Regierungsgeschick bald verpuffte. Ich erkannte, dass eine politische Kampagne, die sich allein auf die Beseitigung von Diskriminierung stützte, egal, wie vernünftig sie war, nur Angst und Gegenreaktionen erzeugte und letztlich den Fortschritt behinderte. Und der rasche Zerfall von Harolds Koalition nach seinem Tod machte mich auf die Gefahr aufmerksam, die drohte, sobald Menschen sämtliche Hoffnungen auf Wandel auf die Schultern einer einzigen charismatischen Figur legten.
Und dennoch: In seiner fünfjährigen Amtszeit hatte Harold eine Menge bewirkt. Trotz aller Blockierungsversuche hatte sich Chicago unter seiner Regierung gewandelt. Städtische Dienstleistungen wie Schneebeseitigung oder Straßenbauarbeiten wurden gerechter auf die Bezirke verteilt. In den ärmeren Stadtteilen wurden neue Schulen gebaut. Die Vetternwirtschaft bei der Vergabe von Stellen in der öffentlichen Verwaltung wurde eingedämmt, und Unternehmen fingen endlich an, sich mit dem Mangel an Diversität unter ihren Führungskräften zu beschäftigen.
Doch vor allem hatte Harold den Menschen Hoffnung geschenkt. Wenn man die Schwarzen Bürger Chicagos während seiner Amtszeit über ihn reden hörte, fühlte man sich daran erinnert, wie eine Generation progressiver Weißer über Bobby Kennedy geredet hatte – es ging nicht so sehr darum, was er für die Menschen getan hatte, sondern um das Selbstwertgefühl, das er ihnen vermittelt hatte. Als wäre alles möglich. Als könnte man die Welt nach eigenen Vorstellungen neu gestalten.
Bei mir setzte das jedenfalls etwas in Gang. Zum ersten Mal keimte in mir der Wunsch auf, mich eines Tages für ein öffentliches Amt zu bewerben. (Ich war nicht der Einzige, der sich von Harold inspirieren ließ – kurz nach seiner Wahl zum Bürgermeister kündigte Jesse Jackson seine Kandidatur für das Präsidentenamt an.) Denn war die Energie der Bürgerrechtsbewegung nicht dorthin geflossen – in die konventionelle Politik? John Lewis, Andrew Young, Julian Bond – hatten sie nicht ebenfalls für ein öffentliches Amt kandidiert, weil sie zu der Überzeugung gelangt waren, so am meisten bewirken zu können? Die Stolpersteine kannte ich – man musste Kompromisse eingehen, ständig Spenden sammeln, seine Ideale im Blick behalten und unablässig auf den Sieg hinarbeiten.
Doch vielleicht gab es noch einen anderen Weg. Mit dem richtigen Ziel vor Augen ließ sich vielleicht eine ähnliche Energie entfachen, und zwar nicht nur in der Schwarzen Community, sondern über die Grenzen der Hautfarben hinweg. Vielleicht konnte man einige von Harolds Fehlern vermeiden, wenn man sich nur ausreichend vorbereitete und politisches Know-how und Führungsqualitäten mitbrachte. Vielleicht konnte man die Prinzipien des Community Organizing nicht nur auf einen Wahlkampf, sondern auf das Regieren selbst übertragen – Menschen, die sich bisher ausgeschlossen fühlten, dazu ermutigen, aktive Bürger zu werden, und ihnen beibringen, nicht nur den gewählten Politikern Vertrauen zu schenken, sondern auch sich selbst und einander zu vertrauen.
Das redete ich mir zumindest ein. Aber das war nicht die ganze Geschichte. Ich musste mir nämlich auch die Frage stellen, was ich selbst erreichen wollte. Durch die Tätigkeit als Community Organizer hatte ich zwar eine Menge gelernt, aber konkrete Ergebnisse konnte ich kaum vorweisen. Selbst meine Mutter, die immer aus der Reihe getanzt war, machte sich langsam Sorgen um mich.
»Ich weiß ja nicht, Bar«, sagte sie einmal an Weihnachten zu mir. »Du kannst natürlich dein Leben lang außerhalb der politischen Institutionen arbeiten. Aber womöglich erreichst du mehr, wenn du versuchst, sie von innen heraus zu verändern.
Und glaub mir«, fügte sie mit traurigem Lachen hinzu, »pleite sein wird überbewertet.«
Und so kam es, dass ich im Herbst 1988 mit meinen Ambitionen im Gepäck an eine Uni kam, wo man als Mensch mit Ambitionen kaum etwas Besonderes war. Jahrgangsbeste, Vorsitzende der studentischen Vertretung, klassische Philologen, Meister der Rededuelle – die Leute, die ich an der Harvard Law School kennenlernte, waren in der Regel beeindruckende junge Männer und Frauen, die im Gegensatz zu mir mit der begründeten Überzeugung aufgewachsen waren, für ein einflussreiches Leben bestimmt zu sein. Dass ich dort sehr gut zurechtkam, führte ich darauf zurück, dass ich ein paar Jahre älter war als meine Kommilitonen. Während vielen das enorme Arbeitspensum zu schaffen machte, kamen mir die Tage, die ich in der Bibliothek verbrachte – oder besser noch auf dem Sofa meiner kleinen Wohnung außerhalb des Campus, während im stumm gestellten Fernseher eine Sportübertragung lief –, wie der reinste Luxus vor, denn schließlich hatte ich zuvor drei Jahre lang Versammlungen organisiert oder bei klirrender Kälte Klinken geputzt.
Hinzu kam: Ich konnte mich im Jurastudium mit denselben staatsbürgerlichen Fragen befassen, die mich schon viele Jahre umgetrieben hatten. Welche Prinzipien sollten das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft lenken, und welche Verpflichtungen hatte jeder den anderen gegenüber? Inwieweit sollte der Staat die Märkte regulieren? Wodurch entsteht sozialer Wandel, und wie können Gesetze dafür sorgen, dass jeder eine Stimme hat?
Ich bekam nicht genug davon. Ich liebte die Wortgefechte, vor allem mit meinen wesentlich konservativeren Kommilitonen, die es trotz aller Meinungsverschiedenheiten offenbar zu schätzen wussten, dass ich ihre Argumente ernst nahm. Bei den Diskussionen im Seminar schoss meine Hand immer wieder nach oben und brachte mir das eine oder andere wohlverdiente Augenrollen ein. Aber ich konnte nicht anders; es kam mir vor, als hätte ich mich jahrelang mit einer merkwürdigen Obsession – Jonglieren oder Schwertschlucken etwa – allein zu Hause eingeschlossen gehabt und wäre nun plötzlich in einer Zirkusschule.
Leidenschaft macht eine Menge Schwächen wett, sage ich oft zu meinen Töchtern, und in Harvard traf das sicherlich auf mich zu. In meinem zweiten Jahr wurde ich zum ersten Schwarzen Chefredakteur der LawReview gewählt, was in der landesweiten Presse einen kleinen Wirbel auslöste. Ich unterschrieb bei einem Verlag einen Vertrag über ein Buch. Aus allen Teilen des Landes trafen Jobangebote bei mir ein, und es schien, als wäre mein Weg, wie schon der meiner Vorgänger bei der Law Review, bereits vorgezeichnet: Ich würde einem Richter des Supreme Court zuarbeiten, für eine Spitzenkanzlei oder das Büro eines United States Attorney tätig werden und, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen war und ich den Wunsch verspürte, mein Glück in der Politik versuchen.