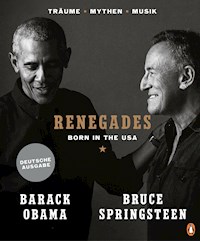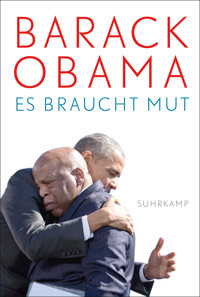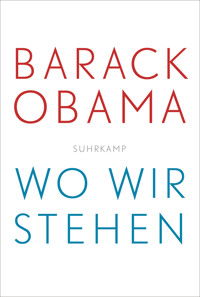9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Persönlich, glaubwürdig, visionär – Ansichten und Standpunkte des politischen Hoffnungsträgers der USA vor seiner Wahl 2008
Wie US-Senator Barack Obama im Wahljahr 2008 Millionen Menschen für sich gewann, ist Legende. Zu seinem schnell aufsteigenden Stern in hohem Maße beigetragen hat sein zuvor erschienenes Buch »Hoffnung wagen« (»
The Audacity of Hope«). Hier präsentierte Obama sich als Mann der Integration, als Liberaler im positiven Sinn mit klaren Positionen. Uns allen machte er Hoffnung auf eine Renaissance des »besseren Amerika«. Nicht wenige wünschen sich Barack Obama heute sehnsüchtig zurück ins Weiße Haus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Barack Obama
Hoffnung wagen
Gedanken zur Rückbesinnung aufden American Dream
Aus dem Englischenvon Helmut Dierlamm und Ursel Schäfer,VerlagsService Dr. Ulrich Mihr
Buch
Barack Obama schrieb dieses Buch, bevor er sich um das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten bewarb. Er gewinnt Anhänger mit elegantem Charme, ausgewogenem Denken und der Fähigkeit, Menschen unterschiedlicher Positionen zusammenzuführen – in jenem Respekt vor der Freiheit des Andersdenkenden, der die USA einmal groß gemacht hat. Wer sein Buch heute liest, erkennt die visionäre Kraft und die leidenschaftliche Überzeugung, mit der Barack Obama eine tief gespaltene Nation aufrütteln und für einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel begeistern konnte.
Autor
Barack Obama wurde 1961 in Honululu geboren. Sein Vater ist Kenianer, seine Mutter stammt aus Kansas. Er verbrachte seine Jugend in Indonesien und auf Hawaii, studierte dann in New York Politikwissenschaft und in Harvard Jura. Der Demokrat wurde zunächst Mitglied des Senats von Illinois und gewann 2004 als Vertreter seines Landes mit überwältigender Mehrheit den Sitz im Bundessenat.
Das britische Magazin »New Statesman« hatte ihn 2005 zu einem der »zehn Menschen, die die Welt verändern werden« gekürt. Am 4. November 2008 wurde Barack Obama zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Die Amtsgeschäfte übernahm er im Januar 2009. Noch im gleichen Jahr erhielt er den Friedensnobelpreis.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel »The Audacity of Hope« bei Crown Publishers, New York, USA.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2007 im Riemann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage Taschenbuchausgabe Oktober 2017 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Neumarkter Str. 28, 81673 München Copyright © 2006 der Originalausgabe by Barack Obama Copyright © 2007 der deutschsprachigen Ausgabe by Riemann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Redaktion: Ulrich Mihr Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München Umschlagfoto: Steffi Loos / getty images KF · Herstellung: kw
ISBN: 978-3-641-22424-0V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
www.randomhouse.de
Den Frauen, die mich aufzogen:
Meiner Großmutter mütterlicherseits, Tutu.Sie war mein ganzes Leben lang ein Fels,auf den ich bauen konnte.
Und meiner Mutter.Ihr liebender Geist trägt mich bis heute.
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
Es ist jetzt fast zehn Jahre her, dass ich zum ersten Mal für ein politisches Amt kandidierte. Ich war damals fünfunddreißig, hatte vier Jahre zuvor mein Jurastudium abgeschlossen, war frisch verheiratet und insgesamt ungeduldig, was mein Leben betraf. Ein Sitz im Senat von Illinois war frei geworden, und mehrere Freunde schlugen mir vor zu kandidieren, weil sie fanden, dass ich als Bürgerrechtsanwalt und dank meinen Kontakten aus meiner Zeit als Community Organizer1 ein geeigneter Kandidat sei. Ich besprach die Sache mit meiner Frau, und dann tat ich, was jeder tut, der zum ersten Mal für ein politisches Amt kandidiert: Ich sprach mit jedem, der mir zuhören wollte. Ich besuchte Nachbarschaftstreffen und kirchliche Veranstaltungen, Schönheitssalons und Friseure. Wenn ich zwei Leute an einer Ecke stehen sah, überquerte ich die Straße und überreichte ihnen Wahlkampfbroschüren. Und wo immer ich hinkam, bekam ich verschiedene Versionen derselben zwei Fragen zu hören.
»Wo haben Sie diesen komischen Namen her?«
Und: »Sie machen einen wirklich netten Eindruck. Warum wollen Sie sich in einem so schmutzigen und gemeinen Bereich wie der Politik engagieren?«
Mit der zweiten Frage war ich vertraut. Sie war nur eine Variante der Frage, die mir Jahre zuvor gestellt worden war, als ich in Chicago ankam und dort in Vierteln mit einkommensschwacher Bevölkerung arbeitete. Die Frage brachte eine zynische Haltung nicht nur gegenüber der Politik, sondern gegenüber dem bloßen Gedanken eines öffentlichen Engagements zum Ausdruck, eine Haltung, die sich (zumindest in den Vierteln der South Side, die ich zu vertreten versuchte) durch den generationenlangen Bruch von Versprechen verfestigt hatte. Normalerweise reagierte ich mit einem Lächeln auf die Frage, nickte und sagte, dass ich den Skeptizismus meines Gesprächspartners verstünde. Es gebe aber auch eine andere politische Tradition, und sie habe schon immer bestanden, von der Gründungszeit der Vereinigten Staaten bis zu den glorreichen Tagen der Bürgerrechtsbewegung, und diese Tradition beruhe auf dem einfachen Gedanken, dass wir gemeinsame Interessen mit unseren Mitmenschen hätten, dass uns mehr miteinander verbinde als trenne und dass wir, wenn genug Menschen an diese Idee glaubten und danach handelten, zwar nicht alle Probleme lösen, aber etwas Sinnvolles erreichen könnten.
Für mich war das ein ziemlich überzeugender kleiner Vortrag. Ich weiß zwar nicht sicher, ob die Leute, denen ich ihn hielt, davon ähnlich beeindruckt waren wie ich, aber viele von ihnen schätzten doch meine Ernsthaftigkeit und meinen jugendlichen Überschwang so sehr, dass ich in den Senat von Illinois gewählt wurde.
Sechs Jahre später, als ich beschloss, für den US-Senat zu kandidieren, war ich meiner Sache schon nicht mehr so sicher.
Allem Anschein nach hatte ich mit meiner Entscheidung für eine Karriere als Politiker Erfolg gehabt. Nach zwei Wahlperioden, in denen ich für die Minderheitsfraktion der Demokraten gearbeitet hatte, errang meine Partei im Senat von Illinois die Mehrheit. Danach bekam ich eine ganze Reihe von Gesetzen durch, angefangen bei einer Reform des Systems der Todesstrafe in Illinois bis zu einer Erweiterung des staatlichen Gesundheitsprogramms für Kinder. Ich behielt meine Stelle als Dozent an der juristischen Fakultät der University of Chicago, weil mir die Arbeit gefiel, und wurde häufig als Redner zu Veranstaltungen in der Stadt eingeladen. Auch bewahrte ich mir meine Unabhängigkeit, meinen guten Namen und meine Ehe, drei Dinge, die statistisch gesehen gefährdet waren, sobald ich den Fuß in die Landeshauptstadt setzte.
Doch die Jahre hatten auch ihren Tribut gefordert. Zum Teil lag es vermutlich einfach daran, dass ich älter wurde. Wenn man sich selbst gut beobachtet, lernt man jedes Jahr mehr über die eigenen Fehler – blinde Flecke in der Wahrnehmung, sich wiederholende Denkmuster, die genetisch oder von der Umwelt bedingt sein können, sich aber mit der Zeit fast unweigerlich verschlimmern, so sicher wie ein Hinken irgendwann zu Schmerzen in der Hüfte führt. Bei mir war einer dieser Fehler meine chronische Unrast; eine Unfähigkeit, selbst wenn alles gut lief, das Positive in meiner unmittelbaren Umgebung zu erkennen. Dieser Fehler ist, glaube ich, typisch für das moderne Leben (und ein Wesenszug der Amerikaner), und er tritt nirgends deutlicher zutage als in der Politik. Ob er tatsächlich durch die Politik verstärkt wird oder ob die Politik einfach Menschen anzieht, die diesen Wesenszug haben, ist eine offene Frage. Jemand sagte einmal, jeder Mann versuche in seinem Leben den Erwartungen seines Vaters gerecht zu werden oder die Fehler seines Vaters wiedergutzumachen, und ich glaube, das ist nicht die schlechteste Erklärung für meine Schwäche in dieser Hinsicht.
Jedenfalls war es eine Folge dieser Unrast, dass ich im Jahr 2000 gegen einen amtierenden demokratischen Kongressabgeordneten kandidierte. Die Entscheidung war unklug, und ich erlitt eine schwere Niederlage – die Art von Lektion, aus der man lernt, dass das Leben keineswegs so laufen muss, wie man es geplant hat. Eineinhalb Jahre später waren meine Wunden einigermaßen vernarbt, und ich aß mit einem Medienberater zu Mittag, der mich seit geraumer Zeit ermutigt hatte, für ein Bundesamt zu kandidieren. Zufällig fand das Essen Ende September 2001 statt.
»Ihnen ist bestimmt klar, dass sich die politische Dynamik verändert hat«, sagte der Medienberater, während er in seinem Salat herumstocherte.
»Wie meinen Sie das?«, fragte ich, obwohl ich genau wusste, was er meinte. Wir blickten beide auf die Zeitung, die neben ihm lag. Auf der Titelseite war ein Bild von Osama bin Laden.
»Teuflisch, nicht?«, sagte er. »Wirklich großes Pech. Sie können natürlich Ihren Namen nicht ändern. Die Wähler werden misstrauisch, wenn man so was tut. Wenn Sie erst am Beginn ihrer Karriere stünden, könnten Sie vielleicht einen Spitznamen benützen oder was in der Art. Aber jetzt …« Er brach ab, zuckte entschuldigend die Achseln und winkte dem Kellner, damit er uns die Rechnung brachte.
Ich vermutete, dass er Recht hatte, und der Verdacht nagte an mir. Zum ersten Mal in meiner politischen Laufbahn wurde ich neidisch, wenn jüngere Politiker Erfolg hatten, wo ich gescheitert war; wenn sie höhere Ämter bekamen und mehr erreichten als ich. Die Freuden der Politik, die Adrenalinstöße in der Debatte, die animalische Wärme beim Händeschütteln im Wahlkampf, das Bad in der Menge, begannen gegenüber der Bürde des Amtes zu verblassen: dem Betteln um Geld, den langen Heimfahrten, wenn ein Bankett zwei Stunden länger als geplant gedauert hatte, dem miesen Essen und der schlechten Luft und den kurzen Telefongesprächen mit einer Ehefrau, die bis jetzt zu mir gehalten hatte, nun aber die Kinder nicht mehr allein aufziehen wollte und mich fragte, ob ich die richtigen Prioritäten setze. Selbst die parlamentarische Arbeit, das politische Gestalten, das mich überhaupt erst zu einer Kandidatur motiviert hatte, erschien mir inzwischen zu ineffektiv, zu weit entfernt von den wirklichen Schlachten um Steuern, Sicherheit, Gesundheit oder Arbeitsplätze, die alle in Washington geschlagen wurden. Ich zweifelte allmählich daran, ob ich den richtigen Weg eingeschlagen hatte. Ich begann mich zu fühlen, wie sich vermutlich ein Schauspieler oder ein Sportler fühlt, der jahrelang vergeblich einem Traum nachgejagt ist. Er hat zwischen den Vorsprechterminen als Kellner gearbeitet oder in der Amateurliga hart erarbeitete Treffer erzielt und muss nun erkennen, dass er mit seiner Begabung und seinem Glück das Ende der Fahnenstange erreicht hat und sein Traum nicht in Erfüllung gehen wird. Nun kann er entweder wie ein Erwachsener den Tatsachen ins Auge sehen und sich eine vernünftigere Tätigkeit suchen, oder er stellt sich der Wahrheit nicht und endet als bitterer, streitsüchtiger und wohl auch bemitleidenswerter Mann.
Realitätsverweigerung, Wut, Verhandeln, Verzweiflung – ich weiß nicht, ob ich all diese von Fachleuten beschriebenen Stadien durchgemacht habe. An einem bestimmten Punkt jedoch gelangte ich zur Akzeptanz, zur Anerkennung meiner Grenzen und in gewisser Weise meiner Sterblichkeit. Ich fand einen neuen Schwerpunkt für meine Arbeit im Senat von Illinois und zog Befriedigung aus den Reformen und Initiativen, die ich in meiner Position anstoßen konnte. Ich verbrachte mehr Zeit zu Hause und erlebte mit, wie meine Töchter heranwuchsen. Ich pflegte die Beziehung zu meiner Frau und machte mir Gedanken über meine langfristigen finanziellen Verpflichtungen. Ich trieb Sport und las Romane und lernte, mich darüber zu freuen, dass sich die Erde um die Sonne dreht und die Jahreszeiten kommen und gehen, ohne dass ich mich dafür besonders anstrengen muss.
Es war, glaube ich, diese Akzeptanz, die es mir erlaubte, mich mit der wirklich verrückten Idee einer Kandidatur für den Senat der Vereinigten Staaten zu befassen. Als »Aufsteigen oder Aufhören« erklärte ich meine neue Strategie meiner Frau, als letzten Versuch, meine politischen Ideen zu verwirklichen, bevor ich mir eine ruhigere, stabilere und besser bezahlte Existenz suchte. Und meine Frau war (vielleicht mehr aus Mitleid denn aus Überzeugung) mit dieser letzten Kandidatur einverstanden, auch wenn sie sagte, dass ich nicht unbedingt mit ihrer Stimme rechnen solle, weil sie für unsere Familie ein ruhiges und gesichertes Leben vorziehen würde.
Ich tröstete sie damit, dass meine Chancen sehr schlecht waren. Der amtierende republikanische Senator Peter Fitzgerald hatte 19 Millionen Dollar aus seinem Privatvermögen ausgegeben, um seine Vorgängerin Carol Moseley Braun zu schlagen. Er war nicht sonderlich populär und schien nicht einmal großen Gefallen an der Politik zu finden, aber er hatte immer noch fast unbegrenzte Geldmittel zur Verfügung, und er besaß eine persönliche Integrität, die ihm bei den Wählern eine Art widerwilligen Respekt einbrachte.
Irgendwann tauchte Carol Moseley Braun wieder auf. Sie war Botschafterin in Neuseeland gewesen und trug sich mit dem Gedanken, ihren alten Sitz zurückzuerobern, was mich zum Verzicht auf meine Kandidatur veranlasst hätte. Als sie sich schließlich entschied, doch lieber für die Präsidentschaft zu kandidieren, war der Senatswahlkampf bereits in die heiße Phase getreten.
Fitzgerald gab bekannt, dass er auf eine erneute Kandidatur verzichtete, aber inzwischen hatte ich sechs Gegner in den Vorwahlen, darunter den amtierenden State Comptroller; einen Geschäftsmann mit Hunderten Millionen Dollar Privatvermögen; den früheren Stabschef des Chicagoer Bürgermeisters Richard Daley; und eine schwarze Gesundheitsfachfrau, durch deren Kandidatur die Reichen und Mächtigen die schwarze Wählerschaft spalten wollten, damit ich überhaupt keine Chance mehr hätte.
Es war mir egal. Angstfrei, weil ich ohnehin keine großen Erwartungen hatte, und mit gesteigerter Glaubwürdigkeit, weil mich ein paar wichtige Leute unterstützten, stürzte ich mich mit einer Energie und einer Freude in den Wahlkampf, die ich eigentlich für immer verloren geglaubt hatte. Ich engagierte vier Mitarbeiter, aufgeweckte junge Leute zwischen Ende zwanzig und Anfang dreißig, die einigermaßen bezahlbar waren, und wir fanden ein kleines Büro, in dem wir Telefone und mehrere Computer installierten. Vier bis fünf Stunden täglich rief ich wichtige demokratische Spender an oder wartete auf ihre Rückrufe. Ich veranstaltete Pressekonferenzen, zu denen niemand kam. Wir meldeten uns zum jährlichen Umzug am St. Patrick’s Day an und bekamen den allerletzten Platz im Zug, sodass meine zehn freiwilligen Helfer und ich nur ein paar Schritte vor den städtischen Müllwagen marschierten und den paar Nachzüglern zuwinkten, die noch am Straßenrand standen, als die Arbeiter den Müll zusammenkehrten und die grünen Aufkleber mit dem irischen Kleeblatt von den Laternenpfählen kratzten.
Die meiste Zeit jedoch fuhr ich, häufig allein, zunächst von Stadtbezirk zu Stadtbezirk, dann von County zu County und schließlich kreuz und quer im Staat herum, an endlosen Mais- und Bohnenfeldern, Bahnlinien und Silos vorbei. Es war keine effiziente Methode. Ohne Unterstützung durch den Apparat der Demokratischen Partei von Illinois und ohne eine ordentliche Mailingliste oder Kampagne im Internet, musste ich darauf bauen, dass Freunde oder Bekannte bei meinen Wahlveranstaltungen wildfremde Menschen in ihre Häuser ließen oder eine Veranstaltung in ihrer Kirche, ihrem Gewerkschaftshaus, bei ihrer Bridgegruppe oder in ihrem Rotary Club arrangierten. Manchmal fand ich nach zwei oder drei Stunden Fahrt nur zwei oder drei Leute vor, die an einem Küchentisch auf mich warteten. In solchen Fällen versicherte ich meinen Gastgebern, dass das Echo sonst besser sei, und bedankte mich für die Erfrischungen, die sie bereitgestellt hatten. Manchmal besuchte ich extra einen Gottesdienst, um danach eine Rede zu halten, aber der Pfarrer vergaß, mir das Wort zu erteilen. Oder der Chef eines gewerkschaftlichen Ortsverbands ließ mich vor den Gewerkschaftsmitgliedern sprechen, nur um dann zu verkünden, dass die Gewerkschaft einen anderen Kandidaten unterstützte.
Aber gleichgültig, ob ich zwei oder fünfzig Personen vor mir hatte, ob die Veranstaltung in einem der gut beschatteten, stattlichen Häuser am North Shore, in einer bescheidenen Mietwohnung in der West Side oder in einem Farmhaus am Stadtrand von Bloomington stattfand, und gleichgültig, ob die Leute freundlich, gleichgültig oder manchmal auch aggressiv ablehnend waren, ich gab mir immer alle Mühe, den Mund zu halten und zuzuhören, was sie zu sagen hatten. Ich hörte sie über ihre Arbeitsstelle oder ihr Geschäft reden oder über die örtliche Schule. Sie schimpften über Bush und über die Demokraten, erzählten von ihren Hunden, ihren Rückenschmerzen, ihrem Kriegsdienst und von Dingen, die sie noch aus ihrer Kindheit in Erinnerung hatten. Einige hatten ausgefeilte Theorien, um die Arbeitsplatzverluste in der Fabrikproduktion oder die hohen Kosten im Gesundheitsbereich zu erklären. Einige wiederholten, was sie bei dem rechtsgerichteten Radiomoderator Rush Limbaugh oder auf National Public Radio (NPR) gehört hatten. Aber die meisten von ihnen waren zu beschäftigt mit ihrer Arbeit oder ihren Kindern, als dass sie der Politik viel Aufmerksamkeit geschenkt hätten, und sie sprachen lieber von dem, was sie unmittelbar betraf: eine Fabrikschließung, eine Beförderung, eine hohe Heizölrechnung, ein Elternteil im Altersheim, der erste Schritt eines Kindes.
Ich gewann keine weltbewegenden Erkenntnisse aus den zahllosen Gesprächen in diesen Monaten. Wenn ich überhaupt etwas erfuhr, dann, was für Hoffnungen die einfachen Leute hatten, und dass sie vieles, was sie glaubten, offenbar unabhängig von ihrer Rasse, Region, Religion oder Klasse glaubten. Sie meinten, dass jeder Arbeitswillige eine Stelle finden sollte, mit der er seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Sie waren der Ansicht, dass Menschen nicht bankrottgehen durften, nur weil sie krank wurden. Sie fanden, dass jedes Kind eine wirklich gute Ausbildung erhalten (und nicht nur mit einem Haufen Geschwätz traktiert werden) sollte, und sie fanden, dass eine College-Ausbildung auch für die Kinder armer Eltern möglich sein sollte. Sie wollten wirksam vor Kriminellen und Terroristen geschützt werden. Sie wollten saubere Luft, sauberes Wasser und Zeit für ihre Kinder. Und im Alter wollten sie mit einer gewissen Würde in den Ruhestand gehen können.
Das war so ziemlich alles. Es war nicht viel. Und obwohl sie wussten, dass ihr Leben größtenteils von ihren eigenen Anstrengungen abhing, obwohl sie nicht damit rechneten, dass der Staat all ihre Probleme lösen würde, und obwohl sie ganz bestimmt nicht wollten, dass ihre Steuergelder verschwendet wurden, erwarteten sie doch staatliche Hilfe.
Ich sagte ihnen, dass sie Recht hätten. Der Staat könne nicht alle ihre Probleme lösen. Aber wenn wir die Prioritäten ein bisschen anders setzten, könnten wir dafür sorgen, dass jedes Kind in seinem Leben ordentliche Chancen bekomme, und wir könnten uns den Problemen stellen, die unser Land plagten. Meistens nickten die Leute zustimmend und fragten, was sie dafür tun könnten. Und wenn ich danach wieder im Auto saß (mit der Karte auf dem Beifahrersitz auf dem Weg zu meiner nächsten Station), wusste ich wieder einmal, warum ich in die Politik gegangen war.
Ich hatte Lust, härter zu arbeiten, als ich je in meinem Leben gearbeitet hatte.
Dieses Buch ist direkt aus den Gesprächen im Wahlkampf entstanden. Meine Begegnungen mit den Wählern bestätigten nicht nur meine Vermutung, dass das amerikanische Volk grundanständig ist, sondern riefen mir auch in Erinnerung, dass der Kern der amerikanischen Erfahrung aus einer Reihe von Idealen besteht, die bis heute unser kollektives Bewusstsein beschäftigen; ein gemeinsamer Satz von Werten, die uns trotz aller Unterschiede verbinden; ein roter Faden der Hoffnung, der dafür sorgt, dass unser unwahrscheinliches Experiment der Demokratie funktioniert. Diese Werte und Ideale finden nicht nur auf den Marmorplatten der Denkmäler und in Zitaten aus Geschichtsbüchern ihren Ausdruck. Sie sind bis heute in den Herzen und Köpfen der meisten Amerikaner lebendig, und sie können uns zu Stolz, Pflichtbewusstsein und Opferbereitschaft inspirieren.
Ich bin mir der Risiken solcher Sätze bewusst. In einer Ära der Globalisierung und des Schwindel erregenden technischen Wandels, halsabschneiderischer Politik und unaufhörlicher Kulturkriege verfügen wir anscheinend nicht einmal mehr über die gemeinsame Sprache, um überhaupt noch über unsere Ideale zu reden, ganz zu schweigen von den geeigneten Instrumenten, um wenigstens einen groben Konsens darüber herbeizuführen, wie wir bei der Verwirklichung dieser Ideale als Volk zusammenarbeiten könnten. Die meisten von uns durchschauen die Strategien der Werbefachleute, Meinungsforscher, Redenschreiber und so genannten Experten. Wir wissen, dass hochfliegende Worte zynisch missbraucht und die erhabensten Ideen durch Machtlüsternheit, Eigennutz, Gier oder Intoleranz befleckt werden können. In jedem normalen Schulgeschichtsbuch kann man lesen, wie weit sich das reale Leben in Amerika von den amerikanischen Mythen entfernt hat. In einem solchen Klima kann jede Berufung auf gemeinsame Ideale oder Werte hoffnungslos naiv oder gar ausgesprochen gefährlich erscheinen – als ein Versuch, ernsthafte Differenzen in Wort und Tat zu übertünchen, oder, schlimmer noch, als Versuch, die Klagen jener zum Verstummen zu bringen, die sich durch den gegenwärtige Zustand unserer Institutionen benachteiligt fühlen.
Mein Argument lautet jedoch, dass wir keine Wahl haben. Man muss keine Meinungsumfrage veranstalten, um zu wissen, dass die große Mehrheit der Amerikaner — Republikaner, Demokraten und Unabhängige — die tote Zone satthaben, zu der die Politik geworden ist. Eine Zone, in der kleine Gruppen um die Durchsetzung von Sonderinteressen ringen und ideologische Minderheiten dem ganzen Volk ihre Version der absoluten Wahrheit aufzwingen wollen. Unabhängig davon, ob wir aus einem roten (republikanischen) oder blauen (demokratischen) Staat stammen, haben wir das starke Gefühl, dass es unseren politischen Debatten an Ehrlichkeit, Genauigkeit und gesundem Menschenverstand fehlt, und wir haben einen Widerwillen gegen einen unaufhörlichen Strom von Entscheidungen, die uns falsch oder halbherzig vorkommen. Gleichgültig, ob wir religiös oder weltlich, schwarz, weiß oder braun sind, haben wir zu Recht das Gefühl, dass die wichtigsten Probleme unseres Landes überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden und dass wir ohne einen baldigen Kurswechsel nach sehr langer Zeit vielleicht die erste Generation sein werden, die ihren Nachkommen ein schwächeres und gespalteneres Amerika hinterlassen wird, als sie es geerbt hat. Mehr als zu jedem anderen Zeitpunkt unserer jüngeren Geschichte brauchen wir heute wahrscheinlich eine neue Politik, eine Politik, die die gemeinsamen Fundamente, die wir als Amerikaner haben, wieder ausgräbt und auf ihnen baut.
Es ist das Thema dieses Buches, wie wir den Prozess beginnen können, der unsere Politik und unser Leben als Staatsbürger verändern wird. Nicht dass ich genau wüsste, wie dieser Veränderungsprozess ins Werk zu setzen ist. Ich weiß es nicht. Zwar spreche ich in jedem Kapitel eine Anzahl unserer massivsten politischen Probleme an und skizziere in groben Strichen den Weg, dem wir meiner Ansicht nach folgen sollten, aber meine Art, die Themen zu behandeln, ist häufig parteiisch oder unvollständig. Weder habe ich eine einheitliche Theorie des amerikanischen Regierungssystems zu bieten, noch enthalten diese Seiten ein Manifest mit Handlungsanweisungen, komplett mit Schaubildern, Kurven, Terminen und Zehn-Punkte-Plänen.
Was ich anbiete, ist wesentlich bescheidener: persönliche Reflexionen über die Werte und Ideale, die mich motiviert haben, in die Politik zu gehen; ein paar Überlegungen, warum unser gegenwärtiger politischer Diskurs uns unnötig entzweit; und meine ehrliche, auf meine Erfahrungen als Senator und Rechtsanwalt, Ehemann und Vater, Christ und Skeptiker gestützte Einschätzung, wie wir unsere Politik auf die Idee des Gemeinwohls gründen können.
Lassen Sie mich genauer erläutern, wie das Buch gegliedert ist: In Kapitel eins wird eine Bilanz unserer jüngeren politischen Geschichte gezogen und versucht, einige der Ursachen für die heutige extreme Polarisierung zu erklären. In Kapitel zwei behandle ich die gemeinsamen Werte, die vielleicht als Grundlage für einen neuen politischen Konsens dienen könnten. In Kapitel drei wird die Verfassung nicht nur als Grundlage individueller Rechte, sondern auch als Mittel untersucht, um einen demokratischen Dialog über unsere gemeinsame Zukunft zu organisieren. In Kapitel vier versuche ich begreiflich zu machen, dass bestimmte institutionelle Kräfte (Geld, Medien, Interessenverbände, das Gesetzgebungsverfahren) selbst den engagiertesten Politiker lähmen können. In den restlichen fünf Kapiteln mache ich Vorschläge, wie wir unsere Differenzen überwinden und die Lösung konkreter Probleme wirksam in Angriff nehmen können: die wachsende wirtschaftliche Unsicherheit vieler amerikanischer Familien, die rassischen und religiösen Spannungen innerhalb der Gesellschaft und die transnationalen Bedrohungen — vom Terrorismus bis zur Pandemie –, die sich jenseits unserer Küsten zusammenbrauen.
Womöglich werden manche Leser finden, dass ich die Probleme nicht ausgewogen genug darstelle. Was diesen Vorwurf betrifft, bekenne ich mich schuldig. Ich bin schließlich Mitglied der Demokratischen Partei; meine Ansichten über die meisten Themen stimmen mehr mit den Kommentaren in der New York Times überein als mit denen im Wall Street Journal. Ich bin zornig über eine Politik, die die Reichen und Mächtigen ständig den Durchschnittsamerikanern vorzieht, und ich bestehe darauf, dass es eine wichtige Aufgabe des Staates ist, für allgemeine Chancengleichheit zu sorgen. Ich glaube an die Existenz der Evolution, an den Nutzen wissenschaftlicher Forschung und an die Existenz der Klimaerwärmung; ich glaube an die freie Rede, sei sie politisch korrekt oder inkorrekt, und ich werde misstrauisch, wenn der Staat irgendwelche religiösen Überzeugungen (auch meine eigenen) Nicht-Gläubigen aufzwingen will. Außerdem bin ich ein Gefangener meiner eigenen Biografie: Ich kann gar nicht anders, als die amerikanische Erfahrung mit den Augen eines schwarzen Mannes aus einer Mischehe zu sehen. Ich kann nicht vergessen, dass Generationen von Menschen, die aussahen wie ich, unterjocht und stigmatisiert wurden und dass die Rassen- und Klassenzugehörigkeit auch heute noch unser Leben auf subtile und weniger subtile Weise beeinflusst.
Aber das ist nicht alles, was mich ausmacht. Ich finde auch, dass meine Partei manchmal selbstgefällig, abgehoben und dogmatisch sein kann. Ich glaube an freie Marktwirtschaft, Wettbewerb und Unternehmertum, und ich bin der Ansicht, dass viele staatliche Programme nicht wie geplant funktionieren. Ich wollte, das Land besäße weniger Rechtsanwälte und mehr Ingenieure. Ich glaube, dass Amerika in der Welt häufiger Gutes als Schlechtes bewirkt hat. Ich mache mir kaum Illusionen über unsere Feinde und habe große Achtung vor dem Mut und der Kompetenz unserer Militärs. Ich bin gegen eine Politik, die allein auf Rassen- oder Geschlechteridentität, sexueller Orientierung oder überhaupt auf der Selbstdefinition als Opfer beruht. Ich glaube, dass viele der Probleme in den Innenstädten durch einen kulturellen Bruch verursacht sind, der sich nicht allein mit Geld heilen lässt, und dass unsere Werte und unser spirituelles Leben mindestens genauso wichtig sind wie unser Bruttoinlandsprodukt.
Zweifellos werde ich wegen einiger dieser Überzeugungen Schwierigkeiten bekommen. Ich bin neu genug in der nationalen politischen Szene, dass ich als leere Leinwand dienen kann, auf die Leute mit sehr verschiedenem politischem Hintergrund ihre diversen Ansichten projizieren. In dieser Eigenschaft werde ich zwangsläufig manche, und vielleicht sogar alle enttäuschen. Womit sich vielleicht ein zweites, persönlicheres Thema dieses Buches andeutet, nämlich wie ich (oder sonst jemand) in einem öffentlichen Amt den Fallen des Ruhms, der Eitelkeit, der Angst vor Niederlagen entgehen und mir dadurch den wahren Kern bewahren kann, jene innere Stimme, die jeden von uns an seine tiefsten Überzeugungen erinnert.
Kürzlich passte mich eine der Reporterinnen, die über den Capitol Hill berichten, auf dem Weg zu meinem Büro ab. Sie sagte, dass sie mein erstes Buch gern gelesen habe. Und dann meinte sie: »Ich frage mich, ob Sie in Ihrem nächsten Buch noch einmal genauso interessant sein können.« Was sie eigentlich sagen wollte, war: Ich frage mich, ob Sie auch als US-Senator noch so ehrlich sein können.
Das frage ich mich manchmal auch. Und ich hoffe, dass ich die Frage mit diesem Buch beantworten kann.
KAPITEL EINS
Republikaner und Demokraten
An den meisten Tagen betrete ich das Kapitol durch den Keller. Ich fahre mit einer kleinen U-Bahn vom Hart Building, wo ich mein Büro habe, durch einen Tunnel, der mit den Flaggen und Siegeln der 50 Staaten geschmückt ist. Der Zug kommt quietschend zum Stehen, und ich bahne mir meinen Weg durch ein Getümmel von Kongressangestellten, Wartungstechnikern und Gruppen von Touristen zu einer Wand mit altertümlichen Aufzügen, die mich in den zweiten Stock des Kapitols bringen. Wenn ich aus dem Aufzug komme, winke ich dem Schwarm von Reportern zu, der sich normalerweise dort versammelt, begrüße die Beamten der Capitol Police und betrete durch eine stattliche Doppeltür den Sitzungssaal des US-Senats.
Der Saal ist nicht der schönste Raum im Kapitol, aber er ist dennoch eindrucksvoll. Die dunkelbraunen Wände sind durch Paneele aus blauem Damast und Säulen aus feingeädertem Marmor gegliedert. Die Decke bildet ein cremeweißes Oval mit dem Wappen der USA, dem amerikanischen Adler, im Zentrum. Rund um die Zuschauergalerie stehen in feierlicher Ruhe die Büsten der ersten zwanzig Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten.
Unten sind auf flachen Stufen leicht ansteigend in vier hufeisenförmigen Reihen 100 Mahagoni-Pulte um die Front des Saales herum angeordnet. Einige Pulte stammen noch aus dem Jahr 1819; auf jedem befindet sich ein hübscher Behälter für Tintenfass und Federkiele. In die Schublade jedes Pultes haben alle Senatoren, die es je benutzt haben, ihren Namen eingekratzt oder hineingeschrieben: Taft und Long, Stennis und Kennedy … Manchmal, wenn ich dort im Sitzungssaal stehe, stelle ich mir vor, wie Paul Douglas oder Hubert Humphrey an ihrem Pult für die Bürgerrechtsgesetze eintreten; oder ich sehe ein paar Pulte weiter Joe McCarthy, wie er Listen von Personen durchgeht, die er der kommunistischen Verschwörung bezichtigen will; oder ich sehe Lyndon B. Johnson durch die Gänge wandern und Senatoren am Revers packen, damit sie richtig abstimmen. Manchmal gehe ich zu dem Pult hinüber, an dem Daniel Webster einst saß, und stelle mir vor, wie er sich vor dem amerikanischen Bürgerkrieg im vollbesetzten Haus und bei vollbesetzter Zuschauergalerie erhebt und mit blitzenden Augen und donnernder Stimme die Union gegen die Befürworter der Sezession verteidigt.
Aber diese Augenblicke verfliegen rasch. Außer in den paar Minuten, die eine Abstimmung dauert, verbringen meine Kollegen und ich kaum Zeit im Sitzungssaal. Die meisten Entscheidungen — darüber, welche Gesetze diskutiert und wann sie aufgerufen werden, wie mit Änderungsanträgen verfahren wird und wie man widerspenstige Senatoren zur Mitarbeit bewegt — werden vom Führer der Senatsmehrheit, von den zuständigen Ausschussvorsitzenden, von ihren Stäben und (je nachdem, wie umstritten ein Gesetz ist und wie großzügig die Republikaner den Gesetzesvorschlag handhaben) auch von den entsprechenden Vertretern der Demokraten getroffen. Wenn ein Gesetz im Sitzungssaal vorgelegt wird und der Protokollführer die Namen aufruft, haben alle Senatoren unter Berücksichtigung ihrer Mitarbeiter, ihres Fraktionsführers, ihres bevorzugten Lobbyisten, bestimmter Interessenverbände, der Briefe ihrer Wähler und ihrer jeweiligen ideologischen Präferenzen längst entschieden, welche Position sie zu dem Thema einnehmen.
Dies beschleunigt das Verfahren, was den Senatoren recht ist, da sie Zwölf oder Dreizehnstundentage haben und wieder in ihre Büros zurückkehren wollen, um Besucher aus ihren Wahlkreisen zu empfangen oder Anrufe zu beantworten. Manche treffen sich auch in einem nahe gelegenen Hotel mit Spendern oder geben ein Live-Interview in einem Fernsehstudio. Wer jedoch etwas länger im Saal bleibt, sieht vielleicht einen einsamen Senator noch an seinem Pult stehen, nachdem alle anderen gegangen sind. Er wartet auf die Erlaubnis, vor dem Senat eine Stellungnahme abzugeben. Es kann sich um die Erläuterung eines Gesetzes handeln, das er verabschieden lassen will, oder um einen ausführlicheren Kommentar zu einem ungelösten Problem. Vielleicht bebt die Stimme des Redners vor Leidenschaft; die Argumente, mit denen er sich gegen Kürzungen bei den Unterstützungsprogrammen für die Armen, gegen die Obstruktion des Senats bei Richterernennungen oder für mehr Unabhängigkeit im Energiesektor ausspricht, können sehr überzeugend sein. Doch er spricht in einem fast leeren Saal: Nur der präsidierende Senator, ein paar Referenten, der Protokollführer und das nimmermüde Auge von C-SPAN2 sind noch da. Der Sprecher kommt zum Ende. Ein blau uniformierter Saaldiener holt leise das Dokument für das offizielle Protokoll bei ihm ab. Während der eine Senator geht, betritt vielleicht eine Senatorin den Saal, geht an ihr Pult, bittet ums Wort und hält ihre Rede. Das Ritual wiederholt sich.
Im bedeutendsten Ratsgremium der Welt hört niemand zu.
Meine Erinnerung an den 4.Januar 2005, an dem ich zusammen mit einem Drittel der Senatoren als Mitglied des 109. Kongresses vereidigt wurde, ist angenehm verschwommen. Die Sonne schien, und die Luft war ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Aus Illinois, Hawaii, London und Kenia waren Verwandte und Freunde von mir gekommen. Sie drängten sich auf der Zuschauergalerie des Senats und spendeten Beifall, als meine Kollegen und ich neben dem marmornen Podium standen und die rechte Hand zum Amtseid hoben. Im alten Sitzungssaal des Senats traf ich danach meine Frau Michelle und unsere zwei Töchter für eine Wiederholung der Zeremonie und einen Fototermin mit Vizepräsident Cheney. (Meine sechsjährige Tochter Malia gab dem Vizepräsidenten höflich die Hand, während die dreijährige Sasha ihm grüßend zunickte und dann herumwirbelte und in die Kameras winkte.) Später sah ich zu, wie die Kinder die Treppe auf der Ostseite des Kapitols hinunterhüpften und ihre Kleidchen rot und pink vor dem majestätischen Hintergrund der weißen Säulen des Supreme Court flatterten. Michelle und ich nahmen die Kinder an der Hand, und zu viert gingen wir zur Library of Congress, wo wir von ein paar Hundert extra angereisten Gratulanten erwartet wurden. Die nächsten paar Stunden verbrachten wir mit Händeschütteln, Umarmungen, Fotografieren und Autogramme geben.
Ein Tag des Lächelns und des Dankes, der Etikette und des Pomps — so muss es den Besuchern im Kapitol erschienen sein. Aber obwohl ganz Washington sich an diesem Tag von seiner besten Seite zeigte und eine kollektive Pause machte, um sich des Fortbestands unserer Demokratie zu versichern, lag doch eine gewisse Spannung in der Luft, ein Gefühl, dass die gute Stimmung nicht lange halten würde. Als die Verwandten und Freunde nach Hause gegangen und die Empfänge zu Ende waren, hatte sich die Sonne schon wieder hinter graue Winterwolken verzogen, und eine finstere, scheinbar unabänderliche Tatsache hing wie ein Schatten über der Stadt: Das Land war gespalten und Washington ebenfalls, die Kluft war größer, als sie seit der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg jemals gewesen war.
Das Gefühl der Spaltung war sowohl durch die Präsidentschaftswahl als auch durch verschiedene statistische Erhebungen bestätigt worden. Die Amerikaner lagen über eine ganze Palette von Themen im Zwist: über den Irak, das Steuer-, Abtreibungs- und Waffenrecht, die Zehn Gebote, die Schwulen-Ehe, die Einwanderung, die Handels- und Bildungspolitik, die Umweltgesetzgebung, die Größe der Regierung und die Rolle der Gerichte. Und sie waren sich nicht nur uneinig, sondern lagen in erbittertem Streit, wobei bestimmte Angehörige beider Lager hemmungslos Gift verspritzten. Weder über das Ausmaß und das Wesen noch über die Gründe ihrer Differenzen konnten sie sich einigen. Alles war umstritten: die Ursachen des Klimawandels, die Tatsache des Klimawandels, die Höhe der Staatsverschuldung oder die Frage, wer für die Schulden verantwortlich war.
Für mich war nichts von alledem wirklich überraschend. Aus einiger Entfernung hatte ich verfolgt, wie die politischen Schlachten in Washington immer erbitterter wurden. Die Iran-Contra-Affäre und Ollie North, die Nominierung von Robert Bork, Willie Norton, Clarence Thomas3 und Anita Hill, die Wahl Bill Clintons und Newt Gingrichs Revolution, die Whitewater-Affäre um einen Immobiliendeal von Bill und Hillary Clinton und die Untersuchung von Starr gegen Clinton wegen Monica Lewinsky, die Blockierung der Staatsausgaben und das Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton, die ungenau gestanzten Lochkarten bei der Präsidentschaftswahl und das Verfahren Bush gegen Gore wegen des umstrittenen Wahlausgangs. Wie der Rest der Republik hatte auch ich beobachtet, dass sich die Wahlkampfkultur wie ein Krebsgeschwür in der Gesellschaft ausbreitete und eine – nachhaltige und durchaus profitable – Beleidigungsindustrie entstand und das Kabelfernsehen, das Talk Radio4 und die Bestsellerliste der New York Times beherrschte.
Auch in den acht Jahren als Senator in Illinois hatte ich eine Ahnung davon bekommen, wie das Spiel inzwischen gespielt wurde. Als ich 1997 in Springfield eintraf, hatte die republikanische Mehrheit im Senat von Illinois dieselbe Geschäftsordnung verabschiedet, mit der Newt Gingrich als Speaker das US-Repräsentantenhaus unter absoluter Kontrolle hielt. Die Demokraten mochten schreien und brüllen und schäumen vor Wut, aber sie hatten nicht die Möglichkeit, auch nur die kleinste Gesetzesänderung debattieren zu lassen, geschweige denn durchzusetzen, und sie mussten hilflos zusehen, wie die Republikaner große Steuervergünstigungen für die Reichen verabschiedeten, die Arbeiterschaft benachteiligten oder die Sozialleistungen zusammenstrichen. Mit der Zeit wurde die demokratische Fraktion von einem tiefen Zorn erfasst, und meine Kollegen merkten sich sorgfältig jede Kränkung und jeden Machtmissbrauch durch die GOP (Grand Old Party). Sechs Jahre später errangen die Demokraten die Mehrheit, und nun erging es den Republikanern nicht besser. Einige Veteranen erinnerten sich wehmütig an eine Zeit, als Republikaner und Demokraten abends noch zusammen gespeist und bei Steaks und Zigarren Kompromisse ausgehandelt hatten. Aber selbst bei diesen alten Kämpen verblassten solche Erinnerungen schnell, wenn die Wahlhelfer der anderen Seite sie zum ersten Mal aufs Korn nahmen und ihre Wahlbezirke mit Postwurfsendungen überschwemmten, die ihnen Straftaten, Korruption, Inkompetenz und sittliche Verkommenheit vorwarfen.
Ich will nicht behaupten, dass ich bei alledem nur ein passiver Zuschauer wäre. Ich verstehe Politik als eine Kontaktsportart, bei der man Ellenbogenstöße und auch mal einen unverhofften Schlag wegstecken muss. Aber da ich eine unumstrittene demokratische Hochburg als Wahlkreis hatte, blieben mir die schlimmsten republikanischen Rufmordkampagnen erspart. Gelegentlich verfasste ich sogar zusammen mit ausgesprochen konservativen Kollegen Gesetzesvorschläge, und manchmal wurde uns bei einem Pokerspiel oder einem Bier bewusst, dass wir mehr gemeinsam hatten, als wir öffentlich zugeben wollten. Das erklärt vielleicht, warum ich während all der Jahre in Springfield an der Idee festhielt, dass Politik anders sein kann und die Wähler sie anders wollen; dass sie die Tatsachenverdrehungen, die Beschimpfungen und die Patentlösungen für komplizierte Probleme satthatten; dass ihr intuitives Gefühl für Fairness und ihr gesunder Menschenverstand sich durchsetzen würden, wenn ich es nur schaffte, sie direkt anzusprechen, ihnen die Probleme zu erklären, wie ich sie sah, und ihnen die möglichen Alternativen ehrlich vor Augen zu führen. Wenn genug Politiker dieses Risiko eingehen würden, könnte sich meiner Ansicht nach nicht nur das politische Klima in den Vereinigten Staaten, sondern auch die Politik selbst verbessern.
Mit dieser Einstellung begann ich 2004 meinen Wahlkampf um einen Sitz im US-Senat. Solange die Kampagne dauerte, sagte ich möglichst, was ich dachte, versuchte sauber zu argumentieren und mich auf Inhalte zu konzentrieren. Als ich die demokratische Vorwahl und dann die allgemeine Wahl jeweils mit einem ordentlichen Vorsprung gewann, war ich versucht zu glauben, dass sich meine Hoffnung, dass eine andere Politik möglich sei, erfüllt hatte.
Es gab nur ein Problem: Mein Wahlkampf war so gut verlaufen, dass es nach einem Glückstreffer aussah. Politische Beobachter wiesen darauf hin, dass von den sieben Kandidaten bei den Vorwahlen der Demokratischen Partei kein einziger einen negativen Spot im Fernsehen gebracht hatte. Der reichste Kandidat von allen, ein ehemaliger Wertpapierhändler mit einem Vermögen von mindestens 300 Millionen Dollar, gab 28 Millionen Dollar aus, und zwar größtenteils für eine Vielzahl positiver Fernsehspots, scheiterte aber in den letzten Wochen des Wahlkampfs, weil belastende Unterlagen aus seinem Scheidungsverfahren an die Öffentlichkeit kamen. Mein republikanischer Gegenkandidat, ein gut aussehender, wohlhabender früherer Teilhaber der Investmentbank Goldman Sachs, der inzwischen Lehrer an einer Innenstadtschule geworden war, kritisierte von Anfang an scharf meine Vergangenheit, aber noch bevor sein Wahlkampf richtig auf Touren gekommen war, wurde auch er durch einen Scheidungsskandal schachmatt gesetzt. Fast einen Monat lang reiste ich in Illinois herum, ohne scharf angegriffen zu werden. Dann hielt ich die Grundsatzrede auf dem Parteitag der Demokraten: 17 Minuten ungekürzte, ununterbrochene Sendezeit im US-weiten Fernsehen. Und schließlich wählte die Republikanische Partei von Illinois unerklärlicherweise den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Alan Keyes zu meinem neuen Gegner, einen Mann, der nie in Illinois gelebt hatte und sich politisch so hart und unnachgiebig gab, dass selbst konservative Republikaner Angst vor ihm bekamen.
Später erklärten mich einige Journalisten zum größten Glückspilz unter den Kandidaten in allen 50 Staaten. Privat waren einige von meinen Mitarbeitern wegen solcher Äußerungen empört, denn sie meinten, unsere harte Arbeit und die Attraktivität unserer Wahlaussagen sei nicht angemessen berücksichtigt worden. Trotzdem war unbestreitbar, dass ich geradezu unheimliches Glück gehabt hatte. Ich war ein Ausreißer, eine Laune der Natur, und für politische Insider bewies mein Sieg überhaupt nichts.
Kein Wunder, dass ich mich bei meiner Ankunft in Washington im Januar 2005 wie ein frischgebackener Profispieler fühlte, der auf sein erstes Spiel brennt, in seinem makellosen Dress aber erst nach dem Spiel eintrifft, als seine schlammbespritzten Mannschaftskameraden in der Kabine schon ihre Wunden lecken. Während ich mit Fototerminen und Interviews beschäftigt gewesen war und großartige Ideen über die Notwendigkeit von weniger Parteilichkeit und Streit vertreten hatte, waren die Demokraten auf der ganzen Linie geschlagen worden — bei der Wahl des Präsidenten, bei den Wahlen zum Senat und bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus. Meine neuen Kollegen von der Demokratischen Partei hätten mich nicht herzlicher empfangen können, für sie war mein Sieg einer von ganz wenigen Lichtblicken. Aber wenn wir uns in den Sitzungspausen in den Gängen des Kapitols trafen, nahmen sie mich beiseite und erinnerten mich daran, wie die typischen Wahlkämpfe für den Senat inzwischen aussahen.
Sie berichteten mir, wie der demokratische Fraktionschef Tom Daschle in South Dakota gescheitert war, weil man ihn mit negativer Wahlwerbung im Wert von Millionen Dollar bekämpft hatte: ganzseitige Zeitungsanzeigen und Fernsehspots, in denen seinen Nachbarn täglich mitgeteilt wurde, er habe für Kindsmord und Männer in Hochzeitskleidern gestimmt. Manche warfen ihm sogar vor, er habe seine erste Frau schlecht behandelt, obwohl sie eigens nach South Dakota gereist war, um für seine Wiederwahl zu werben. Wir sprachen auch über Max Cleland, den früheren demokratischen Senator aus Georgia, einen dreifach amputierten Kriegsveteranen, der in der vorherigen Wahlperiode seinen Sitz verlor, weil man ihm mangelnden Patriotismus vorwarf und ihm unterstellte, er helfe und begünstige Osama bin Laden.
Und dann gab es da noch die kleine Geschichte von den Swift Boat Veterans for Truth. Diese »Schnellbootveteranen für die Wahrheit« hatten mit schockierender Effizienz durch ein paar gut platzierte Anzeigen und das Echo in den konservativen Medien John Kerry, einen hochdekorierten Helden des Vietnamkriegs, in einen schlappen Beschwichtigungspolitiker verwandelt.
Zweifellos gab es auch Republikaner, die sich ungerecht behandelt fühlten. Und vielleicht war es richtig, was in den Zeitungskommentaren stand, die in der ersten Sitzungswoche erschienen; vielleicht war es wirklich an der Zeit, dass beide Parteien sich abregten, ihre Wahlkampfmunition verstauten und sich daranmachten, wenigstens ein oder zwei Jahre lang das Land zu regieren. Vielleicht wäre das möglich gewesen, wenn nicht schon wieder Wahlen vor der Tür gestanden wären und der Irakkrieg nicht mehr getobt hätte oder wenn die Interessenverbände, viele »Experten« und Vertreter der Medien nicht davon profitiert hätten, dass sie das Klima aufheizten. Vielleicht wäre unter einer anderen Regierung auch der Frieden ausgebrochen, einer Regierung, die sich weniger entschlossen einem permanenten Wahlkampf gewidmet hätte, einem Weißen Haus, das einen Sieg von 51 zu 48 Prozent als Aufforderung zur Demut und Kompromissbereitschaft und nicht als unbestreitbares Mandat interpretiert hätte.
Aber welche Bedingungen für eine solche Entspannung auch immer nötig gewesen wären, sie waren 2005 keinesfalls gegeben. Es gab keine Konzessionen und keine Geste des guten Willens. Zwei Tage nach der Wahl trat Präsident Bush vor die Kameras und verkündete, er habe überschüssiges politisches Kapital und gedenke, es zu nutzen. Am selben Tag sagte der konservative Aktivist Grover Norquist, der nicht die Zurückhaltung eines hohen Amtsträgers üben musste, im Hinblick auf die Lage der Demokraten, dass »einem jeder Bauer sagen kann, dass bestimmte Tiere herumrennen und lästig sind, aber ganz friedlich und zahm werden, sobald man sie fest angebunden hat«. Zwei Tage nach meiner Vereidigung stellte die Abgeordnete Stephanie Tubbs Jones aus Cleveland im Repräsentantenhaus wegen der zahlreichen Unregelmäßigkeiten, die es bei den Wahlen in Ohio gegeben hatte, den Wahlausgang in diesem Staat in Frage. Bekannte und unbekannte Republikaner machten finstere Gesichter (»schlechte Verlierer«, hörte ich einige murmeln), aber der Sprecher des Repräsentantenhauses Dennis Hastert und der Mehrheitsführer Tom DeLay blieben mit unbewegten Gesichtern auf dem Podium sitzen; sie fühlten sich völlig sicher, weil sie sowohl die Mehrheit als auch den Vorsitz hatten. Die Senatorin Barbara Boxer aus Kalifornien unterstützte Tubbs Antrag, und als wir in den Sitzungssaal des Senats zurückkehrten, stimmte ich in meiner ersten Abstimmung zusammen mit 73 von 74 Senatoren, die an diesem Tag abstimmten, für eine zweite Amtszeit von George W. Bush als Präsident der Vereinigten Staaten.
Danach bekam ich erstmals eine Menge kritischer Telefonanrufe und Briefe. Ich rief ein paar von meinen verärgerten demokratischen Anhängern zurück und versicherte ihnen, dass ich ebenfalls mit den Problemen in Ohio vertraut sei und ebenfalls eine Untersuchung für richtig hielte, aber dennoch glaube, dass George Bush die Wahl gewonnen habe. Außerdem war es nötig, ihnen zu versichern, dass ich mich nicht schon nach zwei Amtstagen verkauft hatte oder bestochen worden war. In derselben Woche begegnete ich dem in Ruhestand gehenden Senator Zell Miller, einem schlanken und scharfsichtigen Demokraten aus Georgia. Er saß im Vorstand der National Rifle Association (NRA), hatte sich mit der Demokratischen Partei zerstritten, George Bush unterstützt und jene flammende Grundsatzrede auf dem Parteitag der Republikaner gehalten – eine hemmungslose Tirade gegen die Treulosigkeit von John Kerry und seine angeblich windelweiche Haltung zu Fragen der nationalen Sicherheit. Wir hatten einen kurzen Wortwechsel voller versteckter Ironie – der ältere Südstaatler auf dem Rückzug und der junge schwarze Nordstaatler auf dem Vormarsch, ein Unterschied, auf den die Presse in den Berichten über unsere beiden Grundsatzreden hingewiesen hatte. Senator Miller war sehr höflich und wünschte mir viel Glück in meinem neuen Amt. Später stieß ich auf einen Auszug aus seinem Buch A Deficit of Decency, in dem er meine Rede auf dem Parteitag als eine der besten bezeichnete, die er je gehört hatte, bevor er (mit einem süffisanten Lächeln, wie ich mir vorstelle) notierte, dass sie kaum geeignet gewesen sei, eine Wahl zu gewinnen.
Mit anderen Worten: Mein Mann hatte verloren. Zell Millers Mann hatte gewonnen. Das war die harte, kalte politische Realität. Alles andere war reine Sentimentalität.
Meine Frau kann Ihnen sagen, dass ich kein Mensch bin, der leicht aus der Ruhe zu bringen ist. Wenn ich Ann Coulter oder Sean Hannity auf dem Bildschirm hetzen sehe, fällt es mir schwer, sie ernst zu nehmen. Ich nehme an, dass sie nur so reden, weil sie mehr Bücher verkaufen oder ihre Quote steigern wollen, auch wenn ich mich frage, wer seine kostbaren Abende mit solchen Miesmachern vergeudet. Wenn mir demokratische Parteigenossen bei Veranstaltungen versichern, dass wir in der schlimmsten aller politischen Zeiten leben und uns ein schleichender Faschismus langsam die Luft abschnürt, gebe ich mitunter zu bedenken, dass die Internierung der Amerikaner japanischer Abstammung unter Franklin Delano Roosevelt, die Alien und Sedition Acts (Fremden- und Aufruhrgesetze) unter John Adams oder 100 Jahre Lynchjustiz unter mehr als zwei Dutzend Regierungen vielleicht doch noch schlimmer gewesen sind und wir vielleicht alle einmal tief Luft holen sollten. Wenn ich auf Dinnerpartys gefragt werde, wie ich unter den gegebenen politischen Bedingungen, bei all den negativen Wahlkämpfen und persönlichen Angriffen, überhaupt arbeiten kann, erwähne ich vielleicht Nelson Mandela oder Alexander Solschenizyn oder einen Mann, der in irgendeinem chinesischen oder ägyptischen Gefängnis sitzt. Wenn man nur beschimpft wird, statt im Gefängnis zu landen, ist das eigentlich gar nicht so schlimm.
Trotzdem bin auch ich zutiefst beunruhigt. Und wie die meisten Amerikaner kann ich mich des Gefühls kaum erwehren, dass mit unserer Demokratie etwas ernsthaft schiefläuft.
Es ist nicht nur die Kluft zwischen der Realität und den Idealen, zu denen sich unsere Nation bekennt, die uns jeden Tag vor Augen geführt wird. In der einen oder anderen Form hat es diese Kluft seit der Gründung der Vereinigten Staaten immer gegeben. Kriege wurden geführt, Gesetze verabschiedet, Systeme reformiert, Gewerkschaften gegründet und Demonstrationen veranstaltet, um Ideal und Wirklichkeit näher zusammenzubringen.
Nein, was mir wirklich Sorgen macht, ist die Kluft zwischen dem Ausmaß unserer Probleme und den kläglichen Resultaten unserer Politik, die Leichtigkeit, mit der wir uns vom Unbedeutenden und Trivialen ablenken lassen, unsere chronische Vermeidung schwerer Entscheidungen, unsere offenkundige Unfähigkeit, einen belastbaren Konsens zur Lösung auch nur eines der großen Probleme zu finden.
Wir wissen, dass wir aufgrund des globalen Wettbewerbs (und erst recht, wenn wir uns den Werten der Chancengleichheit und der sozialen Mobilität verpflichtet fühlen) unser Bildungssystem von Grund auf reformieren, unsere Lehrerschaft vergrößern, die Ausbildung in Mathematik und den Naturwissenschaften energisch verbessern und den Analphabetismus bei den Kindern der Innenstädte mit aller Macht bekämpfen müssten. Doch unsere Bildungsdebatte stagniert fruchtlos zwischen Extrempositionen: Die einen wollen das öffentliche Schulsystem ganz auflösen, und die anderen verteidigen einen unhaltbaren Status quo; die einen behaupten, dass im Bildungswesen durch Geld nichts bewirkt werden könne, und die anderen fordern mehr Geld für Bildung, ohne den Nachweis über den konkreten Nutzen zu erbringen.
Wir wissen, dass unser Gesundheitssystem mangelhaft ist: unglaublich teuer, schrecklich ineffizient und schlecht angepasst an eine Volkswirtschaft, die nicht mehr auf lebenslangen Beschäftigungsverhältnissen aufbaut – ein System, durch das hart arbeitende Amerikaner chronischer Unsicherheit ausgesetzt und von äußerster Armut bedroht sind. Trotzdem herrscht aus ideologischen Gründen und wegen politischer Winkelzüge seit Jahren Untätigkeit, mit der einen Ausnahme, dass im Jahr 2003 ein neues Gesetz über rezeptpflichtige Medikamente verabschiedet wurde, bei dem es irgendwie gelang, die schlimmsten Auswüchse des privaten und des öffentlichen Sektors zu kombinieren: Preistreiberei und bürokratische Verwirrung, Lücken in der Bedarfsdeckung und haarsträubende Kosten für den Steuerzahler.
Wir wissen, dass der Kampf gegen den internationalen Terrorismus nicht nur ein bewaffneter Kampf, sondern auch ein Wettbewerb der Ideen ist, dass unsere langfristige Sicherheit sowohl von einem klugen Einsatz unserer Militärmacht als auch von verstärkter Zusammenarbeit mit anderen Ländern abhängt und dass eine weltweite Armutsbekämpfung und die Sanierung gescheiterter Staaten nicht nur aus humanitären Gründen notwendig ist, sondern auch in unserem nationalen Interesse liegt. Wer jedoch unsere außenpolitischen Debatten verfolgt, der gewinnt überwiegend den Eindruck, dass wir nur eine Alternative haben: Kriegführung oder Isolationismus.
Wir betrachten den Glauben als eine Quelle von Trost und Verständnis für unsere Mitmenschen, müssen aber feststellen, dass durch unsere Glaubensäußerungen Zwietracht entsteht; wir halten uns für ein tolerantes Volk, obwohl wir allerorten mit rassischen, religiösen und kulturellen Spannungen konfrontiert sind. Und statt dass die Politiker nach Lösungen für diese Probleme suchen oder in den Konflikten vermitteln, heizen sie die Konflikte an, beuten sie aus und entzweien uns dadurch noch mehr.
Im persönlichen Gespräch wird diese Diskrepanz zwischen der Politik, die wir haben, und der Politik, die wir brauchen, von den politischen Entscheidungsträgern durchaus eingestanden. Natürlich sind die Demokraten gar nicht glücklich mit der bestehenden Lage, da sie zumindest gegenwärtig auf der Verliererseite stehen, besiegt von Republikanern, die durch Wahlen, bei denen der Sieger alles bekommt, alle Instanzen der Regierung kontrollieren und Kompromisse nicht für nötig halten. Nachdenkliche Republikaner sind vielleicht trotzdem nicht zu übermütig. Denn die Demokraten sind zwar unterlegen, aber die Republikaner haben mit Versprechungen gewonnen, die häufig realitätsfern waren (Steuersenkungen ohne Abbau staatlicher Leistungen, Privatisierung der Sozialversicherung ohne Änderung der Leistungen, Krieg ohne Opfer) und ihnen das Regieren nun massiv erschweren.
Trotzdem ist in der Öffentlichkeit kaum etwas davon zu spüren, dass in den feindlichen Lagern so etwas wie Selbstkritik eingesetzt hätte und man wenigstens einen kleinen Teil der eigenen Verantwortung für den Stillstand erkennen würde. Was wir stattdessen nicht nur im Wahlkampf, sondern auch in den Leitartikeln, in den Buchregalen oder in dem sich ständig erweiternden Universum der Blogs im Internet beobachten können, sind die Zurückweisung von Kritik und das Verteilen von Schuldzuweisungen. Je nach Geschmack ist unsere Misere die natürliche Folge von radikalem Konservatismus oder extremem Linksliberalismus, von Tom DeLay oder Nancy Pelosi, von Big Oil oder gierigen Anwälten in Schadenersatzprozessen, von religiösen Fanatikern oder Aktivisten der Schwulenbewegung, von Fox News oder der New York Times. Wie gut diese Geschichten jeweils erzählt werden, wie scharfsinnig ihre Argumente sind und wie sauber ihre Beweisführung ist, hängt von den Autoren ab. Ich will hier nicht verhehlen, dass ich eine Vorliebe für die Geschichten der Demokraten habe und die Argumente der Linksliberalen meiner Ansicht nach häufiger auf Vernunft und Tatsachen beruhen. In destillierter Form jedoch sind die Erklärungen der Rechten wie der Linken Spiegelbild der jeweils anderen geworden. Beide Seiten kolportieren Verschwörungstheorien, denen zufolge Amerika von einer bösen Clique erobert worden sein soll. Wie alle guten Verschwörungstheorien enthalten die Geschichten beider Seiten gerade genug Wahrheit, um gutgläubige Anhänger zu überzeugen, und verschweigen alle Widersprüche, die Zweifel an ihrer Grundaussage wecken könnten. Sie sollen nicht die andere Seite eines Besseren belehren, sondern die eigene Basis in ihrer Haltung bestärken und bei der Stange halten. Darüber hinaus sollen so viele Gegner zum Überlaufen verlockt werden, dass die Gegenseite zur Unterwerfung gezwungen werden könnte.
Natürlich gibt es noch eine andere Geschichte. Sie wird von den Millionen Amerikanern erzählt, die ein ganz normales Leben führen. Sie haben einen Arbeitsplatz oder suchen Arbeit, gründen Unternehmen oder helfen ihren Kindern bei den Hausaufgaben. Sie haben mit hohen Gasrechnungen oder mit ihrer unzureichenden Krankenversicherung zu kämpfen, oder sie müssen damit leben, dass ihnen von irgendeinem Insolvenzgericht der Zugriff auf ihre Altersversorgung genommen wurde. Sie blicken manchmal hoffnungsvoll und manchmal ängstlich in die Zukunft. Ihr Leben ist voller Widersprüche und Mehrdeutigkeiten. Und weil die Politik so selten zur Sprache bringt, was sie durchmachen (und weil sie begriffen haben, dass Politik heutzutage ein Geschäft ist und keine Berufung und dass, was als Debatte durchgeht, heute nicht viel mehr als ein billiges Spektakel ist), gehen sie in die innere Emigration, weg von dem Geschrei und Gezänk und dem endlosen Geschwätz.
Eine Regierung, die diese Amerikaner wirklich repräsentieren und ihnen ernsthaft dienen soll, muss eine andere Politik machen. Diese Politik muss sich damit beschäftigen, wie in unserem Land wirklich gelebt wird. Sie ist kein Fertigprodukt, das man nur aus dem Regal zu nehmen braucht. Sie muss sich auf unsere besten Traditionen gründen und darf auch die dunklen Aspekte unserer Vergangenheit nicht verdrängen. Wir müssen verstehen, wie genau wir in die heutige Misere geraten und zu einem von Hass und Stammesfehden zerrissenen Land geworden sind. Und wir müssen uns trotz aller Differenzen daran erinnern, wie viel wir gemeinsam haben: gemeinsame Hoffnungen, gemeinsame Träume, ein Band, das nicht reißen wird.
Nach meiner Ankunft in Washington fiel mir alsbald der relativ herzliche Umgang auf, den die älteren Mitglieder des Senats miteinander pflegten: die unerschütterliche Höflichkeit, von der jede Interaktion zwischen John Warner und Robert Byrd geprägt war, oder die echte Freundschaft zwischen dem Republikaner Ted Stevens und dem Demokraten Daniel Inouye. Es wird allgemein behauptet, dass diese Männer einer aussterbenden Spezies angehörten, einer Spezies, die nicht nur den Senat liebe, sondern auch für eine weniger an der Parteizugehörigkeit orientierte Politik stehe. Und tatsächlich gehört es zu den wenigen Dingen, auf die sich konservative und linksliberale Kommentatoren einigen können, dass es in Washington eine Zeit vor dem Sündenfall gegeben haben soll, ein goldenes Zeitalter, in dem unabhängig davon, welche Partei gerade an der Macht war, ein höflicher Umgang gepflegt wurde und die Regierung funktionierte.
Eines Abends kam ich auf einem Empfang mit einem alten Washingtoner Hasen ins Gespräch, der fast 50 Jahre im Kapitol und darum herum gedient hatte. Ich fragte ihn, warum sich die Atmosphäre im Vergleich zu früher geändert habe.
»Es liegt an der neuen Generation«, sagte er ohne zu zögern. »Früher hatten fast alle, die in Washington irgendwelche Macht besaßen, im Zweiten Weltkrieg gedient. Auch wir stritten manchmal wie Hund und Katze miteinander. Wir hatten sehr unterschiedliche Werdegänge, kamen aus unterschiedlichen Vierteln, vertraten unterschiedliche politische Philosophien. Aber durch den Krieg hatten wir alle etwas gemeinsam. Aus dieser gemeinsamen Erfahrung erwuchsen ein gewisses Vertrauen und eine gewisse Achtung. Das half uns, Differenzen zu überwinden und etwas zu erreichen.«
Als der alte Mann seine Erinnerungen an Dwight Eisenhower und Sam Rayburn, Dean Acheson und Everett Dirksen zum Besten gab, wäre ich der Faszination des leicht verschwommenen Porträts fast erlegen, das er von einer Zeit zeichnete, in der es noch keine 24-stündigen Nachrichtenzyklen und noch keine permanente Spendenkampagne gab und in der ernsthafte Männer ernsthafte Arbeit geleistet hatten. Ich musste mir bewusst ins Gedächtnis rufen, dass der Grund für seine Begeisterung für diese Ära wohl sein selektives Gedächtnis war. Aus seinem Bild waren die Senatoren aus den Südstaaten gelöscht, die im Senat die Bürgerrechtsgesetzgebung angegriffen hatten; auch die üble Hexenjagd des McCarthyismus, die bittere Armut, auf die Robert Kennedy vor seinem Tod hingewiesen hatte, und das Fehlen von Frauen und Minderheiten an den Schalthebeln der Macht kamen in seiner verklärten Vergangenheit nicht vor.
Mir wurde außerdem bewusst, dass der Konsens der führenden Politiker jener Zeit, den mein Gesprächspartner mitgetragen hatte, einer Reihe einzigartiger Umstände zu verdanken war: nicht nur den gemeinsamen Erfahrungen der Abgeordneten im Zweiten Weltkrieg, sondern auch der fast völligen Einigkeit, die durch den Kalten Krieg und die Bedrohung durch die Sowjetunion entstanden war. Vielleicht war die konkurrenzlose Dominanz der amerikanischen Volkswirtschaft in den fünfziger und sechziger Jahren noch wichtiger, weil Europa und Japan die Trümmer des Krieges wegräumen mussten.
Trotzdem lässt sich nicht bestreiten, dass die amerikanische Politik in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg viel weniger ideologisch geprägt war und die Parteizugehörigkeit eine viel weniger scharf umrissene Bedeutung hatte als heute. Die Koalition von Demokraten, die den Kongress den größten Teil dieser Zeit kontrollierte, war ein Amalgam aus linksliberalen Nordstaatlern wie Hubert Humphrey, aus konservativen Südstaatlern wie James Eastland und aus loyalen Parteifunktionären, die sich in den Parteiapparaten der Großstädte hochgedient hatten. Zusammengehalten wurde sie durch den ökonomischen Populismus des New Deal — einer Vision von fairen Löhnen und Sozialleistungen, staatlicher Fürsorge und Staatsbetrieben und einem kontinuierlich steigenden Lebensstandard. In jener Zeit herrschte in der Partei eine Philosophie der falschen Toleranz, die in der Duldung oder gar aktiven Förderung der Rassenunterdrückung in den Südstaaten ihren Ausdruck fand; eine Philosophie, die von einer Kultur geprägt war, in der soziale Normen, etwa im sexuellen Bereich oder in Bezug auf die Rolle der Frau, praktisch nicht in Frage gestellt wurden; eine Kultur, die noch nicht über das Vokabular verfügte, um Unbehagen über diese Zustände zu artikulieren oder sie zum Gegenstand einer politischen Debatte zu machen.
In den ganzen fünfziger und frühen sechziger Jahren tolerierte auch die GOP alle Arten ideologischer Gegensätze, etwa zwischen dem Weststaaten-Liberalismus eines Barry Goldwater und dem Oststaaten-Paternalismus eines Nelson Rockefeller; zwischen denen, die unter Berufung auf Republikaner wie Abraham Lincoln und Teddy Roosevelt für eine aktive Rolle des Staates eintraten, und denen, die sich auf den Konservatismus von Edmund Burke beriefen, der als Traditionalist soziale Experimente ablehnte. Die Überwindung dieser regionalen und charakterlichen Gegensätze bezüglich der Bürgerrechte, des Ausmaßes staatlicher Regulierung und sogar bezüglich des Steuerrechts war alles andere als problemlos. Aber genau wie die Demokraten wurde auch die GOP vor allem durch wirtschaftliche Interessen zusammengehalten, durch eine Philosophie der freien Marktwirtschaft und der steuerlichen Zurückhaltung, die all ihre Wähler teilten, vom Ladenbesitzer an der Main Street bis zum Industriemanager und Countryclub-Mitglied. (Die Republikaner mögen in den fünfziger Jahren auch eine schärfere Form des Antikommunismus favorisiert haben als die Demokraten, aber wie nicht zuletzt John F. Kennedy bewies, waren die Demokraten jederzeit bereit, die Republikaner auf diesem Gebiet herauszufordern und zu überbieten, wann immer ein Wahltag näher rückte.)
Erst in den sechziger Jahren wurden diese politischen Bündnisse aus heute gut dokumentierten Gründen gesprengt. Zuerst entstand die Bürgerrechtsbewegung, die schon in ihren ersten glücklichen Tagen die bestehende Sozialstruktur radikal in Frage stellte und die Amerikaner zwang, Partei zu ergreifen. Präsident Johnson entschied sich letztlich für die richtige Seite, aber als Südstaatler verstand er besser als die meisten, was mit dieser Entscheidung verbunden war. Nachdem er 1964 den Civil Rights Act unterzeichnet hatte, sagte er zu seinem Berater Bill Moyers, er habe gerade mit einem einzigen Federstrich den Süden auf absehbare Zeit der GOP ausgeliefert.
Dann kamen die Studentenproteste gegen den Vietnamkrieg und die Erkenntnis, dass Amerika nicht immer Recht hatte, dass es nicht immer richtig handelte und dass die neue Generation nicht jeden Preis zahlen und jede Last tragen würde, die ihr die Alten auferlegen wollten.
Als schließlich die Mauern des Status quo fielen, strömten alle Arten von »Außenseitern« durch die Breschen: Feministinnen, Latinos, Hippies, Black Panthers, allein erziehende Mütter, die Sozialhilfe bezogen, Schwule, und sie alle bestanden auf ihren Rechten, sie alle verlangten einen Platz am Tisch und ein Stück vom Kuchen.
Es sollte mehrere Jahre dauern, bis sich die Anstrengungen dieser Bewegungen auszahlten. Dass Nixon auf den Süden setzte, dass er das gerichtlich angeordnete Verfrachten von Schulkindern mit Bussen in andere Stadtbezirke, um das rassische Ungleichgewicht an den Schulen auszugleichen, kritisierte und an die schweigende Mehrheit appellierte, zahlte sich an den Wahlurnen sofort aus. Doch seine Regierungsphilosophie verfestigte sich nie zu einer radikalen Ideologie. Es war Nixon, der die ersten nationalen Affirmative-Action-Programme initiierte (Quotenregelungen für Frauen und Behinderte oder Erleichtern des Zuganges zu Universitäten für Afroamerikaner) und die Gesetze zur Gründung der Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) und der Bundesbehörde für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Occupational Safety and Health Administration) unterzeichnete. Jimmy Carter bewies, dass die Unterstützung der Bürgerrechtsbewegung auch mit dem Programm des eher konservativen Flügels der Demokraten zu vereinbaren war. Zwar wechselten damals einige Demokraten aus den Südstaaten zu den Republikanern, aber die meisten Kongressabgeordneten aus den Südstaaten, die in der Demokratischen Partei blieben, wurden aufgrund ihres Amtsbonus wieder gewählt, sodass die Demokraten zumindest im Repräsentantenhaus die Mehrheit behielten.
Doch ein politisches Erdbeben hatte stattgefunden: Politik war nicht mehr nur eine Sache des Geldbeutels, sondern auch ein moralisches Anliegen. Sie wurde moralischen Imperativen und moralischen Absoluta unterworfen. Und sie wurde entschieden persönlich, das heißt, sie wurde für jeden zwischenmenschlichen Kontakt, sei es zwischen schwarz und weiß oder zwischen Männern und Frauen relevant und kam bei jeder Bejahung oder Ablehnung von Autorität zum Ausdruck.
Entsprechend waren Linksliberalismus und Konservatismus in den Augen der Öffentlichkeit künftig nicht mehr durch die Klassenzugehörigkeit, sondern durch die Haltung gekennzeichnet, die man zur traditionellen Kultur und zur Gegenkultur hatte. Es kam nicht mehr nur darauf an, wie man über das Streikrecht oder die Besteuerung der Großkonzerne dachte, sondern auch darauf, welche Einstellung man zu Sexualität, Drogen und Rock and Roll, zur lateinischen Messe oder zu Blooms Canon5