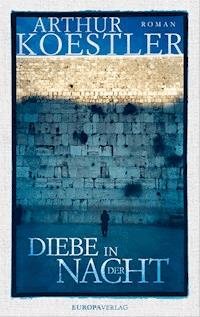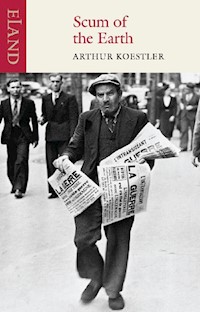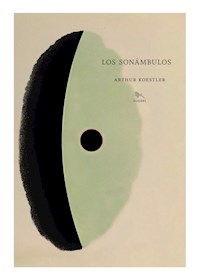Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In "Ein Gott der keiner war" beschreiben sechs Intellektuelle ihre "Bekehrung" zum Kommunismus und ihre Gründe für die spätere Abkehr. Das Bindeglied zwischen den sechs äußerst verschiedenen Persönlichkeiten - drei Schriftstellern und drei Journalisten - ist, daß sie alle den Kommunismus erwählten, weil sie bereit waren, "bourgeoise Freiheiten" zu opfern, um den Faschismus zu bekämpfen, und weil sie - insbesondere nach den Moskauer Prozessen und dem Hitler-Stalin-Pakt - ohne Einbindung in den Apparat ihre Enttäuschung artikulieren und individuelle Konsequenzen ziehen konnten. Die autobiographischen Essays, intern gegliedert nach "Die Aktivisten" (Arthur Koestler, Ignazio Silone, Richard Wright) und "Gläubige Jünger" (André Gide, Louis Fischer und Stephen Spender), erschienen 1950 in einer Hochphase des Kalten Krieges und wurden in erster Linie als Zeugnisse des Anti-Kommunismus gelesen, einem Verdikt, das die meisten Autoren überwiegend bis heute aus dem linken intellektuellen Diskurs eliminierte. Es ist erstaunlich, wie schmerzlos im Vergleich zu diesen Autoren 1989 an den meisten westlichen Intellektuellen vorbeigegangen ist. Nehmt und lest! "Das Seil war gerissen, aber darunter gab es eben noch ein Sicherheitsnetz, in dem ich nun eine sehr gemischte Gesellschaft vorfand - alte Partei-Akrobaten, die ihr dialektisches Gleichgewicht verloren hatten, Trotzkisten, Veteranen der Rechts- und Links-Opposition, abgehängte Mitläufer und andere mehr ... Dieser Schwebezustand dauerte für mich bis zu dem Tag, an dem zu Ehren Ribbentrops die Hakenkreuzfahne auf dem Moskauer Flugplatz gehißt wurde und die Kapelle der Roten Armee das Horst-Wessel-Lied anstimmte. Damit war es Schluß: von nun an war es mir wirklich egal, ob mich die neuen Verbündeten Hitlers einen Konterrevolutionär schimpften." (Arthur Koestler)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Gott, der keiner war
Arthur Koestler
Ignazio Silone
Andre Gide
Louis Fischer
Richard Wright
Stephen Spender,
schildern ihren Weg zum Kommunismus und ihre Abkehr
Mit einer Einführung
von Prof. Wolfgang Leonhard
und einem Vorwort
von Richard Crossman
Titel der Originalausgabe: The God that Failed Einzig berechtigte Übertragung aus dem Englischen Erstveröffentlichung Europa Verlag AG Zürich, 1950
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
dieser Ausgabe Europa Verlag AG Zürich, 2005
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Übersetzung, Vervielfältigung (auch fotomechanisch) und Verbreitung, der elektronischen Speicherung auf Datenträgern oder in Datenbanken, der körperlichen und unkörperlichen Wiedergabe (auch am Bildschirm, auch auf dem Weg der Datenübertragung) vorbehalten.
www.europa-verlag.ch
Umschlaggestaltung: Bayerl & Ost
E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
Leck ISBN 3-85665-514-X
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Wolfgang Leonhard
Zur Einführung
Ein Gott, der keiner war hat einen außerordentlich großen Eindruck auf mich gemacht. Ich las, nein, verschlang das Buch kurz nach seinem Erscheinen Ende 1950, unmittelbar nachdem ich nach anderthalb Jahren Jugoslawien in den Westen Deutschlands gekommen war: Die Anthologie gehörte – nach George Orwells 1984 – zu den ersten Büchern, die ich in meinem neuen Leben im Westen las.
Nach meinem Bruch mit dem Stalinismus berührten mich die Schilderungen der sechs Autoren natürlich sehr. Ich suchte damals nach einer eigenen Alternative und durchdachte kritisch viele Dinge, die mir vorher als selbstverständlich richtig erschienen waren. Da für meine Abkehr vom Sowjet-Kommunismus der Bruch Jugoslawiens mit Moskau im Sommer 1948 und die ersten Schritte Titos auf einem neuen Weg zum Sozialismus entscheidend gewesen waren, glaubte ich allerdings zunächst, mich in einer völlig anderen Situation zu befinden als die Autoren. Nach der Lektüre von Ein Gott, der keiner war erkannte ich aber, daß die grundsätzlichen Probleme gleich oder zumindest sehr ähnlich geblieben waren. Auch bei diesen Autoren verdichteten sich die kritischen Gedanken zu oppositionellen Ansichten. Auslöser waren zwar andere historische Ereignisse: die feindselige Kampagne der Kommunisten gegen die Sozialdemokratie während der Weimarer Republik, die den Widerstand gegen den drohenden Nationalsozialismus schwächte, die Niederlage nach Hitlers Machtantritt 1933, die verspätete und teilweise inkonsequente Volksfrontpolitik, die bedenkliche Entwicklung der Sowjetunion, vor allem die Schauprozesse und Massenverhaftungen während der Großen Säuberung von 1936-38 und schließlich das Entsetzen nach dem Hitler-Stalin-Pakt vom 23. August 1939. Ihre Schilderungen zeigten sehr eindringlich, daß es vor meinem eigenen Bruch bereits ähnliche Situationen und Probleme gegeben hatte, sie bestätigten, ergänzten und beeinflußten außerordentlich eindrucksvoll Erlebnisse, die ich nun in einen größeren Zusammenhang einordnen konnte.
Auch ich hatte immer wieder auf eine entscheidende Wendung der sowjetischen Politik gehofft und war enttäuscht worden. Von 1948 bis etwa Mitte der 50er Jahre setzte ich zunächst auf Jugoslawien, das aus dem Teufelskreis des Stalinismus herausbrach. Im März 1953 starb Stalin, doch die Ulbricht-Führung würgte die Entstalinisierung in der DDR brutal ab. Der Volksaufstand im Juni 1953 in der DDR, Chruschtschows Abrechnung mit Stalin auf dem 20. Sowjetischen Parteitag im Februar 1956 und die anschließende ungarische Revolution im Herbst 1956 – immer wieder gab es Hoffnung, immer wie – der Enttäuschung. Zeitversetzt machte ich ähnliche Erfahrungen wie Koestler, Gide oder Silone.
Als Ein Gott, der keiner war 1950 erschien, kannte ich noch keinen der Autoren persönlich, hatte aber einige ihrer Schriften gelesen. Am frühesten lernte ich Ignazio Silone (1900-1978) durch sein Buch Fontamara kennen, das ich 1935 als 14jähriger in Schweden las. Ein Jahr später – ich lebte seit dem Sommer 1935 bereits in der Sowjetunion – las ich anläßlich seines zunächst hochpropagierten Besuches in der Sowjetunion fast täglich über André Gide (1869-1951). Als er unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Paris sein kritisches Buch veröffentlichte, erlebte ich in Moskau die hemmungslose Beschimpfungskampagne, ohne mir natürlich ein Bild davon machen zu können, was Gide eigentlich geschrieben hatte. Mit Arthur Koestlers (1905-1983) Werken kam ich erstmals 1947 – damals als höherer Funktionär der SED – in Berührung. Ich wohnte in dieser Zeit mit Waldemar Schmidt zusammen, der damals Erster Sekretär der Bezirksleitung Berlin der SED war. Ich las Koestlers Sonnenfinsternis (Darkness at noon) in unserer gemeinsamen Wohnung in Pankow (allerdings ohne Schmidt das Buch zu zeigen) und war sofort tief beeindruckt, denn ich spürte, wie genau Koestler die innere Situation der damaligen kommunistischen Bewegung kannte und erkannte. Nun, 1950, in seinem Beitrag in Ein Gott, der keiner war, erfuhr ich, daß wir uns auch hätten persönlich treffen können, da Koestler Ende der 20er Jahre in der Künstlerkolonie am Breitenbachplatz in Berlin lebte, genau dort, wo ich, damals allerdings erst 10-11 Jahre alt, mit meiner Mutter wohnte. Auch von Louis Fischer (1896-1970) hörte ich bereits während meiner Zeit in der Sowjetunion, aber erst durch seinen Beitrag in Ein Gott, der keiner war kam er mir besonders nahe. Mitte der 60er Jahre lernten wir uns in den USA persönlich kennen.
Von zwei der Autoren, Richard Wright (1908-1960) und Stephen Spender (1909-1995), hatte ich vor dem Lesen der Anthologie nie etwas gehört, fand aber beide Beiträge außerordentlich aufschlußreich. Ein Jahrzehnt später lernte ich Stephen Spender auf ungewöhnliche Weise näher kennen: Wir folgten beide im Herbst 1960 der Einladung zum Kongreß der Ex-Kommunisten in Kerala, im Südwesten Indiens. Dort waren wir mehr als eine Woche zusammen, trafen uns mit Schriftstellern und Gesinnungsgenossen in dem einzigen Staat, in dem die Kommunisten auf parlamentarisch-demokratischem Wege durch Wahlen im Jahr 1957 die Regierung übernommen hatten. In den ersten Wochen war die KP-Regierung noch populär, aber schon bald weckten das Bestreben, Staatsapparate und Justiz durch die eigene Parteiherrschaft zu ersetzen und in den Schulen sowjetische Lehrbücher einzuführen, sowie die zunehmende Bestechung und Korruption den Unwillen der Bevölkerung. Seit Herbst 1957 schlossen sich die von der KP enttäuschten Mitglieder und Funktionäre zum »Ex-Communist-Forum" zusammen. Im Juni 1959 wurde schließlich das KP-Regime durch eine mächtige Volksbewegung – die in vielem an die Montagsdemonstrationen im Herbst 1989 in der DDR erinnerte – gestürzt. Die treibende politische Kraft waren die ehemaligen Kommunisten im »Ex-Communist-Forum", das nicht nur bei den Neuwahlen im Februar 1960, sondern im gesamten politischen Leben des Landes eine entscheidende Rolle spielte.
Es war dieses »Ex-Communist-Forum", das uns beide, Stephen Spender und mich, zum großen Kongreß in Ernakulam am 25. November 1960 eingeladen hatte. Das recht ungewöhnliche Thema lautete: »Die Rolle der Ex-Kommunisten im politischen Leben einer demokratischen Gesellschaft". Der Kongreß fand in einem riesigen, strohgedeckten Pfahlbau ohne Wände statt – sie wurden unter den klimatischen Bedingungen in Kerala nicht benötigt. 500 mit traditionellen weißen Umhängen bekleidete Keralesen waren im Saal versammelt, die Reden und Diskussionen wurden durch Lautsprecher in der Stadt übertragen. Stephen Spender und ich wurden mit stürmischem Beifall begrüßt und erhielten Ehrenplätze in der ersten Reihe. Die Malayalam sprechenden Inder diskutierten in der sengenden Hitze über dieselben Probleme, die auch fast alle Ex-Kommunisten Europas beschäftigten: die Degeneration des Sowjet-Kommunismus und die Verwandlung des schöpferischen Marxismus in eine Sammlung toter Dogmen. Immer wieder wurde Kritik geübt: am Führerkult und Autoritätsaberglauben, an der Unterordnung der kommunistischen Partei unter die Sowjetführung, an der Niederschlagung der ungarischen Revolution, der Begrenzung des künstlerischen Lebens, an den unerträglichen Lobeshymnen auf die Sowjetunion. Kritisiert wurden – teilweise mit ironischen Bemerkungen – die ständigen Schwankungen der Parteilinie, der man immer wieder folgen mußte.
All diese Punkte waren Stephen Spender und mir wohl bekannt, aber noch nie hatten wir erlebt, daß sie in so großem Rahmen erörtert wurden. So wie wir an den Diskussionen in Südindien interessiert waren, so waren die Kongreßteilnehmer an den Reformströmungen in anderen Ländern interessiert. Als Stephen Spender und ich über die kritischen, sich gegen die offizielle sowjetische Parteilinie stellenden Kommunisten in den Ländern West- und Osteuropas berichteten, wurde dies von den Anwesenden mit großem Beifall begrüßt. Über den Kongreß berichteten die Zeitungen Keralas auf den Titelseiten, inklusive Bildern von Stephen Spender und mir, weshalb wir auf unseren Ausflügen überall erkannt wurden – so auch von einem katholischen Priester, der uns höflich begrüßte und die unerwartete Frage an uns richtete: „Wie geht es bei dem Kongreß der Ex-Kommunisten? Sind Sie mit dem Verlauf zufrieden?" Nach einer Woche mußten wir Kerala verlassen, da wir noch weitere Einladungen in Städten im Zentrum und Norden Indiens hatten, aber uns beiden tat es leid, uns von Kerala zu verabschieden – dem wohl einzigen Land der Welt, in dem Ex-Kommunisten nicht von Mißtrauen umgebene, isolierte Einzelgänger waren, sondern Angehörige einer im ganzen Land geachteten politischen Strömung.
Unmittelbar nach Erscheinen des Buches Ein Gott, der keiner war wurde die verleumderische Behauptung verbreitet, die Autoren seien haßerfüllte, rechtsextremistische Gegner der Sowjetunion und des Kommunismus. Dies wurde von den kommunistischen Parteien der westeuropäischen Länder verbreitet, tatsächlich aber handelte es sich um eine von der Moskauer Zentrale gesteuerte Kampagne. Dort hatte man sofort erkannt, daß dieses Buch außerordentlich gefährlich war, und es gab nur eine Möglichkeit zu reagieren: Die Kritiker mußten in die rechte Ecke gestellt werden. Leider gelang dies, da die kommunistischen Parteien damals noch fast alle Moskau folgten. Auf Anweisung von oben waren die Autoren von Ein Gott, der keiner war als Rechtsnationalisten und Verteidiger des Kapitalismus in die rechte Ecke gedrängt worden, und damit schien die Gefahr gebannt: Gedanken kritischer Linker hätten durchaus einen Denk- und sogar Oppositionsprozeß in der kommunistischen Bewegung fördern können, rechte Auffassungen dagegen waren für den Meinungsbildungsprozeß in der kommunistischen Weltbewegung unerheblich.
Das hatte ich in den Jahren 1942-1943 in der Kominternschule selbst erlebt. Dort durfte, ja, sollte man zum Beispiel sämtliche Nazi-Schriften und -Erklärungen studieren, sogar mitten im Krieg. Wir lasen alle Reden Hitlers, Goebbels, Himmlers und Görings sowie die Kommentare Fritsches – niemand mußte Angst haben, daß uns diese Texte beeinflussen könnten. In den geheimen Informationsbulletins, die täglich erschienen, konnten wir auch die Erklärungen bürgerlich-demokratischer Parteien, Politiker, Staatsmänner, Enzykliken des Papstes völlig ungehindert lesen. Bücher von Dissidenten aber waren strengstens verboten, keinen Satz, kein Wort von Trotzki, Bucharin, Paul Levi, Ruth Fischer, Ernst Reuter, Heinrich Brandler oder August Thalheimer durften wir lesen. Diese Schriften hätten uns durchaus interessieren können, wir hätten ihre Denkweise und Sprache verstanden, und damit hätte die Gefahr einer Ausbreitung oppositionellen Denkens bestanden.
Ein Gott, der keiner war war also für die sowjetische Führung deshalb so gefährlich, weil es sich bei den Autoren eindeutig um Personen handelte, die überzeugt für die kommunistische Bewegung tätig gewesen waren. Sie konnten die Verhältnisse von innen schildern, stellten den Übergang von der Kritik zur Opposition und schließlich zum Bruch eindrucksvoll und nachvollziehbar dar und schlugen sich nach dem Bruch nicht auf die rechte Seite, sondern brachten im Gegenteil einen eigenen, unabhängigen linken Standpunkt zum Ausdruck. Genau darin lag für Moskau die größte Gefahr. Daß die Autoren angeblich haßerfüllte „Kalte Krieger” gewesen seien, stimmte mit der Realität nachweislich nicht überein.
Ignazio Silone war sein ganzes Leben ein überzeugter Linker, der in seine sozialistische Zielsetzung freiheitliche Gedanken einbaute. In seinem Beitrag für Ein Gott, der keiner war kam er zu dem Schluß: „Mein Glaube an den Sozialismus aber, von dem wohl mein ganzes Leben Zeugnis ablegt, ist mir lebendiger denn je." Allerdings, so meinte Silone, sei später ein intuitives Gefühl für die Würde des Menschen hinzugekommen und die Erkenntnis, man müsse zwischen Zielsetzung und Bewegung auf der einen und den Doktrinen auf der anderen Seite unterscheiden: „Für mich ist die sozialistische Politik nicht an irgendeine bestimmte Theorie gebunden, sondern an einen Glauben. Je wissenschaftlicher sich die sozialistischen Theorien gebärden, umso vergänglicher sind sie; sozialistische Werte aber bleiben beständig." Durch die Zersplitterung und Grabenkämpfe innerhalb der italienischen Linken enttäuscht und verbittert, zog sich Silone in den 50er Jahren von der aktiven Beteiligung an der institutionellen Politik zurück und definierte sich als ,Sozialisten ohne Partei und Christen ohne Kirche". 15 Jahre nach seiner Mitwirkung an dem Buch Ein Gott, der keiner war kam er in seinen bedeutsamen und einfühlsamen Lebenserinnerungen unter dem Titel Notausgang (1965) noch einmal auf seinen Lebensweg zurück: ,Die Trennung vom Kommunismus war für mich ein sehr trauriges Erlebnis, und ich komme aus einem Lande, wo man länger Trauer trägt, als anderswo." Ignazio Silone verstarb 1978 und wurde 1990, 12 Jahre nach seinem Tod, von den italienischen Kommunisten rehabilitiert.
Arthur Koestler kam nach seinem Beitrag für die Anthologie nur noch ein einziges Mal in seinem Leben auf die Problematik von Kommunisten und Ex-Kommunisten zurück, und zwar in seinem 1951 erschienenen Buch Gottes Thron steht leer (The Age of Longing). Später widmete sich Koestler historischen analytischen Büchern. Am 3. März 1983 schied er durch Selbstmord aus dem Leben.
Richard Wright siedelte nach seinem Bruch mit der Kommunistischen Partei der USA nach Paris über, nahm die französische Staatsbürgerschaft an und schrieb gegen Ende seines Lebens das Buch American Hunger, in dem er ausführlicher und tiefergehend die Hoffnungen und Desillusionierung in der kommunistischen Partei schilderte.
Louis Fischer verfaßte nach seiner Abkehr vom Kommunismus sowjetischer Prägung äußerst kenntnisreiche Biographien, zunächst über Mahatma Gandhi (1950), später über Stalin (1952) und Lenin (1964). Seine Biographien der beiden unterschiedlichen Sowjetführer fanden damals und auch heute außerordentliche Anerkennung. Die 1964 erschienene Monographie Das Leben Lenins gilt als sein Hauptwerk. Fischer war bereits im September 1922 zum ersten Mal in das Sowjetrußland Lenins gereist und verbrachte anschließend fast ein Vierteljahrhundert dort. In den noch etwas freieren 20er Jahren traf er sich mehrfach mit Lenin, besuchte den IV. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale (November/Dezember 1922) und konnte mit vielen der bedeutendsten Mitkämpfer Lenins (die später Opfer Stalins wurden) über ihre Ziele und erste Besorgnisse sprechen. Auch seine jahrelangen Studien historischer Dokumente fanden Eingang in dieses bedeutsame Buch. In den letzten Jahren wirkte Louis Fischer als Professor für sowjetische Geschichte an der Princeton University. Dort habe ich ihn persönlich kennengelernt und war tief beeindruckt. Unsere damaligen ausführlichen Gespräche über die Entstalinisierung Chruschtschows, über dessen Sturz im Oktober 1964 und später über den Prager Frühling von 1968 sind mir eindringlich in Erinnerung geblieben. Louis Fischer gehörte zu jenen Personen, mit denen ich nicht nur gemeinsame Wurzeln und Erfahrungen teilte, sondern auch in Einschätzungen und Beurteilungen weitgehend übereinstimmte. Seinen Tod am 15. Juni 1970 erlebte ich als Kollege – als Professor für sowjetische Geschichte an der Yale University, an der ich seit 1966 tätig war.
Seit meiner Abkehr vom Stalinismus im März 1949 hoffte ich auf innere Veränderungen und Reformprozesse in den kommunistisch regierten Ländern. Der Bruch Jugoslawiens mit Moskau war für mich nicht ein isoliertes, auf dieses Land begrenztes Ereignis, sondern schien mir eine beginnende Emanzipation anzudeuten, die sich in anderen kommunistisch regierten Ländern wiederholen könnte. Bereits damals – und später verstärkt – war ich von der Hoffnung durchdrungen, das Streben der kommunistischen Parteien nach Loslösung von Moskau und größerer Selbständigkeit werde zunehmen und zu alternativen, freieren marxistischen Modellen führen. Diese Hoffnung verstärkte sich nach der Revolution in Ungarn im Herbst 1956 und vor allem nach dem Prager Frühling von 1968 sowie durch den Moskau-Peking-Konflikt und die Herausbildung des Eurokommunismus in den 70er Jahren. Diese Ereignisse veranlaßten mich, in genaueren Darstellungen darauf hinzuweisen, unter welchen Bedingungen und in welcher Richtung große Reformprozesse zu erwarten seien.
Mit Gorbatschow begann im März 1985 in der Sowjetunion – leider viel zu spät – der Reformprozeß. Ich verfolgte jeden neuen Schritt mit großer Anteilnahme. Im Sommer 1987 konnte ich erstmals wieder nach Moskau fliegen, die Schule und Hochschule meiner Jugendjahre besuchen und – nun in erträumter Offenheit und Freiheit – mich mit Schriftstellern, Publizisten, Studenten und Professoren aussprechen. Nach mehreren weiteren Besuchen veröffentlichte die Wochenzeitung Sa Rubeshom (Jenseits der Grenzen) im März 1989 einzelne Kapitel aus meinem Buch Die Revolution entläßt ihre Kinder. Der Aufbruch, aber auch die Schwierigkeiten und Gegenkräfte, waren damals in der Sowjetunion überall deutlich zu spüren. Nur das DDR-System unter Erich Honecker veränderte sich zunächst nicht. Doch im Herbst 1989 war es auch dort soweit, in wenigen Wochen vollzog sich das, worauf ich 40 Jahre lang gewartet hatte: Die SED gab ihre Monopolstellung auf, die Reformbewegung wurde anerkannt, Presse-, Meinungs-, Versammlungs- und Medienfreiheit wurden durchgesetzt, der Staatssicherheitschenst aufgelöst. Erstmals konnte ich wieder in Orte reisen, in denen ich 1945 mit der „Gruppe Ulbricht" aktiv gewesen war.
Die jetzige Neuauflage von Ein Gott, der keiner war ist von außerordentlich großer Bedeutung. Ich hätte sie mir schon viel früher gewünscht. Gerade während des Zusammenbruchs der kommunistischen Systeme in den Jahren 1989-1991 wäre es meiner Auffassung nach besonders dringlich gewesen, das Buch – vor allem in der DDR – in großer Auflage zu verbreiten. Schon damals bestand ein außerordentliches Interesse an diesem Thema. Ich habe es sehr bedauert, daß in der entscheidenden Umbruchsituation Bücher dieser Art nicht ausreichend vorhanden waren. Statt dessen wurden im Westen damals wirtschaftliche und Verwaltungsmaßnahmen überschätzt, die geistigen Bedürfnisse vieler Menschen, die ihren Glauben, ihre Tradition plötzlich verloren hatten, dagegen unterschätzt. Viele Menschen fühlten sich unsicher und unverstanden. Gefühle der politischen Heimatlosigkeit können aber überwunden oder zumindest abgeschwächt werden, wenn man sich in einer langen Reihe von Personen sieht, die, wenn auch in anderen Ländern, zu anderen Zeiten und getrieben von anderen Ereignissen, vor ähnlichen Problemen standen und denen es gelang, eigene Lösungen zu finden.
Die Autoren des Buches Ein Gott, der keiner war und auch andere kritische Linke, die später mit dem System und der Ideologie gebrochen haben, sind durch den Zusammenbruch der kommunistischen Systeme in den Jahren 1989-1991 historisch rehabilitiert. Sie haben die tiefen Widersprüche, die zum allmählichen Niedergang und schließlich zum endgültigen Zusammenbruch führten, lange vorher erkannt, beschrieben und analysiert, nicht selten in ihren Schriften ausdrücklich auf die zu erwartenden schweren Folgen hingewiesen und durch ihre entsprechenden Reformvorschläge Alternativen zu dieser absehbaren Entwicklung aufgezeigt.
Heute sind seit dem Zusammenbruch des Kommunismus fast 15 Jahre vergangen. Naturgemäß konzentrierte sich bisher das Interesse auf die letzten Jahre vor dem Zusammenbruch, sowohl in der Sowjetunion als auch in den mittel- und osteuropäischen Ländern – vor allem auch in der DDR. In den letzten zwei bis drei Jahren hat jedoch eine begrüßenswerte, erfreuliche Veränderung stattgefunden. Mehr und mehr wächst das Interesse – übrigens sowohl bei den Menschen der älteren als auch der jüngeren Generation – an der früheren Entwicklung, an den tieferen Ursachen des Zusammenbruchs, den Wurzeln der Konflikte, dem Beginn der Fehlentwicklungen.
Unter diesem Blickwinkel habe ich in den letzten Tagen noch einmal das Buch Ein Gott, der keiner war gelesen. Erstaunlich, aber wahr: Obwohl seit dem Erscheinen des Buches mehr als fünf Jahrzehnte vergangen sind – die entscheidenden Besonderheiten bleiben: Die enge Verflechtung vom persönlichen Erleben und den größeren politisch-historischen Zusammenhängen, die Beschreibung, wie schrittweise die großen Zukunftserwartungen durch eigene Erlebnisse in Frage gestellt werden, die zunehmende Bedeutung der kritischen Erkenntnisse, die schließlich zu einer Opposition und, nach weiteren inneren Kämpfen, zum Bruch mit dem System und der Ideologie führten. So ist Ein Gott, der keiner war nicht nur ein wichtiges Dokument der Zeitgeschichte, sondern eine erregende, fesselnde Schilderung, die, wie ich annehme, auch die neuen Leser faszinieren wird.
Manderscheid/Etfel, August 2004
VORWORT ZU DEN BEKENNTNISSEN
von Richard Crossman
Der Plan zu diesem Buch entstand in der Hitze eines Streitgesprächs. Ich hielt mich mit Arthur Koestler in Nord-Wales auf, und eines Abends hatten wir in der politischen Diskussion, aus der unsere Freundschaft zu bestehen scheint, einen bisher nie dagewesenen toten Punkt erreicht. „Entweder kannst du oder willst du nicht begreifen", sagte Koestler. „Mit euch bequemen, insularen, angelsächsischen Anti-Kommunisten ist es immer das Gleiche. Ihr haßt unsere Kassandra-Rufe und habt uns sehr ungern zu Verbündeten, doch wenn alles gesagt ist, sind wir einstigen Kommunisten die einzigen Leute auf eurer Seite, die wissen, um was es wirklich geht." Und damit ging das Gespräch über zu der Frage, warum der und der Kommunist geworden sei und warum er aus der Partei ausgetreten sei oder nicht. Als das Gespräch wieder einen hitzigen Charakter annahm, sagte ich: „Halt, warte mal. Sage mir genau, was geschah, als du in die Partei eintratest, – aber nicht, was du jetzt darüber denkst, sondern was du damals empfandest? Da fing Koestler mit der eigenartigen Geschichte seiner Begegnung mit Herrn Schneller in der Schneidemühler Papierfabrik an; und plötzlich unterbrach ich ihn mit der Bemerkung: „Daraus sollte ein Buch entstehen", und wir fingen an, über die Namen ehemaliger Kommunisten zu sprechen, die fähig sein könnten, über sich selber die Wahrheit zu erzählen.
Im Anfang reichte unsere Auswahl sehr weit, doch ehe der Abend vorüber war, beschlossen wir, die Liste auf ein halbes Dutzend Schriftsteller und Journalisten zu beschränken. Wir waren nicht im mindesten daran interessiert, die Flut antikommunistischer Propaganda noch mehr anschwellen zu lassen oder eine Gelegenheit für persönliche Verteidigungsschriften zu schaffen. Unser Augenmerk war darauf gerichtet, den Geisteszustand der bekehrten Kommunisten zu untersuchen sowie die Atmosphäre des Zeitraums von 1917-1939, in dem die Bekehrung so üblich war. Zu diesem Zweck war es wesentlich, daß jeder der Mitarbeiter fähig war, nicht etwa die Vergangenheit noch einmal zu durchleben – das ist unmöglich –, sondern daß er imstande war, durch einen Vorgang schöpferischer Selbstanalyse sie trotz seines Vorwissens von der Gegenwart noch einmal zu gestalten. Wie ich wohl weiß, ist eine Autobiographie dieser Art nahezu unmöglich für den praktisch-tätigen Politiker: sein Selbstrespekt verdreht die Vergangenheit durch Terminologien der Gegenwart. Eine sogenannte wissenschaftliche Selbstanalyse führt gleichfalls in die Irre; da sie die Persönlichkeit in eine Reihe von psychologischen und sozialen Ursachen aufspaltet, zerredet sie durch Erklärungen die Gefühlsregungen, die wir beschrieben haben wollten. Die Objektivität, nach der wir suchten, war die Gabe der Besinnung auf Vergangenes – und zwar wenn nicht in heiterster Gelassenheit, so doch mit Leidenschaftslosigkeit –, und diese Gabe ist außer dem schöpferisch veranlagten Schriftsteller selten jemandem gegeben.
Es ist Tatsache, daß in den Jahren, die zwischen der Oktober-Revolution und dem Stalin-Hitler-Pakt liegen, zahllose Literaten sowohl in Europa wie in Amerika sich zum Kommunismus hingezogen fühlten. Sie waren nicht „typische" Konvertiten. Vielmehr gaben sie, da sie Menschen mit einem recht ungewöhnlichen Feinempfinden waren, äußerst anormale Kommunisten ab, genau so wie der literarische Katholik ein äußerst anormaler Katholik ist. Sie besaßen ein erhöhtes Wahrnehmungsvermögen für den Zeitgeist und empfanden schärfer als andere seine enttäuschten Erwartungen und seine Hoffnungen. Ihre Bekehrung brachte daher in einer scharfen und manchmal hysterischen Form Gefühle zum Ausdruck, die dumpf und verschwommen von Millionen, die es nicht formulieren konnten, ebenfalls geteilt wurden, und die empfanden, daß Rußland „auf der Seite der Arbeiter" stehe. Der Intellektuelle ist in der Politik immer „unausgeglichen", wenn er seine Kollegen beurteilt. Er späht angestrengt um die nächste Ecke, indessen sie ihre Augen auf die Straße gerichtet halten; und er riskiert seinen Glauben an nicht realisierten Ideen, anstatt ihn vorsichtig und klug auf langweilige Ergebenheitserklärungen zu beschränken. Er ist seiner Zeit voraus und in diesem Sinne ein extremer Mensch. Wenn die Geschichte seine Vorahnungen rechtfertigt, dann ist alles gut und schön. Aber wenn die Geschichte im Gegenteil die andere Richtung einschlägt, dann muß er entweder weiter bis in die Sackgasse marschieren oder einen schimpflichen Rückzug antreten und die Ideen verwerfen, die ein Teil seiner Persönlichkeit geworden sind.
In dem vorliegenden Buche beschreiben sechs Intellektuelle die Fahrt in den Kommunismus und die Rückkehr aus ihm. Sie sahen ihn anfänglich – genau so wie ihre Vorgänger vor 130 Jahren die französische Revolution sahen – als eine Vision des Reiches Gottes auf Erden; und wie Wordsworth und Shelley widmeten sie ihre Talente einer Arbeit in Demut, um sein Kommen herbeizuführen. Sie ließen sich nicht durch Zurechtweisungen der Berufsrevolutionäre oder durch die spöttischen Bemerkungen ihrer Gegner entmutigen, bis jeder von ihnen die Kluft entdeckte, die zwischen seiner eigenen Vision von Gott und der Wirklichkeit des kommunistischen Staates klaffte – und der Gewissenskonflikt erreichte seinen kritischen Punkt.
Sehr wenige können den Anspruch erheben, einen genauen Blick um diese besondere Ecke der Geschichte getan zu haben. Bertrand Russell war imstande, sein Buch „Die Praxis und Theorie des Bolschewismus", das er im Jahre 1920 geschrieben hatte, wieder zu veröffentlichen, ohne ein einziges Komma darin ändern zu müssen; doch die meisten von allen denen, die heute so weise und voller Verachtung auftreten, nachdem die Dinge geschehen sind, waren entweder in Beziehung auf die russische Revolution so blind, wie Edmund Burke zu seiner Zeit blind gewesen war, oder sie sind nur mit dem Pendel hin und her geschwankt – mal haben sie verdammt, dann gepriesen und dann wieder verdammt, so wie es eben den Geboten der staatlichen Politik entsprach. Diese sechs autobiographischen Arbeiten sollten zum mindesten die Gefahren offenbaren, die in einem leichtfertigen Antikommunismus aus selbstsüchtiger Opportunität liegen. Daß der Kommunismus als eine Lebensform, wenn auch nur wenige Jahre lang, die tief christliche Persönlichkeit eines Silone gefangennehmen konnte und Individualisten vom Schlage eines Gide und Koestler angezogen hat, offenbart eine schreckliche Unzulänglichkeit innerhalb der europäischen Demokratie. Daß Richard Wright als ein streitbarer Negerschriftsteller in Chicago nahezu selbstverständlich in die Kommunistische Partei hineinging, ist an sich eine Anklage gegen die amerikanische Lebensform. Louis Fischer andererseits repräsentiert jene hervorragende Gruppe britischer und amerikanischer Auslandskorrespondenten, die ihren Glauben nicht so sehr aus Achtung vor dem Kommunismus in Rußland setzten, wie aus Enttäuschung über die westliche Demokratie und – später aus Ekel über die Beschwichtigungspolitik. Stephen Spender, der englische Dichter, wurde sehr stark aus dem gleichen Motiv dazu getrieben. Ihm erschien der spanische Bürgerkrieg, wie beinahe allen seinen Zeitgenossen, als der Prüfstein der Weltpolitik. Er war die Ursache für sein kurzes Verweilen in der Partei und zu einem späteren Zeitpunkt für seine Ablehnung.
Das einzige Bindeglied zwischen diesen sechs verschiedenen Persönlichkeiten ist dies, daß sie alle – nach qualvollen Gewissenskämpfen – den Kommunismus erwählten, weil sie den Glauben an die Demokratie verloren hatten und bereit waren, „bourgeoise Freiheiten" hinzuopfern, um den Faschismus zu bekämpfen. Ihre Bekehrung wurzelte in Wirklichkeit in der Verzweiflung – in der Verzweiflung an den westlichen Werten. Rückblickend ist es recht leicht, zu sehen, daß diese Verzweiflung hysterisch war. Der Faschismus wurde überwunden, ohne daß man alle die bürgerlichen Freiheiten preisgab, wie es der Kommunismus verlangt. Doch wie konnte Silone dies in den Jahren nach 1920 voraussehen, wo die Demokratien Mussolini hofierten und allein die Kommunisten in Italien eine ernsthafte Widerstandsbewegung organisierten? Waren Gide und Koestler zu der Zeit, als sie Kommunisten wurden, so offensichtlich im Unrecht, weil sie das Empfinden hatten, daß die deutsche und die französische Demokratie korrupt seien und sich dem Faschismus ausliefern würden? Teilweise liegt der Wert dieses Buches in der Tatsache, daß es unsere Erinnerungen in so unbequemer Weise wachrüttelt, und daß es uns an die schreckliche Verlassenheit erinnert, die die „vorzeitigen Anti-Faschisten" erlebten, nämlich jene Männer und Frauen, die den Faschismus begriffen und versuchten, ihn zu bekämpfen, ehe er ein ins Gewicht fallender Faktor wurde. Es war jene Verlassenheit, die ihre Gemüter für den Appell des Kommunismus öffnete.
Dieser Appell wurde in besonderer Stärke von jenen empfunden, die zu anständig waren, um den vorherrschenden Glauben an den automatisch weitergehenden Fortschritt, eine ständige Ausbreitung des Kapitalismus und die Beseitigung der Gewaltpolitik zu akzeptieren. Sie sahen, daß der Coolidgeismus in Amerika, der Baldwinismus und MacDonaldismus in England und der „kollektive Pazifismus" des Völkerbundes faule intellektuelle Truggebilde waren, die die meisten von uns vorsichtigen, anständigen Demokraten blind für die Katastrophe machten, in die wir hineintrieben. Weil sie eine Vorahnung von der Katastrophe hatten, hielten sie Ausschau nach einer Philosophie, mittels derer sie sie analysieren und überwinden konnten – und viele von ihnen fanden, was sie suchten, im Marxismus.
Die Anziehungskraft des Marxismus auf die Intellektuellen bestand darin, daß er die liberalen Irrtümer vernichtete – die in Wirklichkeit auch Irrtümer waren. Er lehrte die bittere Wahrheit, daß der Fortschritt nicht automatisch weitergeht, daß jähe Konjunktur und Wirtschaftskrise wesentliche Bestandteile des Kapitalismus sind, daß soziale Ungerechtigkeit und rassische Diskriminierung nicht einfach durch eine Übergangszeit geheilt werden und daß sich Machtpolitik nicht „beseitigen" läßt, sondern nur für gute oder böse Zwecke verwandt werden kann. Wenn man die Wahl zu treffen hatte zwischen zwei materialistischen Philosophien, dann konnte kein intelligenter Mensch nach 1917 die Lehre des automatisch funktionierenden Fortschrittes wählen, von der so viele einflußreiche Leute damals annahmen, daß sie die einzige Grundlage der Demokratie sei. Die Wahl schien zwischen einer extremen Rechtspartei, die entschlossen war, die Macht zur Vernichtung menschlicher Freiheit zu benutzen, und einer Linken Partei zu liegen, die anscheinend eifrig bemüht war, sie zu gebrauchen, um die Menschheit zu befreien. Die westliche Demokratie ist nicht so unreif oder so materialistisch, wie sie dies in der traurigen Waffenstillstandszeit zwischen den Kriegen war. Doch es hat zwei Weltkriege gebraucht und zwei totalitäre Revolutionen, um ihr langsam beizubringen, daß es nicht ihre Aufgabe ist, es dem Fortschritt zu überlassen, die Arbeit für sie zu leisten, sondern eine neue Möglichkeit für eine Weltrevolution zu schaffen, indem sie die Zusammenarbeit freier Völker plant.
Wenn Verzweiflung und Einsamkeit die Hauptmotive für eine Bekehrung zum Kommunismus waren, so wurden sie wesentlich verstärkt durch das christliche Gewissen. Auch hier empfand der Intellektuelle, selbst wenn er das orthodoxe Christentum vielleicht aufgegeben hatte, seine Gewissensbisse viel schärfer als viele seiner nicht nachdenkenden Nachbarn, die gute Kirchgänger waren. Er wurde sich zum mindesten über die Unbilligkeit des Lebenszustandes und der Vorrechte klar, die er genoß, gleichviel, ob sie ihm auf Grund seiner Zugehörigkeit zu einer Rasse oder Klasse oder einer Bildungsschicht zufielen. Der Appell des Kommunismus an das Gefühl ging Hand in Hand mit den Opfern, die er sowohl in materieller wie geistiger Beziehung von dem Bekehrten verlangte. Man kann das Eingehen auf diesen Appell masochistisch nennen oder es als das ernsthafte Verlangen beschreiben, der Menschheit zu dienen. Doch wie man es auch immer benennt, die Idee einer aktiven Kampfgemeinschaft, mit der ein persönliches Opfer und die Beseitigung der Rassen- und Klassenunterschiede verbunden waren, hatte in jeder westlichen Demokratie eine zwingende Kraft. Die Anziehungskraft der üblichen politischen Partei liegt in dem, was sie ihren Mitgliedern bietet; die Anziehungskraft des Kommunismus lag darin, daß er nichts bot und alles verlangte, einschließlich der Preisgabe der geistigen Freiheit. Hier ist in Wahrheit die Erklärung eines Phänomens, das viele Beobachter verwirrt hat. Wie konnten diese Intellektuellen die Dogmatik Stalins akzeptieren? Die Antwort hierauf wird man auf den Seiten verstreut finden, die hier folgen. Für den Intellektuellen sind materielle Annehmlichkeiten verhältnismäßig unwichtig; er legt am meisten Wert auf die geistige Freiheit. Die Stärke der katholischen Kirche hat immer darin gelegen, daß sie ein kompromißloses Opfer dieser Freiheit verlangt und den geistigen Hochmut als eine Todsünde verdammt. Der kommunistische Novize, der seine Seele dem kanonischen Gesetz des Kremls unterwirft, empfand etwas von der Erlösung, die der Katholizismus ebenfalls den vom Vorrecht der Freiheit ermatteten und geplagten Intellektuellen bringt.
Wenn einmal der Verzicht geleistet ist, dann wird der Geist, anstatt frei arbeiten zu können, der Sklave eines höheren unbestrittenen Zieles. Die Wahrheit zu verleugnen ist eine Dienstleistung. Dieses ist natürlich der Grund, weswegen es zwecklos ist, mit einem Kommunisten irgendeinen besonderen politischen Aspekt zu diskutieren. Jeglicher intellektuelle Kontakt, den man mit ihm hat, zieht zwangsläufig einen Angriff auf seine Glaubensgrundlagen und eine seelische Auseinandersetzung nach sich. Denn es ist sehr viel einfacher, das Opfer geistigen Hochmutes auf dem Altar der Weltrevolution niederzulegen als es wieder zurückzuholen.
Dies mag einer der Gründe sein, weswegen der Kommunismus mehr Erfolg in katholischen als in protestantischen Ländern gehabt hat. Der Protestant ist, wenigstens ursprünglich, aus Gewissensgründen Gegner einer geistigen Unterwerfung unter irgendeine Oberherrschaft. Er erhebt den Anspruch, selber durch die innere Erleuchtung zu wissen, was recht und unrecht ist, und die Demokratie ist für ihn nicht nur eine bequeme oder eine gerechte Regierungsform, sondern ein Gebot der menschlichen Würde. Sein Prototyp ist Prometheus, der das Feuer aus dem Himmel stahl und ewig an dem Kaukasischen Felsen hängt, wo ihm der Adler die Leber aushackt, weil er sich weigerte das Recht preiszugeben, seinen Mitmenschen bei ihrem intellektuellen Bemühen zu helfen. Ich frage mich manchmal selber, warum ich als sehr junger Mensch zu der Zeit, als ich mit Willi Münzenberg, dem kommunistischen Führer, in Berlin zusammen war, nie die leiseste Versuchung gespürt habe, seine Einladung, mit ihm nach Rußland zu gehen, anzunehmen. Ich war gefangengenommen von seiner bemerkenswerten Persönlichkeit – wie sie Koestler in diesem Buche beschreibt —, und der Marxismus schien die Vervollständigung der platonischen politischen Philosophie zu sein, der meine Hauptstudien galten. Ich war in hochmütiger Weise sicher, daß die deutsche Sozialdemokratie – es war im Sommer 1931 – vor den Nazis zusammenbrechen werde, und daß ein Krieg unvermeidlich war, wenn Hitler an die Macht gekommen sei. Warum also fühlte ich keinen inneren Widerhall auf den Appell der Kommunisten? Die Antwort darauf ist, dessen bin ich ziemlich sicher, daß es aus reiner nonkonformistischer Halsstarrigkeit oder, wenn man das vorzieht, aus Stolz geschah. Für mich gab es keinen Papst, weder einen geistlichen noch einen weltlichen. Das gleiche Motiv kann man bei Stephen Spender wirksam beobachten, als er gleich nach seinem Eintritt in die Partei einen „von der Linie abweichenden" Artikel im „Daily Worker" schrieb, und zwar auch aus reiner Halsstarrigkeit. Ich glaube gern, daß dies Erlebnis mit dem Kommunismus ebenso typisch britisch ist wie jenes von Silone geschilderte mit dem Genossen, dessen unschuldige Reaktion auf eine bewußte Lüge ein Gelächter verursachte, das durch den gesamten Kreml dröhnte. Als Nation bringen wir mehr als unseren Anteil an Ketzern hervor, denn wir haben mehr als unser rechtmäßiges Soll an gewissenhafter Auflehnung gegen die Unfehlbarkeit bei der Geburt mitbekommen. Schließlich war Heinrich VIII. zu seiner Zeit der Prototyp des Titoismus.
Aber kehren wir nach Europa zurück. Eine der seltsamsten Offenbarungen dieser sechs Autobiographien ist die Haltung der professionellen Kommunisten dem intellektuellen Konvertiten gegenüber. Sie mißbilligen und beargwöhnen ihn nicht nur, sondern sie unterwerfen ihn einer dauernden und bewußten geistigen Folter. Im Anfang bestärkte diese Behandlung nur seinen Glauben und erhöhte sein Demutsgefühl gegenüber dem geborenen Proletarier. Irgendwie mußte er durch geistiges Training die Eigenschaften erlangen, die, wie er sich gerne einbildet; der Arbeiter von Natur aus besitzt. Aber es ist klar, daß der intellektuelle Konvertit, sobald er anfing mehr über die Verhältnisse in Rußland zu erfahren, seine Stimmung änderte. Demut wurde ersetzt, wie Silone es sehr klar schildert, durch einen Glauben (für den Marx, der eine tiefe Verachtung für die Slawen empfand, viel an Einfluß einsetzte), daß der Westen dem Osten und der Mittelstand dem Proletariat die Erleuchtung zu bringen habe. Dieser Glaube war sowohl der Anfang der Enttäuschung wie eine Entschuldigung für das Verbleiben in der Partei. Die Enttäuschung trat ein, weil der Hauptanlaß nur Bekehrung das Verzweifeln an der westlichen Zivilisation gewesen war, von der man nun fand, daß sie Werte enthalte, die wesentlich zur Erlösung des russischen Kommunismus waren; eine Entschuldigung war es, weil man behaupten konnte, daß, wenn der westliche Einfluß sich zurückzöge, die östliche Brutalität aus der Verteidigung der menschlichen Freiheit eine abscheuliche Tyrannei machen würde.
Hier war ein neuer und sogar noch schrecklicherer Gewissenskonflikt, den André Gide durch seine klassische Feststellung von der Sache des Westens gegen den russischen Kommunismus löste.[1]
Gides Rückzug hätte in den letzten Dreißigerjahren den von Tausenden anderer Intellektueller im Gefolge gehabt, wenn es nicht den spanischen Bürgerkrieg und die westliche Politik der Nichteinmischung gegeben hätte. Die Tragik des spanischen Krieges und der Feldzug für eine Volksfront gegen den Faschismus brachte eine gesamte neue Generation junger Leute aus dem Westen entweder in die kommunistische Partei oder doch in engste Zusammenarbeit mit ihr und verzögerte den Rückzug vieler Leute, die bereits durch ihre Erlebnisse entsetzt worden waren. Jetzt den Kommunismus zu verdammen, schien gleichbedeutend mit einer Unterstützung Hitlers und Chamberlains. Für viele wurde allerdings dieser Konflikt bald durch den Stalin-Hitler-Pakt gelöst.
Richard Wrights Geschichte ist von besonderem Interesse, weil sie in eine amerikanische Form des Problems „Imperialismus" und Rasse einführt. Als Neger, der in den Slums von Chicago lebte, empfand er, wie kein westlicher Intellektueller es je empfinden konnte, die zwingende Kraft eines Glaubens, der eine vollständige und endgültige Antwort auf die Probleme sozialer wie rassischer Ungerechtigkeit zu geben schien. Alle anderen Mitarbeiter brachten ein bewußtes Opfer in ihrer persönlichen Stellung und an persönlicher Freiheit, als sie die kommunistische Disziplin akzeptierten; für Wright war diese Disziplin eine großartige Auslösung niedergehaltener Kräfte. Er brachte sein Opfer, als er aus der Partei austrat.
„Denn ich wußte in meinem Herzen, daß ich nie wieder imstande sein würde, in der Art zu schreiben, und nie wieder in jener einfachen Schärfe das Leben empfinden würde, nie wieder eine derartig leidenschaftliche Hoffnung zum Ausdruck bringen und niemals wieder ein so totales Glaubensbekenntnis ablegen würde."
Dieses tragische Eingeständnis ist eine Mahnung, daß der Kommunismus ungeachtet aller seiner Fehlschläge im Westen immer noch als Befreier zu den Farbigen kommt, die die überwiegende Mehrheit der Menschheit ausmachen. Als amerikanischer Neger gehört Wright sowohl zur westlichen Demokratie, wie er andererseits nicht dazu gehört. In seiner Eigenschaft als amerikanischer Schriftsteller, erfüllt von einer westlichen Auffassung von menschlicher Würde und künstlerischen Werten, griff er das kommunistische System an. Aber als Neger äußert er den tragischen Satz, nachdem er die Partei verlassen hat: „Ich werde für sie sein, auch wenn sie nicht für mich sein werden." Millionen farbiger Menschen werden nicht dem schwierigen Konflikt unterworfen, den Richard Wright durchmachen mußte. Für sie bedeutet die westliche Demokratie noch immer nur „Vorherrschaft der Weißen". Außerhalb Indiens, einem Lande, das groß genug ist, um ein Kontinent zu sein, und wo durch eine einzigartige Tat westlicher Staatskunst eine Gleichheit erreicht worden ist, ist der Kommunismus immer noch unter den farbigen Völkern ein Evangelium der Freiheit, und der chinesische oder afrikanische Intellektuelle kann ihn als ein solches hinnehmen, ohne damit die eine Hälfte seiner Persönlichkeit zu vernichten.
Vielleicht erklärt dies die Gleichgültigkeit, die die Russen und der Parteiapparat der westlichen Intelligenz gegenüber zeigen. Vielleicht ist der Kreml letzten Endes der Auffassung, daß der Einfluß dieser durch ihre Gewissenhaftigkeit so unzuverlässigen Intelligenz deshalb ohne Belang ist, weil die kommende Welt-Auseinandersetzung nicht zwischen den Klassen innerhalb einer Nation ausgefochten werden wird, sondern zwischen proletarischen Nationen und ihren Gegnern. Dies mag sein, wie dem wolle, die brutale Behandlung der westlichen Intellektuellen ist unbestreitbar. Wenn die Komintern nur ein gelegentliches Zeichen von Achtung zu irgendwelcher Zeit während der letzten dreißig Jahre gezeigt hätte, dann hätte sie die Unterstützung des größten Teiles fortschrittlichen Denkens in der gesamten westlichen Welt für sich gewinnen können. Anstatt dessen scheint sie von Anfang an diese Unterstützung nur widerwillig angenommen und alles getan zu haben, um sie wieder loszuwerden. Nicht einer der Mitarbeiter dieses Buches zum Beispiel verließ den Kommunismus mit Absicht und mit einem reinen Gewissen. Keiner von ihnen würde gezögert haben, dorthin zu irgendeinem Zeitpunkt des sich langsam hinziehenden Vorgangs seines Ausscheidens, das ein jeder beschreibt, zurückzukehren, wenn die Partei einen Funken von Verständnis für seinen Glauben an menschliche Freiheit und menschliche Würde gezeigt hätte. Aber nein! Mit unnachsichtiger Trennschärfe hat die kommunistische Maschine das Korn ausgeschieden und nur die Spreu westlicher Kultur beibehalten.
Was geschieht dem kommunistischen Konvertiten, wenn er dem Glauben abschwört? Louis Fischer, Stephen Spender und André Gide arbeiteten niemals mit der inneren Hierarchie; ja Louis Fischer trat zu keiner Zeit der Partei bei. Alle drei waren im wesentlichen „fellowtravellers", deren Persönlichkeiten nicht in das Leben der Partei gepreßt wurden. Ihr Ausscheiden, so qualvoll es war, entstellte daher nicht auf die Dauer ihr Wesen. Silone, Koestler und Richard Wright hingegen werden dem Kommunismus nie entrinnen. Ihr Leben wird immer in seiner Dialektik gelebt werden, ihr Kampf gegen die Sowjetunion wird immer ein Spiegelbild eines innerlich schwärenden Kampfes sein. Der wahre Ex-Kommunist kann nie wieder eine geschlossene Persönlichkeit werden. Im Falle Koestler ist dieser innere Konflikt die Haupttriebfeder seines schöpferischen Wirkens. Der Yogi sieht in den Spiegel, erblickt den Kommissar und zerschlägt vor Wut das Glas. Seine Schriftstellerei ist kein Reinigungsakt, der zu einer heiteren Gelassenheit führt, sondern ein erbarmungsloses Verhör seines westlichen Wesens – und aller Bewegungen in der Außenwelt, die es widerzuspiegeln scheinen – durch ein zweites Wesen, das dem Leiden gegenüber gleichgültig ist. Silone hat dadurch, daß er den ganzen Kreis zurück zur christlichen Ethik ging, von der er ausgegangen war, eine moralische Ausgeglichenheit erreicht, die ihm einen gewissen „Abstand" von dem Konflikt gibt. Sein wesentlicher Glaube ist „heute ein Gefühl der Verehrung für das, was sich immer in der Menschheit hervorzutun bemüht und an der Wurzel seiner ewigen Unruhe liegt".
Eines geht ganz klar aus dem Studium der verschiedenartigen Erlebnisse dieser sechs Männer hervor. Silone scherzte, als er Togliatti sagte, daß das letzte Gefecht zwischen den Kommunisten und Ex-Kommunisten ausgefochten werden würde. Aber niemand, der nicht mit dem Kommunismus als einer Philosophie und den Kommunisten als politischen Gegnern gerungen hat, kann wirklich die Werte westlicher Demokratie begreifen. Der Teufel lebte einstmals im Himmel, und diejenigen, die ihm nicht begegnet sind, werden wahrscheinlich nicht imstande sein, einen Engel zu erkennen, wenn sie einen sehen.
DIE AKTIVISTEN
Arthur Koestler
I gnazio Silone
Richard Wright
ARTHUR KOESTLER
Ein Glaube wird nicht durch sachliche Überlegungen erworben. Wer sich in eine Frau verliebt oder in den Schoß einer Kirche eingeht, tut dies nicht auf Grund logischer Denkvorgänge. Die Vernunft mag einen Glaubensakt begründen – aber erst, nachdem er vollzogen worden ist und der Mensch sich auf ihn verpflichtet hat. Der Überredung mag eine gewisse Rolle bei der Bekehrung eines Menschen zufallen, doch nur insofern sie einem Entwicklungsprozeß, der bereits in Bereichen gereift ist, in die keine Logik eindringen kann, zu seinem vollen und bewußten Durchbruch verhilft. Ein Glaube läßt sich nicht „erwerben", er wächst wie ein Baum. Seine Krone strebt dem Himmel zu, seine Wurzeln wachsen hinab in die Vergangenheit, wo sie sich von den dunklen Säften aus dem Humus vergangener Geschlechter ernähren.
Vom Standpunkt des Psychologen aus gesehen, besteht kaum ein Unterschied zwischen einem revolutionären und einem traditionsgebundenen Glauben. Jeder echte Glaube ist kompromißlos, radikal und lauter; mithin ist der wirklich traditionsgebundene Mensch immer ein revolutionärer Eiferer gegen die pharisäische Gesellschaft und gegen die lauwarmen Verwässerer des Glaubens. Und umgekehrt ist das Utopia des Revolutionärs, das scheinbar einen völligen Bruch mit der Vergangenheit darstellt, immer nach dem Vorbild des verlorenen Paradieses, nach dem Bilde eines legendären Goldenen Zeitalters geschaffen. Nach Marx und Engels sollte die klassenlose kommunistische Gesellschaft, in der die dialektische Spirale ausläuft, eine Wiederauferstehung der primitiven kommunistischen Gesellschaft sein, von der die Spirale ihren Ausgang nimmt. So kommt es, daß jeder echte Glaube den Gläubigen gegen seine soziale Umwelt aufbegehren läßt und ein der fernen Vergangenheit entlehntes Ideal in die Zukunft projiziert. Alle Utopien werden aus den Quellen der Mythologie gespeist, und die Entwürfe des Gesellschaftsplaners sind lediglich revidierte Neuauflagen der alten Texte.
Die Hingabe an eine reine Utopie und die Revolte gegen eine „verderbte" Gesellschaft sind also die beiden Pole, welche die allen militanten Glaubensbekenntnissen eigene Spannung erzeugen. Die Frage aufzuwerfen, welcher der beiden Pole den Strom zum Fließen bringt, die Anziehung durch das Ideal oder die Abstoßung durch die soziale Umwelt, hieße, die alte Frage nach Ei und Henne stellen. Der Psychiater sieht sowohl das Verlangen nach der Utopie als auch die Erhebung gegen den status quo als Symptome sozialer Fehlanpassung an. Für den Sozialreformer sind beide Symptome einer gesunden rationellen Haltung. Der Psychiater ist immer geneigt zu vergessen, daß die geschmeidige Anpassung an eine degenerierte Gesellschaft degenerierte Individuen erzeugt. Und der Sozialreformer vergißt zu leicht, daß Haß, selbst auf das wirklich Hassenswerte, nicht zu der Nächstenliebe und Gerechtigkeit führen kann, auf denen allein eine utopische Gesellschaft beruhen kann.
Infolgedessen spiegelt die Meinung des Soziologen wie die des Psychologen lediglich eine Halbwahrheit wider. Zwar läßt die Geschichte der meisten Revolutionäre und Reformatoren einen neurotischen Konflikt mit der Familie oder der Gesellschaft erkennen, doch beweist das nur, um mit Marx zu sprechen, daß eine zum Untergang bestimmte Gesellschaft ihre eigenen morbiden Totengräber hervorbringt. Es läßt sich ebensowenig bestreiten, daß die einzige ehrenhafte Haltung gegenüber einem empörenden Unrecht darin besteht, sich dagegen aufzulehnen und die Introspektionen auf bessere Zeiten zu verschieben. Wenn wir aber die Geschichte überblicken und die großen Ziele, in deren Namen Revolutionen begonnen wurden, mit dem jämmerlichen Ende vergleichen, das ihnen beschieden war, müssen wir immer wieder feststellen, daß eine korrupte Gesellschaft auch ihre eigene revolutionäre Brut korrumpiert.
Setzt man die beiden Halbwahrheiten des Soziologen und des Psychologen zusammen, so darf man folgern, daß, wenn einerseits Überempfindlichkeit gegenüber sozialem Unrecht und krankhaftes Verlangen nach einer Utopie Anzeichen für eine neurotische Fehlanpassung sind, andererseits die Gesellschaft ein Stadium der Dekadenz erreichen kann, in dem der neurotische Rebell dem Himmel wohlgefälliger ist als der gesunde Geschäftsmann, der den Befehl gibt, Schweine vor den Augen hungernder Menschen zu ertränken. Und so war es um unsere Zivilisation bestellt, als ich mich im Dezember 1931, im Alter von 26 Jahren, der Kommunistischen Partei Deutschlands anschloß.
Meine Entwicklung zum Revolutionär
Ich wurde bekehrt, weil ich reif dafür war und weil ich in einer sich auflösenden Gesellschaft lebte, die verzweifelt nach einem Glauben verlangte. Aber der Tag, an dem mir mein Parteibuch überreicht wurde, war lediglich Höhepunkt einer Entwicklung, die begonnen hatte, bevor mir etwas von den ertränkten Schweinen oder von Marx und Lenin zu Ohren gekommen war. Die Wurzeln dieser Entwicklung reichen zurück bis in die Kindheit.
Ich wurde 1905 in Budapest geboren, wo wir bis zu unserer Übersiedlung nach Wien im Jahre 1919 lebten. Bis zum ersten Weltkrieg führten wir das durchschnittliche Leben einer durchschnittlichen europäischen Mittelstandsfamilie. Mein Vater war der ungarische Vertreter einiger alter englischer und deutscher Textilfirmen. Wie so viele andere Existenzen nahm auch seine im September 1914 ein jähes Ende, und mein Vater sollte nie wieder festen Boden unter den Füßen gewinnen. Er ließ sich auf eine Reihe gewagter Unternehmen ein, die um so phantastischer wurden, je mehr er in der veränderten Welt sein Selbstvertrauen verlor. Er eröffnete eine Fabrik für radioaktive Seife, finanzierte eine Reihe von närrischen Erfindungen, wie Dauerglühbirnen, selbsttätige Bettwärmer und dergleichen, und verlor schließlich den Rest seines Vermögens in der österreichischen Inflation der frühen zwanziger Jahre. Als ich 21 Jahre war, verließ ich mein Elternhaus und wurde mit diesem Tage zum einzigen finanziellen Rückhalt für meine Eltern.
Mit neun Jahren, als unser Mittelstandsidyll zusammenbrach, wurde ich plötzlich der wirtschaftlichen Tatsachen des Lebens bewußt. Als einziges Kind wurde ich zwar auch weiterhin von meinen Eltern verwöhnt; da ich aber ihre Geldschwierigkeiten erriet und für meinen Vater, der von einer etwas kindlichen Großzügigkeit war, Mitleid empfand, beschlich mich immer ein Gefühl der Schuld, wenn meine Eltern mir Bücher oder Spielzeug kauften. Auch in späteren Jahren empfand ich das gleiche, als jede Ausgabe für mich selbst einen Abstrich von der Geldsumme bedeutete, die ich nach Hause schicken konnte. Gleichzeitig entwickelte sich in mir eine starke Antipathie gegen die ostentativ Reichen; doch nicht etwa deswegen, weil sie sich alles leisten konnten (der Neid spielt eine weit geringere Rolle bei sozialen Konflikten, als im allgemeinen angenommen wird), sondern weil sie das ohne jegliches Schuldgefühl taten. So projizierte ich meine persönlichen Probleme auf die Gesellschaftsstruktur als Ganzes.
Gewiß war das ein etwas umwegiger Pfad zu einem sozialen Gewissen. Aber gerade weil dieser Konflikt einen so intimen Charakter hatte, wurde auch der Glaube, der aus ihm erwuchs, zu einem ureigensten Teil meiner selbst. Es dauerte mehrere Jahre, bis er sich zu einem politischen Bekenntnis verdichtete; zunächst war es nichts weiter als sentimentale Gefühlsduselei. Jede Berührung mit Menschen, die ärmer waren als ich, wurde mir unerträglich. Der Junge in der Schule, der keine Handschuhe hatte und dessen Finger mit roten Frostbeulen bedeckt waren, der frühere Kommis meines Vaters, der in seiner Not gelegentlich um eine Mahlzeit betteln kam, sie alle machten die mich bedrückende Gewissenslast noch schwerer. Ein Psychoanalytiker würde mühelos nachweisen, daß die Wurzeln dieses Schuldkomplexes tiefer reichten als die Krise unserer häuslichen Wirtschaftslage. Könnte er indessen noch um eine Stufe tiefer dringen, so würde er, jenseits der individuellen Schicht des besonderen Falles, auf den archetypischen Verhalt stoßen, aus dem sich Millionen verschiedener Variationen zum gleichen Thema entwickelt haben. – „Wehe denen, die da leiern zum Klang der Harfe und sich salben mit dem besten Öl, aber sich nicht grämen um den Schaden des Volkes."
Nachdem mir auf diese Weise ein persönlicher Konflikt die Sinne geschärft hatte, war ich reif für die erschütternde Entdeckung, daß Weizen verbrannt und Obst vorsätzlich vernichtet wurde und daß Schweine ertränkt wurden, damit in den Jahren der Krise die Preise stabil blieben und fette Kapitalisten weiterhin zu den Klängen der Harfen singen konnten, während Europa unter dem Gedröhn der Hungermärsche erzitterte und mein Vater seine abgeschabten Manschetten unter dem Tisch verbarg. Diese abgeschabten Manschetten waren der Zunder und die ertränkten Schweine waren sozusagen der Docht, die das archetypische Erlebnis zur Explosion brachten. Man sang die „Internationale", aber es hätten ebensogut die älteren Worte sein können: „Wehe den Hirten, die sich selbst geweidet haben, sollten nicht die Hirten die Schafe weiden."
Auflösung des Mittelstandes
Auch in anderer Hinsicht ist diese Geschichte typischer, als es den Anschein hat. Ein beträchtlicher Teil des Mittelstandes war, wie wir selber, durch die Inflation der zwanziger Jahre ruiniert worden. Es war dies der Anfang vom Untergang Europas. Durch die Auflösung der mittleren Gesellschaftsschichten kam der unheilvolle Polarisationsprozeß in Gang, der bis auf den heutigen Tag angehalten hat. Die verarmten mittleren Stände wurden zu Rebellen der Rechten oder der Linken, eine soziale Völkerwanderung, aus der Schickelgruber und Dschugaschwili zu ungefähr gleichen Teilen profitierten. Diejenigen, die ihren Absturz nicht zugeben wollten und sich an das Phantom einer versunkenen Epoche klammerten, gingen zu den Nationalsozialisten und trösteten sich, indem sie Versailles und die Juden für ihr Schicksal verantwortlich machten. Vielen war nicht einmal dieser Trost vergönnt; sie hatten jeden Daseinszweck verloren und krochen wie ein großer schwarzer Schwarm müder Winterfliegen ziellos auf den trüben Fensterscheiben Europas umher.
Die andere Hälfte wandte sich nach links und bestätigte damit die Prophezeiung des Kommunistischen Manifests:
„Ganze Bestandteile der herrschenden Klasse werden in das Proletariat hinabgeworfen oder wenigstens in ihren Lebensbedingungen bedroht. Sie führen dem Proletariat eine Menge Bildungselemente zu."
Zu diesen „Bildungselementen" gehörte, wie mir zu meiner Begeisterung klar wurde, auch ich. Solange ich dicht am Verhungern gewesen war, hatte ich mich als einen zeitweilig aus der Bahn geratenen Abkömmling des Bürgertums betrachtet. Als ich aber im Jahre 1931 endlich ein ausreichendes Einkommen gefunden hatte, fand ich es an der Zeit, mich dem Proletariat anzuschließen. Doch die Ironie dieses Zusammenhanges wurde mir erst später bewußt.
„Die Familie der Bourgeois fällt natürlich weg ... mit dem Verschwinden des Kapitals ... Die bürgerlichen Redensarten über Familie und Erziehung, über das traute Verhältnis von Eltern und Kindern werden um so ekelhafter, je mehr infolge der großen Industrie alle Familienbande für die Proletarier zerrissen ... werden."
Soweit das Kommunistische Manifest. Jede Seite aus dem Werk von Marx und mehr noch aus dem von Engels brachte mir damals neue Enthüllungen und ein geistiges Entzücken, wie ich es bis dahin nur ein einziges Mal, bei meiner ersten Berührung mit Freud, empfunden hatte. Aus dem Zusammenhang gerissen, klingt das obige Zitat lächerlich; als Teil eines geschlossenen Systems hingegen, das die Sozialphilosophie sich nach einem klaren und verständlichen Schema ordnen läßt, hatte der Nachweis der historischen Realität von Institutionen und Idealen – Familie, Klasse, Patriotismus, bürgerlicher Moral, sexueller Tabus – die berauschende Wirkung einer plötzlichen Befreiung von den rostigen Fesseln, in die eine mittelständische Vorweltkriegskindheit den Geist geschlagen hatte. Heute, wo die marxistische Philosophie in einen byzantinischen Kult entartet und jeder einzelne Grundsatz des marxistischen Programms in sein Gegenteil verdreht worden ist, lassen sich jene leidenschaftlichen Gefühle und geistigen Rauschzustände kaum noch nachempfinden.
Ich war zu dieser Bekehrung reif, weil mein persönliches Schicksal mich darauf vorbereitet hatte, wie Tausende von anderen Angehörigen der Intelligenz und des Mittelstandes durch ihr persönliches Schicksal dafür reif gemacht worden waren; so weitgehend sich diese Schicksale aber auch von Fall zu Fall unterschieden, sie hatten alle einen gemeinsamen Nenner: den schnellen Verfall der moralischen Werte und des alten Lebensstiles im Nachweltkriegseuropa und die gleichzeitige Lockung der neuen Heilsbotschaft aus dem Osten.
Das „Rote Jahrzehnt"
Ich trat der Partei, die für uns ehemaligen Kommunisten bis zum heutigen Tag „die" Partei geblieben ist, im Jahre 1931 bei, zu Beginn jener kurzlebigen Periode des Optimismus, jener mißlungenen geistigen Renaissance, die später unter der Bezeichnung „Rotes Jahrzehnt" bekannt war. Die strahlendsten Erscheinungen dieser trügerischen Morgenröte waren Barbusse, Romain Rolland, Gide und Malraux in Frankreich, Piscator, Becher, Renn, Brecht, Eisler und Anna Seghers in Deutschland; Auden, Isherwood und Spender in England; Dos Passos, Upton Sinclair und Steinbeck in den Vereinigten Staaten. Die kulturelle Atmosphäre war gesättigt mit Kongressen von revolutionären Schriftstellern, mit Experimentalbühnen, mit Komitees gegen Krieg und Faschismus, mit Gesellschaften für kulturelle Beziehungen mit der Sowjetunion, mit russischen Filmen und Avantgardezeitschriften. Es sah tatsächlich aus, als wäre die westliche Welt unter den Nachwehen des Krieges, unter der Geißel von Inflation, Krise, Arbeitslosigkeit und dem Mangel eines Glaubens, für den zu leben sich verlohnte, endlich im Begriffe, den langersehnten Marsch anzutreten: „Brüder zur Sonne, zur Freiheit – Brüder, zur Sonne, zum Licht." Der neue Stern von Bethlehem war im Osten aufgegangen, und für ein bescheidenes Eintrittsgeld war „Intourist" bereit, den Pilger einen kurzen und gut gelenkten Blick in das gelobte Land werfen zu lassen.
Ich lebte damals in Berlin. Während der vorhergehenden fünf Jahre hatte ich für die Zeitungen des Ullstein-Verlages gearbeitet, zunächst als Auslandskorrespondent im Mittleren Osten, dann in Paris. Schließlich, im Jahre 1930, wurde ich von Paris zum Redaktionsstab des Berliner „Hauses" berufen. Zum besseren Verständnis des Folgenden müssen hier einige Worte über den damaligen Verlag Ullstein, ein Symbol der Weimarer Republik, gesagt werden.
Der Ullstein-Verlag war eine Art Supertrust, die größte Organisation dieser Art in Europa und wahrscheinlich in der ganzen Welt. Er gab allein in Berlin vier Tageszeitungen heraus, darunter die im achtzehnten Jahrhundert gegründete ehrwürdige Vossische Zeitung und die B.Z. am Mittag, ein Blatt, das mit seiner Auflage und dem Tempo seiner Nachrichtenvermittlung einen journalistischen Rekord aufgestellt hatte. Daneben veröffentlichte das Ullstein-Haus mehr als ein Dutzend Wochen- und Monatszeitschriften, unterhielt einen eigenen Nachrichtendienst, ein eigenes Reisebüro, und gehörte zu den führenden Buchverlagen. Die Firma gehörte den fünf Gebrüdern Ullstein – sie waren fünf, wie die ersten Gebrüder Rothschild, und wie diese jüdischer Abstammung. Ihre Politik war liberal und in kulturellen Fragen fortschrittlich bis zum Avantgardismus. Sie dachten antimilitaristisch und antichauvinistisch; und es war zum großen Teile ihrem Einfluß auf die öffentliche Meinung zu verdanken, daß die Politik der deutsch-französischen Annäherung der Briand-Stresemann-Ara in den fortschrittlichen Kreisen des deutschen Volkes ein positives Echo fand. Das Haus Ullstein stellte nicht nur einen politischen Machtfaktor dar, es war gleichzeitig auch die Verkörperung des liberalen Kosmopolitismus der Weimarer Republik. Die Atmosphäre im Verlagsgebäude in der Kochstraße glich eher der eines Ministeriums als der einer Redaktion.
Meine Versetzung von Paris nach Berlin ging auf einen Artikel zurück, den ich aus Anlaß der Verleihung des Nobelpreises für Physik an den Prinzen de Broglie geschrieben hatte. Meine Chefs fanden, daß ich ein Talent für populärwissenschaftliche Darstellungen besäße (ich hatte in Wien Naturwissenschaften studiert), und boten mir den Posten des wissenschaftlichen Redakteurs der „Vossischen" und eines wissenschaftlichen Beraters für die übrigen Ullstein-Publikationen an. Der Tag, an dem ich in Berlin eintraf, war der schicksalsschwere 14. September 1930 – der Tag der Reichstagswahlen, bei denen die NSDAP die Zahl der Abgeordneten in einem gewaltigen Sprung von 4 auf 107 erhöhen konnte. Auch die Kommunisten hatten Gewinne zu verzeichnen, während die Parteien der demokratischen Mitte zermalmt wurden. Es war der Anfang vom Ende der Weimarer Republik; die Situation war am treffendsten zusammengefaßt in Knickerbockers berühmtem Buch „Deutschland so oder so?" – wobei das eine „so" auf dem Titel durch das Hakenkreuz illustriert war, das andere durch Hammer und Sichel. Augenscheinlich gab es keine dritte Möglichkeit.
Begegnung mit Marx, Engels und Lenin
Ich tat meine Arbeit und schrieb über Elektronen, Chromosomen, Raketenschiffe, Neanderthaler und Spiralnebel; doch der zunehmende Druck der politischen Ereignisse wurde bald unentrinnbar. Bei einer Arbeitslosenzahl von rund einem Drittel aller Lohnempfänger lebte Deutschland in einem Zustand latenten Bürgerkrieges, und wenn man nicht als untätiges Opfer von dem nahenden Sturm hinweggefegt werden wollte, war es unumgänglich, sich politisch zu entscheiden. Stresemanns Partei war tot, die Sozialdemokraten betrieben eine Politik opportunistischer Kompromisse; die Kommunisten, hinter denen die mächtige Sowjetunion stand, schienen die einzige Kraft, um dem Ansturm der primitiven Horden mit dem Hakenkreuztotem Widerstand zu leisten. Doch es war nicht diese defensive Erwägung, die mich zur KPD hinzog. Ich war der Elektronen und Protonen satt und hatte begonnen, mich ernsthaft mit Marx, Engels und Lenin zu beschäftigen. Die Lektüre des „Feuerbach" und vor allem von Lenins „Staat und Revolution" löste in mir die seit langem fällige geistige Explosion aus. Der Ausdruck, es sei einem plötzlich „ein Licht aufgegangen", ist eine armselige Bezeichnung für das geistige Entzücken, das dem Bekehrten widerfährt – ganz gleich, zu welchem Glauben er bekehrt worden ist. Das neue Licht scheint von allen Seiten in die Schädelhöhle hereinzudringen; die verwirrende Fülle der Erscheinungen nimmt plötzlich eine faßbare Gestalt an, als hätte ein Zauberstab die verstreuten Mosaikstücke eines Puzzle-Spiels mit einem Schlag zusammengefügt. Von nun an gibt es auf jede Frage eine Antwort; Zweifel und Konflikte gehören der qualvollen Vergangenheit an, jener weit zurückliegenden Vergangenheit, als man noch in schmachvoller Unwissenheit in der faden, farblosen Welt der Uneingeweihten gelebt hat. Von jetzt an ist die innere Ruhe und Heiterkeit des Bekehrten durch nichts mehr zu gefährden – höchstens noch durch gelegentliche Anwandlungen der Furcht, er könne den Glauben wieder verlieren und damit alles dessen verlustig gehen, was das Leben allein lebenswert macht, um in die Dunkelheit zurückzustürzen, wo Heulen und Zähneklappern herrscht. Damit allein läßt sich vielleicht erklären, daß Leute, die an und für sich sehen und denken können, noch im Jahre 1950 guten Glaubens der kommunistischen Bewegung treu bleiben können. Es war stets nur eine kleine Minderheit in der Geschichte, die mit der Gefahr der Exkommunizierung zu spielen und im Namen einer abstrakten Wahrheit seelisches Harakiri zu begehen vermochte.
Mein Eintritt in die Partei