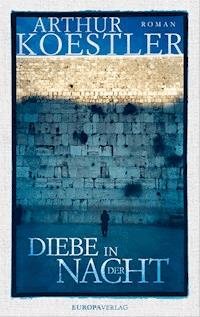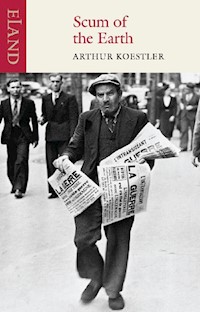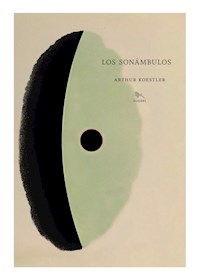Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als im Juli 1936 nach einem Generalputsch der Spanische Bürgerkrieg ausbricht, zeigen sich viele Intellektuelle auf der ganzen Welt solidarisch mit der bedrohten Republik. Auch Schriftsteller und Journalist Arthur Koestler reist wenig später als Kriegsberichterstatter nach Spanien. Dort erlebt er die Eroberung Málagas durch die Truppen von General Franco mit. Kurz darauf wird Koestler von faschistischen Putschisten festgenommen und durch ein Standgericht zum Tode verurteilt. Auf seine Hinrichtung wartend, beginnt Koestler, seine Beobachtungen und Gedanken in Ein spanisches Testament niederzuschreiben. Mit seinen autobiografischen Erinnerungen an jene bewegte Zeit ist Koestler das wohl bedeutendste Werk zum Spanischen Bürgerkrieg gelungen. Schriftstellerkollegen wie Walter Benjamin und Thomas Mann haben Koestlers Buch hoch gelobt. Robert Neumann beschrieb es als eines jener raren Beispiele, in denen ein Mensch über seine Möglichkeiten hinauswächst, wenn es ihm "an den Kragen geht". Gekonnt stellt Koestler in Ein spanisches Testament nüchterne Beschreibungen der Kriegswirren neben intimste Selbstreflexionen im Angesicht des eigenen Todes. Dabei vermittelt er ein erschreckend realistisches Bild über die Zustände seiner eigenen Inhaftierung und gibt somit Tausenden, die sein Schicksal teilten, ein Gesicht. Arthur Koestler kam später durch einen Gefangenenaustausch frei und gilt heute zu Recht als einer der bedeutendsten Intellektuellen und Aktivisten des 20. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ARTHUR KOESTLER
EINSPANISCHESTESTAMENT
Die englische Originalausgabe ist 1937 unter dem Titel Spanish Testament bei Victor Gollancz Ltd., London, erschienen.
Die vorliegende Neuausgabe basiert auf der im Jahr 1938 von Arthur Koestler und dem Europa Verlag Zürich herausgegebenen Ausgabe.
1. eBook-Ausgabe 2018© 1937 Arthur Koestler © 2018 Europa Verlag GmbH & Co. KG,Berlin · München · Zürich · WienUmschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Bildes von © picture alliance / Fred SteinLayout & Satz: BuchHaus Robert Gigler, MünchenKonvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-220-6ePDF-ISBN: 978-3-95890-221-3
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
INHALT
AUS DEM VORWORT DER HERZOGIN VON ATHOLL, KONSERVATIVES MITGLIED DES ENGLISCHEN UNTERHAUSES
Kapitel I.
Kapitel II.
Kapitel III.
Kapitel IV.
Kapitel V.
Kapitel VI.
Kapitel VII.
Kapitel VIII.
Kapitel IX.
Kapitel X.
Kapitel XI.
Kapitel XII.
Kapitel XIII.
Kapitel XIV.
Kapitel XV.
Kapitel XVI.
Kapitel XVII.
Kapitel XVIII.
Kapitel XIX.
Kapitel XX.
Kapitel XXI.
EPILOG
MARCO CLAAS NACHWORT
AUS DEM VORWORT DER HERZOGIN VON ATHOLL, KONSERVATIVES MITGLIED DES ENGLISCHEN UNTERHAUSES
Am 8. Februar 1937, sechs Monate nach Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs, eroberten die Truppen General Francos die Stadt Málaga. Der Verfasser dieses Buches befand sich in der belagerten Stadt, in Ausübung seiner beruflichen Pflicht als Berichterstatter einer englischen Zeitung. Er blieb in Málaga, auch nachdem die republikanischen Truppen die Stadt geräumt hatten; er wollte den Einzug der Aufständischen als Augenzeuge miterleben und hoffte zugleich, dass die Anwesenheit eines ausländischen Zeugen einen mildernden Einfluss auf die angekündigten Racheakte der Sieger haben würde. Am Tage nach dem Einzug der Rebellenarmee wurde er verhaftet, eingekerkert und zum Tode verurteilt. Öffentliche Proteste in England und Frankreich verhinderten die Vollstreckung des Urteils und erwirkten schließlich seine Befreiung. Dieses Buch enthält den Bericht seiner Erlebnisse in den Todeszellen des Kerkers von Sevilla und seine Tagebuchaufzeichnungen aus jenen Monaten, in denen er die Hinrichtungen seiner Leidensgefährten beobachtete und seine eigene Hinrichtung erwartete.
Ein glücklicher Zufall hatte es dem Verfasser ermöglicht, als Berichterstatter einer liberalen Zeitung gleich nach Ausbruch des Bürgerkriegs das Rebellengebiet zu bereisen, das sonst nur Vertretern rechtsgerichteter Zeitungen zugänglich war. Sein Besuch im Hauptquartier General Queipo da Llanos war kurz, aber aufschlussreich. Die liberale Orientierung seiner Zeitung ermöglichte es ihm, ungewöhnlich offen über das von ihm Gesehene zu sprechen. Andere Berichterstatter konnten das nicht, da besonders jene Zeitungen, die ständige Vertreter bei den Rebellen unterhielten, vieles verschweigen, vieles sogar widerrufen mussten, um ihre Vertreter vor Vergeltungsmaßnahmen zu schützen. Man wird sich erinnern, dass 1937 zwei bekannte konservative englische Journalisten General Francos Gebiet verlassen mussten, da die unerträglichen Beschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit ihnen die Ausübung ihrer Berufspflicht unmöglich machten.
Die Tatsachen, die Arthur Koestler nach seiner damaligen Rückkehr aus dem Rebellengebiet in der Presse und in einem ersten Buch1 veröffentlichte, erschütterten die Überzeugungen vieler, die bis dahin angenommen hatten, dass Grausamkeiten nur auf der Seite der Republikaner verübt worden seien und dass General Franco seinen Aufstand unternommen habe, um Spanien vor einer kommunistischen Revolte zu retten.
Arthur Koestler gab in jenem ersten Buch eine bedeutend sachlichere Analyse der Ursachen des Kampfes, vor allem der Agrarfrage, in der er die Wurzel des spanischen Übels sah. Die Ausrufung der Republik brachte zwar eine etwas fortschrittlichere Agrargesetzgebung, aber die sogenannte »radikale Regierung« Lerrouxs machte sie wieder rückgängig, und die Löhne sanken bis zu einer Stufe, die sogar unter dem Niveau der alten Monarchie lag. Der Verfasser beschrieb das unglaubliche wirtschaftliche und kulturelle Elend vor allem der bäuerlichen Bevölkerung, deren Erbitterung durch die grausame Niederschlagung des Aufstandes in Asturien im Jahre 1934 noch stieg. Diese Vorgänge waren es, die zur Bildung der »Frente Popular«, einer Koalition aller Fortschrittsparteien führten, die im Februar 1936 aus den Wahlen als Sieger hervorging. Das Buch gab eine Analyse der unmittelbaren Vorgeschichte und der ersten Monate des Kriegs, es schilderte anhand von Dokumenten und Augenzeugenberichten die Kriegspraxis beider Parteien und setzte sich sachlich mit jenen Behauptungen über einen angeblichen kommunistischen Aufstandsplan auseinander, die zur Rechtfertigung der Rebellion General Francos in der Welt verbreitet worden sind.
Arthur Koestlers Schilderung der Zustände im belagerten Málaga, mit dem Ein spanisches Testament beginnt, zeigt uns, mit welch furchtbaren Schwierigkeiten die spanische Regierung in den ersten Monaten zu kämpfen hatte, gerade weil sie über keine ausgebildeten Truppen verfügte und der Aufstand sie völlig unvorbereitet traf. Es muss allerdings hinzugefügt werden, dass in dem seither vergangenen Jahr ein sehr deutlicher Fortschritt erzielt worden ist; die Regierung und die republikanischen Parteien haben es verstanden, unter ungünstigsten Bedingungen eine wohlorganisierte Armee auf die Beine zu stellen, deren Leistungen Respekt erfordern.
Der angebliche kommunistische Aufstandsplan erscheint nach alldem ebenso legendär wie die Behauptung, dass die Regierung der spanischen Republik kommunistisch war oder ist.
Überdies ist eine der stärksten Charaktereigenschaften der Spanier ein ausgeprägter Individualismus, und es ist kaum anzunehmen, dass Spanien sich jemals der strikten Kontrolle beugen würde, die der Kommunismus mit sich bringt.
Die Kenntnis dieser Zusammenhänge mag dem Leser die seltsamen und erschütternden Erlebnisse des Autors, die er in seinem Buch schildert, noch näherbringen. Seine Tagebuchaufzeichnungen aus dem Zuchthaus in Sevilla, die Schilderung der mitternächtlichen Exekutionen, brachten mir die Tragödie dieses Volkes lebendiger vor Augen als alles, was ich jemals über Spanien gelesen habe.
Katharine Atholl
Das Sterben, auch wenn es im Namen einer überpersönlichen Sache erfolgt, ist eine durchaus persönliche Angelegenheit. Da diese Aufzeichnungen vorwiegend vom Sterben meiner Gefährten handeln und zum Teil in akuter Todesangst geschrieben worden sind, ist es unvermeidlich, dass sie stark persönliche Züge tragen.
Ich widme sie meinem Freunde Nicolas, einem unbedeutenden Soldaten der spanischen Republik, der am 14. April 1937, am Jahrestag der Ausrufung dieser Republik, im Gefängnis von Sevilla erschossen wurde.
Arthur Koestler
1Menschenopfer unerhört. Ein Schwarzbuch über Spanien. Paris, 1937.
I.
Sechs Wochen lang herrschte an den spanischen Fronten relative Ruhe.
Der Winter war kalt, vom Guadarrama kam der Wind über Madrid in Peitschenschlägen; die Mauren in ihren Gräben bekamen Lungenentzündung und spuckten Blut. Die Pässe in der Sierra Nevada wurden ungangbar, die Milizionäre der Republik hatten keine Uniformen und Decken und ihre Spitäler kein Chloroform; sie mussten sich erfrorene Finger und Füße ohne Narkose wegsägen lassen. Im Anarchistenlazarett in Málaga sang einer die Marseillaise, während man ihm zwei Zehen abnahm; diese Methode wurde später populär.
Dann kam der Frühling und alles wurde gut; die Knospen sprangen und die Tanks fuhren wieder. Eine gütige Natur ermöglichte es, dass General Queipo de Llano seine lang geplante Offensive gegen Málaga bereits Mitte Januar beginnen konnte.
Man schrieb das Jahr 1937. General Gonzales Queipo de Llano, der vor nicht langer Zeit gegen die Monarchie konspiriert, in der Madrider Libertad Artikel geschrieben und in den Kaffeehäusern an der Puerta del Sol seine Sympathien für den Kommunismus beteuert hatte, befehligte jetzt die zweite Division der spanischen Insurgentenarmee. Er hatte in sein Zimmer im großen Hauptquartier zu Sevilla ein Mikrofon einbauen lassen und hielt täglich Punkt acht Uhr abends eine einstündige Rede. »Die Marxisten«, sagte er, »sind reißende Tiere, wir aber sind Caballeros. Der Señor Companys verdient, abgestochen zu werden wie ein Schwein.«
Die Armee General de Llanos bestand aus 50 000 Mann italienischer Infanterie, drei Banderas der Fremdenlegion, 15 000 Stammeskriegern aus Afrika. Der Rest der Truppen, etwa zehn von Hundert, war spanischer Nationalität.
Die Offensive begann am 10. Januar.
Ich saß damals in Paris und hatte gerade ein Buch über den Spanischen Bürgerkrieg beendet; die deutsche und die französische Ausgabe waren bereits erschienen, die englische in Vorbereitung. Am 15. Januar rief die Redaktion des News Chronicle aus London an und fragte, ob ich Lust hätte, sogleich nach Spanien zurückzukehren. Ich hatte in den Monaten vorher als Kriegsberichterstatter Portugal und das Rebellengebiet, Madrid und Katalonien bereist; jetzt war Málaga in den Brennpunkt gerückt.
Ich verließ Paris in der gleichen Nacht, fuhr mit dem Zug nach Toulouse und flog von dort nach Barcelona. Ich blieb in Barcelona nur einen Tag; die Stadt machte einen ziemlich deprimierenden Eindruck. Es gab kein Brot, keine Milch, kein Fleisch; vor den Geschäften standen lange Schlangen. Die Anarchisten machten die Regierung verantwortlich und entfalteten eine scharfe Agitation; an allen Straßenbahnfenstern klebten ihre Flugzettel. Die Spannung in der Stadt hatte einen ungesunden Grad erreicht. Es schien, dass auf diesem exotischen Schauplatz nicht nur die weltpolitischen Gegensätze, sondern zugleich auch die tragischen Konflikte innerhalb der europäischen Linken ausgetragen werden sollten.
Ich war froh, dass ich keinen Artikel über Barcelona schreiben musste. Am 16. abends fuhr ich zusammen mit William Forrest vom News Chronicle nach Valencia weiter. Sein Ziel war Madrid, meines Málaga.
Der Zug nach Valencia war überfüllt. In jedem Abteil saßen, lagen und standen viermal so viele Milizionäre, als es fasste. Ein freundlicher Schaffner installierte uns in einem Coupé erster Klasse und sperrte, um uns gegen jede Störung zu sichern, die Tür von außen zu. Kaum hatte sich der Zug in Fahrt gesetzt, als vier anarchistische Milizionäre vom Korridor aus gegen die Abteiltür zu hämmern begannen. Wir wollten öffnen, aber es ging nicht, wir saßen in einem Käfig; der Schaffner mit dem Schlüssel war nirgends zu erblicken. Wir konnten uns beim Lärm des fahrenden Zuges durch die geschlossene Tür nicht verständlich machen, und die Milizionäre glaubten, es sei purer böser Wille, dass wir nicht öffneten. Die Situation wurde dramatisch und umso dramatischer, als Forrest und ich uns nicht zurückhalten konnten, zu grinsen, was die Wut der Milizionäre noch mehr steigerte. Der halbe Wagen versammelte sich vor der Glastür, um die beiden allem Anschein nach faschistischen Provokateure zu betrachten. Endlich kam der Schaffner und sperrte die Tür auf und erklärte alles; und es gab eine große Verbrüderung und ein entsetzliches Gedränge; und katalanische Lieder und eine große Fresserei.
Als der Morgen graute, hatte der Zug bereits sechs Stunden Verspätung. Er fuhr so langsam, dass die Milizionäre von den Trittbrettern sprangen, eine Handvoll Orangen aus den Hainen pflückten, die dicht an der Böschung standen und unter allgemeinem Beifall wieder in den Zug zurückkletterten. Diese Unterhaltung wurde bis gegen Mittag fortgesetzt. Todesopfer waren keine zu beklagen; nur einer hatte sich beim Abspringen das Bein verstaucht. Er blieb auf der Böschung sitzen und war offensichtlich für den Bürgerkrieg verloren.
Auch Valencia präsentierte sich in der strahlenden Januarsonne mit einem nassen und einem heiteren Auge. Das Papier war knapp; einige Zeitungen hatten nur vier Seiten, drei waren mit Bürgerkrieg gefüllt, die vierte mit der Fußballmeisterschaft, mit Stierkämpfen, Theater- und Filmkritiken. Zwei Tage vor unserer Ankunft war eine Verordnung erschienen, wonach die berühmten Valencianer Kabaretts »in Anbetracht des Ernstes der Zeit« um neun Uhr abends zu schließen hatten. Natürlich spielten alle weiter bis ein Uhr nachts, mit der Ausnahme eines einzigen Lokals, das sich streng an das Gesetz hielt. Der Besitzer wurde später als Franco-Agent entlarvt und sein Kabarett geschlossen.
Auf eine Telefonverbindung mit London musste man oft fünf bis sechs Stunden warten. Wenn mir das Warten abends im Hotel zu lang wurde, lief ich schnell hinunter ins Kabarett gegenüber. In den Logen saßen die hübschen Artistinnen brav mit ihren Mamas, Tanten und Geschwistern. Wenn ihre Nummer kam, tanzten und sangen sie mehr oder minder unbekleidet, mehr oder minder begabt ihre Piècen, dann gingen sie zu ihren Mamas und Tanten in die Loge zurück und tranken Limonade. Hätte sich ein vermessenes Mannsbild in ihre Nähe gewagt, ich glaube, er wäre sofort als Faschist verhaftet worden. An den Wänden hingen Plakate: »Bürger, benehmt euch diszipliniert, die Stunde ist ernst. Wir gönnen jedem sein Amüsement, aber keine Frivolitäten usw.« Im Oktober, als ich zuletzt in Valencia war, war jede zweite Nummer ein Nackttanz gewesen; jetzt waren Büstenhalter und Lendenschurz obligatorisch.
Das Telefonieren entbehrte übrigens auch nicht eines gewissen Reizes. Man musste der Zensur bei der Anmeldung des Gesprächs eine Kopie der durchzugebenden Meldung einreichen; während man die Meldung aus seinem Hotel durchtelefonierte, saß der Zensor in seinem Büro, den Text vor den Augen und hörte mit ab. Die Zensur war streng, aber die Zensoren ad personam waren gemütliche Leute, die man alle persönlich kannte. Wenn man vom Text abwich, brüllten sie ins Telefon:
»He, Arturo, das steht nicht im Manuskript.«
»Was, was?«, schrie die verzweifelte Stenotypistin in London.
»Das geht Sie gar nichts an«, sagte der Zensor, »ich spreche mit Arturo.«
Am Sonntag, den 24. Januar, sollte ein großer Stierkampf auf der Plaza del Toro stattfinden; »zu Ehren des russischen Botschafters, der sein Erscheinen persönlich zugesagt hat«, verkündeten die Zeitungen. Der Reinertrag sollte der Sowjetunion offeriert werden für den Bau eines neuen »Komsomol« – »Komsomol« hieß ein russischer Frachtdampfer, der mit Lebensmitteln für Valencia von einem Rebellenschiff versenkt worden war. Aber am Sonntag regnete es, und der Stierkampf wurde im Radio zwischen zwei Frontberichten mit Bedauern abgesagt.
Tags vorher dagegen hatte es sehr schönes Wetter gegeben – wir waren im Auto eines deutschen emigrierten Schriftstellers ein bisschen an den Strand hinausgefahren: der Schriftsteller, sein Chauffeur, Forrest und ich. Der Schriftsteller, wir wollen ihn Alberto nennen (die o’s bekamen wir alle gratis an unsere Namen gehängt), war politischer Kommissär bei der n-ten Kompanie der Internationalen Brigade. Er war auf Fronturlaub in Valencia. Er hatte früher psychoanalytische Romane geschrieben, aber die Uniform stand ihm dennoch sehr gut. Wir legten uns in den Sand, blinzelten in die Sonne, konstatierten, dass angesichts des Meeres und des blauen Himmels der Krieg eine sehr unlogische Affäre sei, und führten ähnlich tiefsinnige Gespräche. Als wir zum Auto zurückkamen, saßen da vier fremde Männer, die sich schwitzend bemühten, es in Bewegung zu setzen, während der Chauffeur, ein kleiner vierzehnjähriger Spanier, weinend danebenstand. Die Tränen liefen ihm über die Wangen herunter.
Einer der Männer verlangte von Alberto den Startschlüssel und bemerkte, dass das Auto requiriert sei. Er zückte seine Legitimation von irgendeiner Kontrollkommission der Iberischen Anarchisten-Föderation »gegen den Missbrauch staatlicher Autos zu privaten Vergnügungszwecken«. Auch seine drei Kollegen waren Anarchisten. Sie hatten entsetzlich große Pistolen, wie sie sonst nur in stummen Wildwestfilmen vor dem Krieg zu sehen waren. Ich hatte den Verdacht, dass man sie von hinten mit schwarzem Schießpulver und Bleikugeln lud.
Auch Alberto zückte seine Legitimation als politischer Kommissär der n-ten Kompanie und protestierte gegen die Requirierung des Autos. Eine Menschenmenge hatte sich angesammelt – Leute in Schwimmanzügen, Uniformen, Frauen und Kinder – und folgte mit freundlichem Interesse den Vorgängen.
Alberto und der Anarchist fuchtelten mit ihren Legitimationen herum wie Duellanten mit ihren Visitenkarten. Der Anarchist sagte, ein Kommissär, der trotz Bürgerkriegs und Benzinmangels sein Auto zu Strandspazierfahrten benutze, könne ihm nicht imponieren, und das Auto sei requiriert.
Alberto sagte, ein Krieger auf Urlaub brauche Erholung, und die Anarchisten möchten aussteigen, widrigenfalls er sie gewaltsam exmittieren werde.
Der Chauffeur war wahnsinnig erschrocken, stand daneben und versuchte den Tränenbach, der ihm über die Wangen lief, durch die Nase wieder hochzupumpen.
Der Anarchistenhäuptling bemühte sich zwischendurch, das Auto in Gang zu setzen. Irgendwo im Bauch der misshandelten Maschine krachte es. Dieser Laut löste bei Alberto eine Welle des Jähzorns aus. Er bekam einen dichterischen Wutanfall. Er zerrte heftig am Ärmel des Anarchisten und brüllte dabei deutsch und aus voller Kehle: »Rrraus, rrraus, rrrausl«
Das imponierte den Anarchisten sehr. Die Wut Albertos war offensichtlich ein Beweis seines reinen Gewissens und seiner bona fide. Sie grinsten und kletterten aus dem Auto heraus. Einer schlug Alberto mit seiner Pistole freundlich auf die Schulter und meinte: »Das nächste Mal erschießen wir dich doch.«
Wir stiegen ein, der Chauffeur schnäuzte sich und startete. Unter den begeisterten Akklamationen der Zuschauer fuhren wir nach Valencia zurück.
Am Tage ehe ich nach Málaga weiterfuhr, wohnte ich im Küstenort X., unweit von Valencia, einer Truppenparade bei. General Julio hatte mich dazu eingeladen.
Die Parade war für europäische Begriffe armselig, fast komisch; für spanische Begriffe war sie ein Wunder an Disziplin und Präzision. Exerziert wurde mit Stöcken; der Truppenteil hatte für neunhundert Mann einhundertvierzig Gewehre. Eine Maschinengewehr-Kompanie führte Zerlegen und Frischmontieren eines Maschinengewehres vor. General Julio Deutsch zog seine Stoppuhr: die Übung hatte hundertfünf Sekunden gedauert, eine sehr schlechte Zeit. Der Kompanieführer starrte ihn an, als sei er verrückt geworden.
»Was starrst du so?«, fragte ihn General Julio.
»Ich habe nie gehört, dass man so etwas mit der Uhr misst«, sagte der Kompanieführer, »ich dachte, das gibt’s nur bei athletischen Wettläufen; aber es ist eine großartige Idee.«
»Ich werde dir eine Stoppuhr kaufen«, sagte der General.
»Das ist großartig«, sagte der Kompanieführer, »die Faschisten werden Augen machen.«
Sie waren alle sehr begeistert für »nuestro general«, der weiße Zwirnhandschuhe trug und lauter großartige und ein bisschen verrückte Ideen hatte, auf die sonst niemand kam. Er hatte zum Beispiel eine besondere Art von Schnalle erfunden, mit der man einen Spaten am Rucksack befestigen konnte. Hat man je so etwas gehört? Es war geradezu wie bei einer richtigen Armee. Nichts schmeichelte den improvisierten Truppen der spanischen Republik mehr, als wenn man ihnen sagte, es sei bei ihnen »schon fast wie bei einer richtigen Armee«.
Man erzählte mir eine Menge Anekdoten aus den ersten Tagen des Bürgerkrieges. Zum Beispiel, dass die Milizionäre der berühmten Kolonne Durutti sich geweigert hatten, Spaten zum Eingraben an die Front mitzunehmen. Sie erklärten mit ihrem doppelten Stolz als Katalanen und Anarchisten: »Wir gehen, um zu kämpfen und zu sterben, aber nicht um zu arbeiten.« Die ersten Truppen der Kolonne Durutti merkten erst nach vierundzwanzigstündiger Eisenbahnfahrt an die Aragonfront, dass man vergessen hatte, Menage mitzunehmen; vielmehr, man war gar nicht erst auf die Idee gekommen, dass der Krieg eine besondere Technik der Verpflegung erfordert.
Die Welt wunderte sich, dass die Rebellen, von Bajadoz über Toledo und Talavera bis Madrid, fast mühelos Sieg nach Sieg feierten. Jeder, der die Verhältnisse nur ein bisschen kennt, wunderte sich über das Gegenteil: dass die Republik den Angriff ihrer eigenen Armee überhaupt überlebte.
Ich persönlich wunderte mich auf der ganzen Heimfahrt, warum der General seinen dicken Militärmantel nicht auszog, obwohl die Sonne brannte und der Schweiß über sein Gesicht hinunterlief. Erst im Hotel erfuhr ich den Grund: Er hatte seinen Mantel und seine Uniformkappe und weiße Zwirnhandschuhe; aber noch keine Uniform.
Am 25. Januar kamen katastrophale Nachrichten von der Südfront. Die Rebellen hatten Marbella und Alhama de Granada erobert – zwei strategische Schlüsselpositionen – und so gut wie keinen Widerstand gefunden. Das Schicksal Málagas musste sich in den nächsten Tagen entscheiden.
Es war nicht einfach, nach Málaga zu gelangen. Die Eisenbahnlinie war abgeschnitten; alle Autobusse waren für Kriegszwecke beschlagnahmt, das Benzin rationiert worden; zwei Kollegen warteten schon seit Tagen auf eine Gelegenheit, hinunterzufahren. Am 26. Januar war es endlich so weit. Die Presseabteilung des spanischen Außenministeriums hatte uns einen Wagen samt Chauffeur zur Verfügung gestellt und Brennstoff-Bezugscheine für dreihundert Kilometer. Bis Málaga sind es rund siebenhundert; aber es zeigte sich, dass man unten im Süden umso leichter Benzin bekam, je weiter man sich von der strengen Rationierungskontrolle der Hauptstadt entfernte.
Wir waren zu viert: Frau G. G., die für skandinavische Blätter arbeitete, W., ein polnischer Journalist, der Chauffeur und ich.
II.
Wir übernachteten in Alicante und erreichten Almeria Mittwochabend, am 27. Januar.
Ich war ziemlich deprimiert, und da ich keine Lust hatte, Artikel zu schreiben, tippte ich meine Notizen auf lose Blätter ab. Es wurde eine Art Tagebuch daraus, ich hatte seit meiner Kindheit keines mehr geführt; eine Chronik der letzten Tage von Málaga.
Ich gebe diese Aufzeichnungen über die Agonie einer Stadt und über die sonderbaren Schicksale der Menschen, die in ihr lebten und starben, unverändert wieder.
Almeria, Donnerstag, den 28. Januar
B. M. von der Internationalen Brigade, den ich gestern in Murcia sprach, erzählte in seiner pedantischen Art, wie im Laufe des italienischen Tankangriffs an der Prado-Front zweiundvierzig Deutsche von der n-ten Kompanie in ihrem Graben massakriert wurden, weil sie nicht rechtzeitig den Befehl zum Rückzug erhalten hatten. Das Erste, was mir heute beim Aufwachen einfiel, war diese Geschichte; ich habe einige der Opfer aus Paris gekannt. Sinnlose Hekatomben, Bürokratismus und Unfähigkeit, wo man hinblickt.
10 Uhr. Besuch mit G. G. beim englischen Konsul in Almeria. Bot uns keine Stühle an – nicht aus Unhöflichkeit, sondern weil er sich offenbar an die spanische Sitte der Steh-Palaver gewöhnt hat. Wir wollten hauptsächlich herausfinden, ob es noch britische Kriegsschiffe im Hafen von Málaga gibt, um, falls wir abgeschnitten werden, auf dem Seeweg zu flüchten. Er sagte, seines Wissens läge noch ein Panzerkreuzer im Hafen, aber alle ausländischen Konsuln, den englischen mit inbegriffen, haben Málaga bereits verlassen. Er meint, es werde ein furchtbares Gemetzel geben; das Proletariat von Málaga – er benützte den Ausdruck »Proletariat« – werde sich bis zum letzten Mann verteidigen.
Er war nett und hilfsbereit – diese englischen Konsuln in gottverlassenen spanischen Nestern ragen wie Säulen aus einer Sintflut; trocken und solide.
Mittags fuhren wir weiter. Die Straße wird schlechter und schlechter; an mehreren Stellen ist sie von Gebirgsläufen überflutet, die jetzt in der Regenperiode überall aus der Sierra brechen. Man fragt sich, wie da Lastautos mit Truppen und Munition durchkommen sollen. Aber es kommen auch gar keine durch. Die Straße – die letzte und einzige Straße, die Málaga noch mit dem regierungstreuen Spanien verbindet – ist vollkommen verödet. Es sieht aus, als ob die Stadt bereits aufgegeben wäre. Wir kamen an keinem einzigen Transportauto vorbei. Aber ebenso wenig kamen uns Flüchtlinge entgegen. Es war, als führen wir durch eine nasse, menschenleere Wüste. Gespenstig.
3 Uhr nachmittags. Motril. Melancholisches Fischernest. Kein Mensch weiß, wo die Militär-Kommandantur ist; wir finden sie schließlich im Schulgebäude. Erneute Herumfragerei nach dem Kommandanten. Es dauert eine Stunde, bis er ausfindig gemacht wird: ein junger Mensch mit einem Fünftagebart, müden, übernächtigen Augen; war früher Postmeister, Mitglied des Prieto-Flügels der Sozialistischen Partei.
Wir fragen ihn, warum die Straße so leer ist, ob keine Transporte durchkommen; er zuckt die Achseln. »Vor drei Tagen«, sagt er, »kamen zwanzig Lastautos mit Munition für die Südfront in Almeria an. In Almeria sollte die lokale Gewerkschaftsleitung die Munition übernehmen und nach Málaga weiterbefördern, denn die Lastautos aus Valencia mussten zurückkehren. Aber die Gewerkschaftsleitung in Almeria lehnte ab: Sie brauche ihre Lastautos für die Lebensmittelversorgung; die Autos aus Valencia sollten den Weitertransport selbst besorgen. Es gab Krach, und schließlich fuhren die zwanzig Lastautos nach Valencia zurück, und ihre Fracht liegt irgendwo in Almeria herum, und Málaga ist ohne Munition. Die Rebellen können die Stadt nehmen, wann immer es ihnen passt. Möglich, dass sie schon drin sind, wenn Sie Málaga erreichen …«
G. G. hat sich das alles brav notiert; gleich darauf zerreißt sie ihre Notizen. Das ist kein Kabelstoff für Kriegsberichterstatter.
»Übrigens«, sagt der Kommandant, »übrigens können Sie gar nicht weiterfahren. Die große Brücke hinter Motril ist kaputt, die Straße ist überschwemmt. Sie müssen warten, bis der Regen aufhört.«
»Das heißt, dass Málaga von der Außenwelt abgeschnitten ist?«
»Solang es regnet – ja.«
»Und wie lange regnet es hier schon?«
Der Kommandant zählt seine Finger ab:
»Heute haben wir den vierten Tag ununterbrochen Regen. Und dann, bis vor einer Woche, da hatten wir eine andere Regenperiode von zehn Tagen.«
»Und wie lange ist die Brücke schon kaputt?«
»Seit vier oder fünf Monaten.«
»Und warum, zum Kuckuck, wird sie nicht repariert?«
Erneutes Achselzucken. »Wir kriegen weder Baumaterial noch Spezialisten aus Valencia.«
Die scheinbare Apathie des Mannes brachte mich ganz aus dem Häuschen. Ich erklärte ihm, dass Málagas Schicksal von dieser Brücke abhänge – was er ohnehin wusste –, und ich sagte etwas von »krimineller Pflichtversäumnis«.
Er blickte uns an aus seinen übernächtigten Augen:
»Ihr Ausländer«, sagte er, »seid immer gleich so nervös. Es kann sein, dass wir Málaga verlieren, es kann auch sein, dass wir Madrid und halb Katalonien verlieren, aber am Ende werden wir trotzdem gewinnen.«
Es ist eine starke Dosis von orientalischem Fatalismus in der Art, wie die Spanier Krieg führen – auf beiden Seiten. Mag sein, dass der Kampf deshalb so gemütlich-schleppend und zugleich so bestialisch grausam ist. Andere Kriege bestehen aus einer Folge von Schlachten – dieser ist eine Kette von Tragödien.
Übrigens ist gestern Motril von zwei Capronis bombardiert worden. Das Ziel war nicht die Stadt selbst, sondern eine kleine Fischerkolonie in der Bucht. Resultat: eine Frau, zwei Kinder und eine Ziege erschlagen. Zwei Stunden später kehrten die beiden Flugzeuge zurück und legten noch eine Bombe auf das gleiche Ziel. Es war offenbar ein sportliches Privatunternehmen der beiden Piloten; vielleicht hatten sie miteinander gewettet. Resultat: noch zwei Ziegen erschlagen. Frau, Kinder und Ziegen wurden heute früh alle zusammen feierlich bestattet.
Um halb fünf fahren wir weiter, trotz der kaputten Brücke. Wir müssen ungefähr zehn Kilometer über sumpfige Feldwege fahren, den letzten Kilometer durch ein Strombett, bis zu den Achsen im Wasser. Für Lastautos ist der Weg natürlich unpassierbar.
Letzte Etappe vor Málaga: Almuñecar. Es steht da ein vormals berühmtes Schweizer Hotel, mit Seeterrasse und allem, was dazugehört; Graf Reventlow empfahl es uns wärmstens. Der Besitzer, ein verträumter, dicklicher Mann aus Zürich, begrüßt uns in schönstem Schwyzerdütsch:
»Sie sind meine ersten Gäste seit sechs Monaten. Sie müssen schon entschuldigen, wenn nicht alles ganz so sauber ist wie sonst; es ist nämlich Krieg in Spanien, wie Sie vielleicht gehört haben dürften.«
Wir beruhigen ihn: Wir hätten auch von dem Krieg gehört. Nach zwei Stunden des Wartens auf der Seeterrasse zaubert der Mann eine vorzügliche Mahlzeit herbei, und wir fahren weiter.
Wir erreichten Málaga nach Einbruch der Dunkelheit.
Der erste Eindruck: eine Stadt nach einem Erdbeben. Finsternis; ganze Straßenzüge in Trümmern; die heil gebliebenen Straßen menschenleer, gleichfalls mit Trümmern übersät; tödliches Schweigen und jener gewisse Geruch in der Luft, den wir alle aus Madrid kennen: feiner Kalkstaub, vermischt mit Branddunst und – oder ist es Einbildung? – der widerliche Gestank verbrannten Fleisches.
Das Lichtbündel unserer Scheinwerfer irrt zitternd über eingestürzte, ausgebrannte Häuser, über Ruinen und nochmals Ruinen. Madrid nach den großen November-Bombardements war ein Kuraufenthalt im Vergleich zu dieser agonisierenden Stadt. Pulvis et praetera nihil.
Im Speisesaal des Hotels Regina sitzen wüst aussehende, aber ansonsten ganz umgängliche Milizionäre herum, spucken auf die Marmorfliesen und essen das einzige in Málaga beschaffbare Gericht: gebratene Sardinen. Wir sind die einzigen Gäste; der Kellner erzählt uns, dass gerade heute Nachmittag eine 500-Kilo-Bombe im Nachbarhaus eingeschlagen hat; zweiundfünfzig Tote allein in diesem Haus.
Die übrigen Kellner sitzen um einen Tisch, essen gebratene Sardinen und besprechen das Bombardement und wie sich jeder Einzelne dabei benahm; wie Bernardo unter einen Tisch kroch und Jesus aus dem Fenster schaute und Dolores, die Köchin, sich siebenundfünfzig Mal bekreuzigt hat, bevor sie in Ohnmacht fiel.
G. G. und ich wollen abends noch ein bisschen durch die Stadt bummeln, aber die Finsternis draußen ist so unheimlich, dass wir sehr rasch wieder umkehren. Der Portier sieht sich beim Öffnen den klaren Sternenhimmel an. »Vorzügliches Wetter für Luftangriffe«, meint er. Seine Tochter hat beim gestrigen Bombardement beide Beine eingebüßt, und er stellt Betrachtungen darüber an, ob ihr Bräutigam sie ohne Beine nehmen wird.
Freitag, den 29. Januar
Kein Brot zum Frühstück, nichts als schwarzen Kaffee; die Lebensmittelversorgung der Stadt ist ebenso zusammengebrochen wie die Munitionszufuhr. Hier sieht man, was die kaputte Brücke von Motril bedeutet: Die Stadt mit ihren zweihunderttausend Einwohnern ist am Verhungern.
Vormittags die Amtsstellen abgeklappert: Propaganda-Abteilung. Gobierno Civil, Hauptquartier. Überall guter Wille, aber Unfähigkeit und hoffnungslose Desorganisation.
Unmöglich, Telegramme durchzugeben; es gibt keine Zensurstelle für ausländische Pressevertreter. Nach langem Palavern erreichen wir schließlich, dass ein junger Offizier, der etwas Französisch versteht, zum Zensor ernannt wird.
Nach dem Mittagessen schaute ich mir den Hafen an. Der Hafeneinfahrt gegenüber ist das britische Konsulat. In der Fassade ein sauberes Loch: Ein Geschoss von einem Rebellenkreuzer trat hier ein, ohne vorherige Anmeldung. Es explodierte zum Glück nicht, aber der Konsul hatte genug und ging nach Gibraltar, was man ihm auch nicht verdenken kann. Auch das englische Kriegsschiff liegt nicht mehr im Hafen. Europa scheint am Schicksal Málagas nicht interessiert zu sein.
Ein paar Männer und Frauen kommen vom Hafen gelaufen, die Gesichter gen Himmel erhoben. Gleich darauf beginnen die Glocken zu läuten: Fliegeralarm. Es gibt nicht einmal Sirenen. Alles rennt kopflos durcheinander, die Panik ist viel schlimmer als je in Madrid. Die Stadt ist kleiner, die Zielpunkte heben sich durch das Meer deutlicher ab; und die Bevölkerung ist sichtlich demoralisiert. Es war übrigens ein blinder Alarm.
Auf dem Rückweg fütterte ich einen alten Droschkengaul mit Brotkrusten aus meiner Hosentasche. Der Kutscher kam, nahm sie mir aus der Hand und fraß sie auf.
Nachher Interview mit Oberst Villalba, Befehlshaber der Streitkräfte von Málaga. Er gibt offen zu, dass es ziemlich schlimm aussieht: aber vor zehn Tagen, als er ernannt wurde, habe es noch viel schlimmer ausgesehen.
»Ich inspizierte zuerst den gefährdetsten Frontsektor«, erzählt er, »die Küstenstraße Marbella-Gibraltar. Ich sah weder Schützengräben noch befestigte Stellungen, bloß zwei Milizionäre, die in etwa drei Kilometer Abstand vom feindlichen Vorposten auf einem Meilenstein saßen und Zigaretten rauchten. Das war die ›Front‹.«
»Wo sind eure Leute?«, fragte ich.
»Da hinten irgendwo im Dorf«, antworteten sie. »Wenn die Faschisten vorrücken wollen, so sehen wir das von hier und haben Zeit genug, die Kameraden zu benachrichtigen. Wozu sollten sie hier draußen im Regen herumsitzen?«
Diese Stadt ist ein Albdruck. Gehe voll böser Vorgefühle zu Bett; versuche mich zu überzeugen, dass, wer an den historischen Materialismus glaubt, nicht an Vorgefühle glauben darf.
Samstag, den 30. Januar
Besuchten die Marbella-Front, von der Villalba gestern erzählte. Fuhren die Küstenstraße entlang über Torremolinos und Fuengirola, ohne einem einzigen Posten zu begegnen, bis wir, nach rund fünfzig Kilometern, von einer Steinbarrikade aufgehalten werden: Das ist also die Front. Rechts von der Barrikade hat man gerade angefangen, einen Schützengraben zu bauen. Die Milizionäre sitzen herum, die Spaten auf ihren Knien. G. G. zückt ihren Fotoapparat. »Kameraden«, ruft der Kommandant, »arbeitet, ihr werdet fotografiert.« Er fragt uns, wie uns die Front gefällt. Ich frage ihn, was er zu tun beabsichtige, wenn Tanks kommen. Er zuckt die Achseln: »Dann gehe ich mit meinen Leuten in die Sierra.«
Sonntag, den 31. Januar
Um elf Uhr sollte uns Commander Alfredo abholen, um uns zum Frontabschnitt von Antequera zu begleiten. Wir warten vergeblich auf ihn. Am Nachmittag kommt ein Milizleutnant, sagt, dass Alfredo krank und er beauftragt ist, uns zur Front zu bringen. Gegen vier fahren wir los. Ich kontrolliere gewohnheitsgemäß auf der Karte den zurückgelegten Weg, aus Angst, falsch zu fahren und den Rebellen in die Hände zu geraten. Das ist bei der Diskontinuität und strategischen Ungereimtheit der spanischen Fronten sehr leicht möglich. Einigen Journalisten ist es passiert; und sogar einer ganzen Anzahl von Offizieren aus beiden Lagern.
Nach zwanzig Minuten ist es klar, dass wir falsch gefahren sind. Die Ortsnamen stimmen nicht. Ich mache den Leutnant auf seinen Irrtum aufmerksam. Er lächelt über den Ausländer, der alles besser wissen will. Wieder ist während der ganzen Fahrt kein Posten, keine Patrouille, nichts zu sehen, was auf die Nähe der Front schließen ließe. Schließlich finden wir zwei Milizionäre, die die Chaussee entlangmarschieren. Es stellt sich heraus, dass wir tatsächlich falsch gefahren sind: die Straße führt nach Alfernate und nicht nach Antequen, wohin wir fahren wollten. Die nächste Ortschaft, sechs oder acht Kilometer vor uns, heißt Colmenar. Wir fragen, wem Colmenar gehört:
»Uns«, sagt der eine Milizionär.
»Den Faschisten«, sagt der andere.
Der Leutnant ist wütend. Schließlich fahren wir weiter nach Colmenar. In der letzten Kurve vor der Ortschaft spähen wir durch die verregneten Fenster und wissen nicht, was wir als Nächstes erblicken werden: die grünen Turbane der Mauren oder die schwarzen Kappen der Milizionäre.
Weder – noch. In ganz Colmenar ist keine Militärperson zu sehen. Die Front liegt fünfundzwanzig Kilometer weiter nördlich.
Der Leutnant will über einen Feldweg, der auf der Karte nicht eingezeichnet ist, quer hinüber nach Antequera. Es dämmert schon. Wir meutern und beschließen, geradeaus weiterzufahren. Von unbekannten Feldwegen wollen wir nichts wissen. Nach einer halben Stunde erreichen wir die Front bei Alfernate. Sie sieht etwas beruhigender aus als der Sektor, den wir gestern sahen: Es gibt betonierte Unterstände zu beiden Seiten der Chaussee.
Aber die Chaussee selbst ist frei. Sie läuft kontinuierlich weiter auf die Rebellenstellung zu, die vier Kilometer vor uns liegt.
Ich frage den Kapitän des Sektors, warum er die Chaussee nicht zerstört habe. Er sagt indigniert, so etwas täte man nicht: Man brauche die Chaussee für eine mögliche Offensive. Die Unterstände zu beiden Seiten genügten, um ein Vorrücken der feindlichen Infanterie zu verhindern.
»Und wenn Tanks kommen?«
Der Kapitän zuckt die Achseln. »Gegen Tanks hilft ohnehin nichts.«
»Dennoch«, frage ich, »was tut ihr, wenn sie kommen?«
»Dann gehen wir in die Sierra.«
(P.S. London, Herbst 1937. Auf dieser Chaussee brachen fünf Tage später die italienischen Tanks durch, um ungehindert bis nach Málaga zu rollen.)
Montag, den 1. Februar
Heute endlich bekamen wir die Front von Antequera zu sehen, zu der wir gestern fahren wollten. Es ist die malerischste und verrückteste Front, die ich je gesehen habe.
Wie so ziemlich in ganz Spanien, mit Ausnahme des Sektors um Madrid, ist auch hier »Front« gleichbedeutend mit »Chaussee«. Nun führt die Chaussee Málaga–Antequera–Cordoba, unmittelbar ehe sie Antequera erreicht, über einen hohen Gebirgspass. Das Gebirge heißt Sierra el Torcal und ist ein westlicher Ausläufer der Sierra Nevada. Der Pass liegt tausend Meter hoch; über ihm ragt, fünfzehnhundert Meter hoch, ein kahler, spitzer Fels in die Wolken: der Teufelsturm. Da oben auf dem Teufelsturm sitzt Kapitän Pizarro und schaut auf die Chaussee hinunter, ob die Faschisten kommen. Neben ihm ist ein Telefon und ein eiserner Draht. Wenn die Faschisten kommen, dann soll Pizarro in die Etappe hinuntertelefonieren; da er aber überzeugt ist, dass das Telefon gerade in diesem kritischen Augenblick nicht funktionieren wird, hat er den Eisendraht legen lassen, der, achthundert Meter lang, längs des Felsens zur Etappen-Kommandantur hinunterläuft; wenn er oben dran zieht, dann läutet unten eine Glocke. Manchmal kommt ein Vogel und pickt an dem Draht, dann ist unten Alarm.
Das geht jetzt so seit sechs Monaten: seit dem Beginn des Bürgerkriegs hat sich in diesem malerischen Sektor nichts gerührt, außer den Wolken, die zu Füßen Pizarros aus dem Rebellengebiet ins Regierungsgebiet ziehen und umgekehrt.
Pizarro hat einen langen Bart und behauptet, ein direkter Nachfahre des Entdeckers von Südamerika zu sein. Als er damals, vor sechs Monaten, diesen Posten bezog, hatten seine Leute weder Decken noch Patronen. Die Nächte sind kalt in der Sierra; zu ihren Füßen lag das feindliche Antequera, wo es Patronen und Decken in Fülle geben musste. Kapitän Pizarro fühlte das alte Blut der Konquistadoren in seinen Adern und zog in einer stürmischen Nacht mit einer Handvoll seiner Leute nach Antequera hinunter, machte einen Überfall auf die Depots und holte Decken und Patronen. Bald darauf gingen ihnen die Zigaretten aus. Daraufhin machte Pizarro einen Überfall auf Antequera und holte Zigaretten. Dann kam der Frühling, und die Bauern hatten kein Korn zum Säen. Der Alkalde stieg feierlich auf den Teufelsturm hinauf und schlug Pizarro vor, er sollte einen Überfall auf Antequera machen und Saatkorn holen. Und Pizarro machte einen Überfall auf Antequera und holte Saatkorn.
Niemals noch waren in diesem abgeschiedenen Winkel des Bürgerkriegs Journalisten, und gar noch ausländische Journalisten, aufgetaucht. Es wurde eine große Festlichkeit. Wir stiegen in die Etappe hinunter, und es wurde ein Schaf geschlachtet, und als wir uns ans Mahl setzten, zog von oben einer an der Glocke, und vom Berg gegenüber schoss es Salut.
Pizarro zeigte uns strahlend alle seine Schätze: ein Maschinengewehr (wir mussten jeder ein Stück des Streifens abfeuern); seine Kavalleriepferde (zwei wurden mitten in die Bauernstube hineingeführt, in der das Mahl stattfand, und schnupperten in die Schüssel mit dem Schaf); eine Kiste voller Handgranaten (wir wurden aus Höflichkeit aufgefordert zu schmeißen, lehnten aber dankend ab). Besonders G. G. hatte es ihnen angetan, erstens, weil sie eine Frau war, und zweitens Hosen trug und drittens einen Fotoapparat hatte. Sie bekam sogar ein lebendes Zicklein geschenkt; es liegt neben meiner Schreibmaschine, während ich dies tippe und klopft mit seinen harten, kleinen Hufen auf den Tisch und jammert nach seiner Mutter und weiß nicht, dass es ein Symbol ist: das Symbol der exzessiven Gutmütigkeit und Kindlichkeit dieses Volkes, dem man die Mohren auf den Hals geschickt hat.
Natürlich fragte ich auch Pizarro, besessen von meiner fixen Idee, was er zu tun gedenkt, wenn die Tanks kommen. Er sagte: »Mögen sie kommen! Wir werden sie mit unseren nackten Händen erwürgen, diese Teufelsmaschinen.«
Dienstag, den 2. Februar
Vormittags Artikel geschrieben. Mittags Besuch bei Sir Peter Chalmers-Mitchell2. Das gepflegte Haus, halb spanisch, halb viktorianisch, und der schöne Garten wirken wie eine verzauberte Oase in dieser Gespensterstadt. Er kam nach Málaga, um hier, wie man so sagt, einen »friedlichen Lebensabend zu verbringen«; Abenteurernaturen seiner Art scheinen einen besonderen Instinkt dafür zu haben, wo man Lebensabende am friedlichsten verbringen kann. Wir freundeten uns an; er lud mich ein, wenn die Sache kritisch wird, in sein Haus zu übersiedeln. Er ist entschlossen zu bleiben, was immer geschehen mag. Ich habe das vage Gefühl, dass ich gleichfalls bleiben werde. Diese Stadt und ihr Schicksal üben eine sonderbare und unbehagliche Anziehungskraft aus.
Sir Peter erzählte übrigens, dass er die Anarchisten für die einzigen vernünftigen Leute, die Kommunisten und Sozialisten für bürokratische Reaktionäre halte. Er hatte die gleichen hungrigen Augen wie alle Leute in dieser Stadt, lebt von Zwieback und gebratenen Sardinen und hat, außer Köchin, Wirtschafterin und Gärtner, noch die Tante der Köchin, die Tochter der Wirtschafterin, Frau und Schwiegermutter des Gärtners zu versorgen; die ganze Sippe wohnt im Gärtnerhäuschen, und in der Garage hausen außerdem an die zwanzig Frauen und Kinder. Flüchtlinge aus dem evakuierten Gebiet. Don Pedro – so nennen sie ihn – lebt unter ihnen wie der alte Scheich eines Beduinenstammes.
Ins Hotel zurückgekehrt, holte ich das Zicklein – wir hatten es Joséfine getauft – aus dem Badezimmer und ließ es vom Chauffeur, mit G. G.s Einverständnis, zu Sir Peter schaffen. An den Hals Joséfines hängten wir eine Papierrolle mit einem Zitat aus Platos Gastmahl;