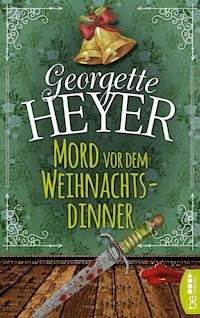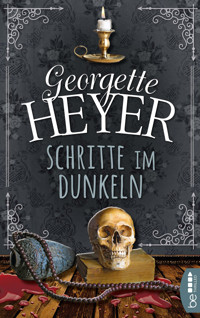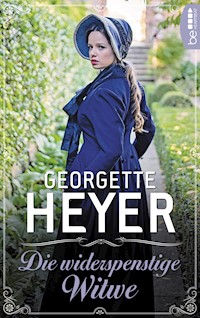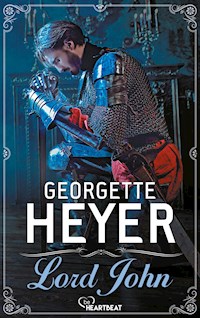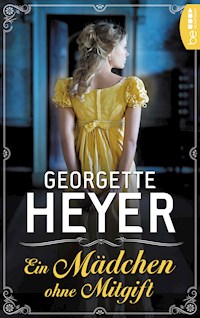
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liebe, Gerüchte und Skandale - Die unvergesslichen Regency Liebesromane von Georgette
- Sprache: Deutsch
Charity Steane - von allen nur Cherry genannt - fristet ein Aschenputtel-Dasein bei ihren bösartigen Verwandten, die sie immer wieder spüren lassen, dass eine junge Frau ohne Mitgift nichts wert ist. Doch dann begegnet das Waisenmädchen mit den schönen Brombeeraugen auf einem Ball dem begehrten Junggesellen Viscount Desford. Endlich scheint sich für Cherry alles zum Guten zu wenden. Aber der Vater des attraktiven Viscounts fürchtet um den Ruf der Familie, und so stiften unerlaubte Küsse, Flucht und eine Scheinverlobung eine Reihe charmanter Verwirrungen.
"Ein Mädchen ohne Mitgift" (Im Original: "Charity Girl") besticht mit wundervollen Figuren und einer unterhaltsamen Geschichte. Ein charmanter Regency-Klassiker von Georgette Heyer - jetzt als eBook bei beHEARTBEAT. Herzklopfen garantiert.
"Ein großartiges Buch ... Georgette Heyer ist unschlagbar."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Über dieses Buch
Charity Steane – von allen nur Cherry genannt – fristet ein Aschenputtel-Dasein bei ihren bösartigen Verwandten, die sie immer wieder spüren lassen, dass eine junge Frau ohne Mitgift nichts wert ist. Doch dann begegnet das Waisenmädchen mit den schönen Brombeeraugen auf einem Ball dem begehrten Junggesellen Viscount Desford. Endlich scheint sich für Cherry alles zum Guten zu wenden. Aber der Vater des attraktiven Viscounts fürchtet um den Ruf der Familie, und so stiften unerlaubte Küsse, Flucht und eine Scheinverlobung eine Reihe charmanter Verwirrungen.
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Ein Mädchen ohne Mitgift
Aus dem Englischen von Emi Ehm und Ilse Walter
Digitale Neuausgabe
«be» – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © Georgette Heyer, 1970
Die Originalausgabe CHARITY GIRL erschien 1970 bei William Heinemann.
Copyright der deutschen Erstausgabe:
© Paul Zsolnay Verlag GmbH, Hamburg/Wien, 1971.
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © Richard Jenkins Photography
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimapr (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7325-8917-3
www.lesejury.de
Kapitel 1
Soweit ein älterer Herr mit verdorbenem Magen und einem besonders heftigen Gichtanfall über etwas vergnügt sein konnte, das nicht mit der Linderung seiner verschiedenen Beschwerden zusammenhing, traf das für den Earl of Wroxton zu. Im Augenblick amüsierte er sich damit, seinem Erben eine Standpauke zu halten. Wer nicht wusste, worum es wirklich ging, musste die ätzenden Bemerkungen für unangebracht halten, denn der Viscount Desford war seiner ganzen Erscheinung nach ein Sohn, auf den jeder Vater stolz sein konnte: ein gutgeschnittenes Gesicht, eine geschmeidige, sportliche Figur und sicheres Auftreten, geboren aus natürlicher Liebenswürdigkeit und guter Erziehung. Er besaß ein großes Maß an Geduld, und sein Sinn für Humor verriet sich in dem Lächeln, das in seinen Augen lauerte und von vielen Leuten für unwiderstehlich gehalten wurde, nicht jedoch von seinem Vater. Wenn die Gicht den Earl quälte, machte ihn dieses Lächeln rasend. Man schrieb Juli, aber es war alles eher denn heiß, und der Earl hatte in der Bibliothek Feuer machen lassen. Die beiden Herren saßen rechts und links am Kamin; der Earl stützte seinen dick bandagierten Fuß auf einen Schemel, und sein Erbe (der seinen Stuhl unauffällig von der Hitze der glimmenden Scheite weggerückt hatte) saß ihm gegenüber, elegant und lässig. Der Viscount trug die Jacke, die wildlederne Reithose und die hohen Stiefel, die als korrekter Vormittagsanzug für den Herrn galten, der sich vorübergehend auf dem Land aufhält; dennoch war der Schnitt seiner Jacke, die Anordnung seines Halstuchs so elegant, dass sein Vater ihn einen verdammten Dandy nannte. Worauf der Sohn sanft protestierend erwiderte: »Nein, nein, Papa! Die Londoner Dandys wären entsetzt, wenn sie dich hörten!«
»Das heißt also«, sagte sein Vater und starrte ihn düster an, »dass du dich für einen Lebemann hältst!«
»Ehrlich gesagt, Papa«, erwiderte der Viscount entschuldigend, »halte ich mich weder für das eine noch für das andere.« Er wartete einen Augenblick, während er ebenso mitfühlend wie vergnügt den Ärger seines Vaters beobachtete und dann einlenkend sagte: »Aber Papa! Was habe ich denn eigentlich verbrochen, dass du mir eine solche Standpauke hältst?«
»Was hast du getan, um dir mein Lob zu verdienen?«, erwiderte der Earl sofort. »Nichts! Du bist ein Wirrkopf, Bursche! Ein aalglatter Flederwisch; du denkst nicht daran, was du deinem Namen schuldig bist, als wärst du irgendein nichtsnutziger Bürgerlicher! Ein verdammter Verschwender bist du – und du brauchst mich nicht erst daran zu erinnern, dass du finanziell von mir unabhängig bist, dein Geld für Pferde, Wetten und leichte Frauenzimmer hinauswerfen kannst, wie es dir beliebt. Ich habe es damals gesagt und sage es heute noch und werde es immer wieder sagen: Es war typisch für deine Großtante, dass sie ihr Vermögen ausgerechnet dir hinterlassen hat. Genau das war zu erwarten, denn sie war total verwirrt. Sie hat dir praktisch eine carte blanche für Extravaganzen aller Art ausgestellt. Aber über diese Dinge«, fügte Seine Lordschaft, zwar nicht wahrheitsgemäß, doch völlig aufrichtig hinzu, »will ich kein Wort verlieren. Sie war die Tante deiner Mutter, und dieser Umstand versiegelt mir die Lippen.«
Er schwieg und warf seinem Erben einen herausfordernden Blick zu, aber der Viscount sagte nur mit geziemender Nachgiebigkeit: »Sehr richtig, Papa!«
»Ich wäre ganz einverstanden gewesen, wenn sie bestimmt hätte, dass ihr Vermögen zum Unterhalt deiner Frau und Familie verwendet werden soll. Was nicht heißen will, dass ich damals und auch jetzt nicht imstande und bereit gewesen wäre, deine Apanage zu erhöhen, damit die Ausgaben, die dir durch deinen Eintritt in den Ehestand erwachsen, gedeckt wären.«
Wieder schwieg er, und da er offensichtlich eine Antwort erwartete, sagte der Viscount höflich, er sei ihm sehr verbunden.
»Oh nein, das bist du keineswegs!«, fauchte Seine Lordschaft. »Und wirst es auch nicht sein können, bevor du mir einen Enkel schenkst, mag das Vermögen deiner Großtante noch so schnell dahinschmelzen. Auf mein Wort, nette Kinder habe ich!«, sagte er, plötzlich weiter ausgreifend. »Kein Einziger von euch kümmert sich auch nur einen Deut um die Familie! In meinem Alter könnte ich schon zwanzig Enkelkinder haben, die meine letzten Jahre erfreuen! Aber habe ich sie? Nein! Kein einziges!«
»Genau genommen hast du schon drei«, hielt ihm der Viscount entgegen. »Ich erwähne sie aus Fairness Griselda gegenüber, obwohl ich nie den Eindruck hatte, dass dich ihre Sprösslinge erfreuen.«
»Mädchen!«, fuhr der Earl auf und fegte sie alle mit einer verächtlichen Geste beiseite. »Die zählen nicht! Außerdem sind es Broxbourne-Bälger. Ich will Söhne, Ashley! Caringtons, die unseren Namen erben, Träger unserer Würden und Bewahrer unserer Tradition!«
»Aber es muss doch nicht gleich ein ganzes Regiment sein!«, protestierte der Viscount. »Überlegen wir vernünftig, Papa: Angenommen, ich hätte dir den Gefallen erwiesen, schon mit zwanzig zu heiraten, und mein unglückseliges Weib hätte mir jedes Jahr Zwillinge geschenkt, dann wären es in deinen Augen noch immer mindestens um zwei zu wenig gewesen – ganz abgesehen davon, dass in einem solchen Schwarm von Enkelkindern wahrscheinlich mehrere Mädchen gewesen wären.«
Dieser Versuch, den Vater von seiner üblen Laune zu befreien, hätte vielleicht Erfolg gehabt (denn der Earl hatte Sinn für das Lächerliche). Doch ein plötzlicher Stich in dem schmerzenden Bein ließ den Earl zusammenzucken, und so stieß er drohend hervor: »Sei ja nicht vorlaut! Ich möchte dich daran erinnern, dass du – Gott sei Dank! – nicht mein einziger Sohn bist!«
»Nein«, pflichtete ihm der Viscount fröhlich bei. »Simon ist wohl noch zu jung, aber ich hoffe doch sehr, dass dich Horace mit einem reichen Kindersegen beglücken wird – das heißt, sobald die Besatzungstruppen aus Frankreich abgezogen werden, was dem Vernehmen nach bald geschehen soll, und Horace nach Hause zurückkehrt.«
»Horace!«, stieß Seine Lordschaft hervor. »Ich kann froh sein, wenn er nicht mit irgendeinem französischen Gänschen am Arm heimkehrt!«
»Oh, das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich«, sagte der Viscount. »Er schätzt Ausländer nicht und nimmt wie du sehr viel Rücksicht darauf, was er der Familie schuldig ist.«
»Das werde ich nicht mehr erleben«, sagte der Earl und versuchte vergeblich, sein hohes Alter als Druckmittel zu verwenden, denn gleich darauf setzte er verbittert hinzu: »Ach, was liegt euch schon daran!«
Der Viscount lachte, sagte aber sehr liebevoll: »Nein, nein, Papa! Versuch nicht, mit dem Tod zu kokettieren! Ich lebe seit neun Jahren in London, ich habe dich neunundzwanzig Jahre lang studiert und ich weiß genau, wann jemand versucht, mir einen Bären aufzubinden. Guter Gott, Papa, du bist schlank und rank, und abgesehen von deiner Anfälligkeit für Gicht, die nicht besser wird, wenn du ein Gutteil von zwei Flaschen Portwein auf einen Sitz leerst, wirst du noch etliche Runden durchstehen! Ich bin überzeugt, dass du auch noch meinen Sohn abkanzeln wirst, so wie heute mich!«
Unwillkürlich geschmeichelt, dass sein Erbe ihm eine so gute Verfassung bescheinigte, erwiderte der Earl streng, er verstehe die Jargonausdrücke nicht, die die heutige Jugend so beklagenswerterweise gebrauche, noch billige er sie. Einen Augenblick lang war er versucht, dem Viscount unmissverständlich klarzumachen, dass er seine Trinkgewohnheiten nicht mit ihm zu diskutieren wünsche, doch er nahm davon Abstand, weil Ashley möglicherweise eine Zurechtweisung nicht in kindlich-ergebenem Schweigen hinnehmen würde und der Earl einen Streit vermeiden wollte, bei dem er auf sehr unsicherem Boden stand. Stattdessen sagte er: »Einen Sohn von dir? Vielen Dank, Desford. Ich will keine unehelichen Bälger, von denen du vermutlich schon zwei Dutzend – ich meine, einige hast?«, verbesserte er sich hastig.
»Nicht dass ich wüsste, Papa«, sagte der Viscount.
»Freut mich, das zu hören. Aber hättest du der Heirat zugestimmt, die ich für dich plante, so könnte eben in diesem Augenblick dein Sohn auf meinem Knie sitzen!«
»Ich zögere, dir zu widersprechen, aber ich kann nicht glauben, dass ein Enkelkind, wollte es – eben in diesem Augenblick – versuchen, auf deinem Knie zu sitzen, etwas anderes als strenge Zurückweisung ernten würde.«
Der Earl quittierte diesen Hieb mit einem rauen Auflachen, sagte jedoch: »Na ja, du brauchst mich wirklich nicht so wörtlich zu nehmen! Wesentlich ist dein schlechtes Benehmen, als du Henrietta Silverdale keinen Heiratsantrag gemacht hast. Nie hätte ich gedacht, dass du dich so undankbar zeigen würdest, Desford! Es sah so aus, als hätte ich eine Braut für dich gewählt, die du entweder nicht mochtest oder gar nicht kanntest – was, wie ich dir verraten darf, zu meiner Zeit gar nicht so ungewöhnlich war. Stattdessen suchte ich ein Mädchen aus, mit dem du aufgewachsen bist und an dem du, wie ich glaubte, aufrichtig hängst. Ich hätte in viel höheren Kreisen Ausschau halten können, aber ich wollte ausschließlich dein Glück. Und wie hast du es mir gelohnt? Sag mir das!«
»Oh, um Gottes willen, Papa –!«, rief der Viscount und ließ sich zum ersten Mal Ungeduld anmerken. »Musst du unbedingt etwas aufs Tapet bringen, das sich schon vor neun Jahren abgespielt hat? Kannst du noch immer nicht glauben, dass Hetta eine Heirat genauso wenig wünschte wie ich?«
»Nein, das glaube ich nicht. Und erzähl mir nicht, dass du nicht an Hetta hängst.«
»Natürlich hänge ich an ihr – wie an einer Schwester! Wir sind die besten Freunde. Aber ein Mann will doch nicht seine Schwester heiraten, mag er sie noch so gernhaben. Wahr ist vielmehr, dass du, Papa, mit Sir John diesen Plan aushecktest. Dabei ist mir bis heute rätselhaft, wie ihr Einfaltspinsel annehmen konntet, dass es diesem köstlichen Plan förderlich wäre, uns so aufzuziehen, als seien wir tatsächlich Bruder und Schwester. Nein, nein, fauch mich nicht an, weil ich ‹Einfaltspinsel› sage! Erinnere dich, dass ich schon damals sagte, es sei mir ein Rätsel!«
»Ja, du hast eine glatte Zunge und bildest dir ein, dass du mich überlisten kannst«, knurrte sein Vater.
»Ach, leider weiß ich zu gut, dass ich das nicht kann!«, sagte der Viscount kläglich. »Aber verrate mir doch, warum du selbst erst vor Anker gingst, als du schon über dreißig warst, während du mich festnageln wolltest, bevor ich überhaupt großjährig war?«
»Um Unfug zu vermeiden«, antwortete der Earl mehr rasch denn klug.
»Oho!«, sagte der Viscount spöttelnd. »Das also war’s, ja? Ich habe allerdings schon lange den Verdacht, dass du – als junger Mensch – durchaus kein Muster an Ehrbarkeit warst, wie du uns weismachen willst.«
»Muster an Ehrbarkeit! Natürlich war ich das nicht!«, knurrte der Earl, die bloße Vermutung angewidert zurückweisend.
»Natürlich nicht!«, rief der Viscount lachend.
»Nein! Ich habe mich wie jeder junge Mensch ausgetobt, aber ich habe mich nie mit Wüstlingen verbrüdert.«
Dieser Vorwurf ließ das Lachen des Viscount schnell verstummen. Unter plötzlich gerunzelter Stirn richtete er einen prüfenden Blick auf seinen Vater und fragte: »Was heißt das? Solltest du mich damit meinen, so erlaube mir festzustellen, dass man dich falsch unterrichtet hat!«
»Nein, nein!«, erwiderte Seine Lordschaft verdrossen. »Ich spreche von Simon, du Schafskopf!«
»Simon! Wieso – was zum Teufel hat er angestellt, dass du so gereizt bist?«
»Du weißt ganz genau, welch ein Abenteurer er ist und dass er mit einer Bande schurkischen Abschaums der Gesellschaft beschämende Streiche ausheckt, alle möglichen ausgefallenen Narrheiten anstellt, Aufruhr und Krawalle inszeniert –«
»Nun, dazu sage ich dir Folgendes«, unterbrach der Viscount diese Anklage ohne viel Förmlichkeit. »Ich sehe Simon selten, doch du kannst dich darauf verlassen, dass ich es sofort erfahren würde, falls er in eine Gesellschaft geriete, wie du sie schilderst! Guter Gott, wenn man dich hört, könnte man meinen, dass sich Simon dem Bettlerklub angeschlossen hat oder jede Nacht wenn nicht im ‹Finish› dann auf der Wache landet! Wahrscheinlich würdest du die Bande, mit der er herumzieht, nicht goutieren. Ich goutiere sie auch nicht, aber das kommt daher, dass ich neunundzwanzig und nicht mehr dreiundzwanzig bin und die Rastlosigkeit meiner ersten Jugend überwunden habe. Schurken jedenfalls sind seine Kumpane nicht, und kein Abschaum! Du übertreibst, Vater, glaube mir!«
»Es ist wirklich ein Jammer, dass du ihn selten siehst!«, entgegnete der Earl. »Wie dumm von mir zu glauben, du würdest dir die Mühe nehmen, dich um ihn zu kümmern.«
»Ja, das hättest du wirklich besser wissen sollen«, antwortete der Viscount offenherzig.
»Vermutlich«, sagte der Earl, sichtlich seinen Zorn meisternd, »ist es vergeudete Liebesmüh, wenn ich dich bitte, den jungen Tunichtgut ein wenig zu zügeln.«
»Da hast du ganz recht, Papa. Meine Güte, glaubst du wirklich, er würde auf mich hören?«
»Nun ja«, antwortete Seine Lordschaft grollend, »trotz deiner vielen Fehler gehörst du zur ersten Gesellschaft, bist Mitglied des Four-Horse-Klubs und – dank meines Unterrichts! – ein ziemlich tüchtiger Fechter. Ich höre, dass sich die jüngeren Leute gern deiner Führung anvertrauen, und möglicherweise wäre daher dein Einfluss auf Simon größer als der meine.«
»Hättest du Brüder gehabt, Papa«, sagte der Viscount lächelnd, »dann wüsstest du, dass der jüngere meist genau das Gegenteil von dem tut, was ihm der älteste rät. Er lässt sich auf keinen Fall führen, selbst dann nicht, wenn der Bruder ein viel bedeutenderer Sportsmann wäre, als ich es bin. Es tut mir leid, dir nicht den Gefallen tun zu können, aber ich muss es energisch ablehnen, mich in Simons Angelegenheiten zu mischen. Ich glaube auch nicht, dass die geringste Veranlassung dazu besteht. Bist du anderer Meinung, dann obliegt es dir, ihn zu zügeln, und nicht mir.«
»Wie zum Teufel kann ich ihn zügeln?«, explodierte der Earl. »Er kümmert sich einen Teufel um andere, und obwohl du mich für einen Einfaltspinsel hältst, kann ich dir versichern, dass ich doch kein so großer Einfaltspinsel bin, seine Apanage zu streichen. Das fehlte noch, dass er bankrottginge und ich gezwungen wäre, ihn aus dem Schuldturm herauszuholen. Was allerdings nicht heißt, dass es ihm nicht guttäte, einmal eingesperrt zu werden!«
»Weißt du, Papa, du siehst die Zukunft Simons viel zu schwarz. Quäle dich doch nicht so schrecklich seinetwegen – selbst wenn er dich wirklich aufbringt!«
»Du quälst dich natürlich nicht – ich hätte es wissen müssen!«, grollte der Earl, wieder von einem stechenden Schmerz im Fuß attackiert. »Ihr seid alle gleich! Warum ausgerechnet mir ein Pack egoistischer, wertloser, undankbarer Bälger aufgehalst wurde, werde ich nie ergründen! Eure Mutter hat euch natürlich maßlos verwöhnt, und ich war so dumm, sie gewähren zu lassen! Du, verdammt noch mal, bist überhaupt der Schlimmste der Meute! Ich will nichts mit dir zu tun haben, und je früher du verschwindest, umso lieber ist es mir! Weiß Gott, was dich hergeführt hat, aber falls du mich besuchen wolltest, hättest du dir die Mühe sparen können. Ich will deine Visage nie wiedersehen!«
Der Viscount stand auf und sagte mit liebenswürdiger Gelassenheit: »Nun, dann werde ich meine Visage eben entfernen, Papa. Ich bitte dich nicht um deinen Segen, denn dein Anstandsgefühl würde dich zwingen, ihn mir zu geben, und ich bin überzeugt, du würdest an den Worten ersticken. Ich will dir nicht einmal die Hand hinstrecken – aber nur deshalb, weil ich mir eine verletzende Abfuhr ersparen will.«
»Geschleckter Affe!«, sagte sein Vater und streckte ihm die Hand hin.
Der Viscount ergriff sie, küsste sie respektvoll und sagte: »Gib gut Acht auf dich, Papa! Adieu!«
Der Earl sah Desford nach, als dieser zur Tür ging, und als er sie öffnete, rief ihm sein Vater mit zornerstickter Stimme zu: »Wahrscheinlich bist du nur heimgekommen, weil du etwas wolltest!«
»Aber sicher«, antwortete der Viscount und warf ihm einen übermütig spöttischen Blick über die Schulter zu. »Ich wollte Mama besuchen.«
Daraufhin trat er entschlossen den Rückzug an und ließ die Tür rasch ins Schloss fallen, bevor der Earl diesen letzten Pfeil mit einem Wutanfall quittierte.
In der Halle traf der Viscount den Butler, in dessen Blick so viel Kummer und Mitgefühl lag, dass Desford ein Kichern nicht unterdrücken konnte und dem betagten Familienfaktotum mitteilte: »Pedmore, du siehst mich heute zum letzten Mal! Mein Vater hat mich soeben hinausgeworfen. Er sagt, ich sei ein wertloser Wirrkopf und ein geschleckter Affe. Was er sonst noch sagte, fällt mir im Augenblick nicht ein. Hättest du je geglaubt, dass er so herzlos sein könnte?«
Der Butler schnalzte missbilligend und schüttelte den Kopf. Mit einem tiefen Seufzer sagte er: »Es ist die Gicht, Mylord, die macht ihn immer so übellaunig!«
»Übellaunig!«, rief der Viscount. »Du alter Schwindler, in Wirklichkeit meinst du, er sieht in jedem, der unklugerweise seinen Weg kreuzt, einen Feind.«
»Es steht mir nicht zu, Eurer Lordschaft recht zu geben, daher schweige ich lieber«, sagte Pedmore streng. »Und wenn mir ein Rat gestattet ist, da ich Ihren verehrten Herrn Vater viel länger kenne als Sie, Mylord, würde ich Sie ergebenst bitten, seinen Worten, wenn er die Gicht hat, kein Gewicht beizumessen, denn in Ihrem Fall meint er es nicht im Ernst! Und sollten Sie beleidigt sein, wäre er schrecklich traurig – wirklich, Mylord, was immer er auch zu Ihnen gesagt haben mag.«
»Heiliger Himmel, Pedmore, glaubst du, ich wüsste das nicht?«, sagte der Viscount und schenkte ihm ein herzliches Lächeln. »Du musst mich ja für einen Schafskopf halten! Wo finde ich meine Mutter?«
»In ihrem Salon, Mylord.«
Der Viscount nickte und lief die breite Treppe hinauf. Als er das Privatgemach seiner Mutter betrat, begrüßte sie ihn mit einem warmen Lächeln und ausgestreckter Hand. »Herein, herein, Liebster!«, sagte sie. »Hat man dir ganz grässlich die Leviten gelesen?«
Er küsste ihr die Hand. »Gott, ja!«, sagte er heiter. »Er hat mich in großem Stil abgekanzelt. Ja er wünscht sogar, meine Visage nie wiederzusehen.«
»Oh Himmel! Aber du weißt ja, dass er es nicht so meint. Natürlich weißt du’s: Du verstehst immer alles, ohne dass man es dir erklären muss, nicht wahr?«
»Wirklich? Das ist sehr unwahrscheinlich. Und ich glaube auch nicht, dass ihr davon überzeugt seid, denn ihr beide, du und der gute Pedmore, scheint zu glauben, dass man mir das erst versichern muss. Wer Papa kennt, muss schon ein rechter Schafskopf sein, wenn er nicht weiß, dass seine heftigen Ausbrüche nur auf eine Kolik und die Gicht zurückzuführen sind. Ich habe ohnehin schon das Schlimmste befürchtet, als ich ihn gestern Abend beim Dinner so herzhaft den Curry-Krabben zusprechen sah; und meine Befürchtungen wurden bestätigt, als er sich an die zweite Flasche Portwein machte. Bitte, glaube ja nicht, dass ich ihn kritisieren will, Mama, aber ist es nicht sehr unklug von ihm, derart zu schlemmen?«
»Natürlich«, erwiderte Lady Wroxton, »ist es sehr schlecht für ihn, aber Vorhaltungen fruchten nichts. Er wird nur unwirsch, wenn man ihm die von Dr. Chettle verordneten leichten Gerichte vorsetzt, während es ihn nach etwas höchst Unverdaulichem gelüstet. Du kennst ihn ja, Ashley. Kommt ihm etwas in die Quere, gerät er sofort in einen seiner sinnlosen Wutanfälle.«
»Ich weiß«, sagte der Viscount lächelnd.
»Danach fühlt er sich noch viel schlechter, ist erschöpft, verfällt in Niedergeschlagenheit und sagt, er sei schon total ausgebrannt, und es bleibe ihm nichts übrig, als die Schlussbilanz zu ziehen. Ebenso sehr leidet der ganze Haushalt, denn selbst Pedmore, der uns doch wirklich ergeben ist, lässt sich nicht gern etwas nachwerfen – besonders wenn es zufällig Hammelbrühe ist.«
»So schlimm ist es?«, fragte der Viscount erschrocken.
»Oh, nicht immer!«, versicherte seine Mutter gelassen. »Im Allgemeinen tut es ihm nachher sehr leid, und er versucht seine Unbeherrschtheit gutzumachen. Vermutlich wird er heute Abend ein bisschen herumquengeln, ich hoffe aber sehr, dass er sich morgen mit Semmelbrei oder gekochtem Huhn zufriedengibt; du brauchst also nicht so bestürzt dreinzuschauen, Liebster. Sehr wahrscheinlich wird es noch einige Wochen dauern, bis er wieder in seinen Lieblingsgerichten schwelgen kann.«
»Viel besorgter bin ich um dich, Mama! Ich weiß nicht, wie du dieses Leben ertragen kannst. Ich jedenfalls könnte es nicht.«
»Nein, du vermutlich nicht«, antwortete sie und sah ihn nachsichtig lächelnd an. »Du hast ihn ja nicht gekannt, als er noch jung war, und natürlich warst du auch nie in ihn verliebt. Ich aber weiß noch, wie lustig und schön und brillant er war, und wie glücklich wir waren. Und wir lieben einander noch immer, Ashley.«
Er runzelte leicht die Stirn und fragte unvermittelt: »Behandelt er auch dich so barbarisch, Mama?«
»Oh nein, nie! Ach ja, manchmal schimpft er mit mir, aber nachgeworfen hat er mir noch nie etwas – nicht einmal damals, als ich vorzuschlagen wagte, er solle doch etwas Rhabarber und Wasser in seinen Portwein tun, weißt du, ein vorzügliches Heilmittel für einen verdorbenen Magen, aber er wollte nichts davon hören. Ja, er ist richtig in Wut geraten.«
»Kein Wunder«, sagte der Viscount und lachte. »Du hast es wirklich fast verdient, dass er dir so ein Gebräu nachwirft!«
»Ja, das hat er auch gesagt, hat es aber dann doch nicht getan, sondern ist genau wie du in Gelächter ausgebrochen. Aber was hat ihn denn jetzt plötzlich derart in Wut versetzt, Liebster? Hast du etwas gesagt, das ihn aufgebracht hat? Du hast dir doch nichts zuschulden kommen lassen, und er war so erfreut, dich zu sehen. Deshalb gab es doch Curry-Krabben, und er ließ Pedmore den besten Portwein aus dem Keller holen.«
»Guter Gott, mir zu Ehren? Natürlich wagte ich nicht, es ihm zu sagen, aber ich mag Portwein überhaupt nicht, und dabei musste ich viel zu viel davon trinken. Nichts, das ich gesagt habe, kann ihn so geärgert haben, denn es kam kein einziges unüberlegtes Wort über meine Lippen. Ich kann nur die Krabben und den Portwein dafür verantwortlich machen.« Er schwieg, dachte daran, was sich in der Bibliothek abgespielt hatte, und wieder runzelte er die Stirn. Er sah seine Mutter an und sagte langsam: »Und doch, Mama – warum ist er nach so langer Zeit wieder auf die Heirat zurückgekommen, die er zwischen Hetta und mir zu stiften versuchte, als ich zwanzig war?«
»Ach, hat er wirklich davon gesprochen? Wie bedauerlich!«
»Aber warum nur, Mama? Seit Jahren haben wir kein Wort mehr darüber verloren.«
»Natürlich nicht. Und das macht ihn ja auch so liebenswert. Er gerät zwar entsetzlich schnell in Zorn, aber er wird nie trübsinnig und wühlt nicht in alten Wunden. Wahrscheinlich wurde ihm alles wieder in Erinnerung gerufen, weil man ihm erzählt hat, dass die liebe Henrietta endlich doch eine sehr passende Verbindung eingehen dürfte.«
»Guter Gott!«, rief der Viscount aus. »Das ist doch nicht dein Ernst! Wer ist denn der Freier?«
»Du kennst ihn wohl kaum, denn er ist erst vor Kurzem nach Hertfordshire gekommen, und ich glaube, dass er sehr selten nach London fährt. Er ist ein Vetter des alten Mr. Bourne und erbte Marley House von ihm. Lady Draycott sagt, er sei ein vortrefflicher, angesehener Mann, besitze viele angenehme Eigenschaften und ausgezeichnete Manieren. Ich selbst habe ihn noch nicht kennengelernt, aber ich hoffe wirklich, dass etwas aus der Verbindung wird, denn ich achte Henrietta sehr und habe mir immer gewünscht, sie gut versorgt zu sehen. Und wenn man Lady Draycott glauben darf, scheint dieser Mr. – Mr. Nethersole –, nein, nicht Nethersole, aber so irgendein Name – genau der Richtige für sie zu sein.«
»Das klingt mir nach einem verflixt langweiligen Kerl!«, sagte der Viscount.
»Ja, aber Menschen, die nicht extravagant sind, wirken meist langweilig, Ashley. Das war mir schon immer rätselhaft. Andererseits darf man sich nicht unbedingt auf das verlassen, was Lady Draycott sagt. Sie hält jeden, den sie gern mag, für ein Muster an Tugend, und jeden, den sie nicht mag, für einen Schurken.« Sie zwinkerte ihm zu. »Von dir sagt sie, du seist ein Mann von Charakter und sehr gutem Benehmen.«
»Ich bin ihr sehr verbunden«, sagte der Viscount. »Wirklich erstaunlich, dass sie mich so richtig zu beurteilen vermag!«
Sie lachte. »Ja, wirklich. Es ist ein frappantes Beispiel dafür, wie wichtig gute Manieren sind. Ist es nicht traurig, dass ein angenehmes Äußeres viel mehr praktischen Nutzen hat als ein guter Charakter?« Sie beugte sich vor und kniff ihn ins Kinn, die Augen voll liebevollen Spotts. »Mich kannst du nicht beschwindeln, du Spitzbub! Du weißt gut, dass du ein unruhiger Geist bist, und Papa hat dir das bestimmt auch gesagt. Ach, könntest du nur Zuneigung zu einem netten Mädchen fassen, zur Ruhe kommen und einen Hausstand gründen! Aber mach dir nichts draus, was ich da sage. Ich will dich nicht quälen.«
Sie zog die Hand zurück, doch er fing sie ein, hielt sie fest und sagte mit einem prüfenden Blick: »Wirklich, Mama? Hast auch du vielleicht vor neun Jahren gewünscht, dass ich um Hetta anhalte? Hättest du sie gern zur Schwiegertochter gehabt?«
»Du hast wirklich seltsame Vorstellungen von mir, mein Liebster! Ich bin doch keine Gans und könnte mir nie wünschen, dass du ein Mädchen heiratest, zu dem du keine dauernde Zuneigung gefasst hast. Sicher, ich achte Hetta, aber vermutlich hättet ihr nicht zusammengepasst. Jedenfalls gehört das der Vergangenheit an, und nichts langweilt mich mehr, als mir Vergangenes in Erinnerung zu rufen. Ich verspreche dir, ich werde die Braut, die du schließlich wählen wirst, freudig willkommen heißen, genauso freudig, wie ich Hettas Hochzeit mit dem Mann ihrer Wahl begrüßen werde.«
»Was – mit diesem Musterknaben, dessen Namen du nicht behalten kannst? Sind die Silverdales in Inglehurst? Ich habe Hetta seit Wochen nicht mehr in London gesehen, aber nach allem, was sie mir erzählte, als wir uns auf dem Ball bei den Castlereaghs trafen, hatte ich angenommen, dass das arme Ding in Worthing sitzt!«
»Als Lady Silverdale erfuhr«, sagte seine Mutter mit ausdrucksloser Stimme, »dass die einzige akzeptable Unterkunft in Worthing für diesen Sommer nicht verfügbar war, zog sie sich lieber nach Inglehurst zurück, statt ein Quartier in einem anderen Kurort zu suchen. Die Meeresluft macht sie reizbar.«
»Was für ein grässliches Weib!«, sagte der Viscont heiter. »Nun ja – vermutlich wird Hetta mit ihrem Musterknaben besser dran sein als mit ihrer Mutter. Ich schaue morgen auf dem Rückweg nach London in Inglehurst vorbei und versuche herauszubekommen, wie dieser Bursche Netherdingsda beschaffen ist.«
Ein wenig verblüfft protestierte Lady Wroxton mild: »Mein lieber Junge, du kannst doch Hetta wirklich nicht ausfragen!«
»Aber ja, natürlich kann ich das«, sagte der Viscount. »Zwischen Hetta und mir gibt es genauso wenig Geheimnisse, Mama, wie zwischen meiner Schwester Griselda und mir. Ich würde sogar sagen«, fügte er hinzu, als er diese Behauptung genauer überlegte, »viel weniger!«
Kapitel 2
Viscount Desford verließ den Sitz seiner Ahnen am folgenden Morgen, ohne sich um ein weiteres Gespräch mit seinem Vater zu bemühen. Da der Earl selten vor Mittag aus seinem Schlafzimmer auftauchte, war das weiter nicht schwer. Der Viscount nahm in einsamer Pracht ein vorzügliches Frühstück ein, lief dann hinauf, um sich liebevoll von seiner Mutter zu verabschieden, gab seinem Kammerdiener, der mit dem Gepäck nach Hampshire folgen sollte, letzte Anweisungen, und kletterte in sein Karriol, als die Stalluhr eben elf zu schlagen begann. Kaum war der letzte Schlag verhallt, befand er sich schon außer Sichtweite des Hauses, und sein Gefährt rollte die lange Allee zum Haupttor hinunter.
Das Tempo, in dem er sein feuriges Gespann lenkte, hätte einen Mann mit weniger eisernen Nerven als die des Grooms mittleren Alters neben ihm beunruhigt; Stebbing jedoch hatte den Viscount aufwachsen gesehen, und so saß er sorglos da, die Arme vor der Brust verschränkt und mit einem Ausdruck völliger Sorglosigkeit in dem vierschrötigen, scharfgeschnittenen Gesicht. So wenig Besorgnis er zeigte, so wenig zeigte er auch seinen Stolz auf den Prachtkerl, dessen erste Reitkünste auf einem Pony er überwacht hatte, und der ein ebenso vollendeter Fechter wie erstklassiger Pferdelenker geworden war. Nur im Kreis seiner engsten Freunde pflegte Stebbing bei einem ausgiebigen Trunk zu prahlen, dass er niemanden kenne, der mit Pferden besser umzugehen verstehe als Mylord Desford.
Das Fahrzeug war kein eigentlicher Rennwagen. Nach Desfords Entwurf von Hatchett in Longacre gebaut, sehr leicht und deshalb für die Pferde angenehm, konnte der Wagen (wenn er von Vollblütern gezogen wurde, wie Seine Lordschaft sie in seinen Ställen hielt) große Entfernungen in unglaublich kurzer Zeit zurücklegen. Im Allgemeinen hatte Desford nur ein Paar an der Deichsel; begab er sich aber auf eine lange Reise, so ließ er ein Vierteam anspannen und führte mit ihm vor (wie seine Freunde spöttisch sagten), dass er die Sache aus dem Effeff beherrsche. Diesmal lenkte er ein Gespann prachtvoller Grauer, und wenn sie auch nicht zu jenen Wundertieren zählten, die sechzehn Meilen pro Stunde zurücklegen konnten und so häufig in den Spalten der Morning Post zum Verkauf angeboten wurden, so erreichten sie den Bestimmungsort des Viscounts doch lange vor Mittag und ohne ein einziges Mal aus ihrem flotten Trab ausbrechen zu dürfen.
Inglehurst Place, ein sehr ansehnlicher Besitz, hatte einem Mann gehört, der von Kindesbeinen an mit Lord Wroxton befreundet gewesen und vor einigen Jahren gestorben war. Nun gehörte es Sir Charles Silverdale, der in Harrow studierte, als er das Erbe nach seinem Vater antreten musste. Er war noch nicht majorenn und zeigte (Berichten zufolge, die von seinem wilden Leben sprachen) nicht den geringsten Wunsch, die mit seinem Erbe verbundenen Verpflichtungen zu übernehmen. Sein Vermögen wurde von zwei Treuhändern verwaltet, die zwar rechtskundige Herren waren, doch keine Ahnung von dem Leben auf dem Lande hatten. So teilten sich Sir Charles’ Gutsverwalter und seine Schwester, Miss Henrietta Silverdale, in die Leitung des Besitzes.
Der Butler, eine sehr imposante Erscheinung, ließ sich zu einer Verneigung herab und sagte, er bedauere, den Viscount unterrichten zu müssen, dass Ihre Gnaden die Nacht nicht sonderlich gut verbracht habe, noch nicht heruntergekommen sei und den Viscount nicht empfangen könne.
»Steig von deinem hohen Ross herunter, Grimshaw!«, sagte der Viscount. »Du weißt ganz genau, dass ich nicht gekommen bin, um Ihre Gnaden zu besuchen. Ist Miss Silverdale daheim?«
Grimshaw war gnädig genug zu sagen, er glaube, Miss sei im Garten anzutreffen, aber während er Desford nachblickte, als dieser um die Hausecke bog, drückte seine düstere Miene nichts als Missbilligung aus.
Der Viscount fand Miss Silverdale im Rosengarten, in Gesellschaft zweier Herren, von denen er nur einen kannte. Henrietta begrüßte ihn mit aufrichtiger Freude. »Des!«, rief sie und streckte ihm die Hände entgegen. »Ich habe dich in Brighton vermutet! Was führt dich nach Hertfordshire?«
Der Viscount ergriff zwar ihre Hände, küsste Hetta jedoch auf die Wange und sagte: »Kindesliebe, Hetta. Wie geht’s dir, meine Liebe? Eigentlich eine überflüssige Frage. Man sieht ja, dass du großartig in Form bist.« Er nickte dem jüngeren der beiden anwesenden Herren lächelnd zu und sah den zweiten fragend an.
»Ich glaube, du kennst Mr. Nethercott noch nicht, Des«, sagte Henrietta. »Mr. Nethercott, Sie müssen mir erlauben, Sie mit Lord Desford bekannt zu machen, der so etwas wie mein Ziehbruder ist.«
Die beiden Männer reichten einander mit schnell abschätzendem Blick die Hand. Cary Nethercott war zwar wesentlich älter als Desford, doch fehlte ihm dessen selbstsicheres und ungezwungenes Auftreten. Er verfügte über gute Manieren, war aber schüchtern und zurückhaltend. Größer und stärker als Desford, machte er, wenn auch korrekt gekleidet, nicht den Eindruck eines modebewussten Herrn. Sogar der Dümmste musste sehen, dass seine Jacke aus Bath-Tuch nicht bei Weston oder Nugee gearbeitet war. Er hatte eine gute Figur, regelmäßige Gesichtszüge und sah meist ernst, wenn auch gütig drein; sein seltenes Lächeln war voll Liebenswürdigkeit.
»Nein, ich glaube, wir sind einander noch nie begegnet«, sagte Desford. »Sie sind erst vor Kurzem in unsere Gegend gekommen, nicht wahr? Meine Mutter hat gestern von Ihnen gesprochen; sie sagte, Sie seien der Erbe des alten Mr. Bourne.«
»Ja«, erwiderte Cary. »Es ist sehr seltsam, dass er mich zum Erben bestimmte, denn ich kannte ihn kaum.«
»Umso besser für Sie«, sagte Desford. »Er war der verschrobenste, wunderlichste alte Kauz, der mir im Leben begegnet ist. Du lieber Himmel, Hetta, wirst du je vergessen, welch ein Aufhebens er machte, als wir unbefugt sein Grundstück betraten und er uns dabei ertappte?«
»Nein, wahrhaftig nicht!«, sagte sie lachend. »Und dabei haben wir nicht das Geringste angestellt. Ich hoffe wirklich, Mr. Nethercott, dass nicht auch Sie in Wut geraten, wenn ich mich je auf den geheiligten Boden von Marley House verirren sollte.«
»Sie können ganz sicher sein, dass ich nicht wütend werde«, sagte er und lächelte sie herzlich an.
In diesem Augenblick stieß der junge Mr. Beckenham, den wohl ein böser Geist verführt hatte, sich an der Konversation zu beteiligen, etwas wirr hervor: »Was mich betrifft, kann ich Miss Silverdale versprechen, dass ich meinen Grund und Boden als geweihte Erde betrachten werde, wenn sie ihn je betritt. Das heißt, ich meine, ich täte es, wenn es mein Grund und Boden wäre, aber das ist unwichtig, weil er es sein wird, wenn mein Vater stirbt – aber glauben Sie nicht, dass ich ihm den Tod wünsche! –, und mein Vater jedenfalls wäre genauso glücklich wie ich, Sie in Foxshot zu begrüßen, wenn die geringste Chance bestände, dass Sie sich wirklich auf unseren Grund und Boden verirren! Ach, wäre Foxshot von Inglehurst zu Fuß zu erreichen!«
Er merkte, dass Cary Nethercott sehr amüsiert dreinsah, und versank errötend in Schweigen.
»Gut gesagt!«, rief der Viscount beifällig und klopfte ihm auf die Schulter. »Wenn du ihm nicht schon sehr verbunden wärst, Hetta, dann solltest du es ihm jetzt sein.«
»Natürlich bin ich es«, sagte Henrietta und lächelte ihren jugendlichen Verehrer freundlich an. »Und wenn Foxshot nicht fünfzehn Meilen entfernt läge, würde ich mich vermutlich wirklich dorthin verirren!«
»Inzwischen«, warf Cary Nethercott ruhig ein, »ist es wohl Zeit geworden, dass wir uns verabschieden und Miss Silverdale die Gelegenheit geben, mit Seiner Lordschaft ungestört zu plaudern.«
Dem konnte Mr. Beckenham nicht widersprechen; und obwohl Henrietta heiter sagte, wahrscheinlich würden Seine Lordschaft und sie einander in die Haare geraten, statt zu plaudern, machte sie keinen Versuch, die beiden Herren zurückzuhalten. Mr. Beckenham küsste ihr ehrerbietig die Hand, während sein älterer und nicht so überschwänglicher Rivale diese in die seine nahm und bat, Miss Silverdale möge ihrer Mama die besten Empfehlungen übermitteln. Dann verabschiedete er sich von Desford, wobei er gemessen der Hoffnung Ausdruck gab, man würde einander wieder begegnen.
»Na«, sagte der Viscount kritisch, als er ihm nachblickte, »er ist besser, als ich erwartet habe. Aber ich glaube nicht, dass es geht, Hetta: Er ist nicht der Richtige für dich.«
Miss Silverdales Augen waren sehr schön, vielleicht sogar das Schönste an ihr, denn ihr Mund, hieß es, sei zu groß, ihre Adlernase zu gebogen und ihr braunes, unansehnliches Haar nicht der Erwähnung wert. Aber ihre Augen beherrschten das Gesicht und waren der Grund, dass man ihr nachsagte, sie sei eine Persönlichkeit. Die Farbe dieser Augen war nicht bemerkenswert – ein unbestimmtes Grau, das sich plötzlich stark verändern konnte, was bei den mehr bewunderten blauen oder braunen Augen nur äußerst selten der Fall ist. Wenn Miss Silverdale sich langweilte, verloren sie alle Farbe, aber sowie ihr Interesse geweckt war, verdunkelten sie sich und glühten; sie konnten funkeln vor Zorn oder, häufiger noch, vor Vergnügen; sie spiegelten stets ihre Stimmung. Als Hetta sich nun dem Viscount zuwandte, stand Überraschung in diesen Augen, eine Spur Zorn und sehr viel Lachen. Sie sagte: »Aber nein, wirklich? Nun, falls du recht hast, ist es wirklich ein Glück, dass er mir keinen Heiratsantrag gemacht hat! Wer weiß, ob ich ihn in meinem Alter nicht vielleicht doch angenommen hätte?«
»Spiel mir nichts vor, Hetta! Es ist klar, dass er dir einen machen wird. Vermutlich ist er ein wirklich wertvoller Mensch. Man sieht, dass er gute Manieren hat. Aber für dich wäre er nichts, verlass dich drauf!«
»Was für ein Neidhammel du doch bist, Ashley!«, rief sie, zwischen Empörung und Amüsement schwankend. »Du selbst willst mich nicht, aber der Gedanke, dass ich einen anderen heirate, ist dir unerträglich!«
»Keine Spur«, sagte der Viscount. »Möglich, dass ich dich wirklich nicht heiraten wollte – aber versuch mir nicht vorzuschwindeln, du hättest die letzten neun Jahre um mich getrauert. Mein Gedächtnis funktioniert tadellos, und ich erinnere mich so klar, als sei es gestern gewesen, wie du mich gebeten hast, nicht um deine Hand anzuhalten, als unsere Väter jenes abscheuliche Komplott schmiedeten. Jedenfalls hab ich dich verteufelt gern und wäre glücklich, wenn du einen Mann heiratest, der deiner würdig ist. Nethercott ist es leider nicht. Er würde dich langweilen, noch bevor eure Flitterwochen vorüber wären, Hetta!«
»Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich dir verbunden bin, Des, dass dir meine Interessen so sehr am Herzen liegen!«, sagte sie in tiefem, allerdings gespieltem Ernst. »Aber weißt du, es könnte immerhin denkbar sein – gerade nur denkbar! –, dass ich doch besser beurteilen kann als du, wer zu mir passt. Da dein Gedächtnis so gut ist, brauche ich dich nicht zu erinnern, dass ich kein dummes Schulmädchen mehr bin, sondern im sechsundzwanzigsten Lebensjahr stehe –«
»Durchaus nicht nötig«, unterbrach er sie mit seinem entwaffnenden Lächeln. »Am 15. Januar wirst du sechsundzwanzig, und ich weiß sogar schon, was ich dir schenken werde. Glaubst du wirklich, ich vergesse den Geburtstag der Besten aller Freunde?«
»Du bist einfach abscheulich«, sagte sie resigniert. »Aber ich würde dich sehr vermissen, wenn wir einmal nicht mehr die besten Freunde sein sollten. Ich kann nicht leugnen, welch ein großer Trost es ist, dass ich mich in jeder Situation um Hilfe an dich wenden kann. Und ich muss zugeben, du hast mir noch nie deinen Rat versagt. Lassen wir also bitte diesen unsinnigen Streit über den armen Mr. Nethercott, bevor wir uns in den Haaren liegen. Du sagtest, Kindesliebe habe dich heimgeführt: Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass Lord Wroxton krank ist?«
»Nein, es sei denn, er hat vor lauter Wut einen Schlaganfall bekommen«, antwortete er. »Wir sind gestern Abend nach einer bösen Auseinandersetzung geschieden – ja, er sagte, er wolle meine Visage nie wiedersehen. Mama und Pedmore hingegen versicherten mir, er habe es nicht ernst gemeint, und ich glaube ihnen. Vorausgesetzt, ich verschone ihn jetzt vorläufig mit meiner Visage, dann wird er sich freuen, sie später wiederzusehen. Es war natürlich ein grober Fehler von mir, dass ich mich in weniger als zwei Monaten gleich zweimal sehen ließ.«
Sie lachte. »Also plagt ihn wieder die Gicht! Armer Lord Wroxton! Aber was hat ihn veranlasst, über dich herzufallen? Hat ihm irgendeine Klatschbase Geschichten über dich zugetragen?«
»Bestimmt nicht!«, erwiderte er streng. »Denn es gibt keine Geschichten!«
»Was – hast du der eleganten Person, mit der ich dich vor einem Monat in Vauxhall gesehen habe, den Laufpass gegeben?«, fragte Miss Silverdale aufrichtig überrascht.
»Nein, umgekehrt – sie mir!«, erwiderte er. »Ein reizender Schmetterling, nicht? Aber leider viel zu kostspielig!«
»Du Armer!«, sagte sie mitfühlend. »Und hast du keinen Ersatz gefunden? Aber du wirst eine andere finden, Des, ganz bestimmt!«
»Eines Tages wird man dich finden, erwürgt, und sehr wahrscheinlich von mir!«, warnte der Viscount. »Wieso weiß eigentlich ein Frauenzimmer, das behütet aufgewachsen ist, über solche Dinge Bescheid?«
»Ach, das ist einer der Vorteile, dass man seine erste Blüte hinter sich hat!«, sagte sie. »Man braucht nicht mehr so zu tun, als sei man ein unschuldiges Mädchen.«
Der Viscount, der sich neben ihr auf einer Gartenbank gerekelt hatte, richtete sich bei dieser Äußerung mit einem Ruck auf und rief: »Um Gottes willen, Hetta –! Sagst du so etwas auch vor anderen Leuten?«
Sie zwinkerte spitzbübisch und sagte unter halb ersticktem Gelächter:
»Nein, nein, nur vor dir, Des! Auch aus diesem Grund bist du ein Trost für mich. Natürlich rede ich mit Charlie ziemlich frei, aber er ist bloß mein jüngerer und nicht mein älterer Bruder. Spricht Griselda nie ganz offen mit dir?«
»Ich kann mich nicht erinnern, dass sie es je tat, aber ich war eben erst aus Oxford zurückgekommen, als sie an Broxbourne hängenblieb, und ich sehe sie jetzt nicht sehr häufig.« Plötzlich lachte er glucksend. »Würdest du es für möglich halten, Hetta, dass mein Vater einen alten Kummer zur Sprache brachte, den ich seit Jahren für tot und begraben hielt? Er hielt mir eine Standpauke, weil ich dich nicht beschwatzt habe, mich zu heiraten!«
»Ach, guter Gott!«, rief sie. »Noch immer? Warum sagst du ihm nicht, dass wir einfach nicht heiraten wollten?«
»Habe ich ja, aber er glaubt mir nicht. Ich habe ihm natürlich nicht erzählt, dass wir alles über dieses unglückliche Komplott wussten und die Konsequenzen zogen. Das, meine Liebe, konnte ich wirklich nicht.«
»Stimmt«, sagte sie. »Und Mama kann ich es ebenfalls nicht erzählen. Papa habe ich zwar alles gebeichtet, und er hat unsere Gefühle vollkommen verstanden und mir kein einziges Mal einen Vorwurf gemacht. Aber Mama hört nicht auf damit! Ich wäre wirklich froh, wenn du ihr einmal unangenehm auffallen könntest. Jedes Mal, wenn sie dir begegnet, beklagt sie meine Undankbarkeit auf eine Art und Weise, dass ich schreien könnte, und dann ersucht sie mich, ihr nie die Schuld zu geben, wenn ich als alte Jungfer ende. Sie behauptet, es gäbe keinen erstrebenswerteren Gemahl als dich, und ich sei von allen guten Geistern verlassen, wenn ich dich nicht nehme. Allerdings habe ich sie nie gefragt, was sie von dir hielte, wenn du zufällig keinen Grafentitel geerbt hättest.« Sie beruhigte sich und lachte kläglich. »Oh Himmel, wie ungehörig von mir, so über sie zu sprechen! Du musst mir glauben, dass du der einzige Mensch bist, bei dem ich das wage. Und ist es nicht schrecklich: Ich bin froh, dass sie sich heute nicht ganz wohlfühlt und ihr Zimmer nicht verlassen will. Ich hoffe nur, man kann auf Grimshaw bauen, dass er ihr nichts von deinem Besuch erzählt.«
»Schrecklich oder nicht schrecklich, ich war sogar noch froher als du, als ich erfuhr, dass sie keine Besuche empfängt«, sagte der Viscount offen. »Sie gibt mir immer das Gefühl, dass ich ein herzloser Vogel bin, denn sie hat die Gewohnheit, zu seufzen und mich traurig und vorwurfsvoll anzulächeln, selbst wenn ich bloß höfliche Phrasen von mir gebe.« Er zog die Uhr heraus und sagte: »Ich muss weg, Hetta. Ich bin auf dem Weg nach Hazelfield, und meine Tante sähe es nicht gern, wenn ich erst um Mitternacht einträfe.«
Henrietta stand auf und begleitete ihn zum Haus. »Du besuchst deine Tante Emborough? Übermittle ihr bitte meine besten Empfehlungen.«
»Das werde ich tun«, versprach er. »Und falls Grimshaw meine Anwesenheit verraten hat, sage deiner Mama meine Empfehlungen, und wie ich es – äh – bedauert habe, ihr keinen Morgenbesuch machen zu können, da sie indisponiert war.« Er drückte sie brüderlich an sich, küsste sie auf die Wange und sagte: »Adieu, meine Liebe. Und stell keine Dummheiten an, ja?«
»Nein, aber du auch nicht!«, erwiderte sie.
»Was – unter den Augen meiner Tante Sophronia? Das würde ich nie wagen!«, rief er und ging zum Stallhof hinüber.
Kapitel 3
Lady Emborough war Lord Wroxtons einzige überlebende Schwester. Die Ähnlichkeit der beiden beschränkte sich nicht nur auf die Gesichtszüge, behaupteten Leute mit empfindlichen Nerven, die ihre laute Stimme und die Art, ihre Meinung ohne Umschweife zu sagen, nur schwer ertrugen. Lady Emborough neigte dazu, sich in anderer Leute Angelegenheiten zu mischen, und wer so töricht war, ihr das zu gestatten, wurde ein Opfer ihres ausgeprägten Selbstbewusstseins und ihrer Überzeugung, dass solche Leute eben unfähig wären, mit dem Leben fertig zu werden. Trotz ihres Glaubens an die eigene Unfehlbarkeit nahm sie es aber nie übel, wenn sich jemand gegen sie auflehnte. Manche Leute hielten sie für grässlich überheblich, während Menschen, die im Augenblick der Not Hilfe bei ihr gesucht hatten, wussten, dass sich hinter ihrer derben Art ein warmes Herz und ein erschöpflicher Vorrat an Güte verbarg. Ihr Gemahl war ein stiller, wortkarger Mann, der zusah, wie sie beinahe uneingeschränkt schaltete und waltete, was Uneingeweihte oft zu der Meinung verleitete, Lord Emborough stehe unter dem Pantoffel. Freunde des Hauses wussten jedoch, dass ihr Herr und Gebieter Mylady mit einem bloßen Blick und einem fast unmerklichen Kopfschütteln zu zügeln vermochte. Sie nahm seinen stillen Tadel nicht übel, sondern sagte dann mit einem gutmütigen Lachen: »Oh, Emborough schaut mich schon wieder stirnrunzelnd an, daher sage ich zu dem Thema kein Wort mehr!«
Die Art, wie sie ihren Neffen begrüßte, war typisch für sie: »Da bist du endlich, Desford! Du hast dich verspätet – und erzähl mir nicht, eines der Pferde habe ein Hufeisen verloren oder ein Riemen sei gerissen, denn ich falle auf deine Flunkereien nicht herein.«
»Warum schüchterst du den armen Des denn gleich ein, Mama!«, mahnte ihr Ältester, ein muskulöser Mann, das Bild eines Landedelmannes.
»Das macht ihm überhaupt nichts aus«, sagte sie und lachte herzlich.
»Natürlich nicht!« Desford küsste ihr die Hand. »Hältst du mich für einen Stümper, Tante? Meine Pferde verlieren keine Hufeisen, es ist kein Riemen gerissen, ich habe auch keinen Unfall gehabt, und wenn du mir erzählen willst, dass ihr meinetwegen mit dem Abendessen warten musstet, werde ich nicht so respektlos sein zu behaupten, du hättest geflunkert – ich werde es mir denken. In Wirklichkeit verhielt es sich so, dass ich auf dem Weg hierher in Inglehurst haltmachte und länger als geplant mit Hetta plauderte. Sie trug mir auf, dir ihre Empfehlung zu übermitteln.«
»Inglehurst! Ja, kommst du denn von Wolversham?«, rief sie aus. »Ich hatte angenommen, du wärest noch in London! Wie geht’s deinem Vater?«
»Gichtanfall.«
Sie schnaubte. »Natürlich. Und er ist ganz allein schuld daran. Es täte ihm gut, wenn ich in Wolversham lebte: Deine Mutter ist viel zu nachgiebig!«
Der Viscount erinnerte sich lebhaft und mit leisem Schauer daran, zu welch heftigen Wortgefechten es gekommen war, als Lady Emborough das letzte Mal über Wolversham und Lord Wroxton hereingebrochen war. Zum Glück enthob ihn seine Tante einer Antwort, indem sie unvermittelt das Thema wechselte und wissen wollte, was ihm eigentlich einfalle, seinen Vorreitern Anweisung zu geben, im »Blauen Eber« zu logieren. »Lass dir gesagt sein, Desford, ich gehöre nicht zu diesen modernen Gastgeberinnen, die sich weigern, außer den Kammerdienern ihrer Gäste anderes Personal zu beherbergen! Solche Knausereien gibt’s bei mir nicht: Vornehm-schäbig nenne ich so etwas! Dein Groom und deine Vorreiter wohnen bei uns, und ich möchte darüber kein Wort mehr hören.«
»Ganz wie du wünschst«, sagte der Viscount gehorsam, »ich werde schweigen.«
»Das mag ich so an dir!« Sie betrachtete ihn mit sichtlichem Wohlgefallen. »Du ärgerst mich nie mit Geschwätz. Erwarte übrigens nicht, dass es hier von mondänen Herrschaften wimmelt, sonst wirst du enttäuscht sein: Wir haben nur die Montsales und den jungen Ross mit seiner Schwester zu Besuch. Aber vermutlich stört dich das nicht, wenn du nur gute Beute am Fluss unten machst, und Ned versichert mir, dass das der Fall sein wird. Außerdem gibt es in Winchester Rennen und –«
Ihr Redeschwall wurde von Lord Emborough unterbrochen, der das Zimmer betreten hatte und humorvoll sagte: »Du überwältigst ihn ja mit all den Vergnügungen, die du in petto hast, meine Liebe! Wie geht’s dir, Desford? Kannst du dich von deinen Forellen losreißen und dir morgen meine jungen Pferde ansehen? Ich möchte wissen, wie dir ein ganz bestimmter Jährling gefällt, sicher der beste, den ich je aufgezogen habe! Er ist von meiner Stute Creeping Polly von Whiffler, und ich wette, er wird ein Sieger.«
Daraufhin vertieften sich die fünf anwesenden Herren sofort in ein richtiges Männergespräch. Mr. Edward Emborough war ganz der Meinung seines Vaters, während der um ein Jahr jüngere Mr. Gilbert Emborough sagte, das Fohlen sei gewiss prachtvoll gebaut und hätte die besten Anlagen, doch könne er sich nicht des Eindrucks erwehren, dass das Tier eine Spur zu gradschultrig sei; Mr. Mortimer Redgrave, der ältere Schwiegersohn, der im Kielwasser Lord Emboroughs hereingekommen war, meinte hingegen, er persönlich habe noch nie ein vielversprechenderes Füllen gesehen; und Mr. Christian Emborough, Oxfordstudent im ersten Jahr, betrachtete voll Bewunderung den exquisiten Schnitt der Jacke, die sein Vetter trug, und sagte dann, es würde ihn interessieren, was Desford von dem Fohlen halte, »weil Des viel mehr von Pferden versteht als Ned und Gil – obwohl er nie damit prahlt!« Nachdem er seinen älteren Brüdern diese Abfuhr erteilt hatte, schwieg er errötend. Der Viscount enthielt sich jeglichen Kommentars, denn er hatte das Fohlen ja noch nicht gesehen, geriet aber dann doch mit seinem Gastgeber in eine allgemeine Fachsimpelei über Pferde. Lady Emborough ließ die Herren eine gute Viertelstunde lang gewähren und verkündete dann, sie würden nichts als Abfälle vorgesetzt bekommen, wenn sie sich nicht sofort zum Abendessen umkleideten. Sie hätte keine Lust, auf sie zu warten. Der junge Mr. Christian Emborough, der mit seinem Vetter die breite Treppe hinaufging, vertraute Desmond an, er wisse zufällig, dass es als Hauptgerichte des zweiten Gangs jungen Hasen und junge Ente geben würde. Die beiden Herren stellten übereinstimmend fest, diese saftigen Gerichte dürften auf keinen Fall zu lange warten; und der junge Mr. Emborough fasste sich ein Herz und fragte, ob Desford sein Halstuch im »orientalischen« Stil gebunden habe. Worauf der Viscount ernst erwiderte: »Nein, es ist die sogenannte mathematische Krawatte. Möchtest du, dass ich dir beibringe, wie man sie bindet?«
»Und ob!«, rief Christian, und seine Wangen erglühten vor Dankbarkeit.
»Abgemacht«, versprach Desford. »Aber nicht gleich jetzt, sonst verbrutzeln die Enten.«
»Oh nein, nein! Wann immer!«, stammelte Christian.
Dann ging er in sein Schlafzimmer, mehr denn je überzeugt, dass Des ein prima Bursche und bei Weitem nicht so herablassend sei wie seine, Christians, Brüder; er berauschte sich schon an dem Gedanken, wie er die beiden älteren verblüffen würde, wenn er vor ihnen mit einem Halstuch erschien, das sie sofort als letzten Schrei erkennen mussten.