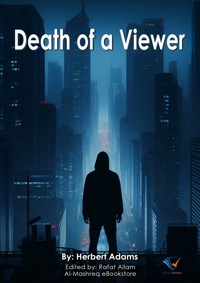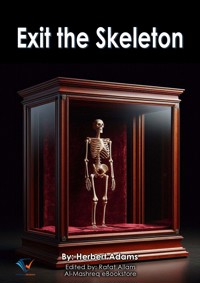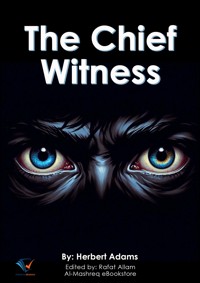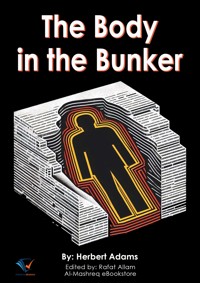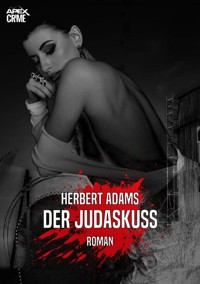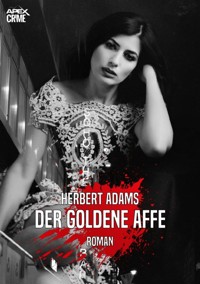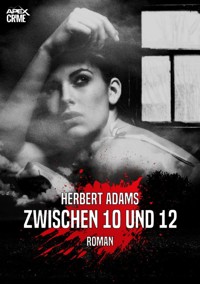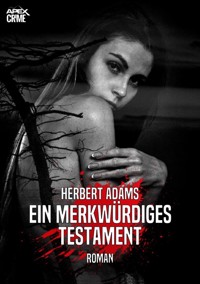
6,99 €
Mehr erfahren.
Massive Bücherschränke, mit gewichtigen Folianten gefüllt, Regale voll von Briefordnern und Akten, der breite Schreibtisch mit säuberlich auf geschichteten Papieren – all dies offenbarte den Charakter des Raums. Und die Bilder an den Wänden – Porträts ernster Richter in Robe und Perücke – wohnten als stumme Zeugen den Folgen menschlicher Torheit und der strengen Beobachtung des Gesetzes bei.
In solcher Umgebung würde es nicht schwerfallen, sich einen leichtsinnigen Erben vorzustellen, der zur Deckung seiner Spielschulden durch einen Federstrich den letzten Rest seines Grundbesitzes preisgibt...
Herbert Adams (* 1874 in Dorset, South West England; † 1958) war ein englischer Schriftsteller. Adams veröffentlichte beinahe sechzig Kriminalromane; viele unter seinem eigenen Namen, einige unter dem Pseudonym Jonathan Gray. Seine Leser – wie auch die Literaturkritik – verglichen Adams oft mit seiner Kollegin Agatha Christie.
Der Roman Ein merkwürdiges Testament erschien erstmals im Jahr 1933; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1951.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
HERBERT ADAMS
Ein merkwürdiges
Testament
Roman
Apex Crime, Band 149
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
EIN MERKWÜRDIGES TESTAMENT
ERSTER TEIL
ZWEITER TEIL
DRITTER TEIL
Das Buch
Massive Bücherschränke, mit gewichtigen Folianten gefüllt, Regale voll von Briefordnern und Akten, der breite Schreibtisch mit säuberlich auf geschichteten Papieren – all dies offenbarte den Charakter des Raums. Und die Bilder an den Wänden – Porträts ernster Richter in Robe und Perücke – wohnten als stumme Zeugen den Folgen menschlicher Torheit und der strengen Beobachtung des Gesetzes bei.
In solcher Umgebung würde es nicht schwerfallen, sich einen leichtsinnigen Erben vorzustellen, der zur Deckung seiner Spielschulden durch einen Federstrich den letzten Rest seines Grundbesitzes preisgibt...
Herbert Adams (* 1874 in Dorset, South West England; † 1958) war ein englischer Schriftsteller. Adams veröffentlichte beinahe sechzig Kriminalromane; viele unter seinem eigenen Namen, einige unter dem Pseudonym Jonathan Gray. Seine Leser – wie auch die Literaturkritik – verglichen Adams oft mit seiner Kollegin Agatha Christie.
Der Roman Ein merkwürdiges Testament erschien erstmals im Jahr 1933; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1951.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
EIN MERKWÜRDIGES TESTAMENT
ERSTER TEIL
Erstes Kapitel
»So ist es wahr? Ich bin hinausgeworfen worden? Varnoll ist nicht länger mein Heim?«
»Ich fürchte, dass es sich so verhält, meine liebe Susan. Dennoch schmerzt es mich, wenn Sie es derart krass ausdrücken.«
»Meines Erachtens stimmt bei der Geschichte etwas nicht, Vater. Es mutet alles so merkwürdig an.«
»Nutzlos, darüber Worte zu verlieren, mein Junge. Wir müssen uns mit den Tatsachen abfinden. Wenn ich auch nur den geringsten Zweifel hegte, würde ich meine Meinung nicht so bestimmt geäußert haben.«
»Natürlich nicht«, murmelte der junge Mann. »Trotzdem.« Er brach ab und betrachtete grübelnd die blonde Besucherin. Mit seiner alten Täfelung, seiner hohen Decke, dem schönen Kamin und der Aussicht auf die blühenden Gartenanlagen von Lincoln’s Inn hätte es ein friedlicher Raum sein können; doch ein Zimmer, das seit sieben Generationen Anwaltsbüro gewesen ist, hat zu viele tragische Szenen erlebt, und vielleicht haftet seiner Atmosphäre immer irgendein Einfluss der Vergangenheit an.
Massive Bücherschränke, mit gewichtigen Folianten gefüllt, Regale voll von Briefordnern und Akten, der breite Schreibtisch mit säuberlich auf geschichteten Papieren – all dies offenbarte den Charakter des Raums. Und die Bilder an den Wänden – Porträts ernster Richter in Robe und Perücke – wohnten als stumme Zeugen den Folgen menschlicher Torheit und der strengen Beobachtung des Gesetzes bei.
In solcher Umgebung würde es nicht schwerfallen, sich einen leichtsinnigen Erben vorzustellen, der zur Deckung seiner Spielschulden durch einen Federstrich den letzten Rest seines Grundbesitzes preisgibt, oder einen verdrießlichen, der Fuchsjagd huldigenden Landedelmann, der seinen Bevollmächtigten beauftragt, gegen einen nicht sportsmännischen Nachbarn Klage zu erheben; oder sich auszumalen, wie unter verbindlichen Komplimenten und leisen Winken Fragen der Mitgift erörtert werden. Schwierig dürfte es hingegen sein, zu erraten, was die drei Personen, die sich an jenem strahlenden Maimorgen gegenübersaßen, zusammengeführt hatte.
Die junge Dame zählte ungefähr zwanzig Jahre. Ihre braunen Augen konnten übermütig blitzen und Funken sprühen; doch gegenwärtig schimmerten sie feucht. Sie hatte einen reizenden Mund, eine gerade, feine Nase und gut gewölbte Brauen, und ihre Kleidung würde man als teuer bezeichnet haben.
Der weißhaarige Herr ihr gegenüber war Martin Onslow, der einzige noch lebende Teilhaber der alten Rechtsanwaltsfirma Harrison, Mutcher & Onslow. Neben dem Schreibtisch saß sein Sohn Robert, der, sofern das Schicksal keinen Strich durch die Rechnung machte, eines Tages die Firma übernehmen und der achte des Namens sein sollte, um das gute und auch einträgliche Werk fortzuführen. Allerdings stand dem jungen Robert Onslow – außerhalb der Bürostunden Bob genannt – noch das letzte juristische Examen bevor, dessen Schrecken er gewöhnlich jedoch vergaß. Lustig blickten seine blauen Augen in die Welt. Er grämte sich nicht im mindesten über seine Nase, der ein Sportunfall jeden Anspruch auf Schönheit geraubt hatte, und verfügte über Schultern, die eigentlich besser für Sport als für gebückte Haltung über Urkunden oder trockenen Gesetzbüchern passten.
»Ich kam gestern zurück«, sagte Susan, wobei sie sich bemühte, ihre Gefühle nicht zu verraten. »Und obwohl ich wusste, dass er tot ist, fuhr ich direkt nach Varnoll. Gerade als ich mit Mrs. Heath, der Haushälterin, sprach, kam Angela in die Halle. Ach, das ist wohl Susan Heriot?, fragte sie hochmütig und musterte mich von oben bis unten, als sei ich nicht wert, auch nur beachtet zu werden. Es wäre gut, Mrs. Heath, wenn Sie ihr eröffneten, dass sie hier nicht mehr die Herrin ist. Ja nicht einmal ein geladener Gast. Wenn Sie ihr den Sachverhalt erklärt haben, können Sie sie in mein Zimmer führen. Nun, Mrs. Heath erklärte mir den Sachverhalt. Sie ließ mich wissen, dass mein Vater – für mich ist er noch immer mein Vater, obschon mir jetzt kaum das Recht zusteht, ihn so zu nennen – ein anderes Testament gemacht und alles Gilbert Brand und seiner Tochter Angela vererbt habe. Ich besitze nichts; auch nicht den Namen, den ich, wie er sagte, immer tragen sollte.«
Trotz ihrer Tapferkeit liefen ihr jetzt die Tränen die Wangen herab. Martin Onslow fühlte heißes Mitleid in seinem Herzen aufsteigen. Bob steckte herausfordernd die Hände in die Taschen.
»Was für eine Gemeinheit!« Die Bemerkung bezog sich auf Angela.
»Haben Sie Miss Brand gesprochen?«, forschte der alte Herr. »Nein. Ich war von der Bahn in einem Taxi gekommen, das noch draußen hielt. Nachdem mir Mrs. Heath alles mitgeteilt hatte, fuhr ich auf der Stelle wieder fort; sie... sie weinte selbst so verzweifelt, dass »ich es nicht länger ertragen konnte.«
Der Anwalt räusperte sich, ehe er von neuem das Wort ergriff. »Was Sie in Varnoll erfahren haben, entspricht nicht ganz der Wahrheit, Kind, aber immerhin ungefähr. Während Ihrer Abwesenheit lud John Brand seinen Bruder Gilbert und Gilberts Tochter Angela ein, die bis zu seinem Tod bei ihm blieben. Inzwischen setzte er eine neue letztwillige Verfügung auf, der zufolge sein gesamter Besitz an Vater und Tochter und an Gilberts Sohn Maurice fiel – mit Ausnahme der Summe von tausend Pfund, die Sie erben, und ein paar hundert Pfund, mit denen er die Dienerschaft, den Gemeindepfarrer, den Doktor und die Krankenschwestern bedachte. Alles andere erhielten jene drei Verwandten.«
»Verwandte, die bis dahin seine Schwelle nie überschreiten durften!«, knurrte Bob.
Susan Heriot schien seine Bemerkung überhört zu haben. Sie schaute, den alten Herrn an. »Haben Sie das Testament aufgesetzt?«
»Nein. Ich ahnte weder etwas von dem Testament noch von der Schwere seiner Krankheit. Sonst hätte ich ihn selbstverständlich besucht. Er war ja mein ältester Freund.«
Er schwieg. John Brands Ableben bedeutete mehr für ihn als den Verlust eines Klienten.
»Es ist ja nicht allein das Geld«, begann Susan mit zitternder Stimme. »Er hinterließ keine Botschaft, keinen Gruß für mich. Ich wurde völlig ausgeschaltet.«
Onslow antwortete nicht sofort.
»Mr. Garcher aus Newburton setzte das Testament auf«, erläuterte er dann sachlich. »Ein Provinzanwalt von makellosem Ruf. Er kannte John Brand flüchtig. Das Testament ist in Garchers Gegenwart unterzeichnet worden; er selbst und ein Chauffeur namens Sharpie fungierten als Zeugen. Ich hielt es für meine Pflicht, gewisse Nachforschungen anzustellen, und erfuhr von Mr. Garcher, dass alles in Ordnung sei. Damit nicht genug, wandte ich mich auch an die beiden Pflegerinnen, die man aus London hatte kommen lassen und die mir versicherten, dass Mr. Brand bis zur letzten Minute sich voller geistiger Klarheit erfreut habe. Des Weiteren sprach ich den Pfarrer und den behandelnden Arzt Doktor Graham, der, wie Sie wissen, ebenfalls sein Freund gewesen ist. Beide bestätigten die Aussagen der Pflegerinnen.«
»Doktor Grahams Wort vertraue ich unbedingt«, murmelte das Mädchen. »Er ist stets gut zu uns gewesen. Er war es auch, der mich fortschickte. Vermutlich wissen Sie das, nicht wahr? Nach einer ziemlich schweren Grippe, an der ich im Winter erkrankte, riet Doktor Graham meinem Vater, mit mir eine Reise nach Westindien zu machen, damit ich auch die letzten Spuren der Krankheit überwände. Oh, wieviel Freude bereitete uns das Pläneschmieden! Dann hielten im letzten Augenblick wichtige Geschäfte meinen Vater zurück. Aber er bestand darauf, dass ich nicht wartete. Trotz meines Sträubens schickte er mich voraus und versprach fest, mir in spätestens vierzehn Tagen zu folgen. Von seiner Erkrankung erfuhr ich nichts; er sagte zu Mrs. Heath, dass meine Ferientage nicht verdorben werden dürften. Und so... so sah ich ihn niemals wieder.«
Sie wischte mit ihrem kleinen Spitzentaschentuch die unbotmäßigen Tränen fort, während Bob grimmig knurrte: »Ich glaube nicht an jenes Testament. Er muss es im Zustand der Hypnose verfasst haben.«
Keiner der beiden griff diese Mutmaßung auf. Nach einem Weilchen entnahm Susan ihrer Handtasche einen Umschlag.
»Dies ist der letzte Brief, den ich von ihm erhielt«, flüsterte sie. »Ich möchte, dass Sie ihn lesen. Damit Sie sehen, dass ich mich nicht schlecht oder undankbar gegen ihn betragen habe. Nein, nichts hat unsere Liebe getrübt. Am selben Tag, an dem ich den Brief bekam, erreichte mich auch das Kabel, das mir meldete, er ringe mit dem Tode. Dann musste ich warten, bis ein Schiff ging...«
Der Anwalt nahm den Brief, setzte umständlich seine goldgeränderte Brille auf die Nase und las still:
Meine geliebte kleine Susan,
nur rasch ein paar Zeilen, um Dir zu sagen, dass ich, wenngleich ich mich heute nicht recht wohl fühle, in Gedanken bei Dir bin. Ängstige Dich aber nur nicht um mich! Du sollst den Aufenthalt dort von ganzem Herzen genießen und so schnell wie möglich wieder kräftig werden. Mein Bruder Gilbert und seine Tochter Angela sind bei mir. Das wird Dich freuen. Deine guten Worte, mein Liebling, tragen Früchte. Gilbert und Angela geben sich alle Mühe, aufmerksam und freundlich gegen mich zu sein, aber wie sehr vermisse ich meine eigene kleine Tochter! Doch das schadet nichts. Du wirst genesen, und ich werde genesen, und bald werden wir uns wiedersehen. Alles Liebe und Gute!
Dein vereinsamter Vater
John Brand.
PS. Bevor Du diesen Brief in Händen hast, wird Dir schon ein Kabel meine Abreise gemeldet haben. Sonst hätte ich Dir nicht so geschrieben. Ich möchte Dich nicht in Sorge versetzen oder den Gedanken in Dir erwecken, ich sei unglücklich. Aber Dir zu schreiben, ist das Beste, wenn ich nicht mit Dir plaudern kann. Und bald werde ich das letztere tun!
Es verstrichen ein paar Sekunden, ehe der Anwalt irgendeine Bemerkung machte. Selten nur spiegelte sein Gesicht seine Gedanken und Gefühle wider, doch jetzt verriet es unverkennbar ein gewisses Befremden.
»Auch ohne diesen Brief war ich überzeugt, dass Ihre beiderseitige Zuneigung keinen Wandel erfahren hatte, mein Kind«, erklärte er freundlich. »Ich habe Sie fast Ihr ganzes Leben lang gekannt und ihn seit den fernen Tagen, als wir als Knaben zusammen spielten. Aber über etwas stutze ich sehr. Dieser Brief wurde zur selben Zeit geschrieben, da John sein neues Testament abfasste. Oder um ganz genau zu sein: Das Datum zeigt den Tag vor der Testamentsunterzeichnung. Dessen ungeachtet deutet in dem Schreiben nichts darauf hin, dass er im Begriff stand, Sie in einer Art zu behandeln, die seiner bisherigen gänzlich zuwiderlief.« Onslow gab den Brief Susan zurück, die ihn wieder in die Tasche steckte. »Was bedeutet übrigens der Satz, dass Gilberts und Angelas Anwesenheit Sie freuen würde?«
»Ich bat ihn immer, sich mit ihnen zu versöhnen«, entgegnete sie. »Er war solch ein prächtiger Mensch, so gut in jeder anderen Hinsicht. Da betrübte es mich, dass er mit seinen einzigen Blutsverwandten nichts zu schaffen haben wollte. Maurice sahen wir allerdings bisweilen bei uns, doch Mr. Gilbert nie; und Angela traf ich gestern zum ersten Mal. Weil ich wusste, dass es ihnen pekuniär nicht gut ging, wünschte ich, er möge ihnen ein bisschen helfen, auch wenn sie es nicht verdienten.«
»Also um Ihnen einen Gefallen zu tun, lud er sie während Ihrer Erholungsreise ein«, sagte Martin Onslow.
»Und so vergelten sie es Ihnen!«, fügte Bob hinzu.
»Varnoll gehörte den Brands seit vielen Generationen«, fuhr der Rechtsanwalt fort. »Als ältester Sohn erbte es Gilbert, der dann sein Vermögen verprasste und den Besitz verkaufte, nachdem er zuvor die Frau, der John zugetan war, geheiratet hatte. Indes auch hierüber wäre es nicht zu einem derartigen Zerwürfnis gekommen, wenn Gilbert sie anständig behandelt hätte. Aber er behandelte sie schmachvoll. Ferner gab es Ärger wegen Geldschwierigkeiten. Ich will mich darüber nicht verbreiten; doch seien Sie versichert, dass Ihr Vater für seine Haltung triftige Gründe gehabt hat. Dann ging er nach dem Fernen Osten, wo ihm großer Erfolg beschieden war. Bei seiner Rückkehr stand Varnoll abermals zum Verkauf, und da er es liebte, erwarb er es und ließ sich mit Ihnen dort nieder. Er wollte, dass es Ihr Heim sei; das ging eindeutig aus seinem Testament hervor – einem anderen Testament. Er wollte, dass Sie den Namen Brand annähmen...«
»Und jetzt bin ich Susan Heriot«, fiel das Mädchen fast zaghaft ein. »Alles, was ich von meinem Vater und meiner Mutter weiß, ist lieb und gut, denn ich weiß nur, was John Brand mir erzählte. Sie ertranken, als ich drei Monate alt war, bei einem Schiffsunglück, und er nahm sich meiner an. Er lehrte mich, mich Susan Brand zu nennen, sodass mir nunmehr zumute ist, als hätte ich meine Persönlichkeit verloren. Aber auch daran werde ich mich allmählich wohl gewöhnen.«
»An Ihrem einundzwanzigsten Geburtstag, also nächstes Jahr, beabsichtigte John, Sie in aller Form zu Susan Brand zu machen. Sein Testament bestimmte außerdem, dass Ihr künftiger Gatte ebenfalls den Namen annehmen oder zum mindesten dem seinigen hinzufügen möge. Ihm lag daran, dass die Brands von Varnoll weiter existierten.«
»Auch jetzt hat er dafür gesorgt«, meinte das junge Mädchen leise.
»Ja. Und das würde die einzige Erklärung für sein Handeln sein, das mir trotz alledem rätselhaft erscheint.« Wieder schwieg Onslow einen Moment, als schwanke er, ob er sich mit Einzelheiten befassen solle oder nicht. Dann aber dünkte es ihn richtiger, Susan kurz die Umstände zu schildern.
»In dem ersten Testament war ich Ihr Vormund und Treuhänder. Überdies gab es darin ein Legat für mich selbst, wohingegen ich in dem zweiten Testament gar nicht erwähnt werde. Abgesehen von dem Umschwung, der Sie betrifft, liebes Kind, stieß ich in der zweiten Verfügung auf eine andere materielle Änderung, die mit den früheren Wünschen meines alten Freundes ebenfalls im Widerspruch steht. Wie Ihnen bekannt sein wird, war John ein sehr wohltätiger Mann. Bevor wir nun das erste Testament aufsetzten, erörterte er mit mir gründlich die Verhältnisse. Dabei errechneten wir, dass sich sein Vermögen nach Abzug der Erbschaftssteuer auf reichlich zweihunderttausend Pfund belaufen würde. Die Hälfte – auf jeden Fall aber ein Minimum von einhunderttausend Pfund – bestimmte er für Sie. Gilbert Brand erhielt nichts, hingegen seine Kinder, Maurice und Angela, je fünftausend Pfund. Ein Brand soll nicht am Hungertuch nagen, Martin, sagte er zu mir. Der Restbetrag fiel mit Ausnahme gewisser anderer Legate an wohltätige Stiftungen, die er mit äußerster Sorgfalt auswählte. Nie war John Brand ein Freund von hastigen Maßnahmen, und so traf er auch seine letzten Verfügungen mit Bedacht. Da war beispielsweise eine Blindenanstalt, für die er sich sehr interessierte und in deren Vorstand er saß. Diese bekam den größten Betrag. In seinem neuen Testament sind hingegen für mildtätige Zwecke seltsamerweise überhaupt keine Summen eingesetzt. Vielmehr geht außer den schon erwähnten örtlichen Legaten die Hälfte des Vermögens an Gilbert Brand und je ein Viertel an Angela und Maurice.«
»Die Brands von Varnoll«, warf Susan mit ihrer weichen Stimme ein.
»Das scheint tatsächlich der Kernpunkt zu sein«, pflichtete Onslow ihr bei, obwohl der Ton sein Missvergnügen offenbarte. »Übrigens erwarte ich Gilbert Brand heute Vormittag. Er bat mich schriftlich um eine Kopie des ersten Testaments. Ohne sich irgendwie festzulegen, deutete er an, dass er vielleicht gewissen Wünschen seines verstorbenen Bruders Rechnung tragen wolle, wenngleich hierfür keinerlei Verpflichtung bestehe. Möglicherweise bezieht sich das auf Sie, Susan. Wünschen Sie, ihm zu begegnen?«
»Nein. Die Art, wie Angela mich abfertigen ließ, zeigt, dass sie keine freundlichen Gefühle für mich hegen. Gleicht Mr. Gilbert meinem... seinem Bruder?«
»Ja, er gleicht ihm«, entgegnete der Anwalt. »Natürlich ist er älter und sein Haar weißer. In Johns Gesichtsausdruck; lag allerdings etwas, das Gilbert fehlt.«
Jetzt mischte sich Bob ein.
»Komische Sache! Ich habe das Gefühl, als sei ich Gilbert Brand bereits begegnet. Aber wo?«
»Da ist er«, wandte sich der Anwalt an Susan, als die Klingel schrillte. »Gehen Sie doch mit meinem Sohn ins Nebenzimmer. Wenn ich es für wünschenswert erachte, lasse ich Sie holen, Kind. Das heißt, sofern Sie es mir gestatten.«
»Selbstverständlich, Onkel Martin.« Der Anflug eines Lächelns huschte um ihren Mund, als sie ihn mit dem Namen nannte, der ihr aus verflossenen glücklichen Tagen geläufig war.
Zweites Kapitel
»Verdammte Geschichte! Was werden Sie tun?« So lauteten Bobs Worte, als sich die Tür geschlossen hatte und sein förmlicherer Vater sich außer Hörweite befand.
»Was kann ich anderes tun, als den Rat meines Anwalts befolgen?«
Wenn Susan sich auch nicht scheute, dem alten Mr. Onslow gegenüber etwas von ihren Gefühlen zu verraten, so beabsichtigte sie nicht, das gleiche Vertrauen seinem Sohn zu schenken, und ihr Blick deutete fraglos an, dass sie von Bob keine Ratschläge erwartete. Sie nahm auch nicht an dem Schreibtisch Platz, der im Zimmer stand, sondern schritt zum Fenster hinüber und blieb dort stehen.
»Was mein Alter Herr sagt, hat ja Hand und Fuß«, erwiderte Bob. »Doch glauben Sie in Ihrem innersten Herzen wirklich, dass bei dem zweiten Testament alles einwandfrei zuging?«
»Glauben...? Die Brands von Varnoll – damit ist alles erklärt. Irgendetwas bewog ihn, es ihnen zurückzugeben. Vielleicht ahnte er, dass ihm nicht mehr viel Zeit beschieden war...«
»Aber warum es zurückgeben?«, ereiferte sich der künftige Anwalt. »Hat Gilbert nicht vor Jahren bewiesen, wie wenig er im Grunde an dem Besitz hing? Lassen Sie sich nur nicht von der ruhigen Art meines Vaters täuschen. Ich weiß, dass es ihn im geheimen bitter wurmt. Gewiss, er rät Ihnen, sich mit der neuen Lage abzufinden; aber nur, weil es keinen anderen Ausweg gibt. Trotzdem steckt irgendein schmutziges Manöver dahinter, das man leider nicht beweisen kann. Einem Gericht würde es als das Allernatürlichste erscheinen, dass John Brand seine Verwandten einlud, sich dann mit ihnen völlig aussöhnte und so weiter. Ich aber wittere Unrat. Er hätte Sie niemals so behandelt, wenn das Kleeblatt ihn nicht auf solch wirklich unanständige Weise überrumpelt haben würde.«
Im Augenblick war seine Entrüstung größer als die ihrige.
»Ich muss lernen, mich umzustellen«, erwiderte Susan. »Das ist alles. Es dreht sich ja nicht um das Geld. Dass ich darauf keinen Anspruch hatte, weiß ich sehr wohl. Aber ich liebe Varnoll, weil ich mit ihm dort lebte. Wie unbeschreiblich gut war er zu mir, wieviel haben wir gemeinsam geplant! Es ist ein schrecklicher Schlag gewesen, aber... aber man überwindet auch das, nicht wahr?« Tapfer schaute sie ihn an, als sie die Frage stellte.
»Susan, wollen Sie mich heiraten?« Ganz unvermittelt stieß Bob Onslow den Satz hervor, als sei ein Gedanke in seinem Hirn aufgezuckt, den er sofort in die Tat umsetzen wollte. »Sie können doch unmöglich allein durchs Leben gehen. Ich bin zwar gegenwärtig noch nicht fertig; doch mit ein bisschen Glück bestehe ich im Juni mein Schlussexamen, und dann wird mich Vater in die Firma aufnehmen. Er hat Sie riesig gern. Meinen Sie nicht...«
Er streckte ihr beide Hände entgegen, worauf sie die Entfernung zwischen sich und ihm noch vergrößerte. Gleichzeitig wurde er gewahr, dass die Liebenswürdigkeit von ihr abgefallen war.
»Mr. Onslow, erwarten Sie, dass ich das ernst nehme?«
Schneidend kamen die Worte aus ihrem Mund, und die kleine Nase hob sich in einer Weise, die Verachtung bedeutete.
»Nennen Sie mich wenigstens Bob, wenn Sie mir schon einen Korb geben«, sagte er kleinlaut. »Das wirkt immerhin etwas mildernd.«
»Natürlich gebe ich Ihnen einen Korb. Was fällt Ihnen denn ein? Treibt Sie Mitleid mit mir oder die Idee, dass Sie auf diese Weise einen größeren Zuschuss für sich erhalten können?«
»Seien Sie nicht allzu grausam, Susan. Ja, es war ein plötzlicher Einfall, den ich aber herrlich fand. Ich weiß, dass ich ein grässlicher Esel bin, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass meine Gedanken sich viel mit Ihnen beschäftigen.«
»Wie nett«, spottete das junge Mädchen. »Nachdem Sie mich, abgesehen vom heutigen Tag, erst ein einziges Mal sahen – und das vor zwei Jahren.«
»Oh, da irren Sie!«, widersprach er. »Vor acht Jahren schon traf ich Sie zum ersten Mal. Erinnern Sie sich nicht mehr? Es war auf einer Kindergesellschaft, und wir spielten Pfänderspiele. Ich musste mich vor der Klügsten verbeugen, vor der Hübschesten niederknien und jene, die ich am liebsten hatte, küssen. Mithin verbeugte ich mich vor Ihnen, kniete vor Ihnen, und dann küsste ich Sie.«
»Ja, jetzt entsinne ich mich.« Susan lächelte, und rechts und links von ihrem Mund erschien ein kleines Grübchen, »Ich hasste Sie deswegen, weil es mir so albern vorkam.«
»Es entsprach aber der Wahrheit!«
»Und seither haben Sie natürlich nie wieder sich verbeugt, gekniet oder geküsst!«
»Das will ich nicht behaupten. Doch habe ich das Spiel in Varnoll nie vergessen.«
»Schön, Bob«, sagte sie besänftigt. »Ich weiß, dass Sie es gut meinten. Wir wollen echte, treue Kameraden sein. Im Übrigen aber gehen Sie mit Ihrem Mitleid sparsam um. Wenn Sie allen Ihren Klientinnen, denen das Schicksal ein bisschen schlimm mitspielte, einen Antrag machen, riskieren Sie, dass Sie eine mal beim Wort nimmt.«
»Aber ich will ja, dass Sie mich beim Wort nehmen, Susan.«
»Unsinn! Sie sind viel zu jung, um an dergleichen auch nur zu denken. Sie und Onkel Martin werden meine besten Freunde sein, und so oft ich nicht allein fertig werde, hole ich mir Rat und Hilfe bei Ihnen.«
»Abgemacht!«, entgegnete Bob, obwohl es ihm nicht recht passte, dass sie ihn in dieser Hinsicht mit seinem Vater auf eine Stufe stellte. »Wie wollen Sie sich Ihr Leben einrichten?«
»Ich muss mir eine Beschäftigung suchen. Wenn ich dann obendrein noch tausend Pfund besitze – das ist doch eine ganze Menge Geld, wie?«
»Nein. Bei fünf Prozent Zinsen bringt es Ihnen fünfzig Pfund im Jahr – weniger als ein Pfund die Woche«, erläuterte Bob in seinem fachmännischen Ton. »Damit können Sie nicht viel anfangen. Das Kapital aber darf auf keinen Fall angetastet werden.«
»Nun, irgendeine Stellung werde ich schon finden.«
»Unmöglich, Susan. Das geht nicht.«
»Was geht nicht? Arbeiten nicht Tausende von Mädchen? Im vergangenen Jahr wohnte ich mit meinem... mit Mr. Brand im Savoy-Hotel, und eines Morgens schlenderte ich um acht Uhr nach der Waterloo Brücke und beobachtete wohl eine Stunde lang, wie ganze Heerscharen von Mädchen an mir vorüberkamen. Kellnerinnen, Ladenmädchen, Büroangestellte, Modistinnen, Schneiderinnen, die von einer der großen Untergrundstationen kamen und ihrer Arbeitsstätte zustrebten. Ohne die Güte von John Brand würde auch Susan Heriot denselben Weg einschlagen, dachte ich. Nun, was ich damals sah und dachte, wird jetzt Wirklichkeit werden. Das ist alles.«
»Für Sie passt das nicht, Susan.«
»Sehr hilfreich sind Sie nicht, Bob. Warum passt es für die andern und nicht für mich? Die meisten von ihnen sahen sehr zufrieden aus, und jedenfalls machten sie sich nützlich.«
»Gewiss. Aber Sie waren im Savoy. Darin liegt der gewaltige Unterschied. Die andern wurden für einen Beruf erzogen; Sie nicht. Können Sie sich vorstellen, wie Sie tagtäglich von neun bis sechs auf eine Schreibmaschine hämmern?«
»Weshalb nicht?« gab sie zurück. »Anfangs wird es mich nicht sonderlich beglücken; doch je schneller ich damit anfange, desto schneller gewöhne ich mich daran.«
Nachdenklich starrte Bob aus dem Fenster. Es war ein Hinterzimmer und die Aussicht mithin nicht angenehm: die gleichen schmalen Fenster anderer Büros und Stenotypistinnen und Angestellte, die sich emsig jener Arbeit widmeten, zu der das Mädchen neben ihm bald gezwungen sein würde.
»Wir wollen sehen, was mein Alter Herr dazu sagt«, erklärte er schroff. »Hat diese Teufelin, diese Angela, je gearbeitet?«
»Meines Wissens nicht. Sie lebte mit ihrem Vater ganz bescheiden in einem Häuschen bei Churbury. Irgendwie schlugen sie sich durch.«
»Und weil Sie Mr. Brand versöhnlich stimmten, behandelt man Sie jetzt auf solche Art. Pfui, was für eine undankbare Gesellschaft! Wenn Angela Brand mir über den Weg liefe, ich würde sie hassen!«
»Beschwören Sie das nicht, Bob. Angela sieht nämlich ungewöhnlich gut aus.«
»Pah!« Er machte eine abwerfende Geste. »Halt – sprachen Sie eben von Churbury in Sussex?«
»Jawohl. Dort lebten sie bisher.«
»Aha, dann weiß ich, wo ich dem tüchtigen Gilbert Brand begegnete.« Bob Onslow grinste. »Das ist wirklich spaßig. Wenn er uns besucht, benimmt er sich wunder wie vornehm. Aber die Art, wie er Girlie Marshall und mich anschnauzte, würde Sie erstaunt haben.«.
»Girlie? Ein Mädchen hat er angeschnauzt?«
»Girlie ist ein Junge. Ein Freund von mir. Er spielt Golf und nahm mich eines Tages mit. Während des ganzen Vormittags wurden wir von ein paar Stümpern aufgehalten. Als wir dann endlich beim Spiel um den Hügel herumkamen, wartete dort einer dieser Pfuscher auf uns und fluchte und schimpfte, weil wir ihn getroffen hätten. Er sitze im Ausschuss, erzählte er, und Leute wie wir seien ein Schandfleck auf dem Golfplatz. Ohne eine Atempause schimpfte er weiter, sodass schließlich das Paar hinter uns ebenfalls herankam und einer ihrer Bälle tatsächlich gegen ihn prallte. Darauf meinte ich: Tut mir leid, Sir; aber wir müssen weiter. Den Rest Ihrer Rede können Sie ja den Herren hinter uns erzählen! Das war meine erste Begegnung mit Gilbert Brand.«
»Wie oft haben Sie ihn seither gesehen?«
»Nur einmal. Er stattete meinem Vater im Büro einen Besuch ab.«
»Erkannte er Sie wieder?«
»Ich glaube kaum. Allerdings stutzte er ein bisschen. Aber ich nehme an, dass er sich mit allzu vielen Leuten herumstreitet, um einen x-beliebigen Fremden im Gedächtnis zu behalten. Girlie sagt, Gilbert Brand sei ziemlich unbeliebt. Ich möchte wissen, was er dort drinnen plappert!« Bobs Daumen wies nach der Verbindungstür. »Wenn er noch ein Fünkchen Anständigkeit in sich hat, fordert er Vater auf, ein geziemendes Jahresgeld für Sie festzusetzen, oder er bietet Ihnen fünfzigtausend statt eintausend Pfund. Aber ich bezweifle es.«
»In Anbetracht des Empfangs, der mir in Varnoll zuteilwurde, bezweifle ich es ebenfalls«, sagte Susan Heriot.
»Ich bin etwas erstaunt, dass er uns die Weiterführung der Geschäfte übertrug«, fuhr Bob fort. »Er hätte es nicht nötig gehabt. Werden Sie hineingehen, wenn es meinem Alten Herrn zweckdienlich erscheint?«
»Gewiss.«
»Ich halte es auch für richtig«, meinte Bob Onslow weise. »Aber neugierig bin ich, was er da drinnen angibt.«
Hierauf antwortete Susan nicht. Es wäre verzeihlich gewesen, wenn auch sie die Neugier geplagt hätte. Doch das, was Gilbert Brand dem Rechtsanwalt tatsächlich vorschlug, würde sie maßlos überrascht haben.
Drittes Kapitel
Gilbert Brand, in Wirklichkeit gut sechzig Jahre alt, wirkte ungeachtet seines weißen Haares jünger. Möglicherweise hatte der neue Reichtum seinem Gebaren Vertrauen und Würde verliehen – jedenfalls überschritt er die Schwelle von Martin Onslows Arbeitszimmer selbstsicher und dennoch liebenswürdig.
Eine schwarze Krawatte, dunkle Hose und der Flor am Revers zeigten die Trauer um den verstorbenen Bruder an.
Er legte ein kleines Paket auf die Schreibtischplatte und ließ sich dann in dem Sessel nieder, den Mr. Onslow anbot – den Sessel, in dem kurz zuvor Susan gesessen hatte. Hierauf zog er einen großen Umschlag aus der Brusttasche seines schwarzen Mantels.
»Es war sehr nett von Ihnen, dass Sie mir Einblick in das erste Testament Johns gewährten«, begann er. »Ich kann mir vorstellen, wie Sie dieser völlige Wechsel in seinen Bestimmungen erstaunt hat. Aber Blut ist eben dicker als Wasser. Wenn es zum Äußersten kommt, halten die Brands immer wie Pech und Schwefel zusammen. Daher würde es vielmehr erstaunlich gewesen sein, wenn er anders gehandelt hätte, als er tat. Wir, das heißt John und ich, haben nicht viel Worte über den Inhalt seines Testaments verloren. Es dünkte mich auch besser so. Sie wissen ja, wie rasch die Leute Böses argwöhnen. Nichtsdestoweniger ließ John gelegentlich durchblicken, dass er ursprünglich gewisse Versorgungen vorgesehen habe, von denen ich, sofern es mir beliebte, vielleicht einige durchführen könne. Sie verstehen mich, nicht wahr? Nichts von Verpflichtungen – er stellte es gänzlich meinem Ermessen anheim.«
Rechtsanwalt Onslow verneigte sich bejahend. Von jeher huldigte er der Politik, mehr zuzuhören als zu sprechen.
»Mir fiel als erstes auf, dass das nunmehr überholte Testament Ihnen, Mr. Onslow, geschnitzte Elfenbeinschachfiguren zuspricht, mit denen Sie und er oft gespielt haben. Ferner sollten Sie ein Legat von tausend Pfund erhalten. Die Schachtel mit den Schachfiguren steht dort. Sie wird Ihnen sicher ein liebes Erinnerungsstück sein, und mir bereitet es Freude, sie Ihnen persönlich auszuhändigen. Was die tausend Pfund anbelangt, so werde ich sie Ihnen überweisen, sobald das Testament gerichtlich anerkannt worden ist. Im Übrigen hoffen mein Sohn und ich, dass Sie uns und unseren Besitz betreuen werden wie zu Lebzeiten meines Bruders.«
Die Rede wurde mit einer Miene noblen Freimuts und echter Großzügigkeit vorgetragen. Ihre Wirkung zu beurteilen, war schwer. Martin Onslow hatte aufmerksame graue Augen, und hinter ihnen saß ein sehr kluges und vielleicht ein wenig misstrauisches Hirn. Es war durchaus wahrscheinlich, dass sein alter Freund, nachdem er ihn in seinem zweiten Testament nicht erwähnt hatte, Wünsche, wie sie Gilbert Brand andeutete, geäußert haben konnte; wiederum war es ebenso unbedingt möglich, dass jene, denen das Testament plötzlich Reichtümer in den Schoß warf, es für eine gute Taktik erachteten, ihm sein Legat auszuzahlen und ihm somit persönliche Beweggründe für einen eventuellen Einspruch zu nehmen – falls irgendetwas zweifelhaft sein sollte.
»Für die Schachfiguren danke ich Ihnen«, erwiderte Onslow ruhig, »weil ich sie tatsächlich als eine Erinnerung hoch werte. Die tausend Pfund jedoch stellten gewissermaßen ein Honorar für meine Tätigkeit als Testamentsvollstrecker dar. Da ich gemäß der neuen letztwilligen Verfügung als solcher aber ausscheide, fühle ich mich nicht berechtigt, die Summe anzunehmen.«
»Mein lieber, verehrter Mr. Onslow, so dürfen Sie die Dinge nicht auslegen. Nein, Sie müssen uns erlauben, die Wünsche meines Bruders zu erfüllen; sonst hätten wir nämlich irgendwie, das Gefühl, uns seines Vertrauens nicht würdig zu erweisen.«
Wiederum verneigte sich Onslow, als stimme er dem Besucher zu, doch er entgegnete nichts.
»Bezüglich der vielen, in dem ersten Testament aufgezählten wohltätigen Stiftungen hoffe ich demnächst mit Ihrer Hilfe eine Entscheidung zu treffen«, fuhr der neue Besitzer Varnolls fort. »Ich werde dann mein eigenes Testament abfassen und dabei erwägen, wie weit ich, ohne das Gut zu schädigen, die ursprünglichen Absichten meines Bruders verwirklichen kann. Es liegen ja nicht mehr allzu viele Lebensjahre vor mir, sodass die in Frage kommenden Anstalten oder Wohltätigkeitsvereine nicht lange zu warten haben werden. Ich hoffe, meine Absichten finden Ihren Beifall?«
Obwohl dies alles so schlicht und menschenfreundlich klang, sah der Anwalt die beiden Seiten des Falles. Gewiss, der Vorschlag war ausgezeichnet und mochte sehr wohl John Brands Absichten entsprechen. Sobald indes Vermögen und Grund den neuen Eigentümern ausgehändigt waren, konnten sie nach ihrem Belieben damit verfahren.
Während Onslow sich abermals zustimmend verbeugte, fragte er ohne jeden Übergang: »Was geschah mit dem zweiten Testament, nachdem John es unterzeichnet hatte?«
»Garcher unterrichtete mich, dass er Klausel um Klausel meinem Bruder vorgelesen und ihm die Urkunde nach, ordnungsgemäßer Unterzeichnung seitens des Erblassers und der Zeugen übergeben habe. John legte sie dann unter sein Kopfkissen, wo wir sie, als er etliche Tage später gestorben war, fanden.«
»Möchten Sie nicht Garcher mit der Wahrung Ihrer Interessen betrauen?«
»Nein«, erwiderte Gilbert Brand, ohne zu überlegen. »Ich kenne ihn nicht. Nur um Zeit zu gewinnen, ließ mein Bruder ihn holen. Wir alle wünschen, dass es sonst bleibt wie zuvor.« Jetzt trat eine Jause im Gespräch ein, der schließlich Onslow ein Ende machte. Langsam und sehr deutlich sagte er: »Ich hatte gehofft, Sie würden eine großzügigere Regelung der Adoptivtochter Ihres Bruders gegenüber anregen. Sie erwähnten vorhin meine Überraschung über die gänzlich veränderten Verfügungen. Nun, am meisten überrascht mich die geringe Summe, die jene erhält, an der er mit wahrhaft väterlicher Liebe hing.«
»Ah, Susan Heriot!« Gilbert Brand räusperte sich. »Sie kehrte gestern nach Varnoll zurück, und es tut mir leid, dass sie es nicht für die Mühe wert hielt, einen von uns zu begrüßen. Offenbar hat ihr Mrs. Heath etwas gesagt – nicht allzu taktvoll, fürchte ich und unmittelbar darauf fuhr sie wieder weg. Wissen Sie, wo sie sich aufhält?«
Natürlich wusste es Martin Onslow. Er hätte ja nur eine Tür zu öffnen brauchen, um Susan hereinzurufen; aber noch war er nicht überzeugt, dass dies die beste Lösung sein würde. Ob Gilbert Brand nicht ahnte, welches Willkommen Angela der Verwaisten bereitet hatte?
»Ich habe die Adresse noch nicht erfahren«, wich er aus.
Der Besucher blickte sinnend zu Boden.
»Es ist Ihnen vielleicht nicht bekannt, dass mein Sohn Maurice und Miss Heriot sich bei verschiedenen Gelegenheiten begegneten«, begann er, als er den Kopf wieder hob. »Und Maurice bringt ihr eine tiefe Bewunderung und Zuneigung entgegen. Wenn er sie nicht äußerte, so gereicht ihm das nur zur Ehre. Das Mädchen war damals aller Voraussicht nach Erbin eines sehr beträchtlichen Vermögens, wohingegen mein Sohn nichts sein eigen nannte. Als Mitgiftjäger betrachtet zu werden, ist das letzte, was ein anständiger junger Mann sich wünscht. Kurz, er befand sich in einer heiklen Lage. Jetzt aber hat sich das Blatt gewendet. Maurice erbt ein Viertel vom Vermögen meines Bruders und wird, wenn ich die Augen schließe, selbstverständlich noch mehr erben. Nichts hindert ihn somit, der Stimme seines Herzens zu folgen und um Susan anzuhalten. Ich spreche ganz offen mit Ihnen, Mr. Onslow, und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Miss Heriot von den Wünschen meines Sohnes in Kenntnis setzten.«
Wiederum überlegte Onslow sorgfältig, ehe er antwortete. Dies war ein ganz unerwarteter Vorschlag, für den allerhand zu sprechen schien. Alles renkte sich so glatt ein, dass es überhaupt keinen Verlierer gab. Er würde seine tausend Pfund bekommen, die Blindenanstalt ihr Legat, und Susan würde die künftige Herrin von Varnoll sein. Nichts war wirklich verändert – nur, dass Gilbert Brand und seine Familie sich im Besitz einer viertel Million sahen, mit der sie nie hatten rechnen können.
»Ist sich Miss Heriot der Gefühle, die Ihr Sohn für sie hegt, bewusst?«, erklang die Stimme des Anwalts.
»Vielleicht. Vielleicht auch nicht, Mr. Onslow. Aus dem vorhin angeführten Grunde ist Maurice möglicherweise nicht so offen gewesen, wie er ja jetzt sein darf.«
»Und Sie wünschen wirklich, dass ich es ihr sage? Sollte man das nicht besser den beiden jungen Menschen überlassen?«