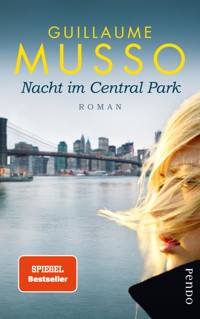9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Aufregender kann Urlaubslektüre nicht sein: Bestsellerautor Guillaume Musso legt viele falsche Fährten und begeistert seine Fans mit einem bewegenden Roman. Ein Schriftsteller, der in Ruhe gelassen werden will. Eine Journalistin, die ihm näherkommen will, und Schockierendes entdeckt: In »Ein Wort, um dich zu retten« tun sich menschliche Abgründe auf. Warum hat sich der Schriftsteller Nathan Fowles aus der Öffentlichkeit zurückgezogen? Die Frage lässt die Journalistin Mathilde Monney nicht los. Um sein Geheimnis zu lüften, folgt sie ihm auf eine kleine französische Insel. Kurz darauf geschieht ein Mord. Wird Monney ihr Ziel erreichen und Fowles' dunkle Vergangenheit ans Licht bringen? Und wenn ja – zu welchem Preis? »Eine Liebeserklärung Mussos an die Literatur und das Schreiben.« Elle Der französische Bestsellerautor Guillaume Musso hat mit »Ein Wort, um dich zu retten« eine Liebeserklärung an die Literatur und das Schreiben verfasst. Wer »Das Mädchen aus Brooklyn« und »Das Atelier in Paris« mochte, wird auch diesen Roman und Bestseller 2020 nicht aus der Hand legen können. Der meistverkaufte Gegenwartsautor Frankreichs erstaunt die Leser einmal mehr mit überraschenden Wendungen und liefert einen der spannendsten Thriller des Jahres ab. Rache an der Côte d'Azur Musso hat einmal mehr die perfekte Lektüre für den Sommerurlaub verfasst. Der Roman spielt auf der abgeschiedenen Insel Île Beaumont in Frankreich. Dadurch ist er perfekt geeignet, um sich an kalten Tagen dem Fernweh hinzugeben – aber nicht zu sehr. Immerhin muss das Rätsel um Autor Fowles gelöst werden. »Was zunächst idyllisch anmutet, wird von der einen auf die nächste Sekunde zu einem richtig guten Thriller. (...) Ein exzellentes Katz-und-Maus-Spiel, das ich in einem Rutsch gelesen habe.« emotion
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum ePUB
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.pendo.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Ein Wort, um dich zu retten« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Aus dem Französischen
von Eliane Hagedorn und Bettina Runge
( Kollektiv Druck-Reif )
Für Nathan
© Calmann-Lévy 2019
Titel der französischen Originalausgabe:
»La vie secrète des écrivains«, Calmann-Lévy, Paris 2019
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Pendo Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2020
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München; Getty Images (ShutterWorx; Vanya Dudumova / EyeEm); Ildiko Neer / Trevillion Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Karte
Zitat
Prolog
Das Rätsel Nathan Fawles
Der Schriftsteller, der nicht mehr schrieb
1 Erste Voraussetzung für einen Schriftsteller
1.
2.
3.
4.
Interview
2 Schreiben lernen
1.
2.
3.
3 Die Einkaufsliste der Schriftsteller
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Toulon
4 Interview mit einem Schriftsteller
1.
2.
3.
4.
5 Die Geschichtenträgerin
2000
2015
2017
Der Engel mit dem goldenen Haar
Auszug aus der Talkshow
6 Der Urlaub des Schriftstellers
1.
2.
3.
4.
7 In der prallen Sonne
1.
2.
3.
4.
8 Jeder ist ein Schatten
1
2.
3.
9 An der Wahrheit zugrunde gehen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Die unaussprechliche Wahrheit
10 Die Schriftsteller gegen den Rest der Welt
1.
2.
3.
4.
11 Und dann wurde es Nacht
1.
2.
3.
12 Ein wechselndes Gesicht
1.
2.
3.
4.
13 Miss Sarajewo
14 Zwei Überlebende des Nichts
1.
2.
3.
4.
5.
Epilog
»Woher kommt die Inspiration?«
Das Wahre vom Falschen unterscheiden
Karte
Zitat
Um zu überleben,
muss man Geschichten erzählen.
Umberto Eco, Die Insel des vorigen Tages[1]
Prolog
Das Rätsel Nathan Fawles
Das Rätsel Nathan Fawles
( Le Soir – 4. März 2017 )
Der Autor des mythischen Werkes Loreleï Strange, der seit nahezu zwanzig Jahren von der literarischen Bühne verschwunden ist, fasziniert auch heute noch Leser jeden Alters. Er lebt zurückgezogen auf einer Mittelmeerinsel und verweigert hartnäckig jede Anfrage der Medien. Nachforschungen über den Einsiedler der Île Beaumont.
Man bezeichnet dieses Phänomen als Streisand-Effekt: Je mehr man etwas zu verbergen versucht, desto mehr lenkt man die Neugier der anderen auf das, was man verheimlichen will. Seit seinem plötzlichen Rückzug aus dem literarischen Milieu im Alter von fünfunddreißig Jahren ist Nathan Fawles nun Opfer dieses heimtückischen Mechanismus. Der geheimnisumwitterte frankoamerikanische Schriftsteller hat in den letzten zwei Jahrzehnten für eine Menge Klatsch und Tratsch gesorgt.
1964 in New York geboren – der Vater ist Amerikaner, die Mutter Französin –, verbringt Fawles seine Kindheit in der Pariser Region, kehrt jedoch in die Vereinigten Staaten zurück, um dort sein Studium zu beenden, das ihn zunächst an die Phillips Academy führt und anschließend nach Yale. Sein Diplom in Rechts- und Politikwissenschaften in der Tasche, engagiert er sich im humanitären Bereich, arbeitet einige Jahre für Aktion gegen den Hunger und Ärzte ohne Grenzen, insbesondere in El Salvador, Armenien und Kurdistan.
DER ERFOLGSSCHRIFTSTELLER
1993 kehrt Nathan Fawles nach New York zurück und veröffentlicht sein erstes Buch Loreleï Strange, einen Coming-of-Age-Roman über eine Jugendliche in einer psychiatrischen Klinik. Der Erfolg stellt sich nicht sofort ein, aber innerhalb weniger Monate gelangt der Roman durch Mundpropaganda – insbesondere unter jungen Lesern – an die Spitze der Bestsellerlisten. Zwei Jahre später erhält Fawles mit seinem zweiten Werk A Small American Town, einem umfangreichen, episch angelegten Roman, den Pulitzerpreis und setzt sich als eine der authentischsten Stimmen der amerikanischen Literatur durch.
Ende 1997 überrascht der Schriftsteller die literarische Welt ein erstes Mal. Er hat sich inzwischen in Paris niedergelassen und veröffentlicht sein neuestes Werk auf Französisch. Les Foudroyés – Die vom Blitz Getroffenen. Dieser Roman ist eine herzzerreißende Liebesgeschichte, aber auch eine Betrachtung über die Trauer, das Innenleben und die Macht des Schreibens. Erst jetzt wird er von einem größeren französischen Publikum entdeckt, insbesondere durch seine Teilnahme an einer Sondersendung der Talkshow Bouillon de culture mit Salman Rushdie, Umberto Eco und Mario Vargas Llosa. Im November 1998 sieht man ihn erneut in dieser Sendung, wobei sich herausstellen sollte, dass dies sein vorletzter Medienauftritt war. Sieben Monate später, mit knapp fünfunddreißig Jahren, verkündet Fawles nämlich in einem schonungslosen Interview mit der französischen Nachrichtenagentur AFP ( Agence France-Presse ) seine unwiderrufliche Entscheidung, mit dem Schreiben aufzuhören.
DER EINSIEDLER DER ÎLE BEAUMONT
Seit jenem Tag hält sich der Schriftsteller an seine Entscheidung. Seitdem er in seinem Haus auf der Île Beaumont lebt, hat Fawles keine einzige Zeile mehr veröffentlicht und auch keinem Journalisten mehr ein Interview gegeben. Er hat zudem alle Anfragen auf Film- oder Fernsehadaptionen seiner Romane abgelehnt. ( Netflix und Amazon sind mit ihren Angeboten erst vor Kurzem wieder gescheitert, trotz, wie es heißt, großzügiger finanzieller Offerten. )
Seit bald zwanzig Jahren hat der »Einsiedler von Beaumont« mit diesem Paukenschlag des Schweigens immer wieder die Fantasie der Menschen beflügelt. Warum hat sich Nathan Fawles mit nur fünfunddreißig Jahren und auf dem Höhepunkt seines Erfolgs zum freiwilligen Rückzug von der Welt entschieden?
»Es gibt kein Mysterium um Nathan Fawles«, versichert Jasper Van Wyck, von Anfang an sein Agent. »Kein Geheimnis, das es zu lüften gilt. Nathan macht jetzt einfach nur etwas anderes. Er hat endgültig einen Schlussstrich unter das Schreiben und die Verlagswelt gezogen.« Über den Alltag des Schriftstellers befragt, bleibt Van Wyck vage: »Soweit ich weiß, ist Nathan mit privaten Dingen beschäftigt.«
UM GLÜCKLICH ZU LEBEN, LEBEN WIR IM VERBORGENEN
Um mögliche Erwartungen der Leser im Keim zu ersticken, präzisiert der Agent, der Autor habe »seit zwanzig Jahren keine einzige Zeile mehr geschrieben«, und er erklärt unmissverständlich: »Zwar wurde Loreleï Strange häufig mit Der Fänger im Roggen verglichen, aber Fawles ist nicht Salinger: In seinem Haus gibt es keinen mit Manuskripten gefüllten Tresor. Es wird nie mehr einen neuen Roman aus der Feder von Nathan Fawles geben. Auch nicht nach seinem Tod. So viel ist sicher.«
Doch auch diese Mitteilung konnte die Neugierigsten nicht davon abhalten, mehr erfahren zu wollen. Im Laufe der Jahre haben zahlreiche Leser und mehrere Journalisten die Reise zur Île Beaumont unternommen, um im Umkreis von Fawles’ Haus herumzustreifen. Sie standen immer vor verschlossener Tür. Dieses Misstrauen scheint auf alle Inselbewohner zuzutreffen. Sehr überraschend ist das nicht an einem Ort, der es sich bereits vor dem Zuzug des Schriftstellers zur Devise gemacht zu haben schien: Um glücklich zu leben, müssen wir im Verborgenen leben. »Die Gemeindeverwaltung gibt keine Informationen über die Identität ihrer Bewohner heraus, ob diese nun berühmt sind oder nicht.« Das erklärt das Sekretariat des Bürgermeisters lapidar. Nur wenige Inselbewohner sind bereit, sich über den Schriftsteller zu äußern. Diejenigen, die uns antworten wollen, beschreiben die Anwesenheit des Autors von Loreleï Strange auf ihrem Inselreich als völlig banal: »Nathan Fawles verkriecht sich nicht in seinem Haus, er versteckt sich nicht«, versichert Yvonne Sicard, die Frau des einzigen Arztes auf der Insel. »Man begegnet ihm häufig am Steuer seines Mini Moke, wenn er im Ed’s Corner, dem einzigen kleinen Supermarkt der Stadt, seine Einkäufe erledigt.« Er besucht auch den Pub der Insel, »insbesondere bei Fußballübertragungen von Olympique Marseille«, erzählt der Wirt des Lokals. Einer der Stammgäste des Pubs bemerkt, dass »Nathan nicht so scheu ist, wie er gelegentlich von Journalisten beschrieben wird. Er ist eher ein angenehmer Bursche, der sich mit Fußball gut auskennt und japanischen Whisky liebt«. Es gibt nur ein Gesprächsthema, das ihn wütend machen kann: »Wenn Sie versuchen, ihn auf seine Bücher oder die Literatur anzusprechen, verlässt er umgehend das Lokal.«
EINE UNERSETZLICHE LÜCKE IN DER LITERATUR
Unter seinen Schriftstellerkollegen findet man zahlreiche bedingungslose Anhänger von Fawles. Tom Boyd beispielsweise bringt ihm grenzenlose Bewunderung entgegen. »Ich verdanke ihm einige meiner ergreifendsten Leseerlebnisse, und er zählt zweifellos zu den Schriftstellern, denen ich viel schulde«, versichert der Autor von La Trilogie des Anges. Gleiche Töne kommen von Thomas Degalais, nach dessen Meinung Fawles mit den drei sehr unterschiedlichen Büchern ein originelles Gesamtwerk geschaffen hat, das Geschichte schreiben wird. »Wie alle anderen auch, bedauere ich natürlich, dass er sich aus der Literaturszene zurückgezogen hat«, erklärt der französische Romanschriftsteller. »Seine Stimme fehlt in unserer Zeit. Ich fände es wunderbar, wenn Nathan sich mit einem neuen Roman zu Wort melden würde, aber ich glaube nicht, dass dies je wieder geschehen wird.«
Es ist tatsächlich unwahrscheinlich, aber vergessen wir nicht, dass Fawles seinem letzten Roman folgenden Satz von König Lear als Motto vorangestellt hat: »Die Sterne sind’s, die Sterne über uns, die unsre Zufälle bestimmen.«
Jean Michel Dubois[2]
Der Schriftsteller, der nicht mehr schrieb
Éditions Calmann-Lévy
21, rue du Montparnasse
75006 Paris
Kennziffer: 379529
Monsieur Raphaël Bataille
75, avenue Aristide-Briand
92120 Montrouge
Paris, 28. Mai 2018
Sehr geehrter Monsieur Bataille,
wir haben Ihr Manuskript Die Unnahbarkeit der Baumkronen erhalten und bedanken uns für das Vertrauen, das Sie unserem Verlag entgegenbringen.
Ihr Manuskript wurde von unserem Lektorat sorgfältig geprüft, leider entspricht es nicht der Art von Literatur, die wir derzeit suchen.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie schon bald einen Verlag für diesen Text finden.
Mit freundlichen Grüßen
Sekretariat Literatur
PS: Ihr Manuskript liegt in unserem Haus einen Monat zur Abholung bereit. Sollten Sie eine Rücksendung per Post wünschen, schicken Sie uns bitte einen frankierten Rückumschlag zu.
1 Erste Voraussetzung für einen Schriftsteller
Erste Voraussetzung für einen Schriftstellerist ein gutes Sitzfleisch.
Dany Laferrière, Tagebuch eines Schriftstellers im Pyjama[3]
1.
Dienstag, 11. September 2018
Der Wind ließ die Segel bei strahlend blauem Himmel flattern.
Die Jolle hatte kurz nach dreizehn Uhr an der Küste des Département Var abgelegt und sauste mit einer Geschwindigkeit von fünf Knoten in Richtung Île Beaumont. Ich saß in der Nähe des Ruders neben dem Skipper und berauschte mich an der Betrachtung des funkelnden goldenen Schimmers über dem Mittelmeer und an der verheißungsvollen Seeluft.
Am Morgen hatte ich meine Pariser Wohnung verlassen und war um sechs Uhr früh in den TGV nach Avignon gestiegen. Von der Papststadt aus war ich mit einem Bus bis nach Hyères gefahren und von dort weiter mit einem Taxi zum kleinen Hafen Saint-Julien-les-Roses, der einzigen Anlegestelle, die Fährverbindungen zur Île Beaumont anbot. Wegen einer der vielen Verspätungen der Bahn hatte ich das einzige Schiff, das mittags fuhr, um fünf Minuten verpasst. Während ich, meinen Koffer im Schlepptau, auf dem Kai umherirrte, hatte mir der Kapitän eines niederländischen Segelschiffs, der es soeben startklar machte, um seine Fahrgäste von der Insel abzuholen, freundlicherweise angeboten, mich mitzunehmen.
Ich war kürzlich vierundzwanzig Jahre alt geworden und stand an einem Wendepunkt in meinem Leben. Zwei Jahre zuvor hatte ich eine Pariser Handelsschule mit meinem Diplom in der Tasche verlassen, mir jedoch keine meiner Ausbildung entsprechende Arbeit gesucht. Das Studium hatte ich nur absolviert, um meine Eltern zu beruhigen, verspürte allerdings keine Lust auf ein Leben, das von Betriebswirtschaft, Marketing oder Finanzen bestimmt sein würde. In den beiden zurückliegenden Jahren hatte ich mehrere kleine Jobs angenommen, um meine Miete bezahlen zu können, meine gesamte kreative Energie aber in das Schreiben eines Romans gesteckt, Die Unnahbarkeit der Baumkronen, der von zehn Verlagen abgelehnt worden war. Ich hatte alle Ablehnungsschreiben an die Pinnwand über meinem Schreibtisch gehängt. Bei jeder Nadel, die ich in den Kork steckte, glaubte ich sie mir ins Herz zu stechen, denn meine daraus resultierende Niedergeschlagenheit war ebenso groß wie meine Leidenschaft fürs Schreiben.
Zum Glück hielten diese depressiven Verstimmungen nie sehr lange an. Bisher war es mir immer wieder gelungen, mir einzureden, solche Fehlschläge seien das Vorzimmer zum Erfolg. Um mich auch wirklich davon zu überzeugen, hielt ich mich an berühmte Beispiele. Stephen King berichtete häufig, dreißig Verlage hätten sein Buch Carrie abgelehnt. Die Hälfte der Londoner Verleger beurteilte den ersten Band von Harry Potter als »viel zu umfangreich für Kinder«. Und bevor er der meistverkaufte Science-Fiction-Roman wurde, hatte Der Wüstenplanet von Frank Herbert etwa zwanzig Absagen erhalten. Was F. Scott Fitzgerald anbelangt, so tapezierte er anscheinend die Wände seines Büros mit den einhundertzwanzig Absagebriefen, die er von Zeitschriften bekam, denen er seine Erzählungen anbot.
2.
Aber diese Autosuggestion nach der Coué-Methode stieß allmählich an ihre Grenzen. Trotz aller Willenskraft fiel es mir schwer, weiterzuschreiben. Es war nicht das Leere-Blatt-Syndrom oder ein Mangel an Ideen, die mich lähmten. Es war der gefährliche Eindruck, beim Schreiben nicht voranzukommen und nicht mehr so genau zu wissen, wohin es gehen sollte. Ich hätte jemanden gebraucht, der meine Arbeit mit unvoreingenommenem Blick betrachtete. Zugleich wohlwollend und kompromisslos. Anfang des Jahres hatte ich mich zu einem Kurs in Creative Writing angemeldet, der von einem angesehenen Verlag organisiert wurde. Auf diesen Schreib-Workshop hatte ich große Hoffnungen gesetzt, war aber schnell desillusioniert worden. Der Autor, der den Kurs abhielt – Bernard Dufy, ein Romanschriftsteller, der seine Glanzzeit in den Neunzigerjahren erlebt hatte –, stellte sich selbst als Goldschmied des Schreibstils vor. »Ihre gesamte Arbeit muss sich um die Sprache drehen, nicht um die Geschichte«, wiederholte er immer wieder. »Die Erzählung hat nur die Funktion, der Sprache zu dienen. Ein Buch darf keinen anderen Zweck verfolgen, als die Suche nach der Form, dem Rhythmus, der Harmonie. Darin liegt die einzig mögliche Originalität, denn seit Shakespeare sind bereits alle Geschichten erzählt worden.«
Die tausend Euro, die ich für diesen Schreibkurs berappen musste – drei jeweils vierstündige Sitzungen –, hatten mich wütend gemacht und finanziell ruiniert. Vielleicht hatte Dufy ja recht, aber ich persönlich dachte genau das Gegenteil: Der Stil war kein Selbstzweck. Die wichtigste Qualität eines Schriftstellers war es, seine Leser durch eine gute Geschichte zu fesseln. Durch eine Erzählung, die ihn aus seinem Alltag zu reißen vermochte, um ihn ins Innerste und in die Wahrheit der Protagonisten zu versetzen. Der Stil war nur das Mittel, um die Schilderung lebendig und mitreißend zu gestalten. Im Grunde konnte mir die Meinung eines akademischen Schriftstellers wie Dufy gleichgültig sein. Die einzige Meinung, die ich gern eingeholt und die in meinen Augen Bedeutung gehabt hätte, wäre die meines ewigen Idols gewesen: meines Lieblingsschriftstellers Nathan Fawles.
Ich hatte seine Bücher gegen Ende meiner Teenagerjahre entdeckt, zu einer Zeit, als Fawles bereits seit Langem mit dem Schreiben aufgehört hatte. Seinen dritten Roman Les Foudroyés hatte mir Diane Laborie, meine feste Freundin in der Abiturklasse, geschenkt, als sie mit mir Schluss machte. Der Roman hatte mich stärker erschüttert als der Verlust einer Liebe, die keine gewesen war. Nach der Lektüre hatte ich mir seine ersten beiden Bücher besorgt: Loreleï Strange und A Small American Town. Seither hatte ich nichts vergleichbar Aufwühlendes mehr gelesen.
Fawles schien sich mit seinem einmaligen Schreibstil direkt an mich zu wenden. Seine Romane waren lebendig, intensiv. Auch wenn ich eigentlich niemandes Fan bin, hatte ich seine Bücher immer wieder gelesen, denn sie erzählten mir etwas über mich, über die Beziehung zu anderen, über die Schwierigkeit, das eigene Leben in den Griff zu bekommen, über die Verletzlichkeit der Menschen und die Fragilität unserer Existenz. Sie gaben mir Kraft und spornten mich zum Schreiben an.
In den Jahren, die auf Fawles’ Rückzug folgten, hatten andere Autoren versucht, seinen Stil zu imitieren, seine Welt aufzugreifen, die Konstruktion seiner Geschichten zu kopieren oder seine Sensibilität nachzuahmen. Meiner Meinung nach war es jedoch niemandem gelungen, ihm das Wasser zu reichen. Es gab nur einen Nathan Fawles. Ob man ihn nun mochte oder nicht, man musste anerkennen, dass Fawles ein einzigartiger Autor war. Auch wenn man nicht wusste, von wem der Text stammte, reichte die Lektüre einer Seite, um ihn als Verfasser identifizieren zu können. Und nach meiner Meinung war das der wahre Hinweis auf Talent.
Auch ich hatte seine Romane eingehend analysiert, um das Rätsel seines Stils zu entschlüsseln, und versucht, ihren Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Später war in mir der ehrgeizige Plan gereift, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Obgleich ich mir keine Hoffnungen machte, eine Antwort zu erhalten, hatte ich ihm mehrfach über seinen Verlag in Frankreich und seinen Agenten in den Vereinigten Staaten geschrieben. Auch mein Manuskript hatte ich ihm geschickt.
Vor zehn Tagen dann entdeckte ich im Newsletter der offiziellen Website der Île Beaumont eine Stellenanzeige. Die kleine Buchhandlung der Insel, La Rose Écarlate, suchte einen Mitarbeiter. Sofort hatte ich mich per Mail um die Stelle beworben, und noch am selben Tag hatte mich Grégoire Audibert, der Besitzer der Buchhandlung, kontaktiert und mir via Facetime mitgeteilt, dass er meine Bewerbung annahm. Es handelte sich um einen auf drei Monate befristeten Job. Die Bezahlung war nicht umwerfend, aber Audibert sagte mir freie Unterkunft und zwei Mahlzeiten pro Tag im Fort de Café zu, einem der Restaurants am Ort.
Ich war begeistert, diesen Job zu bekommen, der mir, soweit ich das den Worten des Buchhändlers hatte entnehmen können, auch Zeit lassen würde, in einer inspirierenden Umgebung zu schreiben. Und der, davon war ich überzeugt, mir die Gelegenheit verschaffen würde, Nathan Fawles zu begegnen.
3.
Ein Manöver des Skippers verlangsamte das Tempo des Segelboots.
»Land in Sicht, geradeaus!«, rief er und deutete mit einer Kopfbewegung auf die Silhouette der Insel, die sich am Horizont abzeichnete.
Die Île Beaumont, eine Dreiviertelstunde mit dem Boot von der Küste des Département Var entfernt, hat die Form einer Mondsichel. Ein rund fünfzehn Kilometer langer und sechs Kilometer breiter Bogen. Die Insel wurde stets als ein unberührtes und geschütztes Schmuckstück gepriesen. Eine der Perlen des Mittelmeers, wo sich kleine Buchten mit türkisgrünem Wasser, Pinienwäldern und Sandstränden abwechselten. Wie die Côte d’Azur, nur ohne Touristen, Verschmutzung und Beton.
Während der letzten zehn Tage hatte ich alle Zeit der Welt, die einzige Broschüre zu studieren, die ich über die Insel finden konnte. Seit 1955 gehörte Beaumont einer diskreten italienischen Industriellenfamilie, den Gallinaris, die Anfang der Sechzigerjahre wahnsinnige Summen in die Erschließung der Insel gesteckt hatten, groß angelegte Arbeiten zur Wasserversorgung und Erdaufschüttungen durchführen ließen, sodass aus dem Nichts einer der ersten Jachthäfen an der Küste entstanden war.
Im Laufe der Jahre war die Entwicklung der Insel nach einer klaren Richtlinie weitergeführt worden: Niemals sollte das Wohlergehen der Inselbewohner auf dem Altar einer angeblichen Modernität geopfert werden! Und für die Inselbewohner hatten die Bedrohungen zwei klar definierte Gesichter: Spekulanten und Touristen.
Zur Begrenzung der Bautätigkeiten hatte der Gemeinderat der Insel eine einfache Regel aufgestellt, die vorsah, die Gesamtzahl an Wasserzählern auf der Insel einzufrieren. Eine Strategie, die von der Praxis der Kleinstadt Bolinas in Kalifornien übernommen worden war. Ergebnis: Seit dreißig Jahren lag die Bevölkerungszahl bei rund tausendfünfhundert Bewohnern. Es gab auf Beaumont kein Immobilienbüro. Ein Teil der Immobilien wurde innerhalb der Familien weitergegeben und der Rest über Kooptation. Der Tourismus wurde mithilfe einer umsichtigen Kontrolle der Verbindungen zum Festland in Grenzen gehalten. In der Hochsaison gab es genau wie im Winter ein einziges Fährschiff – die berühmte Téméraire, ein wenig übertrieben als »Ferry« bezeichnet –, die täglich dreimal zwischen der Insel und dem Festland verkehrte und kein einziges Mal öfter: um 8 Uhr, 12:30 Uhr und 19 Uhr ging es vom Schiffsanleger auf Beaumont hinüber nach Saint-Julien-les-Roses. Alles lief noch nach alter Art ab – ohne vorherige Reservierung –, und die Inselbewohner hatten immer Priorität.
Genau gesagt, war Beaumont Touristen gegenüber nicht feindlich eingestellt, es wurde jedoch auch nichts Besonderes für sie getan. Auf der Insel gab es insgesamt drei Café-Bars, zwei Restaurants und einen Pub, aber kein Hotel, und Privatunterkünfte waren rar. Je mehr man jedoch die Leute davon abhielt hierherzukommen, desto geheimnisvoller erschien die Insel und entwickelte sich zu einem begehrten Ziel. Neben der örtlichen Bevölkerung, die hier das ganze Jahr über lebte, besaßen einige Reiche Ferienhäuser auf der Insel. Im Lauf der Jahrzehnte hatten sich Industrielle und auch ein paar Künstler für diesen ungewöhnlichen, idyllischen und heiteren Lebensraum begeistert. Dem Chef einer Hightechfirma und zwei oder drei Personen aus der Weinindustrie war es gelungen, Villen zu kaufen. Aber egal, wie bekannt oder reich sie waren, alle gaben sich diskret. Die Gemeinschaft sträubte sich nicht dagegen, neue Mitglieder aufzunehmen, solange diese die Werte akzeptierten, die schon immer auf Beaumont gegolten hatten. Die Neuankömmlinge erwiesen sich im Übrigen häufig als die striktesten Verteidiger »ihrer« Insel.
Diese Gesinnung, unter sich zu bleiben, rief viel Kritik hervor – um nicht zu sagen, sie erbitterte diejenigen, die ausgeschlossen waren. Anfang der Achtzigerjahre legte die sozialistische Regierung Bestrebungen an den Tag, Beaumont zurückzukaufen – offiziell, um die Insel zum Landschaftsschutzgebiet zu erklären, tatsächlich jedoch, um diesem Ausnahmezustand ein Ende zu bereiten. Dagegen hatte sich heftiger Widerstand erhoben, und die Regierung musste den Rückzug antreten. Seither hatten sich die Behörden damit arrangiert: Die Île Beaumont war ein besonderer Ort. Und so gab es, in unmittelbarer Nähe zur Küste des Département Var, ein kleines Paradies, umspült von kristallklarem Wasser. Ein Stückchen Frankreich, aber doch nicht wirklich Frankreich.
4.
Sobald ich an Land war, zog ich meinen Koffer über das Pflaster der Anlegestelle. Der Jachthafen war nicht sehr groß, aber gut ausgestattet, belebt und voller Charme. Die kleine Stadt entfaltete sich an der Bucht entlang, wodurch eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Amphitheater entstand: stufenförmig ansteigende, farbige Häuser, die unter dem metallisch-blauen Himmel leuchteten. Ihr strahlender Glanz und ihre Anordnung erinnerten mich an die griechische Insel Hydra, die ich als Jugendlicher mit meinen Eltern besucht hatte. Aber als ich durch die schmalen und steilen Gassen bummelte, fühlte ich mich in das Italien der Sechzigerjahre zurückversetzt, und als ich weiter oben angekommen war, bemerkte ich zum ersten Mal die Strände und ihre weißen Dünen und dachte dabei an die weitläufigen Sandflächen von Massachusetts. Bei dieser ersten Begegnung mit der Insel, begleitet vom Widerhall meines Rollkoffers auf dem Pflaster der Hauptstraße, die ins Zentrum führte, wurde mir klar, dass die Einzigartigkeit und Magie von Beaumont aus dieser undefinierbaren Konstellation resultierte. Beaumont hatte etwas von einem Chamäleon. Die Insel war einmalig und ließ sich nicht einordnen, es war aussichtslos, sie analysieren oder begreifen zu wollen.
Rasch erreichte ich den Hauptplatz. Mit seiner Anmutung eines provenzalischen Dorfes schien dieser Platz einem Roman von Jean Giono entsprungen zu sein. Die Place des Martyrs war die Seele Beaumonts. Eine schattige Esplanade, eingerahmt von einem Uhrturm, einem Kriegerdenkmal, einem plätschernden Brunnen und einem Boule-Platz.
Unter den Weinlauben befanden sich direkt nebeneinander die beiden Restaurants der Insel: Un Saint Jean Hiver und Le Fort de Café. Auf der Terrasse des Letzteren erkannte ich die schroffen Gesichtszüge von Grégoire Audibert, der Artischocken mit Pfeffer-Vinaigrette aß. Er erinnerte an einen Lehrer der alten Schule: grau meliertes Spitzbärtchen, kurze Weste und langes, zerknittertes Leinensakko.
Auch der Buchhändler erkannte mich, lud mich großzügig an seinen Tisch ein und spendierte mir eine Limonade, als wäre ich zwölf Jahre alt.
»Ich sage es Ihnen lieber gleich: Ende des Jahres schließe ich die Buchhandlung«, verkündete er mir ohne Umschweife.
»Warum das?«
»Aus genau diesem Grund suche ich einen Angestellten: um Ordnung zu schaffen, die Buchhaltung zu erledigen und eine große Abschlussinventur zu machen.«
»Sie machen den Laden dicht?«
Er nickte, während er mit seinem Stück Brot einen Rest Olivenöl auftunkte.
»Aber warum?«
»Das Geschäft ist unrentabel geworden. Im Lauf der Jahre ist der Umsatz kontinuierlich zurückgegangen, und das wird sich auch nicht mehr ändern. Nun, Sie kennen die Geschichte ja: Die Obrigkeit lässt die Internetriesen, die in Frankreich keine Steuern zahlen, in aller Ruhe gedeihen.«
Der Buchhändler seufzte, schwieg einige Sekunden nachdenklich und fügte dann halb fatalistisch, halb provozierend hinzu:
»Und seien wir doch einmal realistisch: Warum sollte man es sich antun, in eine Buchhandlung zu gehen, wenn man sich mit drei Klicks auf dem iPhone ein Buch liefern lassen kann!«
»Aus vielerlei Gründen! Haben Sie versucht, einen Nachfolger zu finden?«
Audibert zuckte mit den Schultern.
»Das interessiert niemanden. Heute ist nichts unrentabler als Bücher. Meine Buchhandlung ist nicht die erste, die schließen muss, und wird auch nicht die letzte sein.«
Er schenkte sich den Rest aus der Weinkaraffe in sein Glas und leerte es in einem Zug.
»Ich zeige Ihnen jetzt La Rose Écarlate«, sagte er, während er seine Serviette zusammenlegte und aufstand.
Ich folgte ihm quer über den Platz bis zur Buchhandlung. Im sterbenslangweiligen Schaufenster waren Bücher ausgestellt, die dort offenbar seit Monaten Staub ansammelten. Audibert öffnete die Tür und ließ mich eintreten.
Auch innen war der Laden trostlos. Vorhänge nahmen dem Raum jegliches Licht. Die Regale aus Nussbaumholz hatten zwar eine besondere Note, enthielten jedoch nur klassische, schwer verdauliche, um nicht zu sagen snobistische Titel. Kultur in akademischer Reinform. So wie ich Audiberts Persönlichkeit einschätzte, stellte ich mir einen Moment lang vor, dass er wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekäme, würde man ihn zwingen, Science-Fiction, Fantasy oder Mangas zu verkaufen.
»Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer«, sagte er und deutete auf eine Holztreppe am Ende des Ladens.
Der Buchhändler hatte seine Wohnung im ersten Stock. Meine Bleibe lag im zweiten: ein Mansardenappartement, das sich über die gesamte Hauslänge erstreckte. Als ich die quietschenden Fenstertüren öffnete, erwartete mich die angenehme Überraschung einer Terrasse, die auf den Platz hinausging. Der spektakuläre Blick, der bis zum Meer reichte, hob meine Stimmung ein wenig. Ein Gewirr kleiner Gassen schlängelte sich zwischen den ockerfarbenen Steinbauten, die Patina angesetzt hatten, bis zum Ufer.
Nachdem ich meinen Koffer ausgepackt hatte, ging ich hinunter in die Buchhandlung zu Audibert, um zu erfahren, was genau er von mir erwartete.
»Das WLAN funktioniert nicht sehr gut«, teilte er mir mit und schaltete einen alten PC ein. »Man muss oft den Router im ersten Stock neu starten.«
Während der Computer hochfuhr, befüllte er eine Espressokanne und stellte sie auf eine kleine Kochplatte.
»Auch einen Kaffee?«
»Gern.«
Bis der Kaffee fertig war, spazierte ich durch den Laden. An der Kork-Pinnwand hinter der Theke hingen die alten Livres-Hebdo-Bestsellerlisten, die aus einer Zeit stammten, als Romain Gary noch schrieb ( das ist kaum übertrieben …). Ich hatte Lust, die Vorhänge zurückzuziehen, die abgewetzten purpurroten Teppiche zu entfernen, die Regale und Präsentationstische neu zu ordnen.
Als hätte er meine Gedanken gelesen, erklärte Audibert:
»La Rose Écarlate gibt es seit 1967. Heute sieht man es der Buchhandlung nicht mehr an, aber sie war früher einmal eine echte Institution. Viele französische und ausländische Autoren kamen hierher, um Lesungen oder Signierstunden abzuhalten.«
Aus einer Schublade holte er sein in Leder gebundenes Gästebuch und reichte es mir zum Durchblättern. Auf den Fotos erkannte ich tatsächlich Michel Tournier, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Françoise Sagan, Jean d’Ormesson, John Irving, John Le Carré und … Nathan Fawles.
»Sie wollen die Buchhandlung wirklich schließen?«
»Ohne Bedauern«, bestätigte er. »Die Leute lesen nicht mehr, es ist einfach so.«
Ich differenzierte:
»Die Leute lesen vielleicht anders, aber sie lesen noch immer.«
Audibert schaltete die Kochplatte unter der zischenden Espressokanne aus.
»Kurz und gut, Sie verstehen schon, was ich sagen will. Ich spreche nicht von Unterhaltungsliteratur, ich spreche von echter Literatur.«
Natürlich, die berühmte »echte Literatur« … Bei Menschen wie Audibert kam immer irgendwann der Moment, wo dieser Ausdruck – oder der des »echten Schriftstellers« – als Argument diente. Ich hingegen hatte niemals irgendjemandem das Recht erteilt, mir zu sagen, was ich lesen sollte oder nicht. Diese Art, sich zum Richter zu erheben, um zu entscheiden, was Literatur ist und was nicht, erschien mir grenzenlos anmaßend.
»Kennen Sie in Ihrem Umfeld viele echte Leser?«, regte sich der Buchhändler auf. »Ich meine, intelligente Leser, die dem Lesen ernsthafter Bücher nennenswert viel Zeit widmen.«
Ohne meine Antwort abzuwarten, ereiferte er sich weiter:
»Unter uns gesagt, wie viele echte Leser gibt es in Frankreich noch? Zehntausend? Fünftausend? Vielleicht sogar weniger.«
»Ich finde, Sie sind sehr pessimistisch.«
»Aber nein! Man muss sich damit abfinden: Wir betreten eine literarische Wüste. Heute will zwar jeder Schriftsteller sein, aber niemand liest.«
Um aus dieser Unterhaltung herauszukommen, zeigte ich auf das Foto von Fawles, das im Album klebte.
»Kennen Sie Nathan Fawles?«
Audiberts Gesicht nahm einen misstrauischen Ausdruck an, und er runzelte die Stirn.
»Ein wenig. Also zumindest, soweit man Nathan Fawles kennen kann …«
Er servierte mir eine Tasse Kaffee, der die Farbe und Konsistenz von Tinte hatte.
»Als Fawles 1995 oder 1996 hierherkam, um sein Buch zu signieren, setzte er das erste Mal den Fuß auf diese Insel. Er hat sich sofort in sie verliebt. Und ich habe ihm sogar dabei geholfen, sein Haus zu kaufen – La Croix du Sud. Aber in der Folgezeit hat sich unsere Beziehung sozusagen in Luft aufgelöst.«
»Kommt er gelegentlich noch in die Buchhandlung?«
»Nein, nie.«
»Falls ich ihn einmal sehe, glauben Sie, er wäre bereit, ein Buch für mich zu signieren?«
Audibert schüttelte seufzend den Kopf.
»Ich rate Ihnen wirklich, diesen Gedanken zu vergessen, sonst hätten Sie beste Chancen, einen Schuss aus seiner Flinte abzubekommen.«
Interview
Interview mit Nathan Fawles bei der französischen Nachrichtenagentur AFP
AFP – 12. Juni 1999 ( Auszug )
Sie bestätigen also, dass Sie mit fünfunddreißig Jahren, auf dem Höhepunkt Ihres Ruhms, Ihre Karriere als Romanschriftsteller beenden wollen?
Ja, dieses Kapitel ist für mich abgeschlossen. Seit zehn Jahren schreibe ich ernsthaft. Zehn Jahre, in denen ich jeden Morgen mit meinem Hintern auf einem Stuhl sitze, den Blick auf die Tastatur gerichtet. Dieses Leben will ich nicht mehr führen.
Ihre Entscheidung ist unwiderruflich?
Ja. Die Kunst währt lange, das Leben nur kurz.
Letztes Jahr haben Sie allerdings angekündigt, an einem neuen Roman zu arbeiten mit dem provisorischen Titel Ein unbesiegbarer Sommer …
Das Projekt ist über den Status eines Entwurfs nicht hinausgekommen, und ich habe es definitiv aufgegeben.
Welche Botschaft wollen Sie Ihren zahlreichen Lesern übermitteln, die auf Ihr nächstes Werk warten?
Sie sollten nicht länger warten. Ich werde keine Bücher mehr schreiben. Sie sollten andere Autoren lesen. Daran mangelt es nicht.
Ist Schreiben schwierig?
Ja, aber sicher weniger schwierig als viele andere Jobs. Das Komplizierte daran, das einem auch große Angst macht, ist die irrationale Seite des Schreibens: Nur weil man drei Romane geschrieben hat, bedeutet das nicht, dass man auch in der Lage ist, den vierten zu schreiben. Dafür gibt es keine Methoden, keine Regeln oder vorgezeichneten Wege. Jedes Mal, wenn man einen neuen Roman beginnt, ist es wieder ein Sprung ins Unbekannte.
Und was können Sie außer dem Schreiben denn sonst noch?
Angeblich kann ich ein sehr gutes Kalbsfrikassee zubereiten.
Glauben Sie, dass Ihre Romane der Nachwelt erhalten bleiben werden?
Hoffentlich nicht.
Welche Rolle kann die Literatur in der heutigen Gesellschaft spielen?
Ich habe mir diese Frage nie gestellt und auch nicht die Absicht, heute damit zu beginnen.
Sie haben sich außerdem dazu entschlossen, keine Interviews mehr zu geben?
Ich habe schon viel zu viele gegeben … Das ist eine irregeleitete Methode. Interviews sind etwas Künstliches, das nur der Werbung dient und ansonsten wenig Sinn macht. Meist – um nicht zu sagen, immer – werden die Äußerungen ungenau, verstümmelt und aus dem Zusammenhang gerissen wiedergegeben. Soviel ich auch darüber nachdenke, es war mir keine Befriedigung, meine Romane zu »erklären«, und noch weniger, Fragen zu meinen politischen Ansichten oder meinem Privatleben zu beantworten.
Kennt man die Biografie der Schriftsteller, die man bewundert, versteht man jedoch ihre Werke besser …
Genau wie Margaret Atwood denke ich, einen Schriftsteller kennenlernen zu wollen, weil man sein Buch liebt, ist in etwa so, als wollte man eine Ente kennenlernen, weil man gern Entenleberpastete isst.[4]
Aber ist es nicht legitim, wenn Leser den Wunsch haben, einen Schriftsteller über den Sinn seiner Arbeit zu befragen?
Nein, das ist nicht legitim. Die einzige gerechtfertigte Beziehung zu einem Schriftsteller ist, seine Bücher zu lesen.
2 Schreiben lernen
Verglichen mit dem Beruf des Schriftstellers
scheint der des Jockeys eine sichere Angelegenheit.
John Steinbeck, A Life in Letters[5]
1.
Eine Woche späterDienstag, 18. September 2018
Mit gesenktem Kopf, die Hände um die Lenkstange geklammert, trat ich ein letztes Mal heftig in die Pedale, um den Gipfel am Ostende der Insel zu erreichen. Der Schweiß rann mir in großen Tropfen übers Gesicht. Mein Leihfahrrad schien eine Tonne zu wiegen, und die Riemen meines Rucksacks schnitten mir in die Schultern.
Es hatte nicht lange gedauert, bis auch ich mich in Beaumont verliebte. In den acht Tagen, die ich jetzt hier lebe, nutzte ich meine Freizeit, um die Insel in alle Richtungen abzufahren und mich mit ihrer Topografie vertraut zu machen.
Jetzt kannte ich die Nordküste Beaumonts, an der sich der Hafen, der Hauptort und die schönsten Strände befanden, fast auswendig. Die von Steilküsten und Felsen begrenzte Südküste war weniger gut zugänglich, unberührter, aber nicht minder attraktiv. Ich hatte mich erst ein einziges Mal dorthin gewagt, auf die Halbinsel Sainte-Sophie, um das gleichnamige Kloster zu entdecken, in dem noch etwa zwanzig Benediktinerinnen lebten.
Die Strada Principale, eine etwa vierzig Kilometer lange Straße, die die Insel umrundete, führte nicht zur Pointe du Safranier. Um dorthin zu gelangen, musste man nach dem letzten Strand im Norden, der Anse de l’Argent, zwei Kilometer lang einem schmalen, nicht asphaltierten Weg folgen, der durch einen Pinienwald führte.
Nach allem, was ich im Lauf der Woche herausgefunden hatte, befand sich der Eingang zum Anwesen von Nathan Fawles am Ende dieses Pfades, der den hübschen Namen Sentier des Botanistes trug. Als ich endlich dort ankam, fand ich lediglich ein Eisentor in einer hohen Umfassungsmauer aus Schiefersteinen vor. Es gab keinen Briefkasten und auch kein Namensschild. Das Haus hieß angeblich La Croix du Sud – Kreuz des Südens, aber auch das stand nirgendwo. Man wurde nur von diversen Schildern auf das Herzlichste empfangen: Privatbesitz, Eintritt verboten, Bissiger Hund, Anwesen wird videoüberwacht … Es gab nicht einmal die Möglichkeit, zu klingeln oder auf irgendeine Weise seine Anwesenheit zu signalisieren. Die Botschaft war eindeutig: Egal, wer Sie sind, Sie sind hier nicht willkommen.
Ich ließ mein Fahrrad stehen und ging zu Fuß an der Umfassungsmauer entlang. An einer Stelle wich der Wald einer dichten Macchie aus Heidekraut, Myrte und wildem Lavendel. Nach fünfhundert Metern stieß ich auf eine Felswand, die ins Meer abfiel.
Mühsam kletterte ich an dem Kliff entlang, das ich an einer weniger steilen Stelle zu übersteigen vermochte. Nun folgte ich der Küste noch etwa fünfzig Meter und entdeckte dann endlich Nathan Fawles’ Wohnsitz.
Die Villa war an einen Steilhang gebaut und schien förmlich mit dem Felsen zu verschmelzen. Das Gebäude bildete, ganz im Stil moderner Architektur, ein Parallelepiped, dem unbearbeitete Stahlbetonplatten ein Streifenmuster verliehen, und bestand aus drei Ebenen mit Terrassen, von denen eine Steintreppe direkt zum Meer führte. Wie bei einem Ozeandampfer wurde der Sockel von einer Reihe von Bullaugen durchbrochen. Die hohe und breite Tür ließ vermuten, dass er als Bootshaus diente. An einem Anleger aus Holz war ein Motorboot mit glänzendem Rumpf vertäut.
Während ich mich vorsichtig weiter über die Felsen vorwärtskämpfte, glaubte ich einen Schatten zu bemerken, der sich auf der mittleren Terrasse bewegte. Konnte das Fawles persönlich sein? Ich schirmte meine Augen mit der Hand ab, um die Gestalt besser erkennen zu können. Es handelte sich um einen Mann, der dabei war … ein Gewehr auf mich zu richten.
2.
Ende der Leseprobe