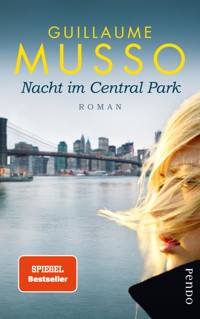9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Juliette Beaumont hat es nicht geschafft, in New York als Schauspielerin zu reüssieren. Am Vorabend ihrer Abreise nach Paris wird sie auch noch fast von einem Auto überfahren. Doch der Fahrer, Sam Galloway, kümmert sich rührend um sie. Sie verlieben sich ineinander und erleben eine leidenschaftliche Nacht. Als Juliettes Flugzeug am nächsten Morgen startet, explodiert es in der Luft. Sam ist verzweifelt. Er ahnt nicht, dass das Schicksal ihrer Liebe einen Aufschub gewährt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
»Wenn ich an Sie denke, klopft mein Herz schneller, und das ist das Einzige, was für mich zählt.«
Übersetzung aus dem Französischen von Antoinette Gittinger
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2014
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-492-96617-7
© 2005 der Originalausgabe by XO Éditions Titel der französischen Originalausgabe: »Sauve-moi …«, XO Éditions, Paris © der deutschsprachigen Ausgabe: 2014 Piper Verlag GmbH, München Die Rechte an der deutschen Übersetzung von Antoinette Gittinger liegen beim Blanvalet Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH Covergestaltung: Zero-Werbeagentur Covermotiv: Matej Krajcovic/Getty Images, Ayal Ardon/Arcangel Images Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
1
Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens.
Anonyme Inschrift auf einer Bank im Central Park
An einem Januarmorgen, in der Hafeneinfahrt von New York, zu der Stunde, da der Tag die Nacht vertreibt …
Hoch oben am Himmel überfliegen wir mit den Wolken, die nach Norden ziehen, Ellis Island und die Freiheitsstatue. Es ist kalt. Die ganze Stadt erstarrt im Schnee und im Sturm.
Plötzlich taucht ein Vogel mit silbernem Gefieder aus den Wolken auf und fliegt schnell wie ein Pfeil auf die Wolkenkratzer zu. Er beachtet die Schneeflocken nicht, sondern lässt sich von einer geheimnisvollen Kraft leiten, die ihn in den Norden Manhattans führt. Er stößt kurze aufgeregte Laute aus, während er mit erstaunlicher Geschwindigkeit über Greenwich Village, Times Square und die Upper West Side fliegt und sich schließlich auf dem Eingangstor zu einem öffentlichen Park niederlässt.
Wir befinden uns am Ende des Morningside Parks, ganz in der Nähe der Columbia University.
In knapp einer Minute wird im obersten Stockwerk eines kleinen Wohnhauses in diesem Viertel ein Licht angehen.
Juliette Beaumont, eine junge Französin, kostet soeben die letzten drei Sekunden Schlaf aus.
Als der Radiowecker klingelte, langte Juliette mit ausgestrecktem Arm nach dem Nachttisch und warf auf diese Weise den Wecker zu Boden, womit das grässliche Summen aufhörte.
Sie schob ihr Federbett zur Seite, rieb sich die Augen, stellte einen Fu orsichtig auf das glänzende Parkett, ging ein paar Schritte vorwärts und verfing sich dann im Teppich, der auf dem gebohnerten Holz wegrutschte. Verärgert rappelte sie sich wieder hoch und griff nach ihrer Brille, die sie hasste, aber unbedingt tragen musste, weil sie kurzsichtig war und keine Kontaktlinsen vertrug.
An der Wand neben der Treppe zeigten ihr kleine bunt zusammengewürfelte Spiegel, die sie auf diversen Trödelmärkten erworben hatte, das Bild einer jungen Frau von achtundzwanzig Jahren mit mittellangem Haar und Schalk im Blick. Sie machte ihrem Spiegelbild einen Schmollmund und versuchte, etwas Ordnung in ihre Frisur zu bringen, indem sie auf die Schnelle ein paar goldene Strähnen glatt strich, die ihr vom Kopf abstanden. Ihr ausgeschnittenes T-Shirt und ihr knapper Seidenslip ließen sie sexy und aufreizend aussehen. Doch dieses angenehme Bild verschwand schnell wieder: Juliette hüllte sich in eine dicke rotkarierte Wolldecke. In diesem Apartment, das sie seit drei Jahren mit ihrer Mitbewohnerin Colleen teilte, war die Heizung schon immer der Schwachpunkt gewesen.
Wenn man bedenkt, dass wir zweitausend Dol lar Miete zahlen, seufzte sie. Fest eingemummt stieg sie mit vorsichtigen Trippelschritten die Treppenstufen hinunter und stieß mit einer sanften Hüftbewegung die Küchentür auf. Ein dicker getigerter Kater, der sie seit einigen Minuten beobachtete, sprang ihr auf den Arm und setzte sich auf ihre Schulter, wobei immer die Gefahr bestand, dass er mit seinen Krallen ihren Hals aufkratzte.
»Schluss damit, Jean-Camille!«, rief sie und packte den Kater, um ihn auf den Boden zu setzen.
Der Kater miaute missbilligend und rollte sich dann doch in seinem Korb zusammen.
Inzwischen stellte Juliette einen Wasserkessel auf den Herd und schaltete das Radio ein:
… der heftige Schneesturm, der seit achtundvierzig Stunden über Washington und Philadelphia hinwegfegt, breitet sich über den ganzen Nordosten des Landes aus und wütet jetzt in New York und Boston.
Heute Morgen liegt eine dichte Schneedecke über Manhattan, die den Verkehr zum Erliegen bringt und die Stadt zur Langsamkeit zwingt.
Das Unwetter wirkt sich auch auf den Flugverkehr aus: alle Flüge ab JFK und La Guardia wurden annulliert oder verschoben.
Der Straßenzustand ist bedrohlich und der Bürgermeister empfiehlt, wenn irgend möglich das Auto zu Hause zu lassen.
Die U-Bahn müsste fahren, aber der Busverkehr ist stark beeinträchtigt. Amtrack verkündet einen eingeschränkten Bahnverkehr, und zum ersten Mal seit sieben Jahren bleiben die Museen, der Zoo und die öffentlichen Gebäude geschlossen.
Dieser Sturm, der auf ein Zusammentreffen feuchtwarmer Luftmassen vom Golf von Mexiko mit einer Kaltluftfront aus Kanada zurückzuführen ist, bewegt sich im Laufe des Tages in Richtung Neuengland.
Wir raten Ihnen zu äußerster Vorsicht.
Sie haben Manhattan 101,4, Ihren Sender, eingeschaltet.
Manhattan 101,4. Sie schenken uns zehn Minuten und wir schenken Ihnen die Welt …
Juliette fröstelte, als sie die Nachrichten hörte. Sie brauchte etwas zum Aufwärmen und schaute in den Küchenschrank: kein Instant-Kaffee, kein Tee. Auch wenn sie sich ein wenig schämte, blieb ihr nichts anderes übrig, als Colleens Teebeutel vom Vortag aus dem Spülbecken zu nehmen.
Verschlafen stellte sie sich ans Fenster, um die Stadt zu betrachten, die einen weißen Mantel trug.
Die junge Französin spürte eine große Wehmut, denn sie wusste, sie würde Ende der Woche Manhattan verlassen.
Die Entscheidung war ihr nicht leicht gefallen, doch sie musste die Tatsache akzeptieren: Juliette liebte New York, doch New York liebte Juliette nicht. Diese Stadt hatte keine ihrer Hoffnungen und keinen ihrer Träume erfüllt.
Nach dem Abitur hatte sie eine Vorbereitungsklasse für Literatur besucht und an der Sorbonne ihren Magister gemacht, während sie in den Theaterklubs der Universität auftrat. Dann war sie in die Schauspielschule Florent aufgenommen worden und galt als eine besonders viel versprechende Schülerin. Sie hatte an Castings teilgenommen, zwei oder drei Werbespots gedreht und Nebenrollen in einigen Fernsehfilmen ergattert. Doch alle weiteren Anstrengungen waren vergebens gewesen, und so musste sie nach und nach ihre Ambitionen herunterschrauben, trat in Supermärkten, vor Aufsichtsräten, in Theaterstücken für Geburtstagsfeiern auf und spielte in Euro Disney den Bär Winnie.
Ihre Aussichten waren nicht rosig gewesen, doch sie hatte sich nicht entmutigen lassen, hatte den Stier bei den Hörnern gepackt und den großen Sprung über den Atlantik gewagt. Mit Träumen vom Broadway war sie voller Hoffnung als Au-pair-Mädchen nach Big Apple gekommen. Hieß es nicht, wer in New York Erfolg hat, würde überall Erfolg haben?
Im ersten Jahr hatte sie neben dem Kinderhüten noch Zeit gefunden, ihr Englisch zu verbessern, sich ihren Akzent abzugewöhnen und Schauspielunterricht zu nehmen. Aber kein Vorsprechen hatte ihr mehr eingebracht als kleine Rollen in experimentellen oder avantgardistischen Stücken, die in winzigen Theatern, in Gemeindesälen oder alten Scheunen aufgeführt wurden.
Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, hatte sie schließlich kleine Jobs angenommen: Halbtagskassiererin in einem Supermarkt, Zugehfrau in einem schäbigen Hotel in der Amsterdam Avenue, Kellnerin in einem Coffeeshop …
Vor einem Monat hatte sie beschlossen, nach Frankreich zurückzukehren. Colleen wollte mit ihrem Freund zusammenziehen und sie hatte weder Mut noch Lust, sich eine andere Mitbewohnerin zu suchen. Es war an der Zeit, sich das Scheitern einzugestehen. Juliette hatte ein riskantes Spiel gespielt und verloren. Lange Zeit hatte sie geglaubt, sie sei schlauer als die anderen, weil sie den Fallen der Routine und der Zwänge aus dem Weg ging. Doch inzwischen fühlte sie sich völlig verloren, ohne Orientierung, ohne Struktur. Im Übrigen war ihr Erspartes aufgebraucht und ihr Visum als Aupair-Mädchen längst abgelaufen, womit sie als illegale Einwanderin galt.
Ihr Rückflug nach Paris war für übermorgen vorgesehen, wenn das Wetter es zuließ.
Nun, Mädchen, hör auf, dein Schicksal zu beklagen!
Sie riss sich vom Fenster los und ging langsam ins Bad. Dort ließ sie die Decke fallen, zog ihre Unterwäsche aus und stellte sich unter die Dusche.
»Aaaahhhh«, kreischte sie, als sie den eiskalten Wasserstrahl auf der Haut fühlte.
Colleen war als Erste unter die Dusche gegangen, und so war kein einziger Tropfen heißen Wassers übrig geblieben.
Nicht gerade sehr nett.
Sich mit kaltem Wasser zu waschen, war eine echte Qual, aber da sie nicht nachtragend war, fand sie schnell eine Entschuldigung für ihre Freundin: Colleen beendete gerade ihr Jurastudium mit glänzenden Noten und hatte heute ein Vorstellungsgespräch bei einer angesehenen Kanzlei.
Juliette war nicht narzisstisch veranlagt, auch wenn sie an jenem Morgen etwas länger vor dem Spiegel verweilte. Immer häufiger quälte sie die Frage:
Bin ich noch jung?
Sie war gerade achtundzwanzig Jahre alt geworden. Natürlich war sie noch jung, aber sie musste zugeben, dass sie eben keine zwanzig mehr war.
Während sie ihr Haar frottierte, stellte sie sich vor den Spiegel, studierte ihr Gesicht und entdeckte winzige Fältchen um die Augen.
Der Schauspielberuf, der bereits für Männer sehr schwierig war, bedeutete für Frauen eine noch größere Herausforderung: an Frauen duldete man keine Unvollkommenheit, während Falten bei einem Mann als Zeichen von Charme und Charakter galten, worüber sie sich von jeher geärgert hatte.
Sie trat einen Schritt zurück. Ihre Brüste waren immer noch schön, aber vielleicht nicht mehr ganz so straff wie noch zwei Jahre zuvor.
Nein, das bildest du dir nur ein.
Juliette hatte es immer abgelehnt, ihren Körper ein wenig zu »verbessern«: ihr Lächeln mit Collagen aufzufrischen, ihre Stirnfalten mit Botox wegzuspritzen, ihre Backenknochen anzuheben, sich ein kleines Grübchen oder einen neuen Busen operieren zu lassen … Vielleicht war sie naiv, aber sie wollte sein, wie sie war: natürlich, einfühlsam und verträumt.
Das Problem bestand jedoch darin, dass sie jegliches Selbstvertrauen verloren hatte. Nach und nach musste sie ihre beiden größten Hoffnungen aufgeben: Bühnenschauspielerin zu werden und eine echte Liebesgeschichte zu erleben. Noch vor drei Jahren hatte sie das Gefühl gehabt, alles sei möglich. Sie könnte eine zweite Julia Roberts oder Juliette Binoche sein. Doch dann hatte der Alltag sie allmählich aufgefressen: Ihr ganzes Geld ging für die Miete drauf, seit einer Ewigkeit hatte sie sich nichts mehr zum Anziehen gekauft und ernähren tat sie sich von Ravioli aus der Dose oder Nudeln mit Ketchup.
Sie war weder Julia Roberts noch Juliette Binoche geworden. Für fünf Dollar in der Stunde servierte sie Cappuccino in einem Coffeeshop, und weil das nicht für die Miete reichte, musste sie am Wochenende einen zweiten Job übernehmen.
Im Geiste stellte sie ihrem Spiegelbild weitere Fragen:
Habe ich noch die Macht zu verführen? Verlangen zu erwecken?
Zweifellos, aber für wie lange noch!?
Sie sah sich direkt in die Augen und sagte wie zur Warnung:
»In nicht allzu ferner Zeit wird sich kein Mann mehr nach dir umdrehen …«
Aber inzwischen könntest du dich mit dem Anziehen beeilen, wenn du nicht zu spät kommen willst.
Sie zog eine Strumpfhose und zwei Paar Socken an, schlüpfte in eine schwarze Jeans, in ein gestreiftes Hemd und streifte sich einen grobmaschigen Pullover und eine Wolljacke mit Fransen über.
Ihr Blick wanderte zur Wanduhr und sie geriet in Panik. Sie musste sich beeilen, denn mit ihrem Chef war nicht zu spaßen. Auch wenn heute ihr letzter Arbeitstag war, und der Schneesturm war für ihn kein Grund.
Sie schnappte sich rasch noch eine Mütze und einen bunten Schal von der Garderobe und eilte die Treppe hinunter. Sie ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen und achtete darauf, ihren Kater nicht zu »guillotinieren«, denn der kühne Jean-Camille hielt, angelockt durch die dichte Schneedecke, die sich über Nacht gebildet hatte, seine Nase in den Wind.
Draußen umfing sie eisige Luft. Noch nie hatte sie New York so still erlebt. In wenigen Stunden hatte sich Manhattan in ein riesiges Skigebiet verwandelt. Der Schnee auf den Straßen ließ die Weltstadt wie eine Geisterstadt aussehen. Auf Bürgersteigen und an Kreuzungen hatten sich Schneeverwehungen gebildet. Auf den gewöhnlich überfüllten und lauten Straßen fuhren nur noch Jeeps mit Allradantrieb und ein paar wagemutige Yellow Cabs. Die wenigen Fußgänger trugen Langlaufskier.
Juliette, die sich für einen Augenblick an ihre Kindheit erinnert fühlte, hob den Kopf und fing mit dem Mund eine Schneeflocke auf. Fast wäre sie gefallen. Sie breitete die Arme aus, um das Gleichgewicht zu halten. Zum Glück war die U-Bahn-Station nicht weit. Sie musste nur aufpassen, dass sie nicht ausru …
Zu spät. Sie ruderte hilflos mit den Armen und landete mit der Nase im Pulverschnee.
Zwei Studenten gingen an ihr vorüber und dachten überhaupt nicht daran, ihr aufzuhelfen, sondern lachten auch noch hämisch. Juliette fühlte sich gedemütigt und spürte plötzlich das Verlangen, zu heulen. Der Tag begann entschieden übel.
2
Und wir sind immer noch miteinander verbunden.
Sie halb lebendig und ich halb tot.
Victor Hugo
Ein paar Kilometer weiter im Süden fuhr ein imposanter Landrover auf den verlassenen Parkplatz des Friedhofs von Brooklyn Hill.
In der rechten oberen Ecke der Windschutzscheibe verriet eine in Plastikfolie eingeschweißte Karte Identität und Beruf des Fahrers:
Dr. Sam Galloway
St. Matthew’s Hospital
New York City
Der Wagen parkte in der Nähe des Eingangs. Der Mann, der ausstieg, war gerade erst dreißig. Mit seinen breiten Schultern und seinem einreihigen gut geschnittenen Mantel wirkte er solide und elegant, doch sein merkwürdiger Blick – er hatte ein grünes und ein blaues Auge – verriet Melancholie.
Sam Galloway band sich den Schal fester um den Hals und blies in seine Hände, um sie zu wärmen. Er stapfte durch den Schnee auf den Eingang zu. Zu dieser Tageszeit waren die Gittertore noch geschlossen, aber Sam hatte dem Friedhof im letzten Jahr eine großzügige Spende für die Grabpflege zukommen lassen und besaß seither einen eigenen Schlüssel.
Seit einem Jahr kam er hierher, einmal in der Woche, immer morgens, bevor er in die Klinik fuhr. Ein Ritual, das zur Droge geworden war.
Die einzige Möglichkeit, noch ein wenig bei ihr zu sein …
Sam öffnete das schmiedeeiserne Tor und schaltete die Beleuchtung an – was für gewöhnlich der Wächter tat –, bevor seine Schritte ihn automatisch die Wege entlangführten.
Der Friedhof war so weitläufig wie ein Park und ziemlich hügelig. Im Sommer kamen viele Spaziergänger hierher, um die vielen Bäume und die schattigen Wege zu genießen. Doch heute Morgen störte kein Vogelgesang oder irgendein anderer Besucher die Stille des Ortes. Nur der Schnee türmte sich schweigend auf.
Nach dreihundert Metern stand Sam vor dem Grab seiner Frau.
Der Schnee hatte den rosafarbenen Granitstein fast völlig unter sich begraben. Mit dem Ärmel seines Mantels entfernte Sam den Schnee von der Inschrift:
Federica Galloway
1974–2004
Sie ruhe in Frieden
Darunter sah man das Schwarz-Weiß-Foto einer dreißigjährigen Frau, die ihr dunkles Haar zu einem Knoten gebunden hatte und deren Blick dem Blitzlicht auswich.
Undurchdringlich.
»Guten Morgen«, sagte er leise, »es ist kalt heute Morgen, nicht wahr?«
Federica war seit einem Jahr tot, und Sam redete noch immer mit ihr, als ob sie lebte.
Dabei war Sam Galloway alles andere als ein wirklichkeitsfremder Schwärmer. Er glaubte weder an Gott noch an ein hypothetisches Jenseits. Ehrlich gesagt, glaubte Sam jenseits der Medizin an nicht gerade viel. Er war ein ausgezeichneter Kinderarzt, der, wie es hieß, großes Mitgefühl für seine Patienten bewies. Trotz seiner jungen Jahre hatte er bereits zahlreiche Artikel in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht und er bekam Angebote von den angesehensten Kliniken, obwohl er gerade erst seine Facharztausbildung beendet hatte.
Sam hatte sich auf ein Gebiet der Psychiatrie spezialisiert, auf die so genannte Resilienz, die von dem Prinzip ausgeht, dass sogar Menschen, die von den schlimmsten Tragödien heimgesucht wurden, die Kraft finden können, sich wieder aufzurichten und sich nicht der Unabwendbarkeit des Unglücks hingeben müssen. Ein Teil seiner Arbeit bestand darin, schwerste psychische Traumata von Kindern zu therapieren: Krankheiten, Misshandlungen, Vergewaltigungen, den zu frühen Tod eines engen Verwandten …
Auch wenn Sam stark genug war, seinen Patienten zu helfen, ihren Schmerz zu überwinden und ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, schien er unfähig zu sein, die Ratschläge, die er ihnen erteilte, selbst zu befolgen. Der Tod seiner Frau vor einem Jahr hatte ihn am Boden zerstört.
Sein Verhältnis zu Federica war schwierig gewesen. Sie kannten sich von Jugend an, waren gemeinsam in Bedford-Stuyvesant aufgewachsen, in jenem gottverdammten Viertel von Brooklyn, das für seine Crackhändler und seine Rekordzahl an täglichen Mordopfern berühmt war.
Federicas Eltern stammten aus Kolumbien. Als sie sechs war, flüchteten sie aus Medellins Straßen, ohne zu ahnen, dass sie eine Hölle verließen, um in einer anderen anzukommen. Gerade mal ein Jahr waren sie dort, als Federicas Vater bei einer Schießerei zwischen zwei rivalisierenden Banden des Viertels von einem Querschläger getroffen wurde. Federica blieb allein mit ihrer Mutter, die immer mehr dem Alkohol, den Drogen und der Depression verfiel.
Sie besuchte eine baufällige Schule inmitten von Müllhalden und ausgebrannten Autowracks. Die Luft war verpestet, die Atmosphäre geladen und überall lungerten Drogendealer herum.
Mit elf Jahren verkaufte sie als Junge verkleidet Stoff in einem schmutzigen crack house in der Bushwick Avenue. Es war Mitte der achtziger Jahre in Brooklyn und es war die einzige Möglichkeit, die Drogen zu beschaffen, die ihre Mutter brauchte. Sie hatte ihr im Übrigen die erste Grundregel des Dealens beigebracht: Niemals die Ware übergeben, bevor der Käufer gezahlt hat.
Auf der Realschule hatte sie zwei Jungs kennen gelernt, die etwas jünger als sie waren und die sich von den anderen zu unterscheiden schienen: Sam Galloway und Shake Powell. Sam, der immer ein Buch unter dem Arm trug, war der Intellektuelle in der Klasse, ein Junge, der bei seiner Großmutter aufwuchs, der einzige »Weiße« in der Schule, was ihm in diesem afroamerikanischen Umfeld jede Menge Feinde einbrachte.
Shake besaß eine Bärennatur. Mit dreizehn war er so groß und kräftig wie die meisten Erwachsenen des Viertels, doch hinter der Fassade des bösen Jungen verbarg er eine große Empfindsamkeit.
Zu dritt bündelten sie ihre Kräfte, um in dieser kaputten Umgebung zu überleben. Ihre gegenseitige Hilfe und ihre Freundschaft baute darauf, dass sie einander ergänzten, jeder von ihnen fand dank der beiden anderen sein Gleichgewicht. Die Kolumbianerin, der Weiße und der Schwarze: das Herz, die Intelligenz und die Kraft.
Während sie heranwuchsen, hielten sie sich so weit wie möglich von den Unruhen im Viertel fern. Sie hatten nur allzu deutlich die verheerenden Auswirkungen der harten Drogen auf ihre Umwelt erlebt, um für immer davor gefeit zu sein.
Sam und Federica hatten sich nie vorstellen können, eines Tages dieser menschlichen Kloake zu entkommen, in der das Leben an einem seidenen Faden hing. Die ständige Lebensgefahr verhinderte jede Langzeitplanung. Sie hatten keine konkreten Bestrebungen, weil niemand hier welche hatte. Dennoch verließen sie wider Erwarten dank günstiger Umstände diese Umgebung. Sam studierte Medizin mit seiner Jugendfreundin im Schlepptau, und es war eine fast natürliche Folge, dass er sie heiratete.
In schweren, nassen Flocken fiel der Schnee auf den Friedhof. Sam starrte wie gebannt auf das Bild seiner Frau. Auf dem Foto hatte sie ihre Haare um einen langen Pinsel geschlungen. Sie trug, wie immer, wenn sie malte, ihren Kittel. Sam hatte sie fotografiert. Die Aufnahme war jedoch ein wenig verschwommen. Das war normal, denn Federica war nie wirklich zu fassen.
In der Klinik wusste niemand von Sams gesellschaftlicher Herkunft, und er sprach nie darüber. Auch nicht mit Federica. Allerdings war Mitteilsamkeit sowieso nicht gerade eine hervorstechende Eigenschaft seiner Frau gewesen. Um sich vor den dunklen Erinnerungen an ihre Kindheit zu schützen, hatte sie sich sehr bald mit ihrer Malerei eine Welt aufgebaut, in der nichts sie berühren konnte. Ihr Panzer war so hart geworden, dass sie ihn noch lange, nachdem sie Bed-Stuy verlassen hatten, nicht abgelegt hatte. Sam hatte immer gehofft, es würde ihm mit der Zeit gelingen, sie zu »heilen«, so wie er viele seiner Patienten geheilt hatte. Doch die Dinge entwickelten sich anders. In den Monaten vor ihrem Tod hatte sich Federica immer tiefer in ihre Welt der Malerei und des Schweigens zurückgezogen.
Und sie und Sam hatten sich immer weiter voneinander entfernt.
Bis zu jenem unheilvollen Abend, an dem der junge Arzt sein Haus betrat und entdeckte, dass seine Frau beschlossen hatte, ihrem Leben ein Ende zu setzen, weil es ihr unerträglich geworden war.
Sam fiel in einen Zustand der Erstarrung. Niemals hatte Federica ihm echte Anzeichen dafür geliefert, dass sie sich umbringen würde. Er erinnerte sich sogar daran, dass sie in den letzten Tagen friedlicher als sonst gewirkt hatte. Jetzt begriff er, dass gerade ihre Ruhe ein Zeichen für ihre Entscheidung gewesen war, weil sie dieses fatale Ende als Erlösung empfunden hatte.
Sam hatte alle Phasen durchgemacht: Verzweiflung, Scham, Aufbegehren … Noch heute verging kein Tag, an dem er sich nicht fragte:
Was hätte ich tun können, was ich nicht getan habe?
Die quälenden Schuldgefühle hinderten ihn zu trauern und daran zu denken, sein Leben »neu zu gestalten«. Er trug immer noch seinen Ehering, arbeitete siebzig Stunden in der Woche und blieb häufig mehrere Nächte hintereinander in der Klinik.
In manchen Augenblicken hegte er Federica gegenüber ein Gefühl des Zorns. Er warf ihr vor, gegangen zu sein, ohne ihm etwas hinterlassen zu haben, an das er sich klammern könnte: kein Wort des Abschieds, keine Erklärung. Niemals würde er erfahren, was sie zu dieser Tat bewogen hatte. Aber es war, wie es war. Es gab Fragen ohne Antworten und er musste es akzeptieren.
Natürlich wusste er in seinem tiefsten Innern, dass seine Frau ihre Kindheit nie wirklich überwunden hatte. In ihrer Vorstellung lebte sie weiterhin in dem Block mit den Sozialwohnungen in Bed-Stuy, umgeben von Gewalt, Angst und den Glassplittern der Crack-Ampullen.
Manche Verletzungen sind weder ungeschehen zu machen noch zu heilen. Das musste er zugeben, auch wenn er seinen Patienten täglich das Gegenteil versicherte.
Ein alter Baum ächzte unter der Last des Schnees. Sam zündete sich eine Zigarette an. Wie jede Woche erzählte er seiner Frau die wichtigsten Ereignisse der letzten Tage.
Nach einer Weile hielt er inne. Er wollte nur bei ihr sein und überließ sich seinen Erinnerungen. Die eisige Kälte brannte auf seinem Gesicht. Eingehüllt in einen Wirbel aus Schneeflocken, die an seinem Haar und seinen Bartstoppeln kleben blieben, fühlte er sich wohl. Bei ihr.
Manchmal entwickelte er nach einer anstrengenden Nachtwache eine merkwürdige Sinneswahrnehmung, die fast einer Halluzination gleichkam: Er glaubte, Federicas Stimme zu vernehmen und sie in der Ecke eines Zimmers oder an der Biegung eines Gangs sogar flüchtig zu sehen. Er wusste, dass es nicht der Wirklichkeit entsprach, aber er gewöhnte sich daran, als sei es eine neue Möglichkeit, ein wenig länger mit ihr zusammen zu sein.
Als die Kälte unerträglich wurde, beschloss Sam, zu seinem Auto zurückzukehren. Er hatte sich bereits auf den Weg gemacht, als er plötzlich stehen blieb.
»Federica, weißt du, dass ich dir schon lange etwas sagen wollte …?«
Seine Stimme versagte.
»Etwas, das ich dir nie gesagt habe … das ich noch nie jemandem gesagt habe.«
Er schwieg einen Augenblick, als sei er sich nicht sicher, ob er diese Beichte fortsetzen solle.
Muss man dem Menschen, den man liebt, alles sagen? Eigentlich nicht, dachte er, doch er fuhr fort.
»Ich habe nie mit dir darüber gesprochen … aber wenn du tatsächlich da oben bist, weißt du es sicher bereits.«
Nie hatte er die Anwesenheit seiner Frau nach ihrem Tode so deutlich gespürt wie an diesem Morgen. Vielleicht lag es an der unwirklich weißen Landschaft um ihn herum, die ihm das Gefühl vermittelte, im Himmel zu sein.
Er redete lange und ohne Unterbrechung und enthüllte ihr endlich, was ihm all die Jahre auf der Seele brannte.
Kein Geständnis eines Seitensprungs, kein Eheproblem, kein Geldproblem. Etwas anderes.
Etwas viel Schlimmeres.
Als er alles gesagt hatte, fühlte er sich leer und erschöpft.
Bevor er ging, fand er noch die Kraft zu murmeln:
»Ich hoffe nur, dass du mich immer noch liebst …«
3
Jemandem das Leben zu retten ist, als würde man sich verlieben: Es gibt keine bessere Droge. Danach geht man tagelang durch die Straßen, und alles sieht verwandelt aus.
Man glaubt, man sei unsterblich geworden, als habe man sein eigenes Leben gerettet.
Aus dem Film Bringen Out the Dead(Nächte der Erinnerung) von Martin Scorsese
St. Matthew’s Hospital
17:15 Uhr
Wie jeden Abend beendete Sam seinen Rundgang mit denselben beiden Zimmern. Immer ließ er diese beiden Patienten bis zum Schluss übrig. Vielleicht weil er sie seit langem beobachtete und sie – ohne es wirklich zuzugeben – ein wenig als seine Familie betrachtete.
Behutsam stieß er die Tür zum Zimmer 403 der Station für Kinderonkologie auf.
»Guten Abend, Angela.«
»Guten Abend, Dr. Galloway.«
Ein junges mageres, durchscheinendes Mädchen von vierzehn Jahren saß im Schneidersitz auf dem einzigen Bett im Zimmer, ein Notebook mit grellen Farben auf den Knien.
»Was gibt’s Neues heute?«
Angela berichtete in ironischem Ton von ihrem Tag. Zumeist auf ihre Verteidigung bedacht, hasste sie jede Art von Mitgefühl und wollte nicht, dass man sie wegen ihrer Krankheit bemitleidete. Sie besaß keine Familie. Ihre Mutter hatte sie nach der Geburt in der Entbindungsklinik einer kleinen Stadt in New Jersey zurückgelassen. Sie war ein aufsässiges, wenig umgängliches Kind, das von Familie zu Familie weitergereicht wurde. Sam hatte viel Zeit gebraucht, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Da sie bereits mehrere Male lange im Krankenhaus gelegen hatte, bat er sie manchmal, kleinere Kinder vor einer Chemotherapie oder einer Operation zu beruhigen.
Wie jedes Mal, wenn er sie lachen sah, dachte er, wie schwer man sich doch vorstellen konnte, dass im selben Augenblick Krebszellen ihr Blut zerstörten.
Das junge Mädchen litt an einer schweren Form der Leukämie. Zwei Knochenmarktransplantationen hatte sie bereits hinter sich, aber jedes Mal hatte ihr Körper das Knochenmark abgestoßen.
»Hast du darüber nachgedacht, was ich dir gesagt habe?«
»Über den neuen Eingriff?«
»Ja.«
Die Krankheit hatte jenes Stadium erreicht, in dem sich Metastasen in Leber und Milz bildeten und Angela sterben würde, wenn man keine neue Knochenmarktransplantation versuchte.
»Ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, Doktor. Muss ich wieder eine Chemo machen?«
»Ja, leider. Und du musst wieder isoliert in einem sterilen Zimmer liegen.«
Einige von Sams Kollegen fanden es nicht richtig, dass er sich so engagierte; sie meinten, er sollte Angela in Ruhe sterben lassen. Ihr Organismus war dermaßen geschwächt, dass die Aussicht auf Erfolg bei einem neuerlichen Eingriff weniger als fünf Prozent betrug. Doch Sam fühlte sich so eng mit ihr verbunden, dass er nicht die Absicht hatte, sie zu verlieren.
Selbst wenn ich nur die Chance von eins zu einer Million hätte, würde ich es versuchen.
»Herr Doktor, ich werde darüber nachdenken.«
»Natürlich. Lass dir Zeit. Du entscheidest.«
Er musste behutsam mit ihr umgehen. Angela war mutig, aber nicht unverletzlich.
Sam kontrollierte das Krankenblatt und zeichnete es ab. Er wollte das Zimmer schon verlassen, als sie ihn zurückrief:
»Warten Sie, Doktor.«
»Was gibt’s?«
Das junge Mädchen betätigte den Drucker, der an ihr Notebook angeschlossen war und eine seltsame Zeichnung ausspuckte. Um Abstand zu ihrer Krankheit zu gewinnen, hatte Sam sie ermutigt, verschiedene künstlerische Tätigkeiten zu versuchen. Seit einiger Zeit halfen Malen und Zeichnen Angela über die Trostlosigkeit ihres Alltags hinweg.
Sie betrachtete aufmerksam ihr Werk und zufrieden reichte sie es Sam.
»Schauen Sie, das habe ich für Sie gemacht.«
Er griff nach dem Blatt und betrachtete es überrascht. Die purpurroten und ockerfarbenen Flächen, die das Blatt füllten, erinnerten ihn an manche Bilder von Federica. Wenn er sich richtig erinnerte, hatte Angela zum ersten Mal nichts Gegenständliches gemalt. Er wollte fragen, was es darstellen sollte, und besann sich sogleich, weil er sich daran erinnerte, wie sehr seine Frau diese Frage gehasst hatte.
»Vielen Dank, ich werde es in meinem Büro aufhängen.«
Er faltete das Bild zusammen und steckte es in die Tasche seines Kittels. Er wusste, dass Angela Komplimente hasste. Deshalb sagte er nichts weiter.
»Schlaf gut«, sagte er und ging zur Tür.
»Ich werde sterben, nicht wahr?«
Er blieb mit einem Ruck auf der Türschwelle stehen und drehte sich nach ihr um. Angela fuhr fort:
»Wenn ich diese verdammte Knochenmarktransplantation nicht bekomme, gehe ich drauf, nicht wahr?«
Langsam kehrte er zu ihrem Bett zurück und setzte sich zu ihr. Sie betrachtete ihn mit einer Mischung aus Patzigkeit und Verletzlichkeit. Er wusste sehr wohl, dass sich hinter ihrer herausfordernden Haltung eine große Furcht verbarg.
»Ja, es stimmt, du könntest sterben«, gab er zu.
Er schwieg eine Weile und fuhr fort:
»Aber das wird nicht passieren.«
Dann:
»Ich verspreche es dir.«
Café Starbucks – Fifth Avenue
16:59 Uhr
»Einen großen Cappuccino und einen Heidelbeermuffin, bitte.«
»Sofort.«
Während Juliette den Wunsch des Gastes erfüllte, warf sie einen Blick durch die Fensterscheibe: Auch wenn es am späten Vormittag zu schneien aufgehört hatte, herrschten immer noch Wind und Kälte in der Stadt.
»Bitte sehr.«
»Danke.«
Sie warf einen Blick auf die Wanduhr: In einer knappen Minute hatte sie Feierabend.
»Einen espresso macchiato und eine Flasche Evian.«
»Sofort.«
Der letzte Gast, ihr letzter Arbeitstag, und in zwei Tagen würde sie New York den Rücken kehren.
Sie reichte die Getränke einem tadellos aussehenden working girl, das hinausging ohne sich zu bedanken.
Juliette schaute immer voller Neugier und Neid auf diese New Yorkerinnen, die ihr im Café oder auf der Straße begegneten. Wie sollte sie sich gegen diese langgliedrigen schlanken Frauen behaupten, die wie Models gekleidet waren, alle Regeln kannten und jeden Code beherrschten?
Sie sind all das, was ich nicht bin, dachte sie, brillant, sportlich, selbstsicher … Sie können selbstbewusst reden, sich hervortun, alle Spiele spielen …
Und vor allem waren sie finanziell abgesichert, anders gesagt, sie hatten einen prima Job und entsprechende Einkünfte.
Juliette trat an den Garderobenschrank, zog ihre Kellnerinuniform aus, ging in den großen Caféraum zurück und registrierte enttäuscht, dass keine ihrer Kolleginnen ihr zum Abschied good luck wünschte.
Sie winkte in Richtung Theke, aber dort reagierte man nur halbherzig. Sie wurde das Gefühl nicht los, unsichtbar zu sein.
Zum letzten Mal durchquerte sie den großen Raum. Als sie hinausgehen wollte, sprach eine Stimme in der Nähe des Eingangs sie auf Französisch an:
»Mademoiselle!«
Juliettes Blick fiel auf einen Mann mit graumeliertem Haar und tadellos gestutztem Bart, der mit dem Rücken am Fenster lehnte. Auch wenn er nicht mehr jung war, wirkte alles an ihm kraftvoll. Seine breiten Schultern und sein hoher Wuchs ließen den Cafétisch klein und zerbrechlich erscheinen. Sie kannte den Mann. Er tauchte von Zeit zu Zeit, vor allem spätabends, auf. Manchmal, wenn der Chef nicht da war, hatte Juliette ihm erlaubt, seinen Hund mitzubringen, eine große schwarze Dogge, die auf den seltsamen Namen Cujo hörte.
»Juliette, ich will mich von Ihnen verabschieden. Wenn ich mich richtig erinnere, kehren Sie bald nach Frankreich zurück.«
»Woher wissen Sie das?«
»Ich habe es gehört«, erwiderte er lakonisch.
Dieser Mann wirkte beruhigend und furchteinflößend zugleich auf sie. Ein seltsamer Eindruck.
»Ich habe mir erlaubt, einen warmen Cidre für Sie zu bestellen«, sagte er und deutete auf den Becher auf seinem Tisch.
Juliette war verblüfft, denn der Mann schien sie gut zu kennen, obwohl sie nie zuvor mit ihm gesprochen hatte. Sie hatte das Gefühl, ein offenes Buch für ihn zu sein.
»Setzen Sie sich einen Moment«, schlug er vor.
Sie zögerte, wagte jedoch, ihm in die Augen zu schauen, und entdeckte keinerlei Feindseligkeit in seinem Blick. Nur eine Mischung aus mitfühlender Menschlichkeit und großer Erschöpfung. Und ein intensives Leuchten, das sie nur schwer deuten konnte.
Sie beschloss, ihm gegenüber Platz zu nehmen und einen Schluck Cidre zu trinken.
Der Mann wusste, dass die junge Französin hinter einem heiteren und dynamischen Äußeren einen unsicheren und verletzlichen Charakter verbarg.
Er hasste es, sie erschrecken zu müssen, aber er hatte nur wenig Zeit. Sein Leben war kompliziert, seine Tage lang und seine Aufgaben nicht immer angenehm. Also kam er gleich zur Sache:
»Auch wenn Sie glauben, Ihr Leben sei ein Misserfolg, stimmt das nicht.«
»Warum sagen Sie das?«
»Weil Sie es sich täglich vor Ihrem Spiegel sagen.«
Überrascht und entsetzt machte Juliette eine abwehrende Bewegung.
»Woher wissen Sie, dass …?«
Der Mann ließ sie nicht weiterreden.
»Diese Stadt ist sehr hart«, fuhr er fort.
»Allerdings«, stimmte Juliette ihm zu. »Jeder kümmert sich nur um sich selbst, aber nicht um den anderen. Die Menschen werden aneinander gedrängt und sind dennoch einsam.«
»So ist es«, bekräftigte er und breitete die Arme aus. »Die Welt ist, wie sie ist, und nicht so, wie wir sie gern hätten: eine gerechte Welt, in der den guten Menschen die guten Dinge widerfahren …«
Der Mann schwieg einen Moment. Dann fuhr er fort:
»Aber Sie, Juliette, gehören zu den Guten: Eines Tages habe ich beobachtet, wie Sie einen Gast bedienten, der nicht zahlen konnte, obwohl Sie genau wussten, dass man den Betrag von Ihrem Lohn abziehen würde.«
»Das ist nichts Besonderes«, protestierte die Französin und zuckte mit den Schultern.
»Vielleicht ist es nichts Besonderes, und doch ist es etwas Besonderes. Nichts ist wirklich unbedeutend, aber nicht immer fürchtet man die Folgen seiner Handlung.«
»Warum sagen Sie mir all das?«
»Weil es notwendig ist, dass Sie sich dessen bewusst sind, bevor Sie abreisen.«
»Bevor ich nach Frankreich zurückkehre?«
»Passen Sie auf sich auf, Juliette«, sagte er und stand auf, ohne die Frage zu beantworten.
»Warten Sie«, rief sie.
Sie wusste nicht warum, aber sie musste ihn unbedingt zurückhalten. Sie rannte ihm nach, aber der Mann hatte das Café bereits verlassen.
Direkt neben der Drehtür hatte man vergessen, den Schneematsch wegzuwischen, den die Gäste mitbrachten. Zum dritten Mal an diesem Tag rutschte Juliette aus. Sie fiel nach hinten und hielt sich am Arm eines Mannes fest, der mit einem Tablett in der Hand einen Platz suchte. Sie zog ihn mit sich und beide landeten auf dem Boden, während sich der heiße Cappuccino über ihre Kleidung ergoss.
Das ist mal wieder typisch für mich! Die ungeschickte Tölpelin, die gern Audrey Hepburns Anmut hätte und immer mit der Nase in der Gosse landet.
Schamrot erhob sie sich rasch wieder, entschuldigte sich höflich bei dem Gast – der ihr wütend mit rechtlichen Schritten drohte – und eilte hinaus.
Manhattan litt unter dem üblichen Wahnsinn. In der Stadt herrschten wieder Getümmel und Stress. Direkt vor dem Café vermischte sich der Krach einer Straßenkehrmaschine mit dem Lärm des übrigen Verkehrs. Juliette setzte ihre Brille auf und blickte die Straße hoch nach Norden, dann nach downtown.
Der Mann war verschwunden.
Zur gleichen Zeit fuhr Sam mit dem Aufzug in den vierten Stock der Klinik und lenkte seine Schritte zum Zimmer 808.
»Guten Abend, Leonard.«
»Immer hereinspaziert, Herr Doktor.«
Der letzte Mensch, den Sam an diesem Abend besuchte, war eigentlich gar nicht sein Patient. Leonard McQueen gehörte zu den Personen, die am längsten im St. Matthew’s lagen. Sam war ihm letzten Sommer während einer Nachtwache begegnet. Der alte McQueen hatte keinen Schlaf gefunden und war auf das Terrassendach des Hospitals ausgebüxt, um sich eine Zigarette zu drehen. Natürlich war das verboten, erst recht, da McQueen an Lungenkrebs im Endstadium litt. Als Sam ihn auf dem Dach entdeckt hatte, war er jedoch feinfühlig genug gewesen, den alten Mann nicht lächerlich zu machen und ihn wie einen unfolgsamen Jungen zu schelten. Er hatte sich lediglich neben ihn gesetzt und sie hatten sich in der Abendkühle eine Weile unterhalten. Später erkundigte sich Sam regelmäßig nach ihm, und die beiden Männer betrachteten sich mit gegenseitigem Respekt.
»Und wie fühlen Sie sich heute?«
McQueen richtete sich in seinem Bett ein wenig auf. »Wissen Sie was, Doktor? Nie fühlt man sich lebendiger als in dem Augenblick, in dem man dem Tod ins Auge schaut.«
»Leonard, so weit sind Sie noch nicht.«
»Bemühen Sie sich nicht, ich weiß genau, dass mein Ende naht.«
Und wie um die Richtigkeit seiner Worte zu unterstreichen, bekam er einen starken Hustenanfall, der die Verschlechterung seines Gesundheitszustands bewies.
Sam half ihm in einen Rollstuhl und schob ihn an das Fenster.
McQueens Husten hatte sich beruhigt. Er schaute wie hypnotisiert auf die Stadt, die sich zu seinen Füßen ausbreitete. Die Klinik lag am East River und von hier aus hatte man einen wunderbaren Blick auf den Sitz der Vereinten Nationen, auf dieses Gebäude aus Marmor, Glas und Stahl, das steil in den Himmel ragte.
»Nun, Herr Doktor, immer noch ledig?«
»Immer noch Witwer, Leonard, das ist nicht dasselbe.«
»Wissen Sie, was Ihnen fehlt: ein paar hübsche gespreizte Beine. Ich glaube, dann wären Sie weniger ernst. In Ihrem Alter ist es gar nicht gut, seine Männlichkeit so lange zu vernachlässigen, wenn Sie verstehen, was ich meine …«
Sam musste unwillkürlich lächeln.
»Ehrlich gesagt glaube ich, Sie brauchen mir noch keine Zeichnung dafür anzufertigen.«
»Allen Ernstes, Doktor, Sie brauchen einen Menschen in Ihrem Leben.«
Sam seufzte:
»Es ist noch zu früh. Die Erinnerung an Federica …«
McQueen unterbrach ihn:
»Bei allem Respekt, Herr Doktor, Sie langweilen mich mit Ihrer Federica. Ich war dreimal verheiratet und ich kann Ihnen eines versichern: Wenn Sie einmal in Ihrem Leben aufrichtig geliebt haben, haben Sie die besten Chancen, erneut zu lieben.«
»Ich weiß nicht …«
Der alte Mann deutete auf die Stadt unter ihnen. »Versuchen Sie nicht mir weiszumachen, dass es unter den Millionen Menschen in Manhattan keine Frau gebe, die Sie genauso lieben könnten wie Ihre Frau.«
»Leonard, ich glaube, so einfach ist das nicht.«
»Und ich glaube, dass Sie alles so kompliziert machen. Wenn ich so jung und so gesund wäre wie Sie, würde ich meine Abende nicht damit vergeuden, mich mit einem alten Mann wie mir zu unterhalten.«
»Und aus diesem Grund werde ich Sie jetzt verlassen, Leonard.«
»Bevor Sie gehen, habe ich noch etwas für Sie.«
McQueen wühlte in seiner Tasche und hielt ihm einen kleinen Schlüsselbund hin.
»Wenn Ihnen danach zumute ist, gehen Sie irgendwann in den nächsten Tagen in mein Haus. Im Keller liegen eine Menge berühmter Weine, die ich für besondere Gelegenheiten aufbewahrt habe, statt sie zu trinken. Wie töricht von mir!«
Er schwieg einen Moment, dann sagte er wie zu sich selbst: »Manchmal ist man eben ein Idiot.«
»Wie Sie wissen, stehe ich nicht so sehr auf …«
»Vorsicht, es handelt sich nicht um irgendwelche Rachenputzer«, erwiderte McQueen gekränkt. »Ich spreche von Jahrgängen französischer Weine, die ein Vermögen wert sind. Sie sind viel besser als all diese Weine aus Kalifornien oder Südamerika. Stoßen Sie auf meine Gesundheit an, das würde mich wirklich freuen. Versprechen Sie mir das.«
»Versprochen«, erwiderte Sam und lächelte.
McQueen warf die Schlüssel in die Luft und Sam fing sie auf.
»Schönen Abend, Leonard.«
»Schönen Abend, Doktor.«
Als Sam das Zimmer verließ, dachte er über Leonards Worte nach: »Nie fühlt man sich lebendiger als in dem Augenblick, in dem man dem Tod ins Auge schaut.«
4
Man liebt, was man nicht ist.
Albert Cohen
»Colleen, bist du da?«
Juliette öffnete die Tür ihres Apartments und gab Acht, dass sie die Fertiggerichte vom Chinesen und die Flasche Wein, die sie vom Trinkgeld der Woche gekauft hatte, nicht fallen ließ.
»Colleen? Ich bin’s. Bist du zu Hause?«
Im Laufe des Vormittags hatte ihre Mitbewohnerin sie im Coffeeshop angerufen und ihr erzählt, dass ihr Vorstellungsgespräch gut gelaufen und sie eingestellt worden sei. Die beiden Frauen hatten sich vorgenommen, einen echten Weiberabend zu verbringen, um das Ereignis zu feiern.
»Bist du da?«
Die einzige Antwort, die sie erhielt, war Jean-Camilles Miauen. Er kam aus dem Wohnzimmer gerannt, rieb sich an ihren Beinen und schnurrte behaglich.
Juliette stellte ihre Pakete auf den Küchentisch, nahm den Kater auf den Arm und eilte ins Wohnzimmer. Es war der einzige Raum des Apartments, in dem die Heizung noch funktionierte.
Sie schloss die Augen und lehnte sich an die Heizung, die auf höchster Stufe lief. Wohlige Wärme erfasste sie von den Beinen aufwärts und breitete sich in ihrem ganzen Körper aus.
Hm … besser als jeder Mann!
Sie ließ die Augen geschlossen und träumte einen Moment lang, sie befände sich in einer vollkommenen Welt, in einer Welt, in der genügend Wasser im Boiler vorhanden war, um nach der Arbeit ein wunderbares heißes Bad zu nehmen.
Aber man sollte nicht zu viel verlangen.
Als sie die Augen öffnete, sah sie, dass der Anrufbeantworter blinkte. Mit Bedauern entfernte sie sich von der Heizung, um die Anrufe abzuhören.
Sie haben eine neue Nachricht:
Hallo, Juliette, ich bin’s. Tut mir Leid, aber ich kann heute Abend nicht. Du wirst nie erraten, weshalb. Jimmy hat mich zwei Tage nach Barbados eingeladen. Stell dir vor: BAR-BA-DOS! Wenn ich dich nicht mehr sehen sollte, gute Heimreise nach Frankreich!
Juliette spürte eine tiefe Enttäuschung.
Das also war Freundschaft auf die amerikanische Art: Drei Jahre lang teilt man sich eine Wohnung mit einem Mädchen und im Augenblick des Abschieds hinterlässt einem dieses zwei Sätze auf einem Anrufbeantworter.
Aber Juliette musste realistisch sein! Natürlich verbrachte Colleen das Wochenende lieber mit ihrem Verlobten als mit ihr.
Sie ging in der Wohnung umher und vergrub sich in ihren Kummer. Ab und zu blieb sie vor den vielen Fotos stehen, die wichtige Etappen der letzten drei Jahre zeigten.
Die beiden jungen Frauen hatten bei ihrer Ankunft in New York ein klares Ziel vor Augen: Colleen wollte Anwältin werden und Juliette Schauspielerin. In drei Jahren wollten sie es geschafft haben. Das Ergebnis: Eine war gerade in einer ange sehenen Kanzlei angestellt worden und die andere arbeitete als Kellnerin in einem Coffeeshop.
Mit ihrer Arbeitswut und ihrer Hartnäckigkeit würde Colleen schließlich zur Teilhaberin aufsteigen. Sie würde viel Geld verdienen, sich bei Donna Karan einkleiden und ihre Fälle in der gedämpften Atmosphäre eines gediegenen Büros in einem Glasturm abwickeln. Sie würde sein, was sie immer werden wollte: eine dieser executive women, denen sie morgens auf der Park Avenue begegnete.
Juliette war keineswegs neidisch auf den Erfolg ihrer Mitbewohnerin. Aber der Gegensatz zwischen Colleens Erfolg und ihrem eigenen Scheitern war dermaßen augenscheinlich, dass ihr übel wurde.
Was sollte aus ihr werden, wenn sie nach Frankreich zurückkehrte? Würde ihr Magister in Altphilologie ihr irgendetwas nützen? Und wenn sie sich vorstellte, dass sie in der ersten Zeit bei ihren Eltern wohnen musste! Sie dachte an ihre Schwester Aurelia, jünger als sie, aber schon unter der Haube! Sie arbeitete als Lehrerin und war ihrem Mann gefolgt, der als Gendarm in die Gegend von Limoges versetzt worden war. Aurelia und ihr Mann urteilten sehr streng über das »Bohème-Leben«, das Juliette ihrer Meinung nach führte, und hielten es für unverantwortlich.
In Paris hatten viele ihrer alten Freunde Karriere gemacht. Die meisten übten freie Berufe aus, angeblich kreative Tätigkeiten, bei denen man sich verwirklichen konnte: Ingenieur, Architekt, Journalist, Informatiker … Sie lebten in Partnerschaften, hatten Kredite für ein Haus aufgenommen, und auf den Rückbänken ihrer Großraumlimousinen spielten bereits ein oder zwei Kinder …
Juliette hatte nichts von all dem aufzuweisen: weder einen festen Beruf noch einen Partner oder gar ein Kind. Sie wusste, dass es ein unsinniges Unterfangen gewesen war, nach New York zu kommen, um hier ihr Glück als Schauspielerin zu versuchen. Im Übrigen hatten ihr alle vorhergesagt, dass es nicht vernünftig sei. Und das stimmte, denn es war nicht die Zeit, in der man Risiken einging. Das Prinzip der Vorsicht herrschte über alles, die Besessenheit vom »Nullrisiko«. Die Gesellschaft predigte die Rentenvorsorge ab 25, die Zwangsdiäten, die Stigmatisierung der Raucher …
Aber Juliette hatte auf niemanden gehört. Sie vertraute ihrem guten Stern, sagte sich immer wieder, dass sie eines Tages alle überraschen und wieder versöhnen würde, wenn auf der Titelseite von Paris Match zu lesen wäre: EINE JUNGE FRANZÖSIN ERHÄLT IN HOLLYWOOD EINE HAUPTROLLE! Sie hatte nie aufgegeben und sich mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Aber vielleicht war sie zu liebenswürdig, ein viel zu »braves Mädchen«, um Erfolg zu haben. Natürlich wäre alles viel leichter gewesen, wenn sie die »Tochter von …« gewesen wäre. Aber ihr Vater hieß nun einmal nicht Gérard Depardieu, sondern Gérard Beaumont und war Optiker in Aulnay-sous-Bois.
Vielleicht besaß sie ja gar kein Talent? Aber wenn sie nicht an sich glaubte, wer dann? Viele Schauspieler und Schauspielerinnen hatten es schwer gehabt, bevor sie zu Ruhm gelangten: Tom Hanks war jahrelang in Schmierentheatern aufgetreten, Michelle Pfeiffer hatte als Kassiererin im Supermarkt gearbeitet, Al Pacino wurde der Eintritt ins Actors Studio verweigert, Sharon Stone hatte ihre erste Hauptrolle erst sehr spät bekommen und Brad Pitt hatte als Huhn verkleidet in einem Großmarkt Sandwiches verkauft.
Das Wichtigste war – und das begriff niemand wirklich –, dass Juliette sich nur dann richtig lebendig fühlte, wenn sie spielte. Es spielte keine Rolle, dass sie in einem Stück an der Uni auftrat, es spielte auch keine Rolle, dass nur zwei Zuschauer gekommen waren: Sie fühlte sich nur dann richtig lebendig, wenn sie eine Rolle spielte. Sie war nur dann sie selbst, wenn sie in eine andere Rolle schlüpfte. Als ob sie eine Leere in sich ausfüllen müsste, als ob das wirkliche Leben ihr nicht genügte. Und jedes Mal, wenn Juliette das erkannte, dachte sie darüber nach, ob dieses Bedürfnis, eine Alternative zur Realität zu suchen, vielleicht etwas Pathologisches hatte.
Sie verscheuchte diese düsteren Gedanken, indem sie Aznavours Worte summte: »Ich sehe mich bereits oben auf dem Plakat …« Leise singend betrat sie Colleens Zimmer. Auf dem Stuhl lagen sorgfältig zusammengefaltet die teuren Kleider, die ihre Mitbewohnerin für die Vorstellungsgespräche gekauft hatte. Eine riskante Investition, die sich ausgezahlt hatte. Juliette gab der Versuchung nach und probierte sie an. Sie hatte Glück, denn Colleen und sie hatten fast die gleiche Kleidergröße.
Die junge Frau zog ihre Jeans und ihren alten Pullover aus, um in das graue Ralph-Lauren-Kostüm ihrer Freundin zu schlüpfen. Sie zwinkerte ihrem Spiegelbild zu.
Nicht übel.
Sie zog auch den eleganten schwarzen Rollkragenpulli aus Kaschmir, einen gerade geschnittenen Mantel aus Tweed und ein paar Ferragamo-Slipper an.
Voller Elan legte sie ein leichtes Make-up auf: etwas Puder aufs Gesicht, Mascara und Eyeliner.
»Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?«
Sie war erstaunt, wie verändert sie aussah. In diesem Outfit sah sie wie eine echte Geschäftsfrau aus. Ganz entschieden machten Kleider Leute.
Verwirrt erinnerte sie sich an den Film, in dem Dustin Hoffman in Frauenkleider schlüpft und damit die Rolle seines Lebens spielt.
Ermutigt sagte sie zu ihrem Spiegelbild:
»Juliette Beaumont, sehr erfreut. Ich bin Anwältin.«
So gekleidet ging sie die Treppe hinunter, wurde aber von Jean-Camilles kläglichem Miauen zurückgehalten. Der Kater forderte energisch sein Futter.
Sie schüttete ihm das chinesische Essen in den Fressnapf. »Da hast du etwas Köstliches: Hühnchen mit fünf Gewürzen und thailändischen Reis.«
Sie tätschelte den Kopf des Tiers, das zufrieden schnurrte, und erklärte ihm: »Juliette Beaumont, sehr erfreut. Ich bin Anwältin.«
Ende der Leseprobe