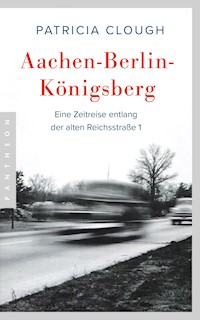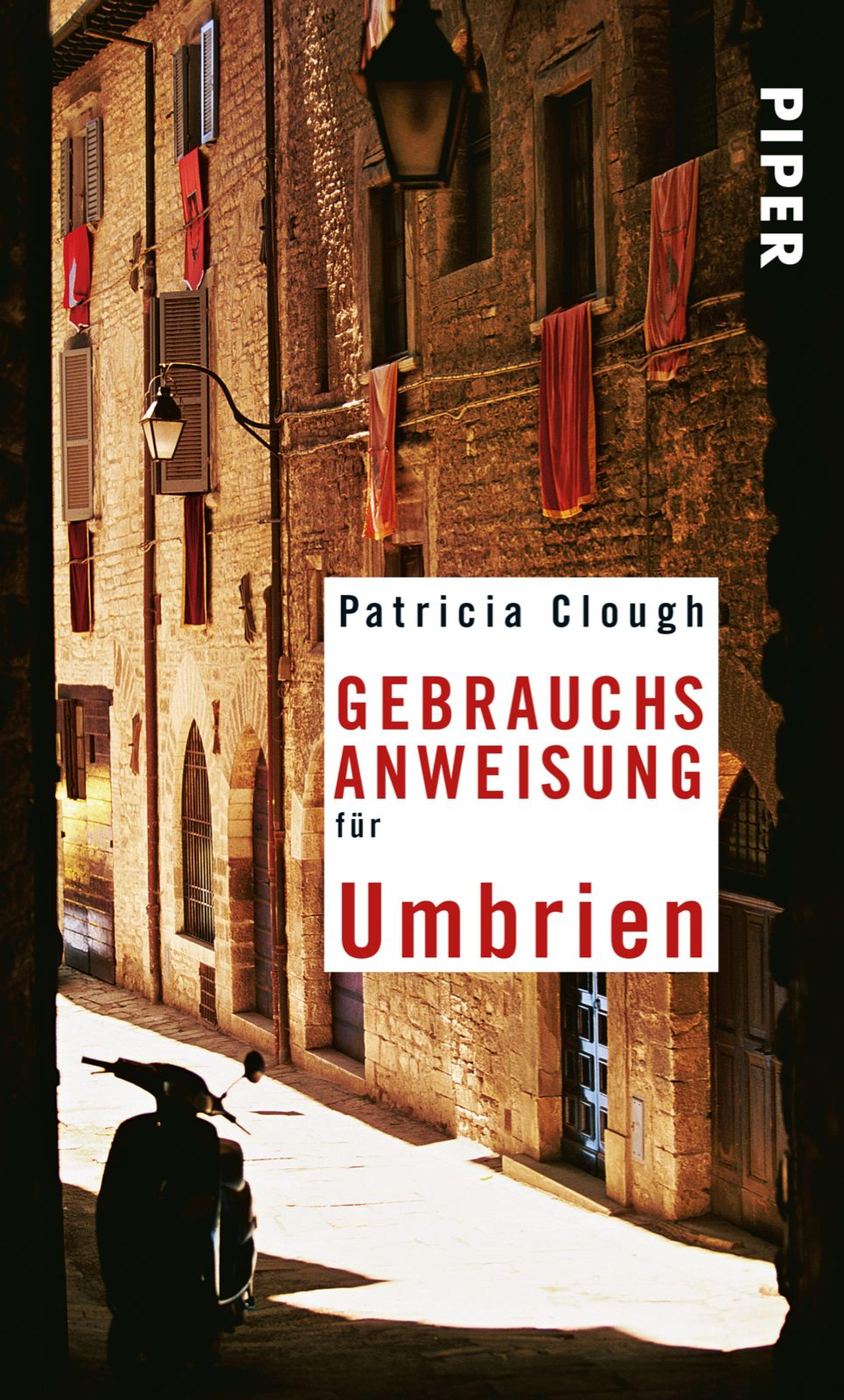10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ein bewegender Roman über das hochdramatische Leben einer jungen Mutter, der das Schicksal immer wieder übel mitspielt – bis sie schließlich ihre Kinder weggeben und für die Deutschen im Ersten Weltkrieg spionieren muss.
Florence wurde jung verheiratet mit einem Pfarrer, der ein strenges Regiment zu Hause führt. Als sie Trost und Zuflucht bei einem anderen Mann sucht, wird sie verstoßen. Von den beiden Söhnen darf sie nur den jüngeren mitnehmen, der ältere muss beim Vater bleiben.
Weder bei ihren Eltern findet sie Unterkunft noch bei kirchlichen Institutionen. Sie arbeitet als Krankenschwester und Pflegerin in privaten Haushalten. Als sie sich in einen wohlhabenden Witwer verliebt, scheint sich ihr Leben endlich zum Besseren zu wandeln. Doch eines Tages stirbt der Mann überraschend. Flo und die Kinder bleiben unversorgt zurück.
Mittlerweile steht der Erste Weltkrieg bevor. In England rekrutieren die Deutschen Spione. Flo auf Jobsuche gerät in deren Fänge. Sie wird mit dem Leben bedroht und gezwungen, für die Deutschen zu spionieren. Es gibt nur einen Weg, das Leben ihrer Kinder zu schützen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Cover
Titel
Patricia Clough
Eine ehrenwerte Frau
Roman nach einer wahren Begebenheit
Aus dem Englischen von Hanne Reinhardt
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Insel Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 4970.
Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen AusgabeInsel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2023© Patricia Clough 2023Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagabbildungen: Alamy/Arcangel/FinePic®
eISBN 978-3-458-77646-8
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Teil
I
Der Sündenfall
1. Kapitel. Pillowell, ein Bergbaudorf in Gloucestershire, 1901
2. Kapitel. Im Great Western Railway
3. Kapitel. Warley bei Brentwood
4. Kapitel. Warley
Teil
II
Eine ehrenwerte Frau?
5. Kapitel. Brentwood
6. Kapitel
7. Kapitel. Aberdare
8. Kapitel. Warley
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel. Pfarrhaus, Aberdare
12. Kapitel. Warley
TEIL III
Ein Sturm braut sich zusammen
13. Kapitel. Littlehampton, Sussex 1910
14. Kapitel
15. Kapitel. Derby, 1912
16. Kapitel. Littlehampton, 1912
17. Kapitel. An Bord der
Sirene
, Kieler Förde, Juni 1911
18. Kapitel. Hereford/Littlehampton 1912
Teil
IV
Krieg
19. Kapitel. Littlehampton 1913
20. Kapitel. Hauptquartier des Admiralstabs, Königgrätzer Straße 70, Berlin
21. Kapitel. Littlehampton 1914
22. Kapitel. Enoggera-Baracken, Brisbane, Australien
23. Kapitel. Littlehampton 1914
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel. Im London and North Western Railway
27. Kapitel. Folkestone 1914
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel. Folkestone
31. Kapitel. Antwerpen, Belgien
32. Kapitel. Folkestone
33. Kapitel
34. Kapitel. Pozières, Frankreich 1916
35. Kapitel. Ypern, Belgien 1916
36. Kapitel. Folkestone 1917
37. Kapitel. Dover 1917
38. Kapitel. Folkestone 1917
Teil
V
Australien
39. Kapitel. Queensland, Australien 1920
Epilog
Informationen zum Buch
Eine ehrenwerte Frau
Teil IDer Sündenfall
1. Kapitel
Pillowell, ein Bergbaudorf in Gloucestershire, 1901
Florence Ada Harris' Beitrag zur Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts hatte seinen Ursprung, so könnte man sagen, in einem heftigen Stoß zwischen die Schulterblätter, der sie zur Vordertür des Pfarrhauses hinaus- und flach auf das Gesicht beförderte, direkt auf die steinernen Platten vor dem Eingang.
Er tobte. Durch das Klingeln in ihren Ohren hindurch hörte sie: »Hure! Dirne! … eine Schande für mich, für meine Arbeit, unsere Familie, deine Söhne!« Und laut und deutlich: »In der Hölle sollst du schmoren!«
Er stand jetzt über ihr, und sie hob schützend die Arme über den Kopf aus Angst vor weiteren Schlägen.
»Mach dich fort!«, zischte er. »Ich gebe dir eine Stunde, um zu packen und von hier zu verschwinden – und nimm deinen Bastard mit! Godfrey bleibt bei mir. Hast du verstanden? Geh mir aus den Augen – ich will dich nie wiedersehen!«
Sie konnte hören, wie er sich umdrehte, es folgte ein kurzes Handgemenge, und dann kam er zurück, einen anderen Mann hinter sich herziehend – offensichtlich Rob, ihren Liebhaber –, den er die Treppen hinab auf die Straße stieß und dabei schrie: »… verdorbener Ehebrecher … ewige Verdammnis … Wie kannst du nur! Wage es nie wieder, dein Gesicht in der Kapelle zu zeigen!« Er folgte dem Übeltäter die Stufen hinunter. Dann überquerte er die Straße und ging den Pfad zu der großen, steinernen Kapelle hinauf. Sie hörte, wie der Schlüssel sich im Schloss drehte, die Tür zufiel und von innen wieder verschlossen wurde.
Ein paar Augenblicke blieb sie am Boden liegen, bebend vor Schmerzen. Sie spürte ein Stechen in ihrem Kopf, sie war hart mit der Stirn auf den Stein aufgeschlagen. Ihre Rippen schienen gequetscht, ihr rechter Arm war aufgeschürft und blutete stark. Schwere Schritte näherten sich und Stimmen – Bergarbeiter vermutlich, auf dem Rückweg von der Nachtschicht in der Grube. Der Morgen dämmerte schon. Unter Schmerzen rappelte sie sich auf, wischte sich den Schmutz aus dem Gesicht und von den Händen, raffte ihr Nachtgewand zusammen und drehte sich zur Tür, um zurück ins Haus zu gehen. Im Eingang standen ihre beiden Jungen, zitternd in ihren Nachthemden und blass im Gesicht.
»Was macht ihr hier?«, rief sie und scheuchte sie hinein. »Ihr holt euch den Tod bei der Kälte! Schnell zurück ins Bett, es ist noch nicht mal richtig hell.«
»Mama, was ist passiert? Warum hat Papa das getan?«
»Warum ist Rob hier?«
»Es ist alles in Ordnung, meine Lieblinge«, versuchte sie, die beiden zu beruhigen. »Euer Vater hat sich nur ein wenig geärgert, er meint das nicht so. Macht euch keine Sorgen. Legt euch einfach wieder hin.«
»Aber … aber …«
»Nein, geht jetzt.«
Schweigend gehorchten sie.
Florence, oder Flo, wie alle sie schon seit Kindertagen nannten, ging in die Küche und setzte sich auf einen Stuhl an den alten Holztisch, zitternd, zu benommen, um zu weinen. Minutenlang saß sie unbeweglich, starr vor Schock, innerlich leer. Dann plötzlich ergoss sich der Horror wie eine Sintflut über sie. Was hatte sie getan? Wie hatte sie so schlecht sein können? Sie hatte ihren strenggläubigen, geistlichen Ehemann betrogen – mit einem ihm anvertrauten Mitglied seiner Gemeinde. Wie hatte es so weit kommen können? Und als ob das nicht genügte: Warum war es ihr nicht in den Sinn gekommen, dass Josiah mit dem Frühzug zurückkehren würde, der viele der Bergarbeiter zur ersten Schicht des Tages brachte?
Niemals hatte sie ihren Mann so wütend gesehen. Doch er hatte recht. Sie hatte eine schreckliche Sünde begangen, das wusste sie. Sie hatte ihn betrogen, hatte ihre Erziehung verraten, alles, was ihr seit frühster Kindheit beigebracht worden war. Vergebung konnte sie keine erwarten, weder von Josiah noch von der Gemeinde. Das war ihr Ende.
Noch immer zitternd erhob sie sich, schlang sich einen Schal um die Schultern, schürte wie mechanisch die Asche in dem alten, schwarzen Küchenherd und füllte den Kessel. Das schiere Grauen umfing sie. Was sollte sie tun? Sie hatte kein Geld, keine Möglichkeiten, welches zu verdienen, und nun hatte sie auch kein Zuhause mehr. Sie fühlte sich nackt, wie eine Schildkröte ohne Panzer. Wie konnte sie überleben, ohne Mann und ohne Heim? Wo sollte sie hin? Auf keinen Fall zurück zu ihrem verwitweten Vater. Der bloße Gedanke ließ sie erschaudern. Doch sie musste gehen, und das so schnell wie möglich. Die Bergarbeiter könnten alles beobachtet haben. Vielleicht verbreiteten sich die Neuigkeiten schon im Dorf. Oh, was für eine Schmach!
Ihr Arm tat weh. Ein scharfer Schmerz durchfuhr sie, als sie ihn im Spülbecken wusch und sich einen Verband anlegte. Sie ging zu dem alten, schon halb blinden Spiegel und befühlte vorsichtig die Beule an ihrer Stirn. Die Schwellung begann bereits, sich blau zu färben. Sie sah furchtbar aus. Ihr ovales Gesicht, umgeben von dichtem roten Haar, war noch immer hübsch, aber es war blass, und die ersten feinen Falten zeigten sich. Sie war nun einunddreißig. Zehn Jahre in frommer Armut, harte Arbeit und zwei Kinder lagen zwischen ihr und dem übersprudelnden jungen Mädchen, das sie gewesen war. Wo waren die blitzenden Augen, die hinreißenden Grübchen, das gewinnende Lächeln, das alle um sie herum, vor allem die Männer, so unwiderstehlich gefunden hatten?
Eine Tasse Tee hob ihre Laune ein wenig. »Es muss jemanden geben, der mir helfen kann«, sagte sie zu sich selbst. Und plötzlich dämmerte es ihr, wohin sie gehen konnte.
»Cyril«, rief sie. »Mach dich fertig, zieh den Matrosenanzug an. Wir besuchen Tante Emily!«
»Tante Emily!« Die Jungen kamen die Treppe herabgepoltert, immer noch barfuß. Sie liebten Flos älteste Schwester, die in den ersten Jahren wie eine zweite Mutter für sie gewesen war.
»Ich komme auch mit«, rief Godfrey, der jüngere.
Flo fühlte sich, als hätte ihr jemand ein Schwert in den Magen gerammt. Sie wurde doppelt bestraft. Nicht nur wurde sie aus dem Haus geworfen und allein mit ihrem älteren Jungen in eine angsteinflößende Welt geschickt. Sie wurde gezwungen, sich von ihrem Jüngsten zu trennen, ihrem Herzblatt, ihrem heimlichen Liebling – vielleicht für immer, wer konnte das sagen? Diesen Gedanken konnte sie nicht ertragen. Sie würde sich weigern. So etwas konnte man von einer Mutter nicht verlangen. Sie lief vor dem Ofen auf und ab. Nein! Niemals!
Doch schon im nächsten Moment begriff sie die Hoffnungslosigkeit ihrer Lage. Sie kannte Josiah und seine puritanische Welt nur zu gut. Die Primitiven Methodisten waren sehr demokratisch, die Ansichten der Gläubigen hatten bei Entscheidungen oft mehr Gewicht als die ihrer Geistlichen, doch sie wusste, dass die Gemeinde wie ein Mann hinter Josiah stehen würde. Geschändet und entehrt, konnte sie kaum um ihre Hilfe bitten – zu kämpfen und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, würde ihre Lage bloß unendlich viel schlimmer machen.
Sie nahm Godfrey in den Arm, drückte das Kind fest an sich. »Wie soll ich es ihm bloß erklären?«, zermarterte sie sich den Kopf. »Die Wahrheit kann ich ihm nicht sagen. Ich brauche eine gute Geschichte.« Sie schluckte, mit den Tränen kämpfend, und nahm Godfreys Gesicht in die Hände. »Diesmal nicht, mein Schatz. Du musst bei Papa bleiben, damit er nicht einsam ist. Wir sind bald zurück, und wenn du schön brav bist, bringt Papa dich vielleicht zu Tante Martha und den Jungs. Und«, fügte sie wild improvisierend hinzu, »nächstes Mal nehme ich dich mit, und Cyril besucht Tante Martha. Wie findest du das?«
Godfrey war nicht überzeugt und begann zu weinen. »Aber warum? Das ist nicht fair, Mama! Ich möchte mit dir gehen«, jammerte er und rannte schluchzend die Treppe hinauf.
Mit tränenüberströmten Wangen lief Flo ins Schlafzimmer und zog ihr »gutes« Kleid an, ein strenges, hochgeschlossenes Kleid aus dunkelblauem Baumwollstoff, wie es sich für die Frau eines Geistlichen der primitiven methodistischen Kirche ziemte. Sie hatte es selbst genäht. Es war alt und bedauerlicherweise schon recht fadenscheinig, aber ihr anderes war noch schäbiger. Ohne nachzudenken, strich sie ihr langes rotes Haar zu dem pedantischen Dutt zurück, den sie seit ihrer Hochzeit trug. Was sollte sie mitnehmen? Sie besaß so wenig. Sie nahm die Fotografie ihrer verstorbenen Mutter vom Kaminsims und betrachtete sie. Das Herz tat ihr weh. »Oh, vergib mir, Mama, vergib mir! Wärst du doch nur hier, um mir zu helfen«, murmelte sie und drückte das Bild für einen Moment an ihre Brust, bevor sie es vorsichtig in ihre abgenutzte Reisetasche legte. Es folgten ihr zweites Kleid, Unterwäsche, ihr Korsett, Nachthemden und ein Extrapaar Schuhe, Cyrils spärliche Habseligkeiten, ihre Bibel und Gebetsbücher. Ein Blick in ihre Geldbörse zeigte ihr, dass die Reste des wöchentlichen Haushaltsgeldes vermutlich nicht einmal für die Zugfahrt reichen würden. Nach kurzem Zögern betrat sie das Arbeitszimmer ihres Mannes und holte den Inhalt aus einer Blechbüchse in der Schublade seines Schreibtisches. An seinem Platz hinterließ sie eine schnell hingekritzelte Notiz: »Sobald ich kann, werde ich es zurückzahlen.« Sie ging noch einmal durch das Haus, um sicherzugehen, dass sie nichts Wichtiges vergessen hatte, dann zog sie ihr Cape über und die Handschuhe. Den Hut setzte sie behutsam ein wenig schief in die Stirn und zog an dem kleinen Schleier, sodass er die Beule kaschierte. »Das mag ein wenig kokett aussehen, aber es muss gehen«, beschloss sie.
Auf der Schwelle blieb sie stehen und hielt sich am Türstock fest. Jede Faser ihres Körpers wollte die Treppe hinaufstürmen und Godfrey mitnehmen. Sie hätte alles dafür gegeben. Stattdessen rief sie: »Mach es gut, mein Schatz, und sei brav! Wir sind bald wieder da.« Mit einem tiefen Atemzug ergriff sie Cyrils Hand, nahm die große Reisetasche und machte sich auf den Weg, das Kinn hoch erhoben und mit einem starren Lächeln auf dem Gesicht.
Es war ein kalter, windiger Tag im Januar. Die halbe Meile durch das Dorf bis zum Bahnhof schien endlos. Sie kamen an den kleinen Häusern vorbei, in denen sie, die beliebte Pastorenfrau, die Kranken besucht und sich um sie gekümmert hatte, dahinscheidende Gemeindemitglieder, mit denen sie so oft gebetet und gesungen hatte, Kinder, denen sie Geschichten aus der Bibel erzählte. Sie grüßte alle mit erzwungener Fröhlichkeit, als sie an ihnen vorbeischritt. »Wir fahren meine Schwester besuchen! Sind bald zurück«, rief sie wieder und wieder.
Sie schienen noch von nichts zu wissen, dachte sie, aber wer konnte ahnen, was für schreckliche Gerüchte und Geschichten die Runde machen würden, wenn sie herausfanden, dass sie niemals zurückkehren würde?
2. Kapitel
Im Great Western Railway
Wie im Koma kauerte sie zusammengerollt auf dem Fenstersitz ihres Abteils, in ihrem geschundenen Kopf und im Brustkorb pochte das rhythmische Da-da-da-da der Räder. Der zehnjährige Cyril ihr gegenüber schien die Ereignisse des Morgens bereits vergessen zu haben, vor lauter Aufregung darüber, in einem echten Zug zu sitzen, mit einer echten, dicken, schwarzen Lokomotive, die dunklen Rauch rülpste und durchdringende Pfeiftöne von sich gab. Fasziniert betrachtete er, wie Felder, Wälder und Häuser, Eisenbahnsignale und gelegentlich entgegenkommende Züge vorbeirasten. Er wollte an dem dicken Lederriemen ziehen und das Fenster hinunterlassen, doch sie hob matt die Hand, um ihn zurückzuhalten.
»Nein, Liebling, der Qualm wird dich einhüllen, und du bekommst Asche in die Augen.«
Nach einer Weile wurde ihr klar, dass sie sich zusammenreißen und versuchen musste, sich ein Bild von ihrer Lage zu machen. Sie öffnete die Handtasche und zählte das Geld. Der Inhalt von Josiahs Blechbüchse, die Beiträge seiner Gemeindemitglieder zur Instandhaltung der Kirche, deren Kassenwart er war, war mehr Geld, als sie seit langer Zeit gesehen hatte. Sie fühlte sich zutiefst schuldig und nahm sich das Versprechen ab, es zurückzuzahlen, sobald sie konnte.
Wie sie das erreichen sollte, war ihr zwar vollkommen schleierhaft, aber sie hoffte inbrünstig, dass Emily ihr helfen würde, ihr Leben in Ordnung zu bringen. Ihre ältere Schwester war immer eine Stütze für sie gewesen, ganz besonders nach dem Tod ihrer geliebten Mutter. Sie und ihr schottischer Ehemann Jack waren praktisch veranlagte, vernünftige Leute, sie würden wissen, was zu tun war. Auch wenn, so ermahnte sie sich selbst, sie Emily nicht erzählen konnte, was an diesem Morgen wirklich vorgefallen war. Niemand durfte das je erfahren. Sie brauchte eine gute Geschichte.
An der nächsten Station öffnete sich die Tür, und ein recht junger, vornehm aussehender Herr in einer hellen Tweedjacke betrat ihr Abteil mit einem höflichen »Guten Morgen«. Flo setzte sich schnell gerade hin, rückte verstohlen den Hut zurecht und strich ihr Kleid glatt.
Der Herr hob seinen Lederkoffer auf die Gepäckablage, setzte sich und begann, die Zeitung zu lesen. Ihr fiel auf, dass sich ein dunkelrotes Muttermal seine linke Gesichtshälfte hinabschlängelte. Cyril bemerkte es ebenfalls, und sie gab ihm ein stilles Zeichen, den Herrn nicht anzustarren.
Irgendwann meldete Cyril sich plötzlich zu Wort: »Mama, was ist ein Bastard?«
Flo versteifte sich und warf einen Blick auf den Mann.
»Das ist ein schlimmes Wort, das die Leute manchmal benutzen, wenn sie sehr wütend sind«, antwortete sie mit gedämpfter Stimme. »Du darfst es nie verwenden.«
»Aber warum hat Papa mich so genannt?«
Nervös blickte Flo wieder zu dem Mann hinüber, doch der schien ganz in seine Zeitung versunken. Sie klammerte sich an einen Strohhalm: »Vielleicht, weil du die Hühner von Mrs Evans freigelassen hast?«
»Aber Godfrey war auch dabei, und ihn hat Papa nicht so genannt.«
Zu ihrer Erleichterung schien ihn der Gedanke an seinen geliebten kleinen Bruder abzulenken. Er begann zu weinen. »Warum konnte Godfrey nicht mitkommen? Warum musste er zu Hause bleiben?«, schluchzte er.
Während sie selbst mit den Tränen kämpfte, angelte Flo nach einem Taschentuch und versuchte, ihn zu beruhigen. Und während sie ihn tröstete, dämmerte ihr langsam die Antwort auf seine Frage: Josiah hatte offensichtlich längst gewusst, dass Cyril nicht sein Sohn war. Unglaublich. Er hatte kein Wort gesagt, als das Baby als »Frühgeburt« auf die Welt kam. Kein Wort, nicht einmal, als die Hebamme unbedacht fallenließ, wie groß und ansehnlich er war für ein »Sieben-Monats-Kind«. In seiner distanzierten Art schien Josiah Cyril immer ebenso gerngehabt zu haben wie Godfrey. Doch wann und wie hatte er erfahren, dass Cyril nicht von ihm war? Und warum hatte er bis zu diesem Morgen nichts dazu gesagt? Sie hatte keine Ahnung, niemals hatten sie über vertrauliche Dinge gesprochen. Seine Mission nahm ihn völlig in Beschlag: den Armen und Unterdrückten das Evangelium zu verkünden, den Bergarbeitern, Fabrikarbeitern, den Arbeitern auf den Bauernhöfen, all jenen, die nach Ansicht der Primitiven Methodisten von der Anglikanischen Kirche im Stich gelassen worden waren, ebenso wie von den offiziellen Methodisten, seit diese »angesehener« und bürgerlicher geworden waren.
Tatsächlich nannten sie sich deswegen »primitiv«, weil sie überzeugt davon waren, dass sie zurückgekehrt waren zu den Anfängen des Methodismus, seinen originären, reinen, ursprünglichen Lehren mit den Predigten und Gebeten unter freiem Himmel, als das Hauptaugenmerk auf den Armen gelegen hatte. Blass, schmächtig, mit mausbraunem Haar und einem Schnurrbart, der in Koteletten überging, war Josiah beinahe fanatisch in seinem Glauben und ein erstaunlich leidenschaftlicher, feuriger Prediger vor einer Gemeinde. Doch zu Hause war er eine ruhige, fast ein wenig geisterhafte Präsenz, im Kopf stets bei seinen Predigten oder, wenn er die Zeit dazu hatte, seinen Hebräisch- und Griechischstudien.
Flo hatte niemandem, nicht einmal ihren Schwestern, ihr Geheimnis anvertraut: dass sie hatte heiraten »müssen«. Das hatte das abrupte Ende einer fröhlichen, unbeschwerten Jungmädchenzeit als jüngste und hübscheste Schwester in einer Bauernschaft in Buckinghamshire bedeutet. Ihr Vater, Zachary Summers, war der Verwalter mehrerer Farmen, die zu einem großen Landgut gehörten, und eine feste Größe in der örtlichen Gemeinde der Primitiven Methodisten. Zachary war ein herrschsüchtiger Mann, jähzornig und streng, und er erlegte seiner Familie einen enthaltsamen, puritanischen Lebenswandel auf, der seinem strikten Glauben entsprach. Seine drei Töchter wollte er zu frommen, gottesfürchtigen Mädchen erziehen, die, nachdem sie mit vierzehn die Schule verlassen hatten, sich dem Kochen und dem Haushalt widmen würden, die Hasen und Hühner versorgten und sich in der Nachbarschaft nützlich machten, bis angemessene junge Männer, am besten Nonkonformisten wie er selbst, des Weges kommen und sie heiraten würden. Die beiden Älteren, Emily und Lizzie, hatten ihm den Gefallen getan und waren zu tugendhaften, folgsamen jungen Frauen herangewachsen, die keinen Ärger machten, aber Flo … Flo war aus einem anderen Holz geschnitzt. Ihre temperamentvolle, lebenslustige, impulsive Natur brachte sie ständig in Schwierigkeiten. Sie wollte sich benehmen, das musste Zachary in seinen milderen Momenten zugeben, aber es gelang ihr nie lange, ihren Übermut zu zügeln. »Ich weiß nicht, warum unser großer Gott uns dieses kleine Luder geschickt hat, Betty«, grummelte er seiner lieben, frommen Frau zu und schüttelte traurig den Kopf. Als sie Kinder waren, zogen Emily und Lizzie Flo damit auf, dass die Feen ihre wahre Schwester gestohlen und sie an ihrer Stelle in die Wiege gelegt hatten. Als sie heranwuchs und umwerfend schön wurde, machte ihr ein ganzer Schwarm von Gleichaltrigen und jungen Männern den Hof – und sie genoss es, der strengen Aufsicht ihrer Eltern zu entfliehen, und sei es nur für Momente, um zu flirten, sich mit den Jungen zu necken und sie zu küssen. Verspielt und lebhaft, wurde sie bewundert und verhätschelt von ihren Freunden und ihrer Familie – außer von Zachary, der kritischer und strenger wurde und sich immer häufiger auf harte Schläge verlegte. Weit entfernt davon, sie zu sittsamer Ergebenheit zu prügeln, veranlasste seine Strenge Flo allerdings dazu, sich zu schützen, indem sie Dinge erfand, die sie »Geschichten« nannte, die aber doch – wie sie später beschämt zugeben musste – nichts anderes waren als Lügen.
Zachary wollte sie unbedingt verheiraten, bevor sie ernsthaft vom Wege abkam, und drängte Flo, Josiah Harris zu ehelichen, den ruhigen, ernsthaften jungen Predigeranwärter in ihrer Gemeinde. Er wusste, dass das mit ziemlicher Sicherheit bedeuten würde, dass sie weit ärmlicher leben würde – denn obgleich er seiner Familie eine schlichte und einfache Lebensführung auferlegte, konnte er ihnen doch mehr Annehmlichkeiten bieten als ein junger Prediger. Aber Josiah, davon war er überzeugt, wäre der richtige Mann, um aus Flo eine gläubige, gottesfürchtige Hausfrau und Mutter zu machen. Flo, fröhlich wie ein Schmetterling, der sich aus seinem Kokon geschält hat, hatte kein Interesse. Sie hatte keine Eile, sesshaft zu werden.
Ich muss zugeben, dass Papa recht hatte, dachte sie reumütig, während sie eine Position suchte, in der ihre Rippen weniger schmerzten. Sie war töricht gewesen, das war ihr nun klar. Töricht und verantwortungslos. Heimliche Küsse waren zu heimlichen Treffen im Wald geworden, während sie die Kranken hätte besuchen sollen. Sie hatte eine sehr ungenaue Idee von dem, was man als »Aufklärung« bezeichnete, und so genoss sie diese romantischen Abenteuer ohne Bedenken, doch eines Tages geschah etwas, auf das sie nicht vorbereitet gewesen war und von dem sie nicht wusste, wie sie ihm Einhalt gebieten sollte. Und bald entdeckte sie zu ihrem großen Entsetzen, dass sie schwanger war. Um es noch schlimmer zu machen, war ihr Liebhaber, ein attraktiver Bauernsohn, zu Verwandten nach Kanada gezogen. Sie war allein, und sie sah einem Schicksal entgegen, das ihr Vater stets als »schlimmer als der Tod« umschrieben hatte. In Panik willigte sie augenblicklich ein, Josiah zu heiraten, und Zachary – in Sorge, dass sie ihre Meinung ändern könnte – kümmerte sich um eine schnelle Hochzeit. In einer wunderbar kurzen Zeit war sie in Sicherheit – und die Freiheit des Schmetterlings nur mehr eine Erinnerung. Sie war einundzwanzig Jahre alt.
»Seltsam, wie die Geschichte sich wiederholt«, sagte sie sich, als sie an die letzten Jahre ihrer Ehe zurückdachte. Sie hatte sich solche Mühe gegeben, eine gute, fromme Predigergattin zu sein. Sie hatte sich in Josiahs wechselnden Gemeinden unentbehrlich gemacht, war für die Bedürftigen da gewesen und hatte für die Jungen so gut gesorgt, wie ihr geringes Einkommen es nur möglich machte. Doch mit der Zeit begann die bittere Armut sie mürbezumachen. Sie hatte Mühe, genug zu essen auf den Tisch zu bekommen, oft gab es bloß trockenes Brot und Kartoffeln und im Sommer das Obst und Gemüse, das die Gemeindemitglieder ihr brachten – auch wenn der Großteil von ihnen ebenfalls kaum etwas hatte. Oft blieb sie hungrig, damit wenigstens die Kinder satt wurden, doch zu häufig mussten auch sie mit knurrendem Magen zu Bett gehen. Um sie einzukleiden, war sie auf abgetragene Kleidungsstücke von Verwandten oder Nachbarn angewiesen; ständig war sie am Flicken, oder sie strickte Neues aus der Wolle alter Pullover. Im Winter musste sie Bergarbeiter bitten, Kohleklumpen herauszuschmuggeln, um nicht zu erfrieren.
Sie sehnte sich nach menschlicher Wärme und Umarmungen, aber Josiah, im Kopf stets bei seiner Arbeit, war sperrig, reagierte kaum und bot ihr keinen Trost. Manchmal fragte sie sich, ob er tief in seinem Inneren davon überzeugt war, dass selbst ehelicher Verkehr eine Sünde war. Ihr Groll gegen ihn wuchs, sie fühlte sich immer ungeliebter und einsamer.
Manchmal träumte sie von einem besseren Leben, einem Leben mit Geld, Annehmlichkeiten, Vergnügen, Freude. Doch nie wäre es ihr in den Sinn gekommen, Josiah zu verlassen. Frauen wie sie hatten nicht die Wahl: Die Ehe war ewig, was auch immer geschah. Dies war ihr Schicksal, lebenslang.
Ein kurzer Flirt mit einem Händler auf der Durchreise entfachte einen alten Funken in ihrem erloschenen Herzen. Es folgte ein weiterer Flirt und noch einer, jeder ein bisschen weniger harmlos als der vorangegangene, jeder eine kleine, aufregende Flucht aus ihrem alltäglichen Elend. Dann kam Rob – und die Katastrophe.
»Fahrt ihr nach London?«, wurde sie plötzlich aus ihren Gedanken gerissen. Der Herr in der Tweedjacke sprach mit Cyril. Cyril schien unsicher zu sein, was er sagen sollte, und so sprang Flo ihm bei. »Wir müssen in London umsteigen. Wir besuchen meine Schwester in Warley, bei Brentwood.«
»Das ist nicht mehr weit von London. Aber Sie müssen den Bahnhof wechseln«, sagte der Mann. »Sie müssen eine Droschke bis Liverpool Street nehmen. Warum fragen Sie den Fahrer nicht, ob er Ihnen auf der Fahrt ein paar Sehenswürdigkeiten zeigt? Ohne einen großen Umweg könnten Sie Buckingham Palace sehen, Westminster Abbey, Trafalgar Square und St Paul's Cathedral.«
»O Mama, machen wir das?«, rief Cyril aufgeregt.
»Warum nicht?«, sagte Flo. »Das klingt nach einer entzückenden Idee.«
Sie plauderten noch etwa eine halbe Stunde, bis der Herr sich mit einem Blick auf seine Taschenuhr erhob und seinen Lederkoffer von der Gepäckablage zog. »Ich muss an der nächsten Station aussteigen. Auf Wiedersehen, es hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Ma'am.« Und an Cyril gewandt: »Pass auf deine hübsche Mutter auf, junger Mann. Gib acht, dass ihr nichts geschieht.« Und mit etwas, das verdächtig nach einem Zwinkern aussah, war er verschwunden.
Flo war sprachlos. Welch ein Kompliment! Hatte er das wirklich so gemeint? Oder hatte das Zwinkern vielmehr bedeutet, dass er einen Scherz gemacht hatte? Sie stand auf und warf einen Blick in den Spiegel über der gegenüberliegenden Sitzreihe. »Na ja, etwas besser als heute Morgen«, dachte sie. Vielleicht sah sie doch nicht so schlimm aus. Ein kleines Rinnsal Selbstvertrauen begann sich seinen Weg zurück in ihre mitgenommene Seele zu suchen.
»Droschke?« – »Droschke, junge Frau, Droschke?« Eine verblüffende Anzahl von Droschken wartete vor dem Bahnhof. Der Fahrer der ersten sprang von seinem Sitz und hielt ihnen die Tür auf. »Bitte sehr, meine Dame, wo soll's hingehen?«
»Zur Liverpool Street Station«, antwortete Flo. »Aber könnten Sie am Buckingham Palace vorbeifahren, am Trafalgar Square und all den wundervollen Orten, die auf dem Weg liegen? Ich möchte meinem Sohn die Sehenswürdigkeiten zeigen.«
Vergnügt machten sie sich auf den Weg. Über dem Rücken des kastanienbraunen Pferdes vor ihnen spannten sich die Zügel des Geschirrs, verschwanden über ihren Köpfen und reichten bis zu dem Fahrer auf seinem hohen Sitz.
Flo und Cyril waren wie verzaubert. Die Wachen mit ihren roten Jacken und den Bärenfellmützen vor dem Buckingham Palace, die berühmten Gebäude, von denen sie schon so viel gehört hatten, die Springbrunnen, die eleganten Leute in ihren Kutschen, die pferdegezogenen Busse, und sogar – zu Cyrils Entzücken – ein paar Automobile.
Sie vergaßen die Zeit, stiegen aus der Kutsche, um einen Blick in die Westminster Abbey zu werfen, kauften Röstkastanien und betrachteten das Schaufenster von Fortnum & Mason. Beim Anblick der Delikatessen begann Cyril, über Hunger zu klagen, und Flo bat den Fahrer, sie am Lyons' Corner House aussteigen zu lassen. Der Fahrer willigte ein, ohne Aufpreis auf sie zu warten, er war ebenfalls hungrig und hatte sein Essenspaket dabei.
Die Sonne ging in einem rosigen Nebel unter, als sie sich wieder auf den Weg machten. Es begann bereits zu dämmern, und die Lampenanzünder mit ihren langen Stäben waren unterwegs und brachten eine Straßenlaterne nach der anderen zum Leuchten. Als sie die Liverpool Street erreichten, war es schon spät. Flo zahlte den Fahrer, und Cyril blieb bei ihrer Tasche, während sie die Tickets kaufen ging. Erschüttert kam sie zurück.
»Stell dir vor, Cyril: Wir haben den letzten Zug verpasst. Bloß um ein paar Minuten! Jetzt fährt keiner mehr bis morgen früh. Wären wir doch nur nicht so lange mit der elenden Droschke herumgefahren!« Bevor sie losgefahren waren, hatte sie Emily vom Postamt aus ein Telegramm geschickt und angekündigt, dass sie am Abend eintreffen würden. Was sollten sie tun? Ratlos stand sie da. Schließlich entdeckte Cyril ein Schild: Warteraum. »Dem Himmel sei Dank«, stieß Flo hervor. »Dort können wir es uns für die Nacht gemütlich machen.«
Der Warteraum war leer. Sie richteten sich auf einer der breiten Holzbänke ein, und schon bald schlief Cyril tief und fest, ausgestreckt und den Kopf im Schoß seiner Mutter. Flo, erschöpft von den Turbulenzen des Tages, war gerade ebenfalls dabei einzunicken, als ein Polizist den Raum betrat, begleitet von einer Dame der Heilsarmee.
»Sie können hier nicht schlafen, Ma'am. Das ist verboten«, sagte der Polizist.
»Aber, Officer«, protestierte Flo. »Wir haben den letzten Zug nach Brentwood verpasst und müssen bis zum Morgen warten. Wo sonst sollten wir warten, wenn nicht im Warteraum?«
»Schlafen im Warteraum ist verboten«, antwortete der Polizist. »Sonst würden sich alle Vagabunden Londons hier auf's Ohr hauen.«
»Nun, wir sind sicher keine Vagabunden«, setzte Flo entrüstet an, doch die Dame der Heilsarmee fiel ihr ins Wort. »Ganz sicher nicht, Ma'am. Aber warum gehen Sie nicht ins Bahnhofshotel? Es ist gleich um die Ecke und hat die ganze Nacht geöffnet. Es ist wirklich nicht teuer, und Sie können in richtigen Betten schlafen.«
»Darauf bin ich gar nicht gekommen.«
»Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen den Weg«, sagte die Dame.
Wenig später schliefen sie, erschöpft von den Geschehnissen des Tages, tief und fest im Bahnhofshotel – so tief und fest, dass sie sich nicht rührten, bis es am Morgen zehn Uhr schlug. Es war bereits um die Mittagszeit, als sie das Haus der Nortons in Warley erreichten.
3. Kapitel
Warley bei Brentwood
»Da seid ihr ja! Gott sei Dank!«, rief Emily, als sie die Tür öffnete. »Wir haben uns wirklich Sorgen gemacht. Wir haben euch gestern Abend erwartet, wie du es in deinem Telegramm geschrieben hast!«
Emily, deren Haar von einem helleren Rot war als Flos und die um einiges rundlicher war als ihre Schwester, war eine freundliche, mütterliche Frau. Ihre fünfjährige Tochter, Madeleine, klammerte sich schüchtern an ihren Rock. Voll Freude nahm Emily Flo und Cyril in ihre Arme. »Jetzt sagt nicht, ihr habt euch stattdessen in London rumgetrieben!«
»Na ja, nicht ganz«, sagte Flo. »Als wir den Bahnhof wechseln mussten, haben wir den Fahrer der Droschke gebeten, einen kleinen Umweg zu machen, um die Sehenswürdigkeiten anzuschauen, und dann haben wir ganz knapp den letzten Zug verpasst. Wir mussten die Nacht im Bahnhofshotel verbringen.«
»Spatzenhirn, das war ja nicht anders zu erwarten«, ertönte eine tiefe, raue Stimme hinter Emily. »Josiah hätte dich nicht aus dem Haus lassen sollen.« Man hörte ein Klopfen und ein Schlurfen, und dann erschien ein kleiner, drahtiger Mann mit kahlem Kopf und weißen Koteletten, einem Holzbein und einem Gehstock. Flo sank das Herz. Ihr Vater. Sie musste all ihre Willenskraft zusammennehmen, um auf ihn zuzugehen und ihn in den Arm zu nehmen, während sie mit gespielter Freude rief: »Papa! Was für eine schöne Überraschung. Was machst du hier?«
»Ich übernachte bei deiner Schwester, was sonst«, war die knappe Antwort. »Ich nehme an einem Treffen mit ein paar deutschen Kameraden drüben in Epping teil. Ihr zwei solltet auch kommen und euch mal ein bisschen für eure Herkunft interessieren.« Das war eine Rüge. Ihr Vater, der in einem Dorf in der Nähe von Braunschweig im Norden Deutschlands zur Welt gekommen war, hatte den Versuch unternommen, ihnen seine Muttersprache nahezubringen. Eine Zeitlang hatte er sogar ein schüchternes »Fräulein« beschäftigt, das ihnen deutsche Volkslieder und Märchen hatte beibringen sollen. Ganz genau wusste niemand, warum er damals, mit Anfang zwanzig, nach Dorset gekommen war, seinen Namen von Zacharias Sommer zu Zachary Summers geändert hatte und nie wieder nach Deutschland zurückgekehrt war, nicht einmal für einen Besuch. Er gab sich nie die Mühe, es zu erklären. Doch es gab Gerüchte unter der Landbevölkerung, die in den Pubs die Runde machten, dass er damals nach England gekommen war, um irgendeiner Art von »Ärger« aus dem Wege zu gehen.
»Und warum bist du hier?«, fragte Zachary.
»Josiah ist bei einer Konferenz der Primitiven Methodisten, und da dachte ich, ich besuche Emily. Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben«, antwortete sie.
»Und Godfrey?«
»Der ist bei Tante Martha und ihrer Familie, Vater.«
»Du hättest ihn mitbringen sollen.« Er fand immer etwas auszusetzen. »Was hast du da für eine Beule an der Stirn?«
Der schwere, eiserne Marmeladentopf habe sie getroffen, als sie versucht habe, ihn aus einem hohen Regal zu ziehen.
Die Anwesenheit ihres Vaters warf einen Schatten über ihre Ankunft, und die Schwestern konnten nicht entspannt und offen miteinander sprechen, bis er sich am nächsten Tag auf den Weg machte, um seine Deutschen zu treffen.
»Lass uns Mittagessen machen«, sagte Emily, nachdem er gegangen war. Während sie Lammkoteletts vorbereitete und Flo die Kartoffeln schälte, bemerkte Emily: »Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Aber warum habt ihr so plötzlich entschieden, vorbeizukommen?«
Flo hatte ihre Geschichte vorbereitet. Emily durfte die Wahrheit nie erfahren. Niemand durfte das. Die Erklärung, die sie sich zurechtgelegt hatte, war absolut glaubwürdig, da war sie sicher. Außerdem war sie wahr. Der entscheidende Teil fehlte schlichtweg. »Emily«, sagte sie mit gedämpfter Stimme, sodass Cyril sie nicht hören konnte, »ich ertrage es nicht mehr länger. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dir von meinem Leben zu erzählen. Du weißt, dass wir bitterarm waren, aber ich muss dir sagen, dass wir oftmals nicht einmal genug zu essen hatten. Kannst du dir vorstellen, was es heißt, deine Kinder hungrig ins Bett zu schicken? Josiah verdient weniger als ein Erntehelfer, und manchmal verdient er gar nichts, weil die örtlichen Behörden kein Geld haben. Und du weißt, wie es in dieser Art von Gemeinden zugeht – keine ›weltlichen Freuden‹, wie sie es nennen, nicht einmal Bier. Kapelle, Sonntagsschule, Gebete, Gemeindetreffen, das ist alles, was sie kennen.
Wir hatten keinen Streit oder Ähnliches. Es wäre fast leichter, wenn wir welchen gehabt hätten. Josiah ist in Gedanken immer bei seiner Gemeinde, wenn er nicht gerade unterwegs ist, um zu predigen. Er hat keine Zeit für mich. Oft denke ich, wir bedeuten ihm überhaupt nichts mehr. Wenn ich ihm sage, dass wir nicht genug zu essen haben, antwortet er, wir sollen auf Gott vertrauen! Er denkt, dass ich nur für einen kurzen Besuch bei dir bin, doch da ist er auf dem Holzweg. Ich habe mich nie beschwert, aber jetzt ist es genug. Ich gehe nicht zurück.«
»Flo, das kannst du nicht machen! Du kannst deinen Mann nicht verlassen – noch dazu einen Pastor! Das ist unerhört. Es wird einen riesigen Skandal geben!« Emily musste sich setzen. »Josiah ist ein guter Mann. Und du hast ihm so geholfen bei seiner Arbeit. Denk mal an Guernsey, als sie ihn ins Gefängnis warfen und du dich so sehr für ihn eingesetzt hast, dass die Queen ihn begnadigte.«
Flo lächelte schief. Das war direkt nach Cyrils Geburt gewesen. Josiah hatte zum ersten Mal als ordinierter Pastor vor seiner eigenen Gemeinde gestanden. Noch unerfahren, hatte er ein Paar verheiratet, ohne zu wissen, dass sie blutsverwandt waren – Onkel und Nichte. Sobald er die Wahrheit erfuhr, meldete er den Fall, dennoch wurde er verhaftet. Die Gemeinde war überzeugt davon, dass mächtige Anglikaner dahintersteckten, die dem Erfolg nonkonformistischer Kirchen feindlich gegenüberstanden. Flo hatte sich an den Protesten beteiligt und Anträge der Inselbewohner auf seine Freilassung unterstützt, sodass er schließlich von der Queen begnadigt wurde, die auf die Missstände hingewiesen worden war.
»Na ja, er hat sich natürlich bei allen bedankt, aber in Wirklichkeit war er überzeugt davon, dass es der Allmächtige war, dem er zu danken hatte, nicht wir«, bemerkte Flo. Sie hätte noch hinzufügen können, dass das ihrer Ehe nicht unbedingt zuträglich gewesen war.
»Und wovon willst du leben?«, fuhr Emily fort. »Dir ist klar, dass du nie wieder heiraten kannst. Selbst wenn er es sich irgendwann leisten könnte, würde es Josiah nicht einmal im Traum einfallen, sich scheiden zu lassen, das würde allem widersprechen, was er je gepredigt hat. Wie willst du allein zurechtkommen? Du musst auch an die Jungen denken!«
»Ich weiß es nicht, aber ärmer, als wir jetzt sind, können wir nicht werden. Wenn ich nur arbeiten könnte … Darüber möchte ich mit dir und Jack sprechen. Ihr beiden wisst mehr von der Welt als ich, und ich bin sicher, ihr könnt mir Rat geben.«
»Lass uns darüber reden, wenn Jack heute Abend heimkommt. Aber du weißt, dass Lizzie und ich nie verstanden haben, warum du Josiah überhaupt geheiratet hast. Was auch immer unser Vater im Kopf hatte, du warst nie dafür gemacht, die Frau eines Geistlichen zu sein, ganz besonders nicht die eines armen wandernden Predigers wie Josiah. Natürlich haben wir uns manchmal gefragt, ob du einen anderen Grund hattest, um so schnell zu heiraten«, fuhr sie mit wissendem Blick fort und lächelte Flo an. »Du hast so plötzlich nachgegeben.«
Flo lachte, doch sie schwieg.
Als es dunkel wurde, kam Emilys Mann von seinen Rundfahrten zurück. Jack Norton war der örtliche Repräsentant eines alteingesessenen Londoner Stoffhändlers, der ihn neben einem großzügigen Gehalt auch mit Pferd und Wagen ausstattete, um Städte und Dörfer in einem weitläufigen Gebiet erreichen zu können, um seine Waren anzubieten und Bestellungen entgegenzunehmen. Etwas später kam auch Dolly Norton, Jacks Schwester. Dolly war nicht besonders hübsch mit ihrem länglichen, blassen Gesicht mit der hervorstechenden Nase, umrahmt von dünnem, straßenköterblondem Haar. Sie redete nicht viel, doch was sie sagte, zeigte sie als kluge und vernünftige Frau. Sie arbeitete als Zahnarzthelferin und lebte bei Jack und Emily, bis sie und ihr Verlobter genug Geld gespart haben würden, um zu heiraten.
Nach dem Abendessen brachten sie die Kinder ins Bett und setzten sich zu viert in die Stube, um über Bechern mit heißem Kakao Flos Zukunft in Augenschein zu nehmen.
Zu Beginn war Jack felsenfest davon überzeugt, dass Flo zu Josiah zurückkehren musste. »Du musst den Weg akzeptieren, für den du dich entschieden hast. Das Leben dort mag hart sein, aber ich denke, du bist dir nicht im Klaren darüber, wie viel härter das Leben für eine Frau ohne Ehemann und Einkommen ist. Wovon würdest du leben? Wie die Jungen großziehen? Und hast du über den Skandal nachgedacht, den das bedeuten würde, die Leute würden hinter deinem Rücken über dich reden und deine Sittsamkeit in Frage stellen. Ich befürchte, du begibst dich vom Regen in die Traufe.«
»Ich sage einfach, ich bin Witwe«, protestierte Flo. »Es ist nichts Unmoralisches daran, Witwe zu sein.«
»Bis sie dich erwischen«, sagte Jack stirnrunzelnd. Doch Flo war nicht zu überzeugen.
»Schau mal, Jack, so schlimm kann es nicht sein«, sprang Emily ihr schließlich bei. »Wenn Flo wirklich entschlossen ist zu gehen, gibt es absolut schickliche Dinge, die sie tun könnte. Sie könnte Hauslehrerin werden, wie Miss Milford oben im Herrenhaus. Ich glaube nicht, dass sie viel verdient, aber sie lebt in einem schönen Haus und isst mit der Familie. Sie reist sogar mit ihnen.«
»Das wäre wunderbar«, sinnierte Flo, »aber unterrichten liegt mir nicht, sei es als Hauslehrerin oder in einer Schule. Ich habe zwar in der Sonntagsschule Geschichten aus der Bibel gelehrt, und ich habe versucht, den Kindern der Bergarbeiter lesen und schreiben beizubringen, aber ich bin selber nur zur Schule gegangen, bis ich vierzehn war, und habe seitdem kaum ein Buch in der Hand gehabt. Was sollte ich ihnen schon beibringen!«
»Du könntest jemandem den Haushalt führen«, schlug Emily vor.
»O nein«, jammerte Flo. »Eine Bedienstete? Ich hoffe, so tief werde ich nie sinken!«
»Aber das sind wir verheirateten Frauen doch sowieso«, neckte Emily. »Du bräuchtest kein besonderes Wissen, und du würdest dafür bezahlt.« Doch die Panik in Flos Augen schob dieser Option einen Riegel vor.
Dolly hatte bisher schweigend danebengesessen, nun begann sie mit Bedacht: »Ich denke, es wäre die beste Lösung, Krankenschwester zu werden. Du müsstest nicht unbedingt in einem Krankenhaus arbeiten, das ist sehr anstrengend, und vermutlich bräuchtest du eine spezielle Ausbildung. Aber was immer gesucht wird, sind sogenannte Monatskräfte, die sich um Kinder, Kranke, Alte oder Sterbende kümmern – wohlhabende Familien zahlen gern jemanden, der eine Weile bei ihnen wohnt und für sie sorgt. Oder die Betreuung von Frauen bei der Niederkunft und im Wochenbett. Du müsstest nur tun, was der Doktor dir sagt, das ist alles.«
»Das ist eine tolle Idee«, sagte Emily. »Im Pflegen bist du großartig, Flo. Du warst fabelhaft mit unserer Mutter, als sie im Sterben lag.«
Flos Gesicht hatte sich aufgehellt. »Das ist eine wundervolle Idee, Dolly!«, rief sie. »Ich habe ein bisschen erste Hilfe gelernt nach der Schule, und ich habe nicht nur unsere Mutter gepflegt, sondern auch verschiedene Mitglieder von Josiahs Gemeinde, wenn sie krank waren. Das könnte ich tun!«
»Aber was ist mit den Jungen?«, wiederholte Jack. »Du könntest sie nicht mitnehmen.« Flo hatte ihnen noch nicht erzählt, dass sie Godfrey zurücklassen musste. Jeder Gedanke an ihn wollte sie schier zerreißen, es war zu schmerzvoll, darüber zu sprechen.
Die Gruppe schwieg eine Weile, jeder war in seine Gedanken versunken. Es schien keine naheliegende Lösung zu geben.
»Warum bleibt Cyril nicht erst einmal hier?«, bot Emily selbstlos an. »Maddy würde sich freuen, einen Spielkameraden im Haus zu haben, und er könnte hier zur Schule gehen. Wir kümmern uns um ihn, bis du eine bessere Lösung gefunden hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass Martha einverstanden ist, Godfrey fürs Erste zu nehmen.«
»Das ist so nett von dir, Emily.« Flo fiel ein Stein vom Herzen. »Ich bin sicher, uns fällt bald eine langfristige Lösung ein. Auch wenn ich mir so etwas wie ein Internat sicher nie werde leisten können«, fügte sie traurig hinzu.
»Warum gehst du nicht bei Dr. Willoughby vorbei?«, schlug Dolly vor. »Erzähl ihm von deinem Vorhaben und frag, ob er Patienten hat, die Hauspflege benötigen. Die hat er sicher. Und du solltest dir eine Schwesterntracht besorgen, dann siehst du professioneller aus.«
»Das ist eine gute Idee. Wo bekomme ich so etwas?«
»Ich kenne einen Ausstatter in London, der sich auf solche Uniformen spezialisiert hat«, sagte Jack. »Anfang nächster Woche muss ich beruflich in die Stadt, wenn du willst, kannst du mitfahren und besorgen, was du brauchst. Aber ich warne dich, wir fahren im Morgengrauen los, und wir nehmen den Zug.«
»Ausgezeichnet«, rief Flo und rang die Hände vor Freude. »Ich fahre wahnsinnig gern noch mal nach London!«
Am nächsten Tag suchte sie Dr. Willoughby auf. Sie erzählte ihm, sie sei seit kurzem verwitwet und müsse einen Weg finden, Geld zu verdienen. Sie gab vor, jede Menge Erfahrung in der Pflege zu haben. Der gute Doktor war interessiert und sagte, er habe oft Patienten, die jemanden brauchten, der sie rund um die Uhr zu Hause betreute, und da er ihre Schwester und ihren Schwager gut kenne, werde er nicht zögern, sie zu empfehlen. Tatsächlich wisse er im Augenblick von keiner freien Stelle, doch sie solle in ein paar Tagen wiederkommen.
Zurück im Haus, fand sie einen Brief von Josiah. Er hatte zu Recht angenommen, dass sie bei ihrer Schwester untergekommen war.
»Du bist dir zweifellos bewusst, dass du eine unverzeihliche Sünde begangen hast, die dich für alle Zeiten verdammt, in den Augen Gottes wie den meinigen«, schrieb er. »Um jedoch einen Skandal zu vermeiden, der großen Schaden anrichten würde, nicht nur für die Gemeinde, sondern ebenso für unsere Familie und natürlich für mein Amt, schlage ich vor, niemanden über die wahren Gründe unserer Trennung in Kenntnis zu setzen. Ich denke, auf Godfrey, der still und zurückgezogen ist seit dem Vorfall, können wir uns verlassen, er wird kein Wort sagen. Ich vertraue darauf, dass du das Gleiche von Cyril und dir selbst sagen kannst.
Aus demselben Grund habe ich dein ›Ausborgen‹ der Gelder für die Reparaturen an der Kapelle nicht bei der Polizei angezeigt, so schändlich es auch ist. Ich verlange, dass du die Gelder sofort zurückschickst, denn ich habe nicht die Mittel, diesen schrecklichen und beschämenden Verlust auszugleichen.
Du kannst, das versteht sich von selbst, in Zukunft keinerlei finanzielle Unterstützung meinerseits für dich oder deinen Sohn erwarten. Und eine Scheidung, das muss ich wohl kaum hinzufügen, steht außer Frage, das wäre eine Abscheulichkeit in den Augen Gottes.«
Sie hätte nichts anderes erwarten können, das wusste Flo, doch es tat trotzdem weh. Ja, sie würde das Geld zurückzahlen, sobald sie konnte. Aber was für eine Erleichterung, dass auch Josiah die Wahrheit für sich behalten wollte! Das machte ihre Situation ein klein wenig einfacher.
Emily konnte es nicht erwarten, den Inhalt des Briefes zu erfahren. »Er möchte, dass ich sofort zurückkomme«, log Flo und stopfte ihn in ihre Tasche. »Ich muss ihm schreiben, dass ich das nicht tun werde. Aber ich mache mir Sorgen um Godfrey. Josiah sagt, er sei still und zurückgezogen. Das passt überhaupt nicht zu ihm.«
»Ich gehe mal eine Runde durch Brentwood, das wird mich auf andere Gedanken bringen«, sagte Flo am Nachmittag. »Es ist eine Ewigkeit her, seit ich ein paar nette Läden gesehen habe.« Was sie nicht sagte, war, dass es ihr, trotz all ihrer guten Vorsätze, in den Fingern juckte, Gebrauch von dem Geld zu machen, das sie sich geliehen hatte. Ein paar Stunden später kam sie mit einem geheimnisvollen Paket zurück, das sie hinauf in ihr Zimmer brachte.
»Was hast du gekauft?«, fragte Emily.
»Haha, das ist ein Geheimnis«, sagte Flo. »Ich zeige es euch nach dem Abendessen.«
Als sie wie gewöhnlich über ihren Tassen mit Kakao saßen und plauderten, verschwand Flo nach oben. Nach einer Weile hörte man ein Rascheln auf den Stufen, dann betrat sie die Stube, die Arme dramatisch ausgebreitet. »Tra-la!«, deklamierte sie.
Sie war wie verwandelt. Ihr Haar hatte sie toupiert und so aufgetürmt, wie die eleganten Damen es derzeit trugen, mit Locken obenauf und dünnen Kringeln, die ihr Gesicht einrahmten. Sie trug ein wunderschönes apricotfarbenes Kleid mit engem Rock, der vom Knie abwärts leicht ausgestellt war, und einen passenden breitkrempigen Hut. Sie strahlte vor Schönheit. Die Familie war wie vom Donner gerührt.
»Flo«, rief Emily, »du siehst umwerfend aus! Was für ein wunderschönes Kleid.«
»Du siehst aus wie eine Prinzessin«, staunte Dolly.
Jack hatte es die Sprache verschlagen. Er konnte die Augen nicht von ihr abwenden.
»Ich wollte etwas Schickes für London«, sagte Flo. »Jahrelang musste ich schlichte, unelegante Kleidung tragen. Josiah hat immer gesagt, ich dürfe nie besser aussehen als die Frau eines Bergarbeiters – die Wahrheit ist, das hätte ich mir nie leisten können. Ich habe mir immer so sehr etwas Hübsches gewünscht.« Verzückt drehte sie Pirouetten durch das Zimmer. »Oh, es ist so wundervoll, endlich ein schönes Kleid zu haben!«
Als sie einander gute Nacht sagten und sich bereitmachten, ins Bett zu gehen, flüsterte Emily Flo zu: »Das muss ein Vermögen gekostet haben. Es geht mich ja nichts an, aber …«
Josiahs Blechbüchse erschien vor Flos innerem Auge. »Es war nicht teuer. Sie hatten es für eine Dame genäht, deren Mann plötzlich verstorben ist, und dann fand sie es unpassend. Mir hat es perfekt gepasst, und so haben sie es mir für sehr viel weniger verkauft. Und ich verrate dir ein Geheimnis: Seit langem schon habe ich einen Teil des Haushaltsgeldes auf die hohe Kante gelegt.« Sie flunkerte schon wieder. »Immer nur ganz wenig, damit ich etwas hatte für den Tag, an dem ich es nicht mehr aushielt. Ich wusste immer, dass ich es früher oder später brauchen würde. Und keine Sorge, ich habe noch genug, um mir die Schwesterntracht zu kaufen.«
Sie mussten früh aufbrechen, Jack hatte sie vorgewarnt. Im Zug plauderten und scherzten sie. Jack war einer von Flos Bewunderern gewesen, bevor er die bodenständigere Emily heiratete, und Flo musste zugeben, dass die beiden weit besser zusammenpassten. Trotzdem spürte sie, dass er sich immer noch sehr zu ihr hingezogen fühlte.
Er brachte sie sofort zu dem Ausstatter, stellte sie vor und bat den Händler, ihr seine ganze Aufmerksamkeit zu widmen, dann wandte er sich seinen eigenen Terminen zu. In dem Laden gab es alles, was sie sich nur wünschen konnte. Sie entschied sich für zwei blassblaue Kleider mit hohen, weißen gestärkten Kragen, vier weiße Schürzen und einige weiße Häubchen. Sie war hocherfreut, dass das helle Blau und Weiß der Tracht, der leicht geraffte Stoff an den Schultern und die schmal geschnittene Taille ihr außerordentlich schmeichelten, und sie gelobte, sie so oft wie möglich zu tragen. Den letzten Shilling aus Josiahs Büchse gab sie für einen kleinen Lederbeutel aus, in dem sich ein Thermometer, Spritze, Schere, Pinzette und andere nützliche Instrumente befanden.
Mit Jack hatte sie sich für ein Uhr unter der Nelsonsäule verabredet. Sie aßen in einem Café in der Nähe zu Mittag und waren gerade auf dem Weg in Richtung St James's Park, um ein wenig spazieren zu gehen, als sie eine kleine Menschenansammlung bemerkten. Auf Jacks Frage, was los sei, bekamen sie die Auskunft: »Der Kaiser kommt! Der Kaiser besucht die Queen!«
Polizisten tauchten auf, um die Menge von der Fahrbahn zurückzuhalten. Es handelte sich nicht um einen Staatsbesuch, ja nicht einmal um eine offizielle Aufwartung. Kaiser Wilhelm II. war unterwegs nach Osborne House auf der Isle of Wight zu seiner Großmutter Queen Victoria, die im Sterben lag. Das Volk allerdings wusste noch nichts von ihrem Zustand.
Bald näherte sich der Wagen des Kaisers, gezogen von vier glänzend schwarzen Pferden. Zwei oder drei der Umstehenden jubelten ihm zu, ein paar winkten der aufrechten Gestalt mit dem gewaltigen Schnurrbart, der frisch gewachst glänzte und an den Seiten zu zwei aufragenden Spitzen gezwirbelt war, doch der Großteil der Gruppe blieb stumm und machte einen eher ablehnenden Eindruck – Deutschland war dabei, seine Marine in beunruhigender Weise zu verstärken, und nicht wenige hatten Angst, dass sie bald die britische Seemacht bedrohen würde. Trotzdem drängelten die Leute hinter ihr, um besser sehen zu können, Flo wurde vom Gehsteig geschubst und landete fast direkt vor dem Wagen. Kichernd sah sie auf und begegnete dem Blick des Kaisers. Er lächelte, und das nächste Winken der kaiserlichen Hand schien nur ihr zu gelten.
»Hast du das gesehen, Jack? Hast du das gesehen? Der Kaiser hat mir zugewunken! Mir!«
»Absolut, das hat er«, sagte Jack.
»Papa würde sich so freuen – weißt du, dass er Deutscher ist?«