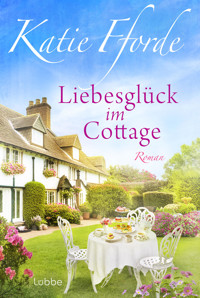5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die schönsten Liebesromane der Bestsellerautorin Katie Fforde
- Sprache: Deutsch
Die 35-jährige Polly wohnt glücklich und zufrieden mit ihrer Katze zusammen. Bei ihrem turbulenten Leben würde eine Beziehung alles nur verkomplizieren, davon ist sie fest überzeugt. Zumindest bis zu dem Tag, an dem ihr der attraktive David begegnet, für den sie ihre Prinzipien glatt noch einmal überdenken würde. Doch auch David scheint einen gut gefüllten Terminkalender zu haben - und zudem schon anderweitig verplant zu sein ...
Das heiter-romantische Debüt von Bestsellerautorin Katie Fforde ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Zum Teufel mit David!" erschienen.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumGewidmet D.S.F fürs LachenDanksagungKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Über dieses Buch
Die 35-jährige Polly wohnt glücklich und zufrieden mit ihrer Katze zusammen. Bei ihrem turbulenten Leben würde eine Beziehung alles nur verkomplizieren, davon ist sie fest überzeugt. Zumindest bis zu dem Tag, an dem ihr der attraktive David begegnet, für den sie ihre Prinzipien glatt noch einmal überdenken würde. Doch auch David scheint einen gut gefüllten Terminkalender zu haben - und zudem schon anderweitig verplant zu sein …
Das heiter-romantische Debüt von Bestsellerautorin Katie Fforde ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel »Zum Teufel mit David!« erschienen.
Über die Autorin
Katie Fforde hat bereits zahlreiche Romane veröffentlicht, die in Großbritannien allesamt Bestseller waren. Ihre romantischen Beziehungsgeschichten werden erfolgreich für die ZDF-Sonntagsserie »Herzkino« verfilmt. Katie Fforde lebt mit ihrem Mann, drei Kindern und verschiedenen Katzen und Hunden in einem idyllisch gelegenen Landhaus in Gloucestershire, England.
Offizielle Website: www.katiefforde.com
Katie Fforde
Eine glückliche Fügung
Roman
Aus dem Englischen von Ursula Walther
beHEARTBEAT
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © by Katie Fforde
Titel der englischen Originalausgabe: »Living dangerously«
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2010/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-4819-4
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Gewidmet D.S.F fürs Lachen
Danksagung
An alles und alle in Mutter Natur, die mich inspiriert haben.
An Alison Moylan, die mir das Töpfern beibrachte. An Nicholas und Maggie Gundry Wines, die mir viel über Weinhändler erzählten. An Radio Gloucestershire, das mir so großzügig Zeit zur Verfügung stellte. An Sarah Molloy, meine Agentin, die mich in ihre Kartei aufgenommen und betreut hat. An Hilary Johnson, Elizabeth Harrison und den Rest von R.N.A. für die vielfältige Unterstützung. An Jane Oxborn, Barbara Gordon-Cumming und Peg Gardner, die mich das Schriftstellern lehrten. An Lynne Coleman, die mir bei den Recherchen geholfen hat. An meine Kinder und Freunde, die hinnahmen, daß ich sie sträflich vernachlässigte, und an meine Katzen, die mir überhaupt keine Hilfe waren, obwohl sie vom Gegenteil überzeugt sind.
Kapitel 1
Polly war überzeugt, daß es auch nichts half, sich ein bißchen Mut anzutrinken, und strich verzagt mit den Fingerspitzen über ihr Wasserglas. Es würde ein gräßlicher Abend werden.
Melissa hatte angekündigt, dafür sterben zu wollen, wenn sie Polly mit einem ganz bestimmten Mann bekannt machen könnte, und sie gleich, nachdem sie den Rem betreten hatte, diskret auf ihn aufmerksam gemacht. Polly beäugte ihn aus den Augenwinkeln, und im Grunde hätte sie Melissa nun ohne Umschweife den Kopf zurechtsetzen müssen. Es bestand für sie nicht die geringste Chance, sich je mit diesem Mann schmücken zu können. Er war zu groß, zu gut gekleidet und durch und durch erwachsen.
Polly war sich bewußt, daß ihr frischgewaschenes, ungewöhnlich arrangiertes Haar nur mühsam der Schwerkraft trotzte und wünschte, sie hätte sich die Zeit genommen, es schneiden zu lassen. Ein Kämmchen war bereits in ihren Ausschnitt gerutscht. Ihre großen grünbraunen Augen waren das Beste an ihr, da sie aber normalerweise eine Anhängerin unverfälschter Mimik war, sahen Kajalstrich und Wimperntusche bei ihr aus wie mit ziemlich schwerer Hand aufgetragen. Das Resultat: lässiger Sexappeal, zwar zu ihrer üppigen Figur und dem kurzen, hautengen Samtkleid passend, aber nicht zu ihrer partymüden Mauerblümchenlaune. Melissas Wundermann würde nur einen Blick auf Polly werfen und die Beine in die Hand nehmen.
Melissa hatte sie zudem unter falschen Voraussetzungen hergelockt. Dies war beileibe kein »gemütlicher Abend mit ein paar Freunden« – mindestens zehn vornehme Paare hatten sich zu diesem luxuriösen gesellschaftlichen Ereignis versammelt. Und wenn man von einem Mädchen bedient wurde – wenn auch von einem kleinen –, dessen weißes Häubchen ständig über seine Augen rutschte und dessen Englisch eher bruchstückhaft als gebrochen war, dann konnte man eine solche Gelegenheit nur als formell bezeichnen. Melissa verdiente es wirklich, daß ihre Kuppelei fehlschlug.
Polly versuchte, Anteil an den Problemen der Frau zu nehmen, die ihr gegenüber saß. Die Ärmste hatte Schwierigkeiten, ihr Kind im richtigen Kindergarten unterzubringen. Sie wirkte umwerfend elegant. Ihr Bouclékostüm hatte die klaren Linien und dezenten Knöpfe, die es, wie selbst Polly wußte, als Designerware auszeichneten. Ihr klotziger Goldschmuck hätte durchaus von Butler and Wilson oder Cartier stammen können, jedes Stück perfekt plaziert und aufeinander abgestimmt. Und jedes schimmernde, mit Packungen und Spülung gepflegte, dunkelbraune Haar auf ihrem Kopf war untadelig gewellt und lag so, wie es von ihm erwartet wurde. Das Make-up blieb unauffällig, aber effektiv – die Frau hatte einfach Stil.
Dennoch offenbarte sie eine geradezu rührende Verletzlichkeit, als sie über ihre Kinder sprach. Wenn man ihr Glauben schenken durfte, dann war Kindererziehung eine hochtechnische, äußerst pannenanfällige Angelegenheit. Praktisch in jedem Stadium konnte die Sache grauenvoll und unwiderruflich schiefgehen.
Es genügte nicht, sie zu lieben, sie warm zu halten, sie zu ernähren und später in eine örtliche Schule zu schicken. Diese primitive Methode war völlig out. Jeder Sprößling, der nicht ein absolutes Genie war, würde bei einer derartigen Behandlung unweigerlich im urzeitlichen Schlamm steckenbleiben und nie Zugang zu einem der angesehenen Berufsstände erhalten. Nein, wenn man heutzutage ein Baby bekam, mußte man in jeder Phase den Spezialisten konsultieren, angefangen vom vorschwangerschaftlichen Diätberater bis zu dem Pauker, der den Nachkömmling in das richtige Oxforder College bugsierte. Ohne diese Expertenhilfe konnte man das Ganze von vornherein vergessen. Der falsche Gynäkologe, ein ungeschickter Anästhesist oder die verkehrte Kindermädchenagentur, und der kleine Sohn und Erbe würde nie sein volles Potential ausschöpfen können. Wenn es dann noch darum ging, die passende Schule zu finden, na ja ...
Polly stieß ein kurzes Dankgebet aus, daß sie es bis jetzt geschafft hatte, sich mütterliche Instinkte zu verkneifen. Sie hätte nicht das Zeug dazu, sich die Unterstützung all dieser fabelhaften Spezialisten zu sichern, könnte sich solche Leute gar nicht leisten und wäre vermutlich nicht einmal in der Lage, sich durch die endlose Namensliste zu quälen.
Oh, warum hatte sie Melissa nicht einfach erklärt, daß sie krank wäre und nicht zu dieser schrecklichen Dinnerparty käme? Weil sie wußte, daß Melissa sie dann mit weiteren Einladungen bombardierte, bis sie schließlich doch nachgeben und annehmen würde. Ihre Freundschaft, die sie leichten Herzens nach der Schule hatten einschlafen lassen, mußte erneuert werden. Und heute war Melissa nicht weniger einschüchternd als mit fünfzehn. Wenn sie sich überhaupt verändert hatte, dann grenzte ihre damalige Herrschsucht heute an eine Art Absolutismus, und Melissa hatte Polly immer schon dazu gebracht, haargenau das zu tun, was sie ihr suggerierte.
Aber auch wenn die Jahre Melissas Charaktereigenschaften verstärkten, bei ihrem Sinn für Stil und Geschmack hatten sie versagt. Die üppige Langeweile in Melissas Salon konnte Pollys depressive Stimmung keineswegs aufhellen – im Gegenteil. Alles sah aus wie in Schöner Wohnen und war unerbittlich in Beige gehalten. Im Bemühen, sich auf keinen Fall eine Entgleisung zu leisten, war es Melissa gelungen, überhaupt keinen eigenen Geschmack vorzuweisen. Zu keinem einzigen Bild, keinem Möbelstück oder Kunstobjekt schien die Hausherrin eine persönliche Beziehung zu haben. Auf diese Weise brauchte Melissa wenigstens keine Angst zu haben, daß ihre Vorlieben kritisiert wurden.
Selbst die bildschöne reinrassige Perserkatze, die hastig aus der Schußlinie gescheucht worden war – »in der kritischen Zeit, wagen wir es nicht, sie aus dem Haus zu lassen. Wir haben einen ausgezeichneten Zuchtkater aufgetan und hoffen auf einen zahlreichen Wurf mit allen Rassemerkmalen« –, sogar dieses edle Tier also hatte man wegen der goldschimmernden Fellfärbung ausgesucht und nicht um seiner Persönlichkeit willen. Es war, als hätte ein Innenarchitekt »Georgianischer Cotswold-Stil« in seinen Computer getippt und alles, was das Elektronenhirn zu diesem Stichwort ausspuckte, unbesehen beherzigt. Die Katze war nur eines der unvermeidlichen Accessoires.
Ein rauhes Lachen erhob sich über das zivilisierte Murmeln. Ein großer Mann im Dinnerjackett ergötzte zwei Damen mit einer Anekdote, die er selbst unglaublich witzig fand. Entweder registrierte er nicht, daß seine Zuhörerinnen nicht in sein Lachen einstimmten, oder es war ihm gleichgültig. Jedenfalls versuchten die beiden Damen die Tatsache, daß sie mit ihren Gedanken meilenweit entfernt waren, höflich zu verstecken.
»Und in welcher Lesestufe ist Freddy jetzt?« Polly mochte kinderlos sein, aber den Jargon kannte sie.
»Nun, seit er in Boreham angefangen hat ...«
Polly fixierte den Blick auf Freddys Mutter. Boreham war offensichtlich ein wichtiger Meilenstein, der Zenit der erzieherischen Einrichtungen für Fünfjährige. Das System kam Polly lächerlich vor, aber da Melissa strahlend, mit gelegentlichem Nicken nach verschiedenen Seiten und geschäftig auf dem Parkett klappernden Absätzen auf sie zukam, setzte sie versuchsweise eine äußerst interessierte Miene auf, um Melissas schauerliche Mission zu unterlaufen.
Doch diese Freundin besaß die volle Energie und Entschlossenheit einer jungen, hübschen Scharfrichterin, und da Polly noch immer von Schüttelfrost geplagt wurde – mit wahrscheinlich mehr als 38,5 Fieber –, war nicht anzunehmen, daß ihr genügend Kraft für eine wie immer geartete Notwehr blieb.
»Polly!« Melissa erreichte ihr angepeiltes Ziel und ergriff ohne Umschweife Pollys Arm. »Louise verzeiht mir bestimmt, wenn dich ihr entziehe. Da ist jemand, den du unbedingt kennenlernen mußt.«
»Melissa, ich fühle mich wirklich nicht ...«
Melissas Griff wurde fester. Ihr steifer Rücken – von einer Spitzenbluse und einem nüchternen BH verhüllt – ermahnte Polly, sich am Riemen zu reißen und sich nicht wie ein Waschlappen aufzuführen.
»Er unterhält sich mit Thalia Bradley«, informierte Melissa sie über die Schulter hinweg. »Sie tut so viel für wohltätige Zwecke.«
Aus der Entfernung hätte man für möglich halten können, daß Thalia Bradleys Wohltätigkeit auf Kosten ehrlich arbeitender Mädchen ging. Doch bei näherem Hinsehen erkannte Polly, daß sie eine richtige Schönheit war und vermutlich auch noch echten Charme hatte. Sie schwebte auf dem schmalen Grat zwischen gutem Geschmack und Sex und schaffte es, beidem gerecht zu werden. Ihr weiches Seidenchiffonkleid war auf eine Art drapiert, die viele Frauen unförmig und fett hätte aussehen lassen, und hatte wahrscheinlich mehr Geld gekostet, als Polly in den letzten fünf Jahren für Klamotten ausgeben konnte. Ihr goldenes Haar wellte sich um ein herzförmiges Gesicht mit winzigem Stupsnäschen und einem Mund, der ebenso sinnliche Schwünge aufwies wie ihr offensichtlich uneingeengter Busen. Der Effekt war schlichtweg umwerfend.
Polly kam abrupt hinter Melissa zum Stillstand wie ein kleines Kind, das von seiner Mutter einer Gruppe neuer Spielkameraden vorgestellt werden sollte; auf keinen Fall würde der Neuankömmling Anschluß finden – nicht, nachdem sich die Mutter eingemischt und die Party gestört hatte.
Thalia hatte die Hand auf den Arm des großen Mannes gelegt und sah ihm flehentlich in die Augen. »Das wirst du doch für mich tun, nicht wahr, David?« Ihre Stimme, honigsüß mit nikotingefärbtem Unterton, war so sexy wie der Rest von ihr.
Er hielt den Kopf nach vorn gebeugt, um jedes faszinierende Wort aufzusaugen, das von ihren wohlgeformten Lippen tropfte. Er würde ihr gar nichts abschlagen, egal wie unvernünftig es auch sein mochte. Er war vollkommen bezaubert, und Polly war sicher, daß nicht einmal Melissa es fertigbrachte, ihm ihre alte Schulfreundin als Gesellschaft aufzudrängen.
Polly unterschätzte die ehemalige Hockeykapitänin von Heathermount. Melissa wartete kaum ab, bis David Thalias drängender Bitte nachgab, ehe sie das Gespräch rüde unterbrach.
»Thalia, Liebes«, verkündete Melissa eine Spur zu scharf, »ich glaube, Hugh sucht dich. Dein Kindermädchen hat gerade angerufen.«
Es fiel Thalia nicht schwer, ihre Fassung zu bewahren. Sie hatte David in der Hand, aber offenbar wußte sie auch, wie sie ihren Bewunderer so in Atem halten konnte, daß er nach mehr lechzte. Sie gestand das Vorhandensein eines Ehemannes, eines Kindermädchens und demzufolge auch von Kindern mit einem zögernden, sinnlichen Lächeln ein, das ihr Verehrer sein Leben lang nicht vergessen würde.
»David!« Unbarmherzig riß Melissa seine Aufmerksamkeit von der scheidenden Thalia, die über den Parkettboden schwebte, als müßte sie das Girl aus Ipanema imitieren. »Das ist Polly Cameron – praktisch meine älteste Freundin.«
Polly zwang ihre Lippen zu einem Lächeln, das nicht ganz bis zu den Augen reichte, und hoffte, daß sie nicht so uralt aussah, wie Melissa sie beschrieben hatte.
»Und, Polly, das ist David Locking-Hill. Er ist schon viel zu lang Witwer. Er war mit Angela, einer wundervollen Frau, verheiratet.«
Warum, überlegte Polly, durfte man immer ganz sicher sein, daß man eine Person, die als »wundervoll« beschrieben wurde, auf gar keinen Fall leiden konnte? Aber wenigstens mußte sie diese wundervolle Angela nicht von Angesicht zu Angesicht verabscheuen.
»Aber, meine Liebe, du bist genau die Richtige, die ihn ein bißchen aufheitern kann«, fuhr Melissa bedeutsam fort, ohne die Tatsache zu berücksichtigen, daß die wohltätige Thalia den gebrochenen Mann bereits ausreichend in gehobene Stimmung gebracht hatte. »In der Schule warst du auch immer so amüsant.«
In der Gewißheit, zwei Menschen auf den Pfad der wahren Liebe geführt – oder ihnen zumindest zu einem erfreulichen Abend verholfen zu haben –, marschierte Melissa davon. Sie nahm ihre Pflichten als Gastgeberin ausgesprochen ernst.
Polly befeuchtete ihre Lippen und zermarterte sich das Gehirn. Aber der von Medikamenten und Fieber gleichermaßen verursachte Nebel verhüllte sogar die Erinnerung an allgemeine Höflichkeitsfloskeln, ganz zu schweigen von den witzigen Geistesblitzen, auf die Melissa angespielt hatte. Offenbar war die Gute der Meinung, Polly könne auf Anhieb und in jeder Lebenslage mit humorigen Bemerkungen aufwarten. Zudem hatte die wohltätige Thalia im ersten Akt einen ganz schönen Brocken vorgelegt, und Polly bezweifelte stark, daß sie im zweiten eine Steigerung für David bewerkstelligen konnte.
»Als Konversationshemmer dürfte diese Vorstellung einen Preis, wahrscheinlich sogar den ersten, gewinnen.« David, den nur seine guten Manieren davon abhielten, Thalia hinterherzuhetzen, packte den Stier bei den Hörnern. »Darf ich Ihnen einen Drink holen?« Er schielte auf Pollys beinahe noch volles Glas. »Nein? Dann sollten wir uns irgendwo hinsetzen.« Man mußte ihm zugute halten, daß sein Seufzer kaum zu hören war.
Einen Augenblick später hockte Polly am Ende einer glatten Chaiselongue und war gezwungen, ihrem unfreiwilligen Begleiter in die Augen zu sehen. Seine Seelenstärke wirkte irgendwie ansteckend.
Er hatte das unnachgiebig gute Aussehen, das die Kolonien über Generationen in Schach gehalten hatte. Unter dichten, flatternden Brauen schimmerten graugrüne Augen, die Polly an einen See im Winter erinnerten – kalt und wenig einladend. Die Adlernase und das kantige Kinn deuteten daraufhin, daß dieser Mann das Leben mit britischer Gelassenheit betrachtete. Ein ziemlich prächtiger Hals, mit einem genau richtig großen Adamsapfel, wuchs aus dem blendenden Kragen des weißen Hemds. Sein Mund wirkte beunruhigend unverbindlich: entweder er hatte überhaupt keinen Sinn für Humor, oder sein Humor war so trocken, so subtil, daß nur echte Intelligenz ihn zum Lachen bringen konnte. Die Krawatte hätte die Farben einer »alten und sehr spartanischen Privatschule« haben müssen, um zum Rest zu passen, sie bewies jedoch mehr den Einfluß von Sir John Harvey-Jones als den von einer Alma Mater.
Polly kam sich vor wie ein zottiges Shetlandpony, das man dazu gebracht hatte, bei einem Rennen am Derby Day einzuspringen, und ihre Chancen, David für die vom Anstand erforderten zehn Minuten zu unterhalten, standen ungefähr so wie die des Ponys, mit einem Siegerkranz davonzukommen. Da sie von Natur aus nicht wettbewerbsfähig war, beschloß sie, sich zurückzulehnen und den Anblick zu genießen.
Etwas an Davids offenkundiger Reinlichkeit war relativ reizvoll. Die meisten ungebundenen Männer, die Polly in die Quere kamen, waren Künstler oder Handwerker. Bärtige Jungs mit Pferdeschwanz und Ohrring, die rechts dachten und links wählten, denen der Geruch von ehrlicher Arbeit und Mühe anhaftete und die ebenso bedrückend sein konnten wie ihre pessimistischen Zukunftsprognosen für diesen gebeutelten Planeten. Offensichtlich konnte man David zutrauen, daß er sich in gemischter Gesellschaft nicht über das Ozonloch ausließ.
»Die Frau, mit der Sie sich vorhin unterhalten haben, ist sehr schön«, sagte Polly schließlich.
»Ausgesprochen schön«, stimmte er zu.
Polly war nicht wirklich überrascht, daß er nicht hinzufügte, Thalia sei dafür ein Schafskopf und dreimal geschieden oder daß ihre Brüste seltsamerweise auch dann noch aufrecht stünden, wenn sie flach auf dem Rücken lag, aber im Grunde war sie dennoch ein wenig enttäuscht. Natürlich war David zu sehr Gentleman, um sich in solchen Gehässigkeiten zu ergehen, und Polly hätte sich eigentlich schämen müssen, weil ihr diese Niedertracht jede weitere Idee für ein anderes Gesprächsthema unmöglich machte. Glücklicherweise war er nicht in gleicher Weise gehandikapt.
»Woher kennen Sie Melissa?« Er schaffte es sogar, aufrichtig interessiert zu klingen – dem Mann gebührte ein Verdienstorden.
Polly trank ein Schlückchen von ihrem lauwarmen Perrier.
»Wir waren zusammen in der Schule und hatten lange überhaupt keinen Kontakt, aber vor kurzem sind wir uns zufällig über den Weg gelaufen.«
»Ach, und wo?«
»Im Supermarkt.« Das war nicht gerade der aufregendste Ort der Welt, aber es entsprach der Wahrheit.
»Oh?«
»Hmm. Wir haben beide nach essigsaurer Tonerde gesucht.« Sie hatte nicht die Energie, die schauerlichen Schreie des Wiedererkennens, die eifrige Suche nach Anzeichen des Alterns im Gesicht der jeweils anderen und den temperamentvollen Austausch der wichtigen persönlichen Ereignisse in den letzten fünfzehn Jahren zu schildern, deshalb setzte sie lahm hinzu »Aber sie hatten dort keine essigsaure Tonerde.«
Davids Blick glitt an seiner gebogenen Nase entlang und auf sie herab. »Wie interessant.«
Nichts in seinem Tonfall und nicht einmal das leiseste Augenbrauen- oder Mundwinkelzucken verriet den Sarkasmus, aber trotzdem konnte Polly ihn unmöglich überhören.
Sie schloß kurz die Augen. Es war vollkommen verständlich – er plante vermutlich, Melissa unter Anklage zu stellen und ihr ein für allemal das Einkaufen in Supermärkten verbieten zu lassen. Und recht hatte er.
Es war genauso wenig seine Schuld, daß sie aufeinander losgehetzt worden waren, wie die ihre. Kein Zweifel, sie war die vorläufig letzte einer langen Reihe von alleinstehenden Frauen, die ihm als zweite Besetzung für die wundervolle Angela angeboten worden waren. Es wäre nur fair, wenn sie ihn wenigstens bis zum Dinner einigermaßen unterhalten würde. Besonders weil man ihn ihretwegen von der Seite der attraktivsten Frau in diesem Raum gerissen hatte.
Sie vollzog vage eine verächtliche Geste mit der Hand. »Eigentlich nicht, aber es war lustig, Melissa wiederzusehen.
Sie hat mir erzählt, daß sie und Sheldon vor einem Jahr von London weggegangen und wieder in diese Gegend gezogen sind. Wir haben unsere Telefonnummern ausgetauscht, und sie sagte, sie würde mich mal zum Essen einladen.«
Polly hatte Melissas Enthusiasmus für eine Freundschaft, die nie mehr als lauwarm gewesen war, ziemlich überrascht. Polly war für Melissas Geschmack immer eine viel zu große Rebellin gewesen, und Melissa hatte sich nach Pollys Ansicht zu gründlich der fröhlichen Hockey-Kameradschaft-Philosophie verschrieben. Melissa war am Boden zerstört, wenn die Schulmannschaft ein Spiel verloren hatte, sie war eines der wenigen Mädchen, die sich die Mühe machten, die Schuluniform korrekt und nach Vorschrift zu tragen, und die tatsächlich all die vielen Dinge besaßen, die zu einer ordentlichen Hockeyausrüstung gehörten. Wahrscheinlich empfand Melissa jetzt Mitleid für Polly, weil sie noch immer unverheiratet und offenbar finanziell nicht besonders gut bestückt war. Sie hatte Polly vermutlich aus reiner Menschenfreundlichkeit eingeladen. Polly war jedoch glücklich, Single zu sein, und zufrieden mit ihrer Mittellosigkeit, und sie wünschte, Melissa hätte sich zurückgehalten.
Außerdem sollte es eine Einladung für ein Essen sein und nicht für ein Bankett. Und Polly, geschwächt von einer scheußlichen Grippe und einer Antibiotika-Kur, war selbst erstaunt über ihr Versprechen gewesen, zu kommen. Als Melissa noch erklärt hatte: »Es gibt da jemanden, den ich dir sehr gern vorstellen würde«, war es bereits zu spät für einen Rückzieher gewesen.
»Und jetzt bin ich hier«, sagte Polly laut.
»Ich verstehe.«
Sie taxierten sich gegenseitig, bis sich der Zwang zur gutbürgerlichen Höflichkeit Bahn brach und David die Konversation wieder anzukurbeln versuchte. »Sie tragen prächtige Perlen.«
Er stieg um ein Grad in Pollys Achtung. Sie hatte eine unbezähmbare Leidenschaft für extravaganten Modeschmuck, und die bombastische Kette mit den riesigen, amethystfarbenen Glasperlen reichte ihr fast bis zur Taille. Die dazu passenden Ohrclips waren so üppig und vulgär wie südafrikanische Trauben.
Da sie sich rechtzeitig daran erinnert hatte, daß Melissa schlichten, aber edlen und echten Schmuck bevorzugte, hatte Polly, nur um ihre Gastgeberin zu ärgern, die Perlen zu ihrem einfachen schwarzen Kleid angelegt. Unglücklicherweise waren die Dinger verdammt schwer – vermutlich war das auch der Grund, warum sie die Vorbesitzerin auf einem Flohmarkt angeboten hatte.
»Danke.« Sie nahm die Perlen in die Hand und hielt sie über ihrem Busen fest, um den Druck auf den Nacken ein wenig zu lindern. »Und woher kennen Sie Melissa?«
»Sie war eine Freundin von Angela. Die beiden haben sich zusammen für karitative Zwecke engagiert.«
»Oh. Für welche karitativen Zwecke?« Hoffentlich ging es um etwas, bei dem Polly mitreden konnte, und nicht um ein Rehabilitationszentrum für pensionierte, betrügerische Vermögensberater oder so was.
»Ich fürchte, das habe ich vergessen.« Es entstand eine Pause, während er überlegte, wie er diese unproduktive Unterhaltung weiterführen konnte. »Arbeiten Sie auch für die Wohltätigkeit, oder haben Sie keine Zeit für derlei Dinge?«
Polly dachte über ihre Antwort nach. Sie verbrachte ganz sicher einen großen Teil ihrer knapp bemessenen Freizeit damit, unentgeltlich zu arbeiten, aber sie glaubte eigentlich nicht, daß ihr Kampf um die Erhaltung der halben Laureton High Street als »karitative Arbeit« durchging. Etwas an ihrem Gesprächspartner ließ sie vermuten, daß er in diesem kontroversen Fall nicht unbedingt auf ihrer Seite stehen würde, deshalb beschloß sie, die Sache lieber nicht zu erwähnen.
Sie lächelte verbindlich. »Ich unterstütze so viele Wohltätigkeitsinitiativen, wie ich kann. Oxfam, Kinderschutzbund, Altenhilfe ...«
Ein vager Eindruck verriet ihr, daß sie durchschaut wurde und daß David Locking-Hill nicht annahm, sie würde von Komitee zu Komitee hetzen und jede freie Minute damit verbringen, Lose für irgendwelche Tombolas zu verkaufen. »Sie meinen, Sie kaufen ihre Weihnachtskarten?«
»Bestimmt nicht. Meine Weihnachtskarten mache ich jedes Jahr selbst.«
Er gestattete sich, sie überrascht anzusehen. »Oh, das ist sehr ... geschäftstüchtig.«
Selbst in ihrem geschwächten Zustand konnte es sich Polly nicht verkneifen, ihn ein wenig auf den Arm zu nehmen. »Ja, es ist erstaunlich, was man alles mit selbstklebenden Sternen und Goldfolie zustande bringen kann.«
Sie wurde mit einem so wohlkontrollierten Schaudern belohnt, daß ein weniger aufmerksamer Mensch als sie es glatt übersehen hätte.
»Das ganze Geheimnis ist«, fuhr sie unbeirrt fort, »daß man sich die Umschläge zuerst besorgt, sonst findet man nie die passenden. Ich erwähne das nur für den Fall, daß Sie vorhaben, im nächsten Jahr Ihre Karten auch selbst zu basteln.«
»Ich werde es mir merken. Vielen Dank.« Er besaß Selbstbeherrschung und antwortete ihr vollkommen ernst – nicht einmal seine Nasenflügel bebten dabei.
Mit dem Gefühl, endlich die Oberhand in diesem Gespräch gewonnen zu haben, bohrte sie weiter: »Tun Sie viel für karitative Zwecke?«
Er nickte. »Zumindest lege ich Wert darauf, jeden Tag einen mildtätigen Gedanken zu haben.«
»Oh, über irgend jemanden speziell?«
»Ja. Heute abend zum Beispiel strenge ich mich sehr an, nett von Melissa zu denken.«
Polly hatte ihre Fehler, aber sie war bestimmt nicht schwer von Begriff. »Eine Menge Frauen wären beleidigt wegen dieser Bemerkung«, erwiderte sie vergnügt, um deutlich zu machen, daß sie nicht zu der empfindlichen Sorte gehörte.
»Tatsächlich? Warum?«
»Weil eine solche Bemerkung darauf hindeutet, daß Sie böse mit Melissa sind wegen der Unterbrechung Ihrer Konversation mit ...« sie suchte nach dem Namen, »... mit dieser schönen Frau – Thalia, nicht wahr?«
»Wirklich?«
»Natürlich, und Sie waren ärgerlich, stimmt’s?«
»Meine liebe Polly – ich darf Sie doch Polly nennen?«
»Das ist mein Name. Andererseits bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich ›Ihre Liebe‹ bin.«
»Was ich sagen wollte ...« Als perfekter Kavalier ignorierte er ihre Entgleisung in den Feminismus. »Wenn ich mich über die Unterbrechung geärgert hätte, würde ich es Ihnen sicherlich nicht sagen.«
Polly kicherte. »Das ist auch gar nicht nötig. Ihre Körpersprache spricht Bände. Aber verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin nicht im mindesten gekränkt. Ich bemühe mich selbst, mildtätige Gedanken aufzubringen.«
»Ach, und warum?«
»Weil Melissa mich von einer äußerst interessanten Diskussion über Kindererziehung weggezerrt hat, um mich Ihnen vorzustellen.«
David Locking-Hill kam mit einer geschmeidigen Bewegung auf die Füße. »Und das heißt ...« Es blieb ihm erspart, den Satz zu beenden, weil das Mädchen mit schriller, unsicherer Stimme ankündigte: »Das Dinner wird serviert!«
Polly lächelte. »Perfektes Timing.«
David musterte sie von oben herab und bot ihr seinen Arm an.
Polly, darauf bedacht, ihm nicht noch mehr zuzusetzen, erhob sich ebenfalls und hakte sich leicht unter.
Kapitel 2
David erledigte seinen Part der Zeremonie mit unbeteiligter Effizienz. Er führte Polly an ihren Platz, legte seine Hand an genau der richtigen Stelle unter ihren Ellbogen und zog ihr exakt zum passenden Zeitpunkt den Stuhl zurecht. Bei ihm konnte man ganz sicher sein, daß er niemals wild in der Luft herumfuchteln würde, während er einem in den Mantel half. Seine Manieren waren untadelig. Aber Polly war nicht im mindesten überrascht, daß er Melissa erlaubte, seine Aufmerksamkeit für sich zu beanspruchen, und sie selbst allein ließ, damit sie ihre Umgebung mit ungläubiger Ehrfurcht in sich aufnehmen konnte.
Jetzt verstand sie, warum sich Melissa scheute, kleine, intime Dinners zu veranstalten. Es wäre einfacher, in einer Schulkantine eine behagliche Atmosphäre zu schaffen. Melissas Eßtisch blitzte und blinkte und war so riesig, daß er auch als Eishockeyfeld hätte durchgehen können – bestens geeignet für langweilige Winterabende.
Doch trotz seiner Größe war nur wenig von der polierten Mahagoniplatte zu sehen. Melissa hatte es fertiggebracht, den Tisch mit so vielen Kandelabern, Weinkühlern, Konfektschalen, Blumenarrangements, Bestecken und Gläsern zu schmücken, daß ein kleineres Hotel vor Neid erblassen würde. Jedes einzelne Gedeck war mit genügend Messern, Gabeln und Löffeln ausgestattet, daß eine Durchschnittsfamilie ihren kompletten Bedarf damit hätte decken können. Und nur ein Schluck aus jedem der Gläser, die neben den Gedecken aufgereiht waren, hätte die meisten Menschen in sinnlose Trunkenheit gestürzt – von der für Autofahrer zulässigen Alkoholmenge ganz zu schweigen. Melissa mußte wohl Thomas Goodes beste Kundin sein.
Nach einer etwas genaueren, diskreten Inspektion entdeckte Polly jedoch, daß der Tisch Ausziehplatten hatte und wahrscheinlich ohne große Schwierigkeiten auf die halbe Größe reduziert werden konnte. Also bestand eigentlich kein zwingender Grund für Melissa, eine Gesellschaft in so großem Stil zu geben – wenn man einmal davon absah, daß es nicht Melissas Art war, Dinge zu verkleinern. Polly erinnerte sich daran, schon während ihrer Schulzeit Bekanntschaft mit dieser Eigenart gemacht zu haben. Wenn sich Melissa je einen so gewöhnlichen Gedanken gestattet hätte, dann hätte sie »Gib mit allem an, was du hast« zu ihrem Motto erkoren. Sie hatte seinerzeit von allen Schülerinnen das am besten ausgestattete Federmäppchen, den glänzendsten Lederranzen, die teuerste Garnitur mit Haarbürste, Handspiegel und Kamm sowie dazu passendem »Manikürtäschchen« besessen und auch sichergestellt, daß jeder ihre Kostbarkeiten gebührend zur Kenntnis nahm. Ihr Licht unter den Scheffel zu stellen – oder ihren verschwenderisch gefüllten Geldbeutel vor den neugierigen Augen anderer zu verstecken – war für sie gleichbedeutend mit Zweckentfremdung.
Offenbar hatte sich Melissa seit jenen Tagen nur wenig verändert. Ihre Gläser waren samt und sonders aus Kristall und tadellos poliert, aber für Pollys Geschmack viel zu protzig, das Silber geschmacklos und zu reich verziert und die Blumenarrangements so mächtig, daß man sich unmöglich quer über den Tisch unterhalten konnte.
Ein Blick auf die Versammlung von schönen Frauen und wohlhabend aussehenden Männer verriet Polly, daß Melissa immer noch größten Wert darauf legte, sich die Leute zu Freunden zu machen, die sie für die »richtigen« hielt. Damals in der Schule hatte Polly Melissas Eifer, sich bei gewissen Mädchen lieb Kind zu machen und damit ihren gesellschaftlichen Aufstieg zu sichern, gar nicht so sehr bemerkt. Erst jetzt, als sie daran zurückdachte, registrierte sie, daß diese Mädchen entweder Eltern mit eindrucksvolle Titeln gehabt hatten oder selbst adelig gewesen waren.
Sie erinnerte sich düster an bissige Seitenhiebe auf Menschen, die »nach Geschäften rochen«, und daran, wie sehr sich Melissa über diese Anspielungen aufgeregt hatte. Damals hatte Polly nie verstanden, worum es überhaupt ging – sie fand, daß Geschäfte und Läden himmlisch rochen, nach geröstetem Kaffee, frisch gebackenem Brot oder anderen verführerischen Düften. Nur beim Eisenwarenhändler, der auch abgewogenes Knochenmehl verkaufte, stank es meistens fürchterlich.
Der glücklichste Tag in Melissas Schulzeit war der gewesen, an dem ihr Vater in den Ritterstand erhoben wurde und sein Name zu Neujahr auf der Ehrenliste erschien. »Ihre Mutter ist jetzt endlich eine Lady«, kommentierte ein scharfzüngiges Nymphchen die Vorgänge. – »Das ist mehr, als man von deiner behaupten kann, meine Liebe«, erwiderte ein anderes.
Polly ließ ihren Blick zur anderen Seite des Tisches schweifen. Sheldon, Melissas Mann, bewunderte Thalia in unangenehm auffallender Weise.
Polly fragte sich, warum Melissa diesen Menschen geheiratet hatte. Hatte sie ihre Hoffnungen auf einen eigenen Titel aufgegeben und sich mit dem »schlichten« Zutritt zu Debrett zufriedengegeben? Bestimmt konnte ihr Sheldon das bieten, ansonsten gab es kaum etwas, das zu seinen Gunsten sprach. Sein Hals quoll über den Hemdkragen, er hatte dicke, fleischige Hände, und es schien, als müßte er eine Frau nur ansehen, um vor Gier nach ihr ins Geifern zu geraten.
Über Geschmack ließ sich natürlich nicht streiten, möglicherweise hatte er ihr Herz im Sturm erobert. In jüngeren Jahren war er vielleicht auf forsche Weise charmant gewesen, oder er hatte eine Nase für die lukrative Chance gehabt. Melissa war eine großartige Partie – das einzige Kind eines reichen Vaters und eine Frau, die versessen auf erfolgreiche Männer war und ihren eigenen Mann zu Ruhm und Berühmtheit anspornen würde. Möglich, daß er sich, was den Erwerb eines Titels betraf, ebenso auf sie verließ, wie sich ihre Mutter auf ihren Vater verlassen hatte.
Welchen Grund es auch für diese Heirat gegeben haben mochte, Polly hoffte, daß sie Melissa Glück gebracht hatte. Melissa war schon immer außergewöhnlich herrschsüchtig und tyrannisch gewesen – offensichtlich hatte sie diese Eigenschaft bis heute noch nicht abgelegt –, aber sie konnte auch auf ihre Weise liebenswürdig und nett sein. Sie hatte etwas Besseres verdient als einen Mitgiftjäger. Einmal, als Polly im Internat wegen eines hartnäckigen Hustens auf die Krankenstation verbannt worden war, hatte Melissa umgehend ihre Mutter angerufen und veranlaßt, daß sie Polly ihre ganze Sammlung von Georgette Heyer-Büchern zuschickte. Polly hatte nie vergessen, wie groß ihre Freude gewesen war, weil sie endlich einmal genug zu lesen gehabt hatte.
»Guten Tag. Ich bin Hugh Bradley.« Die volltönende Stimme drängte sich in ihre Reminiszenzen, und ein langer Arm kam über den weiten Raum vom Nebenplatz auf sie zu, bis sie sich entschloß, ihm auf halbem Weg entgegenzukommen und ihm ihre Hand zu reichen.
»Polly Cameron.« Verstohlen rieb sie sich die Finger der rechten Hand.
»Ist Ihre bessere Hälfte auch hier?«
Polly richtete ihr Besteck neu aus und riß die riesige gefaltete Leinenserviette auf. »Nein, ich habe keine bessere Hälfte.«
»Geschieden, verwitwet oder in einem eheähnlichen Verhältnis lebend?«
Wollte er wissen, ob sie noch zu haben war, oder nur eine Unterhaltung in Gang bringen?
»Nein. Ich bin Single. Ist Ihre Frau hier?«
Sie lächelte herzlich, wohl wissend, daß er elastisch dehnbare Arme und Beine haben müßte, wenn er ihr Knie tätscheln oder Spielchen mit den Füßen treiben wollte.
Hugh nickte und deutete mit dem Kopf zum anderen Ende des Tisches. »Thalia – sie sitzt neben Sheldon.«
»Oh.« Polly wartete darauf, daß er die Partie mit einem neuen Eröffnungszug noch einmal beginnen würde.
»Und was tun Sie beruflich?« versuchte er es prompt.
Ihre massigen Ohrclips machten sich schmerzhaft bemerkbar. Polly nahm sie unauffällig ab, während sie darüber nachdachte, welche der vielen möglichen Antworten Hugh am besten gefallen würde. »Ich bin Kellnerin«, wäre zu ungeschliffen und würde die anderen Aspekte ihrer beruflichen Pflichten wie Tellerwaschen und ähnliches nicht berücksichtigen. »Ich kreiere Salate«, würde zu viele Erklärungen nötig machen. Es wäre hübsch, wenn sie sich als Töpferin bezeichnen könnte, aber das würde sie erst tun, wenn sie sich ihren Lebensunterhalt damit verdiente. »Ich arbeite in einem Vollwertkostcafé«, sagte sie und entschied sich damit für das Unkomplizierte. »Und was machen Sie?«
Bevor ihr Hugh davon erzählen konnte, wurden sie von dem Mädchen unterbrochen. Das arme Ding schwankte und taumelte unter dem Gewicht der riesigen aufeinander gestapelten Suppenteller. Sie stellte einen auf jeden Platz, und Polly machte eine erstaunliche Entdeckung – die Teller waren kalt. Ein anderes Mädchen, möglicherweise die Zwillingsschwester des ersten, folgte mit der vollen Terrine die sie mit waghalsigen Manövern über die eingezogenen Schultern der Gäste hievte.
Polly beobachtete ängstlich, ob nicht doch ein Tropfen daneben ging oder sogar – der Himmel möge es verhüten – eine ganze Ladung Suppe überschwappte und in einem einzigen Augenblick die mehrere hundert Pfund werte, von geübter Schneiderhand geschaffene Eleganz ruiniert wurde. Glücklicherweise erwies sich das Mädchen, obwohl winzigklein, als eine sehr akkurate Schöpfkünstlerin. Nachdem endlich alle bedient waren und Melissa die Leute aufforderte, »kräftig zuzugreifen«, war die Suppe ebenso kalt wie die Teller.
Hugh, der vollkommen vergaß, daß er Polly eigentlich mit seiner Lebensgeschichte beglücken wollte, schaufelte eine gehörige Prise Salz in seine Bouillon mit Eiersticheinlage und getrockneter Petersilie und schlürfte sie im Nu in sich hinein.
Polly war beeindruckt. Neben ihr saß ein Mann, der sich nicht um die Feinheiten der Etikette kümmerte und offenbar einen herzhaften Appetit hatte. »Möchten Sie meine Suppe auch noch haben?« fragte sie ihn. »Ich bin nicht sehr hungrig.«
»Und ich komme fast um vor Hunger«, gestand Hugh. Sie vergewisserten sich beide, daß Melissa, die ihren Suppenlöffel geziert von sich spreizte, zu sehr in ein Gespräch vertieft war, um ihre Transaktion zu bemerken. Dann tauschten sie die Teller. Hugh vernichtete Pollys Suppe mit derselben Geschwindigkeit wie seine eigene. »Ich war den ganzen Tag auf dem Golfplatz«, erklärte er.
»Golf?« Was könnte sie wohl zum Thema Golf beisteuern? Gar nichts. »Und was, sagten Sie, tun Sie beruflich?«
Hugh, dem es offenbar auf der Seele brannte, endlich jemandem zu erzählen, welche Probleme er gehabt hatte, einen Ball aus dem Bunker zu bekommen, und sich dieser Möglichkeit durch Pollys Frage schnöde beraubt sah, wurde wesentlich zurückhaltender.
»Oh, ein bißchen dies, ein bißchen das. Grundsätzlich könnte man wohl sagen, ich kümmere dich um mein Vermögen.«
Polly brachte in exakt dem richtigen fragenden Tonfall ein »Oh?« zustande.
»Ja.« Hugh kratzte hoffnungsvoll mit dem Löffel über seinen leeren Teller. »Im Moment habe ich ein ganz ordentliches kleines Geschäft mit Immobilien in Laureton vor. Kennen Sie Laureton?«
»Ja.« Polly kannte es in der Tat. Sie wohnte in Laureton und liebte es.
»Dann wissen Sie vermutlich auch, daß es dort eine Häuserzeile mit Geschäften gibt, die vor kurzem eingerüstet worden sind. Eine Menge Flugblätter wurden wegen dieser Straße verteilt.«
Kaum jemand wußte besser darüber Bescheid. Sie ging jeden Tag durch diese Straße und dachte sehr oft an die hübschen alten Häuser. Sie stützte den Ellbogen auf den Tisch und nahm die schwere Glasperlenkette in die Hand. »Ja.«
»Ich glaube, ich kann Ihnen versprechen, daß diese Gegend bald um einiges attraktiver wird. Sehr viel attraktiver.«
»Oh?« Das waren unheilvolle Neuigkeiten. Bis jetzt hatte die Gemeinde noch keinen Käufer für die Häuser gefunden, und während sie nach einem Interessenten suchte, bemühte sich die Laureton-Aktionsgruppe verzweifelt, Geld zu sammeln, um die Häuser selbst kaufen und erhalten zu können.
»Dann haben Sie die Gebäude also schon erworben?« erkundigte sich Polly.
Hugh zwinkerte ihr zu und tippte sich mit der Fingerspitze an die Nase, ohne Farbe zu bekennen. Augenscheinlich war er hocherfreut, daß er ihre Neugier geweckt hatte und sie im Ungewissen lassen konnte. Polly hätte ihm am liebsten eine Ohrfeige oder einen Tritt gegen das Schienbein versetzt. Da beides sowohl aus Gründen des Anstands Melissa gegenüber als auch wegen der relativ großen Entfernung zwischen ihr und ihrem Tischnachbarn nicht möglich war, verfiel Polly in würdevolles Schweigen.
Die Mädchen sammelten die Suppenteller ein und stapelten sie gekonnt auf ihre Unterarme. Polly, deren Nerven bis zum Zerreißen angespannt waren, sehnte sich danach, ihnen helfen zu können, zum Teil, um Melissas Porzellan zu retten, zum Teil, weil sie sich auf der anderen Seite der grün tapezierten Tür wesentlich wohler und mehr zu Hause gefühlt hätte als an diesem Tisch. Sie hatte schon eine ganze Menge Jobs gehabt – die meisten im Gastronomiegewerbe –, und Melissas Personal würde es ganz sicher nichts schaden, ein wenig auf Vordermann gebracht zu werden.
Das Essen zog sich endlos hin. Polly nahm ihre Perlenkette ab und verstaute sie in der Handtasche. Sie kam sich vor, als befände sie sich in einer Art gesellschaftlichem Disney Land, in einem Themenpark. Nur war diese Szenerie für alle anderen äußerst real – lediglich sie, die Außenseiterin, fand die ganze Angelegenheit einfach lächerlich. Hugh widmete sich, nachdem er sich Pollys Hühnchen in heller Sauce und ihr vitaminfreies Gemüse einverleibt hatte, der zugänglicheren Zuhörerin zu seiner Rechten und wurde die Geschichte über seinen Abschlag aus dem Bunker doch noch los. Ein eigenartiger Instinkt verriet David, daß er ab jetzt für Pollys Unterhaltung zuständig war, und er schenkte ihr ein überraschend warmherziges Lächeln.
»Spielen Sie auch Golf?« fragte sie ihn.
Er schüttelte den Kopf.
Das war ein Plus. »Was spielen Sie dann? Ich meine, was tun Sie, um sich fit zu halten?«
David zuckte mit den Schultern. »Ich hab’ nicht viel Zeit, für meine Fitneß zu sorgen, dafür halte ich mich ständig geschäftlich auf Trab.«
»Und womit?«
»Ich bin Weinhändler.«
»Macht das großen Spaß?«
Anscheinend war David daran gewöhnte seine Empfindungen hinter einer Fassade von guten Manieren zu verbergen, aber die Fassade geriet ins Wanken. »Nicht immer.«
»Ach.« Polly war enttäuscht. »Dann stimmt es also gar nicht, daß die frisch geteerten Fässer so gut riechen und daß man in alten Gummistiefeln durch die Landschaft schreitet?«
Er schüttelte den Kopf. »Sie verwechseln das, was ich tue, mit dem, was ein Fernsehdokumentator erzählt, wenn er über Wein redet. Ich verkaufe ihn nur.«
»Aber eigentlich ist es doch ganz vergnüglich, oder? Sie könnten immerhin auch medizinische Hilfsmittel oder chemische Toiletten oder etwas ähnlich Langweiliges verkaufen, das wäre schlimmer.«
Er nickte gewichtig, und Polly gewann den vagen Eindruck, daß er vielleicht doch ein bißchen Humor hatte. »Das könnte ich. Und was machen Sie so?«
Ich sollte mir wirklich eine geeignete Antwort für diese Frage ausdenken, überlegte Polly. Etwas Umwerfendes, was das Thema mit einem einzigen knappen Satz beendete und ihr die Möglichkeit gab, erhobenen Hauptes eine Situation wie diese zu meistern. Polly haßte es, über sich selbst zu sprechen, und ganz besonders scheußlich war es für sie, mit Leuten, die nicht die geringste Ahnung hatten, was es hieß, in einer Küche zu arbeiten, über ihren Job zu reden. Von ihrer Töpferei erzählte sie nur den Menschen, die sie gut kannte oder die selbst Künstler waren und sie verstehen konnten.
»Nichts Aufregendes«, erwiderte sie. »Oh, sehen Sie, da kommt der Nachtisch.«
Es gab eine blasse, von einem knallrotem Sahne-Gemisch umgebene Mousse. Ganz sicher hatte das Dessert auf dem Foto in der Gourmet-Zeitschrift großartig ausgesehen, aber augenscheinlich war die Umsetzung des Rezepts nicht ganz gelungen.
»Meine liebe Consuela.« Melissas Ton war so sauer wie die pürierten Erdbeeren. »Ich dachte, ich hätte genau erklärt, daß man Sahnehäubchen auf das Erdbeermark setzt. Erinnerst du dich? Es sollte genauso aussehen wie auf dem Bild.«
Consuela hatte offenbar ihre eigenen Mittel, sich zur Wehr zu setzen. Sie knickste und piepste: »Ja, Madam.«
Melissa beugte sich um ihren Tischherrn zur Linken herum und beschwerte sich bei Thalia darüber, daß es heutzutage unmöglich war, anständiges Personal zu bekommen. Da die Zwischenräume zwischen den einzelnen Plätzen ziemlich groß waren, mußten Consuela und ihre Schwester die Klagen der Hausherrin zwangsläufig mitbekommen. Polly wand sich vor Verlegenheit, nahm ihren Löffel in die Hand und rückte ihrer Mousse zu Leibe.
Sie überlegte gerade, ob sie Hugh vielleicht irgendwie dazu bringen könnte, ihr seine Pläne für die Geschäftszeile zu verraten, als sie merkte, daß David sie auf sich aufmerksam zu machen versuchte.
»Verzeihung, was sagten Sie? Ich war ganz in Gedanken.«
»Ich sagte, daß Melissa Ihnen ein Zeichen gibt.«
Polly warf einen Blick auf Melissa, die mit Thalia sprach, dann sah sie David wieder an. »Wirklich?«
Er nickte. »Sie möchte, daß Sie sich zurückziehen.«
Polly fühlte sich wie eine Schauspielerin in einem Theaterstück, die ihren Text vergessen hatte. »Ich? Warum? Was hab’ ich falsch gemacht? Hat Melissa gesehen, daß ich Hugh mein Dinner überlassen habe?«
Sie mußte endlich etwas Komisches gesagt haben, denn David grinste. »Nicht nur Sie sollen sich zurückziehen, sondern alle anwesenden Damen.«
Das Wort »Damen« wirkte wie eine Alarmglocke. »Sie meinen doch nicht ...? Nein, das kann nicht wahr sein!«
David nickte wieder. »Ich fürchte, Melissa hat vor, die Herren ihrem Portwein zu überlassen, damit ihr Mädchen in Ruhe den neuesten Klatsch austauschen könnt.« Er rührte nicht einen Muskel, während er auf die Explosion wartete.
Polly blieb reglos sitzen. Wut, Entrüstung und schlichte Ungläubigkeit ballte sich in einer Blase zusammen, die unweigerlich platzen mußte. Aber irgendwie gelang es ihr doch, ihre Empfindungen zu unterdrücken. Sie hatte nicht genügend Elan, eine Szene zu machen, und falls Melissa dringend eine Aufklärung brauchte, dann war dies bestimmt weder der rechte Zeitpunkt noch der geeignete Ort dafür.
Sie betrachtete David, als wäre er allein an dieser unmöglichen Situation schuld. Seine ernste Miene wirkte wie eine Verhöhnung ihres stummen Protestes. Für einen kurzen Moment erhaschte sie einen Blick auf das, was hinter diesem gut geschnittenen Anzug und den geschliffenen Umgangsformen steckte – sie entdeckte einen Mann, der ihr gefallen könnte. Aber als sie noch einmal hinsah, war dieser Eindruck wie weggewischt. Die Maske der Respektabilität senkte sich über das, was auch immer Polly erkannt zu haben glaubte, und verbarg es, als wäre es nie vorhanden gewesen.
Enttäuschung regte sich in Polly, und als sie merkte, was mit ihr los war, lachte sie im stillen. Tat Melissas Versuch, sie zu verkuppeln, doch seine Wirkung? Oder war sie einfach noch nicht bereit, sich in eine exzentrische alte Lady zu verwandeln, die nur Katzen zur Gesellschaft hatte? Weshalb sonst sollte sie sich, um Himmels willen, einbilden, daß an David mehr dran war als ein perfekt gebügeltes Hemd und eine ordentlich gebundene Krawatte?
Rasch musterte sie nacheinander die anderen Männer in der Runde, um herauszufinden, ob irgendeiner ihre Jungfernseele anrührte. Aber nein – sie bestätigten lediglich ihre Überzeugung, daß ein Singledasein die beste aller Möglichkeiten war. Der letzte Funke einer längst erstickten Flamme – einer Flamme, die niemals richtig stark gelodert hatte – war kurz aufgeflackert, ehe er für immer erstarb.
Nachdenklich ordnete Polly ihre Ansammlung von unbenutzten Gläsern neu, aber nicht einmal eine zusammenpassende Serie von Wasserkelchen – mit Sicherheit ein Hochzeitsgeschenk – stellte eine ausreichende Verlockung für eine Heirat dar.
»Aber bevor Sie gehen –« nahm David das Gespräch wieder auf.
»Ja?«
»Was genau tun Sie mit solcher Begeisterung für Oxfam, für den Kinderschutzbund und die Altenhilfe?«
Sie würde diesen Menschen nie wiedersehen – es spielte wirklich keine Rolle, ob sie ihn mit ihrer Erwiderung in Verlegenheit brachte. Er war selbst schuld, wenn er so persönliche Fragen stellte.
Sie lächelte honigsüß. »Was meinen Sie, wo ich meine Klamotten kaufe?«
Mach daraus, was du willst, dachte sie. Melissas Blick fixierte sie eingehend. Polly erhob sich wie alle anderen weiblichen Mitglieder der Gesellschaft und folgte ihnen aus dem Zimmer.
Wie ein Mann stapften sie die Treppe hinauf, vermutlich um ihre Erscheinung nach der strapaziösen Mahlzeit zu restaurieren, obwohl bei keiner auch nur ein Härchen in Unordnung geraten zu sein schien. Die Reihe der »kleinen« Jean Muris, Caroline Charles und Ronald Kleins sah so umwerfend aus wie vorher auch. Doch Melissa hatte es immer schon fertiggebracht, den Leuten das Gefühl zu geben, daß die Frisuren einen Kamm gebrauchen könnten und Söckchen hochgezogen werden müßten, und diese Frauen gehörten offensichtlich auch zu ihren Opfern.
Polly verspürte nicht die geringste Lust sich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, daß ihre Wimperntusche auf die Wangen gerutscht oder ihr Haararrangemant aus den Fugen geraten war. Die Entdeckung, daß sie – wahrscheinlich schon seit zwei Stunden – aussah, als hätte sie sich wacker in einem Handgemenge geschlagen, wäre ein Schock gewesen, und den wollte sie lieber vermeiden. In solchen Fällen war es hilfreich daß sie immer ihr Haar bürstete und mit einem Tüchlein ihre unteren Augenlider abwischte, bevor sie sich vor einen Spiegel stellte.
Polly hatte sich eigentlich vorgenommen, Melissa unmißverständlich klarzumachen, wie sie über ihre antiquierten Vorstellungen von Gastfreundschaft dachte. Wenn sie es nicht selbst erlebt hätte, wäre ihr nie in den Sinn gekommen, daß es immer noch Menschen gab, die Männer und Frauen auf diese überkommene, sexistische Weise voneinander trennten. Es wurde höchste Zeit, daß sich Melissa und ihre Freunde an das Leben im zwanzigsten Jahrhundert anpaßten.
Aber angenommen sie wollten das gar nicht? Polly könnte genausogut an den ganzen harten Kern der Antifeministinnen geraten sein. Vielleicht fielen sie schon nach dem ersten Wort der Kritik über sie her, hielten sie auf dem Bett fest, lackierten ihr die Fußnägel oder quälten sie so lange, bis sie eingestand, daß die Suche nach einem Ehemann die einzige passende Karriere für eine echte Frau sei. Sie schauderte. Nein, wenn sie tatsächlich der Meinung waren, daß Portwein nicht in gemischter Gesellschaft getrunken werden durfte, wieso sollte dann ausgerechnet sie, Polly, diese Leute vom Gegenteil überzeugen?
Eine Perserkatze huschte aus Melissas Schlafzimmer, als Polly dort ankam. Offenbar hatte das Tier sich verbotenerweise in diesem Raum für ein Nickerchen gemütlich gemacht, und jetzt klebten an irgendeinem Mantel verwerfliche Katzenhaare.
»Oh, das ist meiner.« Polly sah, daß ihr Mantel voller Entsetzen hochgehoben wurde, und erkannte auf den ersten Blick, daß die vielen Haare von ihrer eigenen Katze stammten. »Das macht nichts, wirklich nicht.«
»O doch, das macht sehr wohl etwas«, widersprach Melissa.
»Sie weiß genau, daß sie nicht hier herauf darf. Ich sage den Mädchen, daß sie den Mantel ausbürsten sollen.«
»Unsinn«, versetzte Polly entschieden und befreite ihren Mantel aus Melissas manikürtem Griff. »Die Mädchen haben genügend anderes zu tun. Ich mach’ das selbst.« Und dann gehe ich sofort nach Hause, fügte sie im stillen hinzu. Wieso ist mir das nicht schon früher eingefallen?
Die Frauen beobachteten sie erstaunt.
»Habt ihr alle Polly schon kennengelernt?« erkundigte sich Melissa, die sich plötzlich fragte, ob es eine so gute Idee gewesen war, Polly überhaupt einzuladen. »Polly und ich waren zusammen in der Schule. Ganz anders als ich, hat sie es geschafft, unverheiratet zu bleiben.«
Die Frauen nickten und lächelten – sie waren mit Melissa der Meinung, daß es ein Unglück war, Single zu sein.
»Wie klug«, sagte eine. »Männer sind so anstrengend, ganz zu schweigen von Kindern. Man hat nie eine Minute für sich, weil man alles für sie organisieren muß.«
»Ja«, stimmte Thalia eifrig zu. »Eine Ehe ist ein Full-Time-Job.«
Polly rang sich ein Lächeln ab. Aber sie verkniff sich die Frage, was geschah, wann Thalias Job ein jähes Ende fand – wenn ihre Kinder aus dem Haus gingen, der geldscheffelnde Immobilienspekulant seine in die Jahre gekommene, einstmals schöne Frau ebenso abstieß wie ein altes, einstmals schönes Gebäude und sich statt dessen mit einem betörenden jungen Ding abgab, das viel weniger kostspielig im Unterhalt war und möglicherweise noch andere nützliche Vorzüge aufzuweisen hatte.
Der Fairneß halber mußte sie jedoch zugeben, daß Hugh nicht notwendigerweise zu dieser Sorte gehören mußte. Vielleicht hatte sie auch voreilige Schlüsse gezogen, was die »neue Attraktivität« der Häuserzeile betraf. Denkbar wäre auch, daß er plante, die Gebäude zu erhalten und zu renovieren.
Polly atmete befreit auf, als die Frauen das Gespräch wieder aufnahmen, das sie vor dem Malheur mit dem Mantel geführt hatten.
Thalia ging zum großen Spiegel. »Endlich habe ich David so weit, daß er mitmacht. Und er steuert auch den Wein bei. Gott allein weiß, wie ich es geschafft habe, ihn dazu zu überreden.«
Thalia begutachtete den Grund für seine Kapitulation im Spiegel und seufzte zufrieden.
»Ich dachte, Hugh und David waren zusammen in der Schule«, bemerkte die Frau, mit der sich Polly über Kinderziehung unterhalten hatte. »Vielleicht hat er sich deswegen einverstanden erklärt.«
Thalias wunderschöne Augen wurden schmal, und Melissa, die Spannungen witterte, schaltete sich eilends ein: »Dein Haus ist perfekt für diese. Gelegenheit, Thalia. Wenn du Hilfe brauchst – Anruf genügt. Ich würde mich freuen.«
»Lade nur all deine Bekannten ein, Liebes«, entgegnete Thalia. »Und bring sie dazu, eine Menge Geld auszugeben. Ich habe mir vorgenommen, ein Vermögen einzunehmen.«
»Und das wirst du natürlich auch. Es ist eine so gute Sache.« Melissa fuhr mit dem Kamm durch ihre Haare, die sofort gehorsam an ihren Platz zurückfielen. »Aber wenn es sonst noch irgend etwas gibt, was ich tun kann, laß es mich einfach wissen, ja?«
Melissa biedert sich zu sehr an, dachte Polly, genau wie früher in der Schule. Wenn man sie nur davon überzeugen könnte, daß ein gutes Herz mehr wert ist als jeder Zacken in einer Adelskrone, und wenn sie endlich aufhören würde, dem sozialen Aufstieg nachzuhetzen, wäre sie wahrscheinlich sehr viel glücklicher. In ihrer Position war sie höchst anfällig für dieselben Brüskierungen, die sie schon als Mädchen hatte erdulden müssen.
Polly bürstete ihren Mantel aus. Sie wollte auf ihre Chance warten und sich unauffällig verdrücken. Wenn sie sich nach den Regeln des Anstands verabschieden und für die freundliche Einladung bedanken würde, könnte es noch Ewigkeiten dauern, bis sie von hier wegkam, weil sicher alle ein Riesentheater um ihren frühen Aufbruch veranstalten würden. Melissa würde sicher darauf bestehen, daß sie jemand – wahrscheinlich David – nach Hause fuhr, und dazu fehlte Polly die Kraft.
Sie trödelte herum, bis sich alle für eine oder zwei weitere Stunden geistsprühenden Geplauders mit Ehemännern anderer gerüstet hatten und in einer Wolke von verschiedenen Duty-free-Düften die Treppe hinunterschwebten.
»Ich brauche bestimmt nicht lange, Melissa. Ich bringe mich nur schnell noch ein wenig in Ordnung.«
»Ich finde es äußerst schwierig, mit langem Haar zurechtzukommen«, sagte Melissa und sah dabei Polly an, als wäre sie das lebende Beispiel dafür, daß es ganz und gar unmöglich war.
Polly schnupperte an Melissas Fläschchen, überlegte, ob sie ihre Bürsten und Kämme täglich wusch, und sah auf ihre Uhr. Auf Melissas schrille Frage, die von der Halle herauf drang, erwiderte sie: ja, es sei alles in Ordnung, und sie versuche immer noch, ihre Frisur zu bändigen; dann hörte sie, wie die Tür zum Salon geschlossen wurde.
Als sie sicher sein konnte, daß sich alle auf Melissas beigefarbene Sofas niedergelassen hatten und Spekulationen anstellten, welche ihrer Freundinnen mit dem Mann einer anderen Freundin schlief, schlich Polly die Treppe hinunter.
Sie kam sich vor wie damals, als sie sich heimlich aus der Schule gestohlen hatte, und erinnerte sich, daß sie in diesem Stadium immer von einem Lachanfall geschüttelt worden war. Auch jetzt drohte die Hysterie, ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen. Als sie vor der Haustür ankam, verging ihr allerdings das Lachen, und sie wollte nur noch raus. Sie hätte genausogut versuchen können, von Alcatraz auszubrechen: Die Unzahl von Schlössern und Riegeln hätte Fort Knox hundertprozentig einbruchssicher gemacht. Melissas Versicherungsgesellschaft mußte eine Menge herber Verluste erlitten haben, sonst hätte sie nicht auf solche Vorsichtsmaßnahmen bestanden. Entweder das, oder Sheldon und Melissa hingen extrem an ihren Habseligkeiten.
Doch was auch immer der Grund dafür war, Polly fürchtete, daß sie die Riegel und Schlösser niemals lautlos aufbekam, bevor die Kerle von ihrer geheimnisvollen Portwein-Zeremonie aus dem Eßzimmer zurückkamen. Und es wäre entsetzlich peinlich, beim Weglaufen erwischt zu werden.
Die Tür war ein gehöriges Stück größer als Polly, und ausgerechnet ganz oben befand sich auch ein Riegel. Eine vernünftige Person hätte sich geschlagen gegeben und wäre in den Salon gegangen. Aber Polly war kein Drückeberger, und außerdem wollte sie unbedingt nach Hause.
Unglücklicherweise befand sich nichts so Nützliches wie ein Stuhl in dieser eleganten Halle, nur ein polierter Tisch und eine Art Marmorsäule, die von einem teuren, professionell zusammengestellten Blumengesteck gekrönt war.
Polly betrachtete nachdenklich die Tür, den Tisch und das florale Arrangement und entschied sich für die Blumensäule. Sie hob das Gesteck vorsichtig hoch, plazierte es auf den Boden, dann rückte sie die Säule von der Wand und schob sie das kurze Stück bis zur Tür. Schließlich lüftete sie den engen Rock ein wenig, um ein Knie auf die Säule stützen zu können, und zog sich hoch, bis sie an den obersten Riegel heranreichte.
Bingo! Methodisch arbeitete sie sich von einem Musterbeispiel moderner Sicherheitssysteme zum nächsten nach unten – gottlob waren alle gut geölt und quietschfrei. Zum Schluß kletterte sie wieder von der Säule und machte sich daran, sie an ihren angestammten Platz zu zerren und die Blumen zurückzustellen, als sie hörte, wie im Eßzimmer Stühle über den edlen Marmorboden kratzten und männliche Stimmen laut wurden.
Auf keinen Fall hatte sie vor, sich mit bis zur Hüfte gerafftem Kleid dabei erwischen zu lassen, wie sie Kunstobjekte durch die Gegend schob. Deshalb ließ sie Blumensäule Blumensäule sein und benutzte beide Hände, um die richtige Kombination von Klinken und Schnappriegel zu betätigen und die Tür aufzureißen.
Bedauerlicherweise schrammte die Tür über die Fußmatte und blieb hängen, das hieß, Polly mußte mit aller Macht ziehen und zerren, bis der Spalt so groß wurde, daß sie hindurchschlüpfen konnte. Ihr war nicht bewußt, daß sie nicht das einzige Wesen war, das begierig darauf wartete, endlich die vornehme Schwelle überqueren zu können. Die Tür stand gerade mal fünfzehn Zentimeter auf, als drei abgerissene Kater wie Windhunde aus der Startbox durch den Spalt und die Treppe hinauf schossen, nachdem sie das Blumenarrangement krachend beiseite gefegt hatten.
Benommen sah Polly zu, wie sie an ihr vorbeiflitzten, und floh einen Augenblick später in die entgegengesetzte Richtung – irgendwie schaffte sie es, ihren Körper durch die winzige Lücke zu zwängen, aber ihre Tasche verhakte sich an der Klinke. Als sie den Handtaschenriemen befreit hatte, verriet ihr ein Jaulen aus Melissas Schlafzimmer, daß die kätzische Gruppenorgie bereits in vollem Gange war. Möglicherweise würde Melissa ihr eine Vaterschaftsklage anhängen. Zu schade. Aber die Flucht war gelungen. Polly zog die Tür mit einem Ruck zu und strebte zu ihrem Auto.
Ein boshafter Januarwind fegte ihr den Regen ins Gesicht, und der grobe Kies verschwor sich mit ihren hohen Absätzen, um sie zum Stolpern zu bringen.
Jede Minute konnte sich die Haustür öffnen, und sie würde beobachtet, wie sie in hellster Aufregung den Ort des Verbrechens verließ. Dann wäre klar, daß sie und niemand sonst für das entstandene Chaos verantwortlich gemacht werden konnte. Wo waren ihre verdammten Autoschlüssel? In ihrer Verzweiflung lehnte sie sich an den nächststehenden Wagen, um ihre Tasche gründlich zu durchsuchen.
Augenblicklich flammten die Scheinwerfer des derart mißbrauchten Gefährts auf, und ein schrilles Kreischen zerriß die Winternacht.
»Scheiße!«
Als sich ihre Finger endlich um die Schlüssel schlossen, drang ein Lichtstreifen aus der Eingangstür. Die Fußmatte hatte sich offenbar wieder verfangen und verschaffte Polly so viel Zeit, in ihr Auto zu springen und den Motor zu starten.
Jemand lief die Außentreppe hinunter, als sie mit Vollgas zurücksetzte. Sie schaltete die Scheinwerfer ein und raste die Einfahrt hinunter. Der Kies spritzte nach allen Seiten von den Reifen.
»Melissa wird nie wieder ein Wort mit mir reden.« Ein kleiner Pflanztrog fiel um, als sie eine Kurve zu schnell nahm. »Und das ist auch verdammt gut so.« Sie kam auf die Straße und fing an zu lachen.
Kapitel 3
Also, Bridget, erinnere mich gelegentlich daran, daß ich mich nie wieder im Schutz der Dunkelheit aus dem Staub mache. Eine Blaskapelle mit Tambourmajorin wäre wesentlich unauffälliger gewesen als ich.« Polly beendete ihre Schilderung vom Fiasko des Samstagabends und klaubte die Krautreste von der Reibe.
»Na ja, wenigstens brauchst du dir jetzt um eine Gegeneinladung keine Gedanken mehr zu machen.« Bridget holte ein Blech mit perfekt aufgegangenen, goldbraunen Hefebrötchen aus dem Ofen und stellte es zum Abkühlen auf die Gefriertruhe. Als Chefköchin des Vollwertkostladens und –cafés war sie für die meisten der warmen Gerichte, die serviert wurden, verantwortlich. Außerdem belieferte sie andere Vollwertkostgeschäfte mit Quiche, selbstgemachten Suppen und tiefgefrorenen Mahlzeiten.
Sie erledigte ihre umfangreiche Arbeit mit einer unerschütterlichen Effizienz, die einen bei jedem anderen Menschen zur Raserei getrieben hätte. Bridget selbst war bemerkenswert unkritisch. Ab und zu waren auch die anderen mit Kochen dran, aber Bridget hätte nie erwartet, daß jemand anderes so viel in so kurzer Zeit leistete wie sie. Sie beseitigte ohne Aufhebens Unordnung, merzte Fehler aus und machte jeden glücklich. Für alle war dies nur ein Teilzeitjob, aber Bridget arbeitete vier Tage die Woche, und ohne sie wäre der ganze Laden auseinandergebrochen.
Sie war klein und zierlich, hatte kurzes, dunkles Haar und war erstaunlich vital. Obwohl sie hin und wieder eingestand, daß sie müde war – nach neun Stunden auf den Beinen –, trat sie niemals kürzer, und sie wäre nie auf die Idee gekommen, den Abwasch und das Saubermachen auch nur einmal auf den nächsten Tag zu verschieben. Sie war sechs Jahre älter als Polly und ihre beste Freundin. Jeden Montagmorgen erzählten sie sich haarklein, was sie am Wochenende erlebt hatten.
Polly kippte Mayonnaise in die Schüssel mit den Karottenstiften und dem geriebenen Kraut. »Das nicht, aber dafür muß ich wohl ein Heim für ein halbes Dutzend Bastardkätzchen finden.«
Sie hatte Melissa eine besonders hübsche Bedanke-mich-und-Tut-mir-leid-wegen-des-Durcheinanders-Karte geschickt, die sie mit viel Mühe gebastelt hatte, aber sie bezweifelte, ob diese Geste die beabsichtigte Wirkung erzielte. Schon in der Schulzeit hätte Polly ein wesentlich leichteres Leben gehabt, wenn Melissa auch nur einen Funken Humor gehabt hätte. Trübsinnig tauchte Polly ihre Hände in die Schüssel. Die Mayonnaise war eisigkalt. »Und wie war dein Wochenende?«
Bridget schob resolut ein Blech mit gefrorenen Baguettes in den Ofen. »Ganz gut. Man hat mich angerufen und gebeten, nächste Woche bei einer Versprechen-Auktion mitzuhelfen und dafür zu sorgen, daß mit den Speisen und Getränken alles klappt. Es ist ein bißchen kurzfristig, aber ich habe trotzdem zugesagt.«
»Du bist zu gutherzig«, meinte Polly. »Ich habe noch nie erlebt, daß du mal nein sagst.«
»Na ja ... Am Samstag war Flohmarkt in der Schule, und am Sonntag waren wir bei Alans Mutter.« Bridget wechselte das Thema, um sich eine Gardinenpredigt darüber zu ersparen, daß sie sich ausnutzen ließ.
»Ein Flohmarkt! Und du hast zugelassen, daß ich so was versäume?«
»Ich habe das nicht zugelassen. Dir ging es nicht gut, und du mußtest dich für den großen Abend ausruhen, schon vergessen?« Bridget nahm ein Messer und zerkleinerte eine Zwiebel mit ein paar Längsschnitten und rasendschnellen, hämmernden Bewegungen auf die Größe von grobkörnigem Salz. Karotten und Kraut quollen Polly durch die Finger, während sie sich bis zum Boden der Schüssel vorarbeitete. »Schon gut. Wie war Alans Mutter?«
»Mütterlich.« Die zweite Zwiebel erlitt dasselbe Schicksal wie die erste.
»Und wie geht’s Alan?«
»Prima.« Bridget unterbrach für einen Moment ihr Hackwerk, und ihr Lächeln nahm die verträumte Zufriedenheit einer Frau an, die eine schöne Liebesnacht erlebt hatte.
Polly seufzte. Bridgets Beziehung zu ihrem Mann stellte eine ernsthafte Bedrohung für ihren selbstauferlegten Zölibat dar. Nach zwanzig Ehejahren waren die beiden immer noch Freunde und ein Liebespaar, und das gab Polly zu denken – vielleicht ließ sich doch etwas finden, das für eine Verbindung von Mann und Frau sprach. Aber, wandte sie vor sich selbst und allen, die ihr zuhörten, des öfteren ein, wie viele Paare gab es schon, die so glücklich miteinander waren wie Bridget mit ihrem Alan? Weit mehr waren in einer Beziehung gefangen, die ihnen weder Vergnügen bereitete noch sonst einen Vorteil bot. Bridget und Alan waren die Ausnahme.
Polly durchquerte die Küche und tauchte ihre kalten, mit Kraut verklebten Hände in das heiße, saubere Abwaschwasser, das ihre Mitarbeiterin Beth vorsorglich ins Becken hatte laufen lassen.
Das war eine Todsünde. Beth konnte es nicht ausstehen, wenn Krautstücke oder sonstiges in ihrem Abwaschwasser schwammen, und hatte extra eine Schüssel mit warmem Wasser bereit gestellt, damit Polly ihre Hände waschen konnte. Polly entdeckte die Schüssel zu spät, zog sich mit schlechtem Gewissen an ihren Arbeitsplatz zurück und hoffte, Beth würde nichts merken.
Polly ging die Arbeit besser von der Hand, wenn um sie herum Chaos herrschte, und es war für sie immer wieder von neuem ein Kampf, alles so in Ordnung zu halten wie ihre Kolleginnen. Sie redete sich damit heraus, daß sie keine Zeit hatte, zwischendurch aufzuräumen, wenn sie sechs verschiedene Salatberge bis zwölf Uhr fertig haben mußte. Ihre Mitarbeiterinnen waren anderer Ansicht, und sie konnten auch Pollys Theorie nicht unterstützen, daß man unmöglich ein Omelette zubereiten konnte, ohne den Fußboden zu verschmieren. Aber sie hatten es längst aufgegeben, ihr Disziplin bei zubringen.
Beth kam mit einem beladenen Tablett in die Küche und sah auf den ersten Blick die Essensreste in ihrem Spülwasser. Wie üblich beschwerte sie sich über Pollys Gedankenlosigkeit. Polly verzog reuevoll das Gesicht – ihr war klar, daß ohne Beths Fleiß und gutgemeinte Umsicht noch mehr Streß im Vollwertkostcafé herrschen würde als ohnehin.