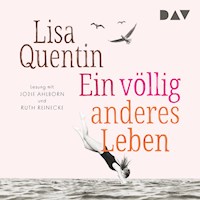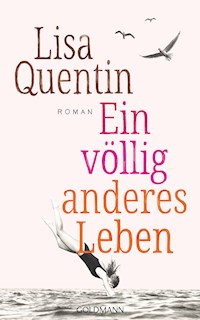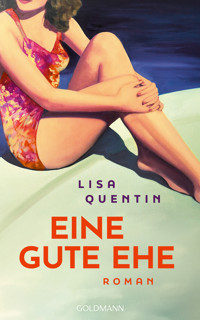
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Muss eine Frau ihre Träume aufgeben, um eine gute Mutter und Ehefrau zu sein?
Deutschland 1960: Als Margarete ungewollt schwanger wird, bricht sie schweren Herzens ihr Studium ab und nimmt den Heiratsantrag von Lenz an. Denn sie, die als Kind aus Ungarn vertrieben wurde und in Armut aufwuchs, wünscht sich nichts mehr als eine sichere Zukunft. Doch das Muttersein überfordert sie, und bald hat Margarete, mittlerweile Mutter von zwei Mädchen, fast täglich das Gefühl zu versagen. Als sie dann herausfindet, dass Lenz sie betrügt, ist sie am Boden zerstört: Sie liebt ihre Familie, aber muss sie sich dafür wirklich selbst aufgeben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Deutschland 1960: Als Margarete ungewollt schwanger wird, bricht sie schweren Herzens ihr Studium ab und nimmt den Heiratsantrag von Lenz an. Denn sie, die als Kind aus Ungarn vertrieben wurde und in Armut aufwuchs, wünscht sich nichts mehr als eine sichere Zukunft. Doch das Muttersein überfordert sie, und bald hat Margarete, mittlerweile Mutter von zwei Mädchen, fast täglich das Gefühl, zu versagen. Als sie dann herausfindet, dass Lenz sie betrügt, ist sie am Boden zerstört: Sie liebt ihre Familie, aber muss sie sich dafür wirklich selbst aufgeben?
Weitere Informationen zu Lisa Quentin sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Lisa Quentin
Eine gute Ehe
Roman
Originalausgabe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe April 2024
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile Werbeagentur GmbH
Umschlagmotive: Bridgeman Images/T.S. Harris
Redaktion: Lisa Wolf
LK · Herstellung: ast
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-30911-4V002
www.goldmann-verlag.de
Die folgende Geschichte spielt vorwiegend in den 1950er- und 1960er-Jahren. Die in einigen Szenen verwendete Sprache kann diskriminierend wirken. Ähnlichkeiten mit realen Personen sind rein zufällig.
Für meine Kinder
Erster Teil
1. Kapitel
Ungarn, 1946
Anikó war sechs Jahre alt, als sie ihr Zuhause verlor und lernte, dass sie an dem Ort, den sie für ihre Heimat hielt, nur zu Gast war. An diesem trüben Herbstmorgen hüpfte sie lustlos über die Pfützen, in denen sich graue Wolkentürme spiegelten. Bei jedem Sprung bauschte sich das Tuch, das sie über ihren schmalen Schultern trug. Es war ein kurzer Besuch in der Schule gewesen. Diesmal hatten Erzsébet und Szigfrid gefehlt, der Platz neben Anikó, auf dem eigentlich ihre beste Freundin Hanneliese saß, blieb schon seit zwei Wochen leer. Wenn Anikó sich im Klassenraum umschaute, sah sie jetzt zu viele Holzbänke für zu wenige Kinder.
Die verbleibenden Schüler hatten artig auf die Lehrerin gewartet, dabei saß Frau Friedinger normalerweise immer schon im Klassenzimmer und plauderte gerne mit den Kindern, bevor der Unterricht begann – fragte, wie es den Großeltern ginge, ob die Ernte in diesem Jahr gut ausgefallen sei und ob die Mutter wieder ihre berühmten Krapfen für das Dorffest vorbereiten würde.
Doch an diesem Morgen kam sie nicht, und es blieb ganz still im Klassenraum. Anikó starrte vor sich auf den Holztisch, an dem schon so viele Kinder vor ihr gesessen und gelernt hatten, darunter auch ihr Vater als kleiner Junge, ihre Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen, und fuhr die Holzmaserung mit dem Zeigefinger nach. An einer Stelle war das Holz ganz rau, und es gelang ihr, eine kleine Faser herauszukratzen. Als die Kirchturmuhr zur halben Stunde schlug, wusste sie, dass es sinnlos war, noch länger zu warten. Die Lehrerin war weg. Wortlos stand Anikó auf und ging.
Wenn sie den Blick jetzt von den Wolkenpfützen hob, konnte sie schon den Hof sehen, der sich in die kleine Senke zwischen den Feldern schmiegte wie in eine liebevolle Umarmung. Seit fünf Generationen lebten die Szájers hier. Sie besaßen Land zum Getreideanbau, mit Obstbäumen und Viehwirtschaft. Das prächtige Langhaus mit Küche, Kammern, Wirtschaftsräumen und dem säulengestützten Laubengang war vom Großvater errichtet worden, das Baujahr und seine Initialen zierten den Giebel. Bis vorletzten Winter hatten die Großeltern zusammen mit Anikó und ihren Eltern dort gelebt, dann waren sie kurz nacheinander gestorben.
Ein Segen, würde ihr Vater später sagen.
Es waren nur noch wenige Meter bis zu ihrem Hof, da hörte Anikó den Hund. Sein verzweifeltes Bellen, ein Heulen, das durch Mark und Bein ging. Immer, wenn wieder ein Zug das Dorf verließ, rannte der Hund kläffend neben den Waggons her. Er bellte und japste bis zur Erschöpfung. Irgendwann kam er mit gesenktem Kopf und langer Zunge zurückgetrottet, um zu schauen, wer noch da war.
Anikó hielt sich die Ohren zu und summte eine kleine Melodie, wollte den Hund nicht hören und nicht wissen, wer diesmal gegangen war.
Es war so gemein. Der Krieg war endlich vorbei, und nun könnte alles wieder gut werden, alles so, wie es früher gewesen war. Sie wollte mit Hanneliese über die Stoppelfelder laufen und Papierdrachen steigen lassen, mit ihren Cousins im Heulager toben, und beim Bethlehemspiel in diesem Jahr hätte sie ganz gewiss die Maria sein dürfen. Doch als im Spätsommer die Uniformierten in den Ort gekommen waren und ein Plakat an die alte Eiche auf dem Dorfplatz geschlagen hatten, war ihr klar geworden, dass nichts je wieder so sein würde wie früher.
»Sonderbefehl«, hatte auf dem Plakat gestanden. Alle, die deutschen Ursprungs seien und bei der Volkszählung vor fünf Jahren angegeben hätten, Deutsch sei ihre Nationalität oder Muttersprache, müssten das Land binnen acht Wochen verlassen. In wessen Adern deutsches Blut floss, trug Mitschuld am bestialischen Krieg der Nationalsozialisten, sei in Ungarn nicht mehr geduldet und müsse zurück nach Deutschland gehen. Fünfzig Kilo Reisegepäck pro Person waren erlaubt, alles andere musste zurückgelassen werden und fiel in den Besitz der ungarischen Regierung. Nichtausführung des Befehls würde mit schärfsten Strafen verfolgt werden, einschließlich Waffengebrauch.
Und weil erst keiner reagierte – wer folgt schon widerstandslos einem flatternden Stück Papier und lässt dafür Haus, Heimat, Grund und Boden zurück? –, hatten die Soldaten einige Wochen später an die Türen derjenigen gehämmert, die unverzüglich gehen sollten. Die Nachbarn, die die deutsche Zeitung abonniert hatten. Der Schuster, der sich freiwillig als Soldat bei der SS gemeldet hatte. Der Bauer, der das größte Stück Land besaß. Seitdem lebten alle in Angst, dass es bald auch an ihrer Tür klopfen würde. Jedes Geräusch wurde zur Gefahr, jede Bewegung auf der Straße eine dunkle Vorahnung.
Nach und nach zogen ihre Freunde und Verwandten in stummen, geduckten Karawanen zum Bahnhof. Im Gepäck befanden sich die wenigen Habseligkeiten, die sie mitnehmen durften. Ihre Handwagen und Karren ließen sie einfach vor dem Bahnhof stehen. Zurück blieb ein Geisterdorf. Die Fenster des Nachbarhofs schlugen im Wind, die Kühe schrien, weil niemand sie molk.
Am Abend zuvor war der Vater in die Ställe gegangen.
Anikó hatte Schüsse gehört.
Dann Stille.
Anikó betrat das Langhaus durch die Hoftür, die immer offen stand. Sie fand ihre Mutter in der Küche, Ibolya hob den Blick vom großen Topf, in dem sie gerade rührte, musterte ihre Tochter nur für einen Wimpernschlag und wusste Bescheid. »Komm her, mein Kind.« Sie legte den Löffel beiseite und zog Anikó zu sich heran, die drückte ihr Gesicht an den warmen, weichen Bauch der Mutter und schluchzte in ihre Schürze.
»Wo ist Papa?«, fragte Anikó schließlich, nachdem sie sich beruhigt hatte.
»Die Saat ausbringen. Keiner da, der ihm helfen könnte. Er wird noch eine Weile brauchen.« Ibolya widmete sich wieder dem Sud, der im Topf brodelte, gab getrocknete Kräuter und geschnittenes Gemüse dazu.
Anikó setzte sich auf den kleinen, dreibeinigen Schemel neben den Ofen, kippelte von einer Seite zur anderen und überlegte, was sie mit diesem Tag noch anfangen könnte. Vielleicht die trächtige Katze suchen und nachschauen, wie es ihr ging? Ihr Bauch wölbte sich jetzt schon so stark, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis die kleinen Kitten zur Welt kamen. Wenn sich die Katze von Anikó streicheln ließ, fühlte sie manchmal kleine Bewegungen in ihrem Bauch, an ein Säckchen Murmeln erinnerte sie das. Anikó überlegte gerade, ob es ihr wohl gelänge, zu ertasten, wie viele Kätzchen es werden würden, da hämmerte es dreimal kräftig an die Tür.
Sofort sah Anikó zur Mutter, die wie erstarrt am Herd stand.
»Aufmachen«, rief ein Mann.
Und Ibolya ließ den Löffel fallen.
2. Kapitel
Deutschland, 1960
Noch am Tag vor ihrer Hochzeit besucht Margarete, wie Anikó jetzt heißt, eine Vorlesung. Sie sitzt im Audimax auf einem der harten Holzstühle und macht sich auf der kleinen Schreibfläche Notizen zur Geschichte der Neueren Deutschen Literatur. Bis zum letzten Wort des Professors schreibt sie mit, fängt jede Silbe auf, nichts darf vergeudet werden. Sie braucht das Wissen für die Abschlussprüfung, wenn sie erst zurück ist, fehlen nur noch wenige Scheine.
Der Gong ertönt, aber Margarete lässt sich nicht vom Aufstehen, Reden, Lachen, Räumen der anderen stören und vertieft sich in die letzten Zeilen.
»Nun komm schon«, ruft Gitte, die es in der tosenden Menge Hunderter Studenten schon bis zur Treppe geschafft hat. »Oder willst du hier festwachsen?«
Margarete seufzt und dreht die Kappe auf den Füller. Dann verstaut sie ihre Unterlagen ordentlich in ihrer Umhängetasche. Sie ist die Letzte, die die große Treppe herunterkommt, aufrecht und nachdenklich, den Kopf noch voller Gedanken an das gerade Gehörte. Wie sie das alles vermissen wird. Und unglaublich, dass sie ab morgen ein völlig anderes Leben führt.
Draußen nimmt Margarete Umarmungen und gute Wünsche entgegen. Es ist ein ungemütlicher Tag im Februar, grau und stürmisch. Die jungen Frauen stehen dicht beisammen, Margarete muss ihren Hut festhalten, der Wind rüttelt an ihren Worten. »Bis bald, ihr Lieben«, ruft sie ihren Kommilitoninnen entgegen.
»Du wirst uns fehlen«, sagt Christa. »Wer erklärt uns denn jetzt Philosophie?«
»Und ich muss bei den Vorlesungen wieder selbst mitschreiben. Du weißt, wie unleserlich meine Handschrift ist, wie kannst du mir das nur antun?« Gitte verzieht theatralisch das Gesicht.
»Wir sind doch alle nur neidisch.« Edith umarmt sie. »Einen wie Lenz hätte jede von uns genommen.«
Die anderen haben Lenz ein paarmal getroffen, als er Margarete von der Hochschule abholte. Oft hatte er Blumen dabei, und immer war er freundlich und sah umwerfend aus. Sie wissen, dass er als Arzt im Krankenhaus arbeitet und schon jetzt gut verdient. Dass er zehn Jahre älter ist als Margarete, stört niemanden, im Gegenteil, Margarete hat ausgesorgt.
»Und ihr seid so ein schönes Paar«, ergänzt Christa. »Wie aus der Reklame.«
Margarete lächelt verlegen, doch der Stolz pocht in ihrer Brust. Ja, sie sind ein schönes Paar. Beide hochgewachsen, schlank und feingliedrig. Sie dunkel, er hell und strahlend.
Für Edith und Christa wird es Zeit zu gehen, noch eine letzte Umarmung, dann sind sie weg. Nur Gitte will sich noch nicht trennen.
»Es ist ja nicht für lang«, tröstet Margarete sie und fügt flüsternd hinzu: »Sobald das Kind ein bisschen älter ist, bin ich wieder hier.«
Gitte ist die Einzige, die den brombeergroßen Grund für die frühe Hochzeit kennt.
»Ich habe noch keine zurückkommen sehen«, erwidert sie missmutig.
»Natürlich komme ich zurück. Wir haben doch einen Plan.«
»Die Pädagogik revolutionieren.« So niedergeschlagen, wie Gitte es jetzt sagt, klingt es lächerlich. Aber genau das ist es, was Margarete antreibt. Den Nachkriegsmief aus den Schulen kehren, den Alten zeigen, dass es auch anders geht. Mit Zuwendung, Liebe und Vertrauen statt Schlägen und Strafen.
Seit Margarete dreizehn war, hatte sie Nachhilfeschüler, die sie über Jahre begleitete. Und die besten Resultate erzielte sie durch Geduld und Kreativität. Jedes Kind lernt anders. Es ist doch irrwitzig, anzunehmen, dass eine Methode für alle funktioniert.
»Du hältst die Stellung für mich«, sagt sie zu Gitte. »In zwei, spätestens drei Semestern bin ich zurück. Und wer weiß, vielleicht kann ich mehr Kurse belegen, und dann werden wir kurz nacheinander Junglehrerinnen und sehen uns im Seminar.«
Möglich ist es, Margarete weiß, wie schnell sie lernen kann. Und sie hat ja auch ihre Eltern. Ihre Mutter wird auf das Kind aufpassen, wenn Margarete Vorlesungen und Seminare besucht. Und wenn es alt genug ist, kann es in den Kindergarten gehen, während sie unterrichtet. Immer vormittags, das passt. Natürlich hat sie es als Frau eines Arztes nicht nötig, zu arbeiten. Aber Lenz ist kein Mann, der verlangt, dass seine Frau zu Hause bleibt. Wenn Margarete ihm von ihren pädagogischen Entdeckungen erzählt, hört er interessiert zu. Er stellt ihr Fragen, manchmal hat er sogar selbst Ideen.
Dass sie Lehrerin wird, steht fest. Sie studiert doch nicht nur um des Studierens willen. Sie wird eine gute Lehrerin werden, eine, die ihre Schüler ernst nimmt, immer ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte hat. Eine mit pädagogischem Geschick und hervorragender Fachkenntnis. Ab morgen ist sie Frau Dr. Kron, wie das klingt, Frau Dr. Kron! Im Kollegium wird man sie respektieren, auch ältere Lehrerinnen werden sie um Rat fragen. Margarete sieht es genau vor sich: Wie sie morgens das Haus verlässt mit ihrem kleinen Sohn an der Hand – insgeheim hofft sie auf einen Jungen –, sie trägt ein hübsches Kostüm, er weiße Kniestrümpfe. An der Pforte des Kindergartens verabschiedet sie ihn mit einem Küsschen, lächelnd grüßt sie die anderen Mütter, die nur Hausfrauen sind, ihr neidvolles Tuscheln ignoriert sie. Dass eine Frau beides haben kann, eine Familie und einen Beruf, der ihr Erfüllung bringt, davon ist sie überzeugt.
»Komm mich bald besuchen, Gitti«.
»Mal schauen.«
»Ich kann dir auch bei deiner Seminararbeit helfen. Bestimmt habe ich Zeit dafür.«
»Vielleicht.«
»Gitti, nun gib dir einen Ruck, ich bin doch nicht aus der Welt.«
»Aus meiner schon«, sagt Gitte, umarmt sie noch einmal fest und tritt dann einen Schritt zurück. »Jetzt geh, Reisende soll man nicht aufhalten.«
Margarete schickt ihr noch einen Luftkuss, bevor sie sich auf den Weg macht. Sie muss sich sputen, wenn sie die Straßenbahn erwischen will. Nach einigen Schritten dreht sie sich noch einmal um, aber Gitte ist schon verschwunden, untergetaucht zwischen den vielen Menschen vor dem Audimax. Dass sie so pessimistisch sein muss, dafür gibt es wirklich keinen Grund. Aber so ist Gitte eben, sie hält nicht viel von der Ehe, von Männern allgemein und Konventionen überhaupt.
Aber Margarete wird ihr beweisen, dass sie falschliegt. Bei Lenz und ihr ist es anders. Sie wird zurückkehren, und all ihre Träume werden sich erfüllen. Zwar stimmt die Reihenfolge nicht, sie hatte erst studieren und als Lehrerin arbeiten, dann heiraten, ein schönes Haus beziehen und anschließend ein Kind bekommen wollen. Aber so ist es eben nun, eine kleine Pirouette des Schicksals auf einem sonst festgelegten, gradlinigen Weg.
3. Kapitel
Als Margarete noch Anikó war, träumte sie von einer Hochzeit in der kleinen Feldsteinkirche, vor dem hölzernen Altar und dem Triptychon, das Maria und die Heiligen zeigt. Unter deren sanftmütigen Blicken wurden seit jeher alle Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen der Szájers gefeiert. Es sollte eine Hochzeit in Tracht sein, mit Gottes Segen und einem rauschenden Fest. Tagelang würden die Vorbereitungen andauern, das ganze Dorf war eingeladen, sie würden all die alten Bräuche zelebrieren, um Mitternacht gäbe es Wirscht und Sulz, die Kapelle würde »Schön ist die Jugend« spielen, und es würde getanzt bis zum Morgengrauen.
Doch nun reicht es nicht einmal mehr für eine Verlobung, schnellstmöglich muss die Trauung vollzogen werden, bevor sich Margaretes Bauch verräterisch wölbt. Sie versucht, es mit Fassung zu nehmen, sagt sich, dass Verlobungen aus der Mode kommen. Eine Mitgift hätte sie ohnehin nicht zu erwarten, bei ihren Eltern reicht das Geld kaum fürs Nötigste. Und sie darf nicht vermessen sein. Lenz heiratet sie, das ist erst mal alles, worauf es ankommt. Selbst dass er Protestant ist, gerät zur Nebensache.
Es ist ein gewöhnlicher Dienstag im Februar, der Himmel trägt ein wässriges Grau, hinter dem sich die Vormittagssonne nur erahnen lässt. Passanten in dicken Mänteln eilen vorbei, nur schnell ins Warme, die feuchte Kälte zieht in die Knochen.
Es ist vereinbart, dass sich die kleine Hochzeitsgesellschaft direkt vor dem neu gebauten Behördenhaus trifft, in dem auch das Standesamt untergebracht ist. Sechs Etagen Beton, zwei Nuancen dunkler als der Himmel, reihenweise Fenster. Davor ein gut besuchter Parkplatz, ausgebreitet wie ein bunter Flickenteppich.
Wo bleibt er nur? Margarete sieht sich um, ihr Herz ist ein Klumpen aus Furcht. Er wird sie doch nicht im letzten Moment sitzen lassen? Auch ihre Eltern sind stumm und zittrig vor Aufregung, nur ihre Tracht hält sie zusammen. Sie tragen ihre schönsten Sachen, der Vater den dunklen Doppelreiher, an dessen Saum er ohne Unterlass nestelt. Die Mutter den Rock aus festem dunkelblauem Stoff mit weißem Muster, der weit und ausladend schwingt. Das dicke schwarze Kopftuch. Über der Bluse ein weiteres Tuch, über dem Rock eine Schürze. Diese vielen Schichten dunkler Stoff, acht Meter sind nötig für die Röcke, und immer diese Tücher, niemand trägt hier noch Tücher.
Margarete ist der Aufzug ihrer Eltern peinlich. Sie hätte mit ihnen besprechen sollen, was sie anziehen. Doch als sie von zu Hause aufbrachen, war es zu spät, ihre Garderobe noch zu ändern.
Sie selbst hat sich für ein schlichtes beigefarbenes Kostüm mit Hahnentrittmuster entschieden, das ihrer Figur schmeichelt. Sie hat es zwar extra für die Hochzeit gekauft, wird es später aber auch zum Unterrichten anziehen können. Darüber einen dünnen Mantel, in dem sie jetzt entsetzlich friert.
Als Lenz’ Wagen endlich auf den Parkplatz einschert und er aussteigt in seinem feinen dunklen Anzug und einem Strahlen im Gesicht, das nur ihr gehört, schließt sie für einen Moment erleichtert die Augen.
Begleitet wird Lenz von seinem Bruder Boje, der Margarete und ihre Eltern mit einem knappen »Moin« begrüßt. Margarete ist erstaunt über den kräftigen, wortkargen Mann, der sich sichtlich unwohl fühlt in seinem Anzug. Sie hat sich Lenz’ Bruder ganz anders vorgestellt.
»Entschuldige, mein Liebling, es gab eine Baustelle«, erklärt sich Lenz und küsst sie flüchtig auf die Wange.
»Ich dachte schon, du kommst nicht.« Es soll lustig klingen, doch ihr Lächeln verrutscht.
»Was hast du nur für eine schlechte Meinung von deinem Ehemann!« Mit gespieltem Entsetzen schüttelt er den Kopf und küsst sie erneut. Dann wendet er sich an ihre Eltern und begrüßt sie freundlich. »Was für eine schöne Stickerei«, lobt er das Tuch ihrer Mutter. »Selbst gemacht?«
Ibolya nickt und lächelt stolz, Margarete atmet aus.
Mit dem Aufzug fahren sie in den zweiten Stock. In der Kabine ist es eng, Lenz und Boje scherzen ausgelassen, Margarete und ihre Eltern bleiben stumm. Erneut mustert sie Boje. Er ist groß und grob, die Brüder sind sich überhaupt nicht ähnlich, außerdem hat sie ihn sich nicht so jung vorgestellt. Wie alt mag er sein? Achtzehn oder neunzehn? Und bewirtschaftet schon allein einen ganzen Hof?
Sie gehen den Flur entlang, der Teppich unter ihren Füßen dämpft die Geräusche ihrer Absätze, bald haben sie das Zimmer erreicht. Lenz klopft an, und dann geht alles ganz schnell: Sie nehmen auf den beiden Stühlen gegenüber dem Standesbeamten Platz, Boje steht hinter Lenz, ihre Eltern hinter Margarete, und die nächsten Minuten, in denen der Standesbeamte über die Ehe, ihre Pflichten und Rechte referiert, verlieren sich im Raum. Margarete fühlt sich schwindelig.
Dann fragt er: »Frau Anikó Milliza Seier, möchten Sie den hier anwesenden Lenz Kron, geboren am 14. April 1930 in Marne, zu Ihrem Ehemann nehmen?«, und Lenz drückt sachte ihre Hand.
Erst am Tag zuvor hat sie ihm ihren ungarischen Namen gebeichtet. Und davon erzählt, wie sie zu Margarete wurde. Lange hat sie gezögert, weil sie seine Reaktion fürchtete. Würde er sich betrogen und getäuscht fühlen, weil sie keine echte Margarete ist?
»Und wenn du Rumpelstilzchen heißen würdest, es wäre mir gleich«, meinte Lenz dann aber und strich ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
Margarete sagt ja, doch weil sie mit ihren zwanzig Jahren noch nicht großjährig ist, muss der Vater auf der Urkunde unterschreiben. Er versteht den Standesbeamten nicht, und sie muss übersetzen. Dann sagt auch Lenz Ja zu Margarete, Boje reicht die Ringe, und Lenz steckt ihr den schmalen goldenen Ehering an den Finger, den schon seine Mutter trug. Als Margarete sieht, dass er einen Brillanten hat einarbeiten lassen, bleibt ihr die Luft weg. Für einen Moment bleibt die Zeit stehen, und Margaretes Gedanken rasen hinterher, sie kommt an diesem Augenblick an und kann endlich einen klaren Gedanken fassen. Der Stein muss mindestens zwei Monatsgehälter gekostet haben. Und ist ein funkelndes Versprechen an das Leben, das sie ab jetzt gemeinsam führen werden.
Lenz selbst wird keinen Ring tragen, das haben sie vorher besprochen. Den passenden Ring seines Vaters gibt es nicht mehr, verschollen, zusammen mit dem Vater im Krieg geblieben. Und ein neuer Ring würde sich nicht lohnen, im Krankenhaus müsste er ihn ja doch nur ständig abnehmen. Dafür ist Margaretes Ehering umso schöner. Sie ist jetzt eine Frau, der kostbarer Schmuck geschenkt wird.
Danach gehen sie im Ratskeller essen, ein Restaurant, das Lenz ausgesucht hat und in dem er offensichtlich bekannt ist.
»Guten Tag, Herr Dr. Kron«, begrüßt sie ein Kellner in makelloser Livree am Eingang. Dann nickt er lächelnd in Margaretes Richtung. »Und Frau Dr. Kron. Herzlichen Glückwunsch zur Vermählung. Bitte folgen Sie mir.« Er führt sie zu ihrem Tisch, der mit roten Rosen und silbernen Kerzenleuchtern geschmückt ist. Frau Dr. Kron, es ist passiert! Das ist jetzt tatsächlich sie.
Kaum dass sie Platz genommen haben, werden fünf Sektflöten mit prickelndem Champagner gebracht, und Lenz erhebt das Glas: »Auf meine wunderschöne Ehefrau!«, sagt er mit so lauter Stimme, dass sich die Gäste an den anderen Tischen nach ihnen umsehen. Dann beugt er sich zu ihr und küsst sie leidenschaftlich, Applaus ertönt, es ist Margarete ein wenig unangenehm, verstohlen blickt sie zu ihren Eltern. Ein solches Spektakel gehört sich nicht.
Doch Ibolya und Georg vertiefen sich in die Getränkekarte, flüsternd übersetzt der Vater für die Mutter, am Ende bestellen sie dann aber doch nur ein Bier und eine Weinschorle.
Zum Essen gibt es Rinderbraten, Kartoffeln und Rotkraut, als Nachspeise Obsttorteletts mit Schlagrahm. Margarete isst in winzigen Bissen. Der Anblick des zerfaserten Fleisches auf ihrem Teller verursacht ihr ein flaues Gefühl im Magen.
Vielleicht ist es die Schwangerschaft, das Mieder, das ihren Bauch schön flach halten soll, oder doch Bojes anzügliche Schoten über den Bräutigam, die Margarete auf den Magen schlagen? Lenz’ Bruder ist schon beim dritten Bier und poltert eine Anekdote nach der nächsten über den Tisch:
Lenz, der schon als kleiner Junger lieber mit Mädchen spielte.
Lenz, der jugendliche Charmeur, der den Mädchen in Marne den Kopf verdrehte.
Lenz, der Schwerenöter, der mit der Nachbarsmagd regelmäßig im Heuschober verschwand.
Die Geschichten drängen aus ihm heraus, als wäre Boje erleichtert, all die Fehltritte seines Bruders endlich zum Besten geben zu können. Nun, da er in festen Händen ist.
Lenz sagt nichts dazu, lächelt nur, doch unter dem Tisch sucht seine Hand wieder die ihre. Sie konzentriert sich auf die kleinen Kreise, die Lenz’ Daumen auf ihren Handrücken malt, will diese ganzen Geschichten nicht hören und hofft, dass ihre Eltern Bojes Plattdeutsch nicht verstehen.
Um sich abzulenken, sucht sie nach dem Wort, das Boje beschreibt. Impertinent! Ein klasse Wort, sie hält sich daran fest. Lateinisch impertinens, nicht dazugehörig. Das passt doch ganz wunderbar.
Lenz wählt eine andere Taktik, will den redseligen Bruder offensichtlich auf andere Themen lenken.
Wie viele Schweine?, fragt Lenz. Welches Futter? Wie war die Ernte im letzten Jahr?
Margarete wusste nicht, dass er so interessiert an landwirtschaftlichen Dingen ist. Vom Hof in Marne in Dithmarschen hat er ihr erzählt. Vom platten Land, das ins Meer übergeht und am fernen, fernen Horizont mit dem blassblauen Himmel verschmilzt. Vom Blöken der Schafe, das überall zu hören ist. Von Alma, seiner Lieblingskuh, auf der er als Kind geritten ist. Von seiner Mutter, die im letzten Jahr beim Melken vom Schemel fiel und nicht mehr aufstand. Und natürlich auch von Boje, seinem jüngsten Bruder, der auf dem Hof geblieben ist und ihn mithilfe der Nachbarn nun allein führt.
Neu ist für Margarete die Begeisterung ihres frisch angetrauten Ehemanns, die nun im Gespräch mit Boje aufflammt. Die Hingabe, die Versiertheit, die sie sonst nur bei ihm hört, wenn er von medizinischen Themen spricht.
»Wenn du mol bi uns blieben wär’s«, sagt Boje.
Lenz winkt ab. »Nee, lass man. Ich habe genug Kooschiet an mien Hands hat. Dat langt für ein Leben.«
Doch da ist ein leises Zögern in seiner Antwort, und für einen kurzen Moment sieht Margarete sich schon im Klassenraum einer kleinen Dorfschule. Auf einer weiten statt grünen Weide. Mit ihrem Kind zwischen Strohballen tobend. Mit einem Tuch in den Haaren im Kuhstall. Dann wäre es so, wie sie es sich früher immer erträumt hat.
Später hebt Lenz Margarete über die Schwelle seiner Wohnung, die ab jetzt ihre gemeinsame Wohnung ist. Den Koffer mit ihren Sachen stößt er mit dem Fuß voran, lässt ihn dann achtlos liegen und steigt darüber. Er trägt seine Ehefrau durch den dunklen Flur, statt Lampen hängen starre Kabel von den Decken.
Lenz hat die Wohnung vor zwei Wochen angemietet, noch sind die beiden Zimmer spärlich möbliert, bis auf ein Bett und einen Tisch mit zwei Stühlen gibt es nichts in diesen kahlen Räumen. Die Wohnung liegt mitten in der Stadt an einer geschäftigen Straße, die Wände wackeln, wenn unten eine Straßenbahn vorbeifährt.
Lenz lässt Margarete sachte aufs Bett fallen. Dann fällt er wie verhungert über sie her. Hastig öffnet er die Knöpfe ihres Jacketts und schiebt seine Hand unter ihren Rock. Alle Berührungen kommen gleichzeitig, alles an ihm ist fordernd und laut, ein schrilles Orchester.
Erst wenn er zum Höhepunkt gekommen ist, wird er für ein paar Minuten ruhig. Das, was ihn so rastlos macht, fällt von ihm ab, und für wenige Minuten ist er wirklich bei ihr. Nie ist sie ihm näher als in diesen Momenten.
Nun liegt sie auf seiner Brust und hört das kräftige Pumpen seines Herzens. »Wie schade, dass deine Eltern die Hochzeit nicht mehr erleben konnten«, sagt sie. »Ich hätte sie gerne kennengelernt.«
»Meine Mutter vielleicht. Bei meinem Vater hast du nichts verpasst.«
»Nein?«
»Er war ein Hundertfünfzigprozentiger. Hat meine Brüder und mich zu Disziplin und Härte erziehen wollen. Richtig verdroschen hat er uns. Als er sich mit Kriegsausbruch freiwillig gemeldet hat, war ich froh, dass er weg war. Nur drei Monate später der Heldentod.«
»Das tut mir leid.« Sie richtet sich auf, um seine Miene zu lesen. Doch er starrt nur ausdruckslos an die Decke.
»Dass meine beiden älteren Brüder nicht aus dem Krieg zurückgekommen sind, war schlimmer.« Lenz erzählt vom Geräusch der Bomber, die donnernd über den Hof flogen. Vom Aufblitzen der Detonationen in der Ferne. Er erzählt von den Schreien der Tiere. Und den Schreien der Mutter, als ein Mann auf den Hof kam, kaum war der älteste Sohn gefallen. Irgendein Kerl, der gehört hatte, dass dort auf dem großen Hof eine Frau allein mit ihrem kleinen Sohn lebte.
Den Schreien des winzigen Boje, der neun Monate später geboren wurde.
Wie danach auf dem Schrank in der Diele die Schrotflinte lag. Immer geladen. Immer schussbereit. Wegen der Krähen auf den Feldern. Und den fremden Männern in den Betten.
Irgendwann hatten sie nichts mehr zu essen, keine Tiere mehr, keine Vorräte. Mit bloßen Händen grub die Mutter den kleinen Acker hinter dem Haus um, weil keine Geräte geblieben waren, hielt nächtelang Wache, damit niemand die Kartoffeln stahl.
Lenz war zwölf Jahre alt, und seine Aufgabe bestand darin, den kleinen Bruder warm zu halten. Er fürchtete sich vor dem leeren, kalten Haus. Wenn nun wieder einer kam? Der Junge lauschte den Geräuschen der Nacht, schlief nicht, wachte.
Dabei beobachtete er Boje, der fest eingewickelt neben ihm im Bett der Mutter lag, und untersuchte, ob man ihm das Böse anmerkte, aus dem er gemacht worden war. Er zwickte ihn in seine kleinen, dicken Beine und fragte sich, warum es so lange dauerte, bis er zu schreien begann. Er stellte fest, dass das Baby wild strampelte, wenn er ihm die Decke über den Kopf zog. Lotete die Grenze aus, bis zu der er ihn an einem Fuß in der Luft halten konnte, bis er sich übergab.
»Hat er mir nicht übel genommen, meine kleinen Experimente«, sagt Lenz, und Margarete wird ganz bang bei seinen Geschichten. Mit seinen eigenen Kindern würde er doch wohl fürsorglicher umgehen?
»Und willst du irgendwann zurück nach Marne?«, fragt sie, um schnell das Thema zu wechseln.
»Zu den Dithmarscher Kohlköpfen?« Er lacht. »Niemals.«
»Vermisst du deine Heimat nicht?«
»Es gibt kein langweiligeres Leben als auf dem platten Land.«
»Du könntest dort aber doch auch als Arzt arbeiten.«
»In einem winzigen Landkrankenhaus, wo Blinddarmoperationen meine spannendsten Fälle wären? Nein, hier habe ich alles, was ich brauche.« Er küsst ihren Scheitel und seufzt. »Das alte Leben habe ich hinter mir gelassen.«
Vor der Hochzeit kannte sie nur das Besondere mit ihm. Sie aßen in Restaurants, waren im Kino und im Theater. Nun ist es aufregend, ihn im Alltag kennenzulernen: sein Gesicht gleich nach dem Aufwachen, wenn seine Augen noch ganz klein sind. Seine Konzentration, mit der er sich rasiert, oder wie er penibel darauf achtet, dass das Besteck symmetrisch zur Tischkante ausgerichtet ist. All diese kleinen Besonderheiten, die ihn ausmachen.
Ihre Aufgabe als verheiratete Frau ist es nun, die dunkle, leere Wohnung in ein Zuhause zu verwandeln. Und diese Aufgabe versöhnt sie mit der ungeplanten Schwangerschaft, schließlich träumt Margarete, seit sie in Deutschland angekommen ist, von einem echten Zuhause. Hier wird sie mit ihrer Familie glücklich sein, sagt sie sich, hier wird Lenz nach anstrengenden Diensten Ruhe finden, sie werden es warm haben und schön, ihr Kind wird in Geborgenheit aufwachsen.
Sie besorgt Illustrierte, um sich Tipps zu holen. Dabei lernt sie, wie herausfordernd die Einrichtung einer Wohnung ist. Man kann unglaublich viel falsch machen, wenn man unbesonnen und uninformiert vorgeht.
Sie nimmt Bleistift und Lineal und unterstreicht das Wichtigste in den Artikeln. Auf Anraten der Zeitschriften kauft sie vom Haushaltsgeld, das Lenz ihr überlässt, einen modernen Tisch und Stühle mit dünnen Beinen und bunten Resopalplatten. Lampen, die wie träge Tropfen über dem Esstisch schweben. Ein Fernsehgerät. Stoffe, Kissen und Teppiche. Grün, Braun und Orange. Weiches und Warmes, das die Wohnung gemütlich macht.
Sie wirtschaftet sparsam, trotzdem rinnt ihr das Geld nur so durch die Finger. Lenz soll nicht denken, dass sie verschwenderisch ist. In den kleinen Heftchen erfährt sie auch, wie sie noch effektiver sparen kann, zum Beispiel, indem sie Speisereste geschickt verwertet. Der Fischpudding mit Makkaroni gelingt ihr ganz ausgezeichnet, und Lenz lobt ihren Einfallsreichtum.
Außerdem informiert sie sich über praktische Haushaltshelfer und bereitet sich auf ihre Aufgaben als Mutter vor. Sie liest, wie wichtig es ist, über Babys Entwicklung Buch zu führen, und macht die Gymnastikübungen, mit denen sie am zweiten Tag nach der Entbindung beginnen soll, vorsichtshalber schon jetzt. Besonders interessant findet sie die Rubrik »Wie ER es sieht«. Darin wird monatlich ein Thema aus Männersicht erläutert. Es ist enttäuschend für den Mann, wenn seine Frau nach Feierabend schlechte Laune hat, und befremdlich, wenn er sieht, dass die Väter in Frankreich den Kinderwagen schieben.
Margarete macht sich Notizen, Ablaufpläne und Listen. Das Wichtigste wiederholt sie Dutzende Male wie früher die Vokabellisten. Wenn sie Neues probiert, hält sie die Ergebnisse in kleinen Berichten fest, damit sie später analysieren kann, warum etwas nicht klappt.
Letztendlich sind es auch nur Aufgaben. Und Aufgaben lassen sich lösen.
Die antiquierte Haushaltsführung ihrer Mutter dient nicht als Vorbild, Ibolya wäscht die Wäsche noch immer wie in Ungarn im Zuber unten im Hof. Viele Liter Wasser müssen dafür im Kessel erhitzt werden, die Wäsche wird gekocht und mit einem großen Holzstab mühsam bewegt. Dann wird Wäschestück für Wäschestück auf dem Waschbrett geschrubbt, vom Wringen sind ihre Hände ganz rissig. Rücken und Arme schmerzen, der Kopf wird heiß von der elenden Plackerei in der dampfenden Hitze. Kein Vergleich zu jetzt: Margarete gibt die Wäsche und Waschmittel in die Maschine, Tür zu, Knopf an, und in zwei Stunden ist alles erledigt. Unglaublich!
Wenn Ibolya sie jetzt besuchen kommt, dann meist unter dem Vorwand, zu viel gekocht zu haben, mit der Bitte, ob sie ihr nicht etwas abnehmen will. Sie fährt ihre Töpfe und Schüsseln mit Gulyás und Lecsó im Handwagen durch die halbe Stadt und sieht sich dann jedes Mal aufs Neue mit großen Augen in der Wohnung um, bestaunt all die Dinge, die Margarete gekauft hat.
»Anikó«, sagt sie kopfschüttelnd, »was bist du verschwenderisch, so haben wir dich nicht erzogen. Wir hätten doch noch einen Tisch gehabt, und dein Onkel Tomasz hätte dir drei Küchenstühle geben können, sie passen sogar zusammen und stehen bei ihm nur auf dem Speicher rum. Es muss doch nicht immer alles neu sein.«
»Ach, Mama, das hat nichts mit Verschwendung zu tun. Ich richte einen Hausstand ein, und mein Mann will es schön haben, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, und nicht auf Onkel Tomasz’ wackligen Küchenstühlen sitzen.«
Aber das kann Ibolya nicht verstehen. Noch immer lebt sie, als wäre sie hier nur auf der Durchreise. Margarete hingegen ist angekommen.
4. Kapitel
Mit klopfendem Herzen steht Margarete vor dem Audimax. Dumpf klingt die Stimme des Professors hinter der dicken Holztür. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Ende der Vorlesung, gleich werden Hunderte Studenten aus dem großen Hörsaal strömen. Margarete liebt diesen Geräuschteppich, das Gemurmel unzähliger Stimmen.
Sie wartet schon eine Weile, hat die Aushänge der angebotenen Seminare für das neue Semester gelesen. Die Inhalte klingen verheißungsvoll. Das alte Kribbeln ist noch da. Wie immer, wenn sie zu Beginn des Semesters vor den neuen, ihr unbekannten Themen steht, würde sie sich am liebsten überall einschreiben. Es gibt noch so unfassbar viel zu entdecken.
Nur Geduld, sagt sie sich. Es ist ja noch nicht vorbei. Sie wird das alles noch erforschen und lernen können. Nur eben später. Jetzt erst mal das Kind. Eins nach dem anderen.
Sie möchte Gitte treffen und ihr von den letzten Wochen erzählen. Sie hat sich ein paar unterhaltsame Anekdoten zurechtgelegt, mit der sie Gitte überraschen kann. Sie will ihr erzählen, wie sich die Bewegungen des Kindes in ihrem Bauch anfühlen – zart und kitzelnd. Und wie ihr die Haushaltsführung immer besser gelingt. Wie großzügig Lenz ist, dass er ihr von seinem Ersparten eine Küchenmaschine und sogar einen Staubsauger gekauft hat, damit sie es leichter hat. Wie die Waschmaschine bei der ersten Benutzung durch die Küche tanzte, weil der Boden uneben war, sie panisch den Aus-Knopf suchte und schließlich den Stecker zog. Wie sie es endlich geschafft hat, ein vernünftiges Soufflé herzustellen, von ihren vielen misslungenen Versuchen will sie Gitte erzählen und dass sie vermutlich zeitlebens keine Eierspeisen mehr sehen kann, weil sie all die zusammengefallenen Soufflés aus Frust in sich hineinstopfte.
Kein einziges Mal hat Gitte sie bislang besucht. Ihr keinen Brief geschrieben. Hat nichts mehr von sich hören lassen. Dabei sind sie doch eigentlich gut befreundet.
Gleich am ersten Tag an der Pädagogischen Hochschule haben sie sich kennengelernt, in diesem kleinen kastenförmigen Anhängsel der echten Universität. Hier wurden nur die Volksschullehrer ausgebildet, drüben an der altehrwürdigen Universität die richtigen Akademiker.
Margarete stand in der langen Schlange vor dem Einschreibungstisch in der Aula, wie ausgestellt kam sie sich vor, gut sichtbar für alle Studenten und Dozenten, die schon mal einen Blick auf die neuen Erstsemester werfen konnten. Zwischen den ganzen duftigen Haaren, den pastellfarbenen Kostümen und Perlenohrringen, dem ausgelassenen Geplapper und Gekicher hatte Margarete sich wieder einmal völlig fehl am Platz gefühlt. Zwar trug auch sie ein mintgrünes Kleid mit weißer Paspel, dazu eine passende Jacke und hübsche Schuhe. Ihre Haare hatte sie mühevoll geglättet, toupiert und hochgesteckt, es gab wirklich nichts auszusetzen an ihrem Äußeren, aber wie sehr sie sich auch anstrengt, nie gelingt es ihr, wie die anderen auszusehen – ihre Augen sind immer zu dunkel, die Haare zu dicht, ihre Haut weniger rosig.
Angespannt hatte Margarete gewartet und gehofft, dass die Prozedur bald vorüber sein würde, man sie schnell auf dieser Liste da vorne abhakte und sie dann untertauchen konnte in irgendeiner Ecke, sich verstecken hinter einem Buch.
»Na, dieser Rock ist ja zum Piepen!«, hörte sie die Studentin, die direkt hinter ihr stand. »Sieht aus wie ein Lampenschirm, wenn du mich fragst«, raunte sie.
Margarete musste schmunzeln, tatsächlich trug das Fräulein vor ihr in der Schlange einen dunkelroten, weit ausgestellten und plissierten Rock, der stark an eine Deckenlampe erinnerte.
»Und bekommt die nichts zu essen?«, kommentierte die Stimme hinter ihr murmelnd weiter. »Was für ein Hungerhaken!«
Margarete drehte sich um, wollte nun doch sehen, wer solche bissigen Kommentare von sich gab.
Die junge Frau war eine auffällige Erscheinung: Sie trug Hosen, ihre Haare unerhört kurz, und zwei tiefe Grübchen rahmten ihr Lächeln. »Stimmt doch, oder?«, fragte sie jetzt Margarete. »Die bricht noch in der Mitte durch. Dass Frauen so dünn sein müssen! Das kann doch nicht gesund sein.«
Margarete hatte sich auf die Lippen gebissen, konnte sich ein kleines Nicken aber nicht verkneifen.
Nachdem sie es endlich in der Schlange nach vorne geschafft hatten, setzte sich Gitte bei der darauffolgenden Einführungsvorlesung ganz selbstverständlich neben sie. Und fortan waren die beiden nur noch gemeinsam auf dem Campus zu sehen. Die große Ruhige und die kleine Quirlige mit den kurzen Haaren. Ein ungleiches Paar, ähnlich waren sie sich nur in ihrer Andersartigkeit.
Der Gong ertönt, und nur Sekunden später strömen die Studenten aus dem Audimax. Margarete flüchtet sich zur Seite, stellt sich auf die Zehenspitzen und versucht, Gitte in der Menge zu finden. Als sie sie endlich erspäht, macht sie mit lauten Rufen und Winken auf sich aufmerksam.
»Was willst du denn hier?« Erstaunt kommt ihre Freundin auf sie zu.
»Dich besuchen!«
»Himmel, du bist ja richtig dick geworden!« Sie zeigt auf Margaretes Bauch.
»Ich kann es schon spüren. Mittlerweile ist es so groß wie eine Birne.«
Margarete erzählt von Lenz und dem tanzenden Vollwaschautomaten und auch vom Fischpudding. Doch Gitte scheint sich nicht besonders für die Geschichten zu interessieren. Vielleicht kann sie Margarete aber auch nur nicht richtig verstehen, so laut ist es im Vorraum des Audimax.
»Wollen wir in ein Café gehen?«
»Kann nicht. Muss gleich zu einer Lerngruppe.«
Eine Studentin in einem unerhört kurzen Rock kommt zu Gitte und spricht mit ihr. Margarete kann ihre Worte nicht verstehen. Wohl aber sieht sie, wie zugewandt und freundlich Gitte auf einmal ist. In ihren Gesten und ihrer Mimik blitzt die alte Begeisterung durch, ihr Elan, dieses Funkeln, das Gitte so besonders macht – das sie offensichtlich nicht mehr mit Margarete teilen will.
»Ich muss dann mal«, sagt Gitte und umarmt Margarete flüchtig.
»Du kannst mich ja mal bes…« Doch da hat Gitte sich schon umgedreht, bei der anderen untergehakt und ist mit ihr davonmarschiert.
Auf dem Heimweg kämpft Margarete gegen die Tränen an. Wie fremd ihr die Freundin war. Hat sie etwas Falsches gesagt oder getan? Oder hat Margarete sie einfach in einem schlechten Moment erwischt?
Zu Hause empfängt sie nichts als Stille.
Lenz hat Tagesschicht, aber versprochen, zum Mittagessen zu Hause vorbeizuschauen. »Und dann erzählst du mir von deinem Besuch in der Hochschule«, hat er am Morgen gesagt. »Dass du mir aber nicht dortbleibst und dich zwischen deinen Büchern versteckst, ja?«
Er weiß, wie gerne sie zur Pädagogischen Hochschule gegangen ist. Während die Zeit an der Universität für ihn nur ein notwendiges Übel war, er wollte immer schon operieren, hätte Margarete sich vorstellen können, noch jahrelang zu studieren.
Sie legt ihre Schürze um und macht sich daran, das vorbereitete Gemüse anzubraten, dann schneidet sie das Fleisch in feine Streifen. Die Kartoffeln hat sie schon am Morgen geschält, sie müssen nur noch in Salzwasser gekocht werden. Den Pudding zum Nachtisch hat sie bereits gestern vorbereitet.
Sie verbringt weniger Zeit mit Lenz, als sie angenommen hat. Seine Schichten im Krankenhaus sind lang und wechseln häufig. Überstunden sind eher Regel als Ausnahme, oft muss er ganze Wochenenden durcharbeiten. Und wenn er nach Hause kommt, ist er so müde, dass er sofort im Bett verschwindet. Manchmal hat Margarete den ganzen Tag mit niemandem gesprochen, außer der paar Worte beim Einkaufen.
So ist es eben, er arbeitet hart, sagt sie sich.
Du darfst dich nicht beschweren.
Er muss sich beweisen, das ist wichtig für seine Karriere.
Und gerade weil die Zeit mit ihm so rar und kostbar ist, macht sie alles möglich, um mit ihm zusammen zu sein. Abends zögert sie das Zubettgehen hinaus, in der Hoffnung, ihn noch zu treffen. Und mittags hält sie das Essen für ihn warm, falls er es doch für einen kurzen Abstecher nach Hause schafft.
Sie ist zuversichtlich, dass er kommen wird. Er weiß, wie aufgeregt sie wegen des Besuchs an der Hochschule war, und wird sicherlich hören wollen, wie es ihr ergangen ist.
Das Essen gerät zur Punktlandung. Um zwölf Uhr ist es servierbereit. Flink schlüpft sie aus der Schürze, unter der Woche sind es die geblümten, die ihre Mutter ihr näht, am Wochenende die ordentlich weißen mit den Rüschen. Dann huscht sie noch einmal ins Badezimmer, richtet ihre Haare und tupft einen Tropfen Parfüm hinter die Ohren. Sie überlegt sich, was sie ihm erzählen kann, was ihn amüsieren wird.
Aus dem Wohnzimmerfenster blickt sie auf die Straße. Die Minuten verstreichen, ihr Blick sucht ihren Mann zwischen den unbekannten Passanten auf der Straße, die Ungeduld wächst.
Wenn er später kommt, kann er nicht länger bleiben. Und irgendwann würde es sich nicht mehr für ihn lohnen. Mit jeder Minute steigt Margaretes Anspannung. Und nach einer Dreiviertelstunde weiß sie: Er wird nicht kommen. Es ist die immer gleiche Spirale aus Vorfreude, Hoffen, Bangen und Enttäuschung.
Sie wird wieder allein sein, lustlos in ihrem Essen herumstochern, es dann in den Kühlschrank stellen. Der Nachmittag liegt öde und ereignislos vor ihr. Natürlich gäbe es viel zu tun, die Ratgeber sind voller Vorschläge, aber sie fühlt sich zu träge. Die Schwangerschaft erschöpft sie schon jetzt. Wohin soll das nur führen? Wo doch noch Monate vor ihr liegen.
Dann hat sie eine Idee.
Und noch bevor ihre Zweifel sie einholen, packt sie das Essen in einen Henkelmann und macht sich auf den Weg ins Krankenhaus.
Eine frisch verheiratete Ehefrau, die ihrem Mann das Mittagessen bringt. Nichts spricht dagegen. Er wird sich freuen, sie erwartet ja auch gar nicht viel, seinen überraschten Blick, sein Lächeln, einen schnellen Kuss vielleicht. Mit klopfendem Herzen meldet sie sich am Empfang, sie war noch nie allein hier.
»Ach, wie schade«, sagt der freundliche Mann hinter dem Empfangstresen. »Ihr Mann hat das Gebäude vor einer halben Stunde verlassen. Da haben Sie ihn verpasst.«
Margaretes Herz macht einen Satz. War er doch noch auf dem Weg nach Hause? Sind sie auf der Straße womöglich aneinander vorbeigeeilt?
Auf dem Rückweg sucht sie die Gehsteige nach ihm ab. Aber nichts, keine Spur von ihm. Wird er in der Wohnung sein und auf sie warten? Sich fragen, warum sie nicht zu Hause ist? Was für eine schlechte Idee dieser überstürzte Besuch gewesen ist. So viel Verwirrung!
Doch er ist nicht in der Wohnung, und nichts deutet darauf hin, dass er während ihrer Abwesenheit hier war. Fahrig versucht Margarete, die Wäsche zu bügeln, sich irgendwie abzulenken. Aber heute will ihr einfach gar nichts gelingen, später hat sie ein paar große Falten in Lenz’ Hemden gebügelt. Wohin war er unterwegs? Wieso ist er nicht nach Hause gekommen? Und wenn ihm nun etwas passiert ist?
Auch am Abend kommt er nicht. Wieder hat sie ihm etwas gekocht, das nun abgedeckt im Kühlschrank wartet. Es ist nicht das erste Mal, dass sie ihn einen ganzen Tag nicht zu Gesicht bekommt. Doch noch nie war da dieses schwelende Gefühl des Unheils, das sie in den Schlaf begleitet und ihre Träume bestimmt.
Am nächsten Morgen, immer steht sie vor ihm auf, um sich herzurichten, Kaffee zu kochen und ihm das Frühstück vorzubereiten, erzählt er ausgiebig von den Patienten, die er behandeln musste, ohne Unterbrechung, den ganzen Tag, keine Pause. Nach ihrem Ausflug zur Hochschule fragt er nicht. Doch er berührt sie viel, lächelt sie an, streicht ihr durchs Haar.
»Keine Pause?«, fragt sie.
»Dein Mann ist ein gefragter Chirurg, Gretchen.« Er zieht sie auf seinen Schoß. »Stell dir vor, übermorgen darf ich meine erste Metastasenresektion vornehmen. Also nicht nur als Assistenz, sondern als Operateur.«
»Das ist wunderbar.« Sie lässt sich von ihm küssen und verscheucht alle dunklen Gedanken. Ganz bestimmt hat sich der Mann vom Empfang getäuscht. Lenz hat das Krankenhaus gar nicht verlassen. Er hat gearbeitet. Sie sollte ihm glauben. Sie muss.