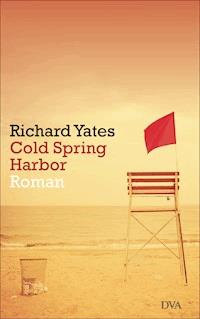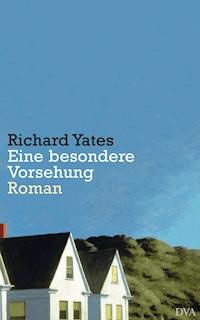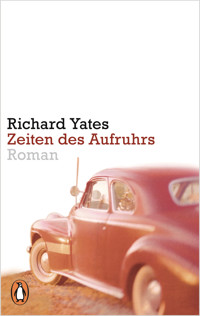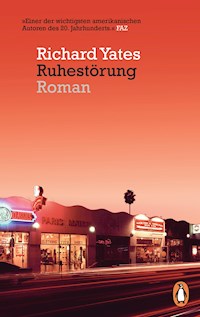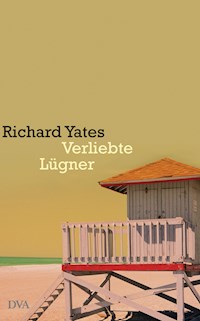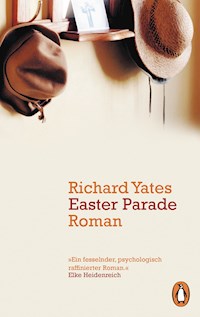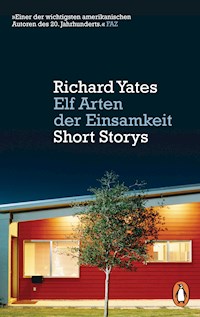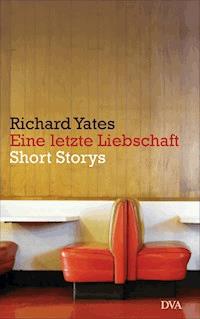
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ganz gleich, ob er das unterdrückte Begehren einer Hausfrau in der Vorstadt thematisiert, die Verzweiflung eines Büroangestellten in Manhattan oder das gebrochene Herz einer alleinerziehenden Mutter – niemand porträtiert die Alltagshoffnungen und -enttäuschungen seiner Figuren so schonungslos und doch mitfühlend wie Richard Yates. »Eine letzte Liebschaft« versammelt neun Erzählungen aus dem Nachlass des Autors, der als einer der bedeutendsten Schriftsteller der US-amerikanischen Nachkriegsgeneration gilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Inhalt
Richard Yates gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller der US-amerikanischen Nachkriegsgeneration; für manche ist er der "missing link" zwischen Tennessee Williams und Raymond Carver. Ganz gleich, ob er das unterdrückte Begehren einer Hausfrau in der Vorstadt thematisiert, die Verzweiflung eines Büroangestellten in Manhattan oder das gebrochene Herz einer alleinerziehenden Mutter – niemand portraitiert die Alltagshoffnungen und -enttäuschungen seiner Figuren so schonungslos, doch mitfühlend wie Richard Yates. »Yates' Geschichten sind immer Abschiedsgeschichten; die Sätze sind so berührend simpel, dass sie Bitterkeit nicht durch Poesie abmildern. Man kann sich an ihnen nicht festhalten – bei Yates muss man immer gegenwärtig sein, tief zu stürzen. Sein Ton hat die Schmucklosigkeit zum Grad der Empfindsamkeit erhoben.« Frankfurter Rundschau
Zum Autor
Richard Yates wurde 1926 in Yonkers, New York, geboren und lebte bis zu seinem Tod 1992 in Alabama. Obwohl seine Werke zu Lebzeiten kaum Beachtung fanden, gehören sie heute zum Wichtigsten, was die amerikanische Literatur des 20. Jahrhunderts zu bieten hat. Wie Ernest Hemingway prägte Richard Yates eine Generation von Schriftstellern. Die DVA publiziert Yates’ Gesamtwerk auf Deutsch, zuletzt erschien der Roman Cold Spring Harbor. Das Debüt Zeiten des Aufruhrs wurde 2009 mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in den Hauptrollen von Regisseur Sam Mendes verfilmt. In dem Band Eine letzte Liebschaft sind die letzten neun noch nicht veröffentlichten Erzählungen des Autors versammelt.
Richard Yates
Eine letzte Liebschaft
Short Storys
Aus dem Englischen vonThomas Gunkel
Deutsche Verlags-Anstalt
INHALT
Der Kanal
Eine Krankenhausromanze
Glocken am Morgen
Abend an der Côte D’Azur
Diebe
Ein persönliches Besitzstück
Der Rechnungsprüfer und der wilde Wind
Eine letzte Liebschaft
Ein genesendes Selbstbewusstsein
DER KANAL
»Moment mal – ist das nicht dieselbe Division, in der du warst, Lew?« Betty Miller wandte sich in Erwartung eines außergewöhnlichen Zufalls mit weit aufgerissenen Augen an ihren Mann und hätte fast ihren Drink verschüttet. Sie hatte Tom Brace mitten in einer Geschichte unterbrochen, und jetzt mussten alle auf Lew Millers Antwort warten.
»Nein, Liebling«, sagte er, »tut mir leid. Das Heer war ziemlich groß.« Er legte den Arm um ihre schmale Taille und fand es angenehm, dass ihre Hand sich um seine schlang. Wie todlangweilig diese Party doch war; seit fast einer Stunde standen sie nun mit den Braces zusammen, die sie nur flüchtig kannten – Tom Brace war Kundenbetreuer in der Werbeagentur, in der Miller als Texter arbeitete –, und es schien kein Entrinnen zu geben. Miller taten vom Stehen die Beine weh, und er wäre am liebsten nach Hause gefahren. »Erzählen Sie weiter, Tom«, sagte er.
»Ja«, sagte Betty. »Entschuldigung, Tom, erzählen Sie bitte weiter. Sie wollten gerade einen Kanal überqueren, vor ziemlich genau sieben Jahren.«
Tom Brace lachte zwinkernd und verzieh die Unterbrechung, denn er wusste, dass Frauen alberne Fragen stellten. »Nein, aber mal im Ernst, Lew«, fragte er, »bei welcher Truppe waren Sie denn?« Miller klärte ihn auf, und während Betty »O ja, natürlich« sagte, starrte Brace an die Decke und wiederholte die Zahlen. Dann sagte er: »Mensch, Lew! Bei der Aktion, von der ich gerade erzählt hab, wart ihr direkt links von uns – die Kanalüberquerung? März fünfundvierzig? Ich kann mich genau erinnern.«
Miller hatte die ganze Zeit befürchtet, es könnte sich herausstellen, dass es derselbe Kanal war, und jetzt konnte er bloß erwidern, ja, das stimme tatsächlich, im März fünfundvierzig.
»Na so was«, sagte Nancy Brace und spielte mit elegantem Zeigefinger an ihren Perlen.
Tom Brace war vor Aufregung knallrot. »Ich kann mich genau erinnern«, sagte er, »Ihre Truppe hat den Kanal ein gutes Stück weiter nördlich, links von uns, überquert, und dann haben wir einen Bogen geschlagen und uns ein paar Tage später in einer Zangenbewegung wieder getroffen. Wissen Sie noch? Verdammt, darauf müssen wir anstoßen.« Er reichte frische Cocktails herum, während das Dienstmädchen das Tablett hielt. Miller nahm dankbar einen Martini und trank einen zu großen ersten Schluck. Die beiden Männer mussten kurz über die Beschaffenheit des Geländes und die Uhrzeit des Angriffs sprechen, während ihre Frauen einander beipflichteten, dass es bestimmt ein großartiges Erlebnis gewesen war.
Miller, der Brace ansah und nickte, dabei aber den Frauen lauschte, hörte Nancy Brace schaudernd sagen: »Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie sie all das überstanden haben. Aber ich kann mir Toms Kriegsgeschichten immer wieder anhören; irgendwie macht er das Ganze so anschaulich – manchmal habe ich das Gefühl, ich wäre selbst da gewesen.«
»Ich beneide Sie«, sagte Betty Miller leise, in einem Ton, von dem Lew Miller wusste, dass er dramatisch klingen sollte, »Lew erzählt nie vom Krieg.« Und zu seinem Unbehagen begriff Miller, dass Betty, die zu viele Frauenzeitschriften las, es als romantisch empfand, einen Mann zu haben, der nie vom Krieg erzählte – vielleicht einen etwas tragischen, sensiblen oder zumindest charmant bescheidenen Mann –, sodass es eigentlich keine Rolle spielte, ob Nancy Braces Mann besser aussah, ob er in seinem Brooks-Brothers-Anzug gediegener wirkte oder früher in seiner adretten Uniform schneidiger gewesen war. Das war lächerlich, und am schlimmsten fand er, dass Betty es besser wusste. Sie wusste ganz genau, dass er im Vergleich zu jemandem wie Brace kaum etwas vom Krieg gesehen und seine Militärzeit größtenteils bei einer Pressestelle in North Carolina verbracht hatte, bis er 1944 zur Infanterie versetzt worden war. Insgeheim freute er sich natürlich – denn das hieß ja bloß, dass sie ihn liebte –, doch später, wenn sie allein sein würden, musste er sie auffordern, ihn nicht ständig zum Helden zu stilisieren, sobald jemand vom Krieg sprach. Plötzlich wurde ihm bewusst, dass Brace ihm eine Frage gestellt hatte. »Wie bitte, Tom?«
»Ich hab gefragt, wie die Überquerung bei Ihnen ablief. Wie sah die Gegenwehr aus?«
»Artilleriefeuer«, sagte Miller. »Keine nennenswerten Kleinwaffen; wissen Sie, unser eigenes Sperrfeuer gab uns genügend Deckung, und die deutsche Infanterie war wohl zurückgedrängt worden, bevor wir loslegten. Aber ihre Artillerie funktionierte noch, und die hat uns ziemlich zu schaffen gemacht. Acht-Achter.«
»Keine Maschinengewehre am anderen Ufer?« Mit der freien Hand fingerte Brace an seinem akkuraten Windsorknoten herum und reckte das Kinn, um noch ein paar Zentimeter Hals zu befreien.
»Nein«, sagte Miller, »soweit ich mich erinnern kann, gab’s da keine.«
»Wären welche da gewesen«, versicherte Brace ihm mit grimmigem Zwinkern, »dann würden Sie’s noch wissen. Die waren von Anfang an unser Problem. Wissen Sie noch, wie breit der Kanal war? Wahrscheinlich nicht mal fünfzig Meter? Also, von dem Augenblick an, als wir in diese gottverdammten kleinen Boote stiegen, waren wir in Reichweite der beiden deutschen Maschinengewehre, die vielleicht hundert Meter voneinander entfernt am anderen Ufer postiert waren. Sie warteten, bis wir mitten auf dem Wasser waren – ich saß im ersten Boot –, dann legten sie los.«
»Mein Gott«, sagte Betty Miller. »In einem Boot. Hatten Sie denn gar keine Angst?«
In Tom Braces Gesicht trat ein schüchternes, jungenhaftes Grinsen. »Hab noch nie so viel Schiss gehabt«, sagte er leise.
»Musstest du auch mit einem Boot fahren, Liebling?«, fragte Betty.
»Nein. Tom, ich wollte gerade sagen, dass wir da, wo wir waren, keine Boote brauchten. Da gab’s eine kleine Brücke, die nur zum Teil gesprengt war, die haben wir benutzt und sind das letzte Stück durchs Wasser gewatet.«
»Eine Brücke?«, fragte Brace. »Das muss ja ein echter Glücksfall gewesen sein. Konnten Sie mit den Fahrzeugen und allem ans andere Ufer fahren?«
»O nein«, sagte Miller, »nicht auf dieser Brücke; es war eher ein kleiner Holzsteg, und wie gesagt, zum Teil ins Wasser gestürzt. An jenem Tag hatte man schon mal versucht, den Kanal zu überqueren, wissen Sie, und die Brücke war zum Teil zerstört worden. Eigentlich kann ich mich nicht mehr besonders deutlich an sie erinnern – wenn ich’s mir recht überlege, könnte sie vielleicht auch von unseren eigenen Ingenieuren errichtet worden sein, aber das ist eher unwahrscheinlich.« Er lächelte. »Es ist schon lange her, und ich kann mich einfach nicht mehr erinnern, Tom. Um die Wahrheit zu sagen, ich hab ein ziemlich schlechtes Gedächtnis.«
Um die Wahrheit zu sagen … Um die Wahrheit zu sagen, dachte Miller, müsste ich zugeben: von wegen schlechtes Gedächtnis. Ich habe nur das vergessen, was mir nicht wichtig war, und in jener Nacht ging’s allein darum, im Dunkeln zu rennen, erst auf dem Beton einer Straße, dann auf lockerer Erde, danach auf schräg abfallenden Planken, die unter den Füßen bebten, und dann im Wasser. Dann waren wir am anderen Ufer, und dort mussten wir Leitern raufklettern. Es herrschte ein Riesenlärm. Daran kann ich mich gut erinnern.
»Tja«, sagte Tom Brace, »wenn es Nacht war und Sie unter Artilleriebeschuss standen, haben Sie wahrscheinlich nicht besonders auf die verdammte Brücke geachtet; da mach ich Ihnen keinen Vorwurf.«
Doch Miller wusste, dass er ihm einen Vorwurf machte; es war unverzeihlich, sich nicht an die Brücke erinnern zu können. Tom Brace hätte so etwas nie vergessen, denn von seinem Wissen hätte zu viel abgehangen. Er hätte unter den schmutzigen Gurtbändern eine plastikumhüllte Landkarte in seiner Feldjacke stecken gehabt, und wenn die Männer in seinem Zug atemlos Fragen stellten, hätte er ruhig und unaufgeregt über die gesamte taktische Lage Bescheid gewusst.
»In was für einer Einheit waren Sie, Lew?«
»Einer Schützenkompanie.«
»Waren Sie Zugführer?« Damit versuchte Brace herauszubekommen, ob er Offizier gewesen war.
»O nein«, sagte Miller. »Ich hatte keinen Rang.«
»Doch«, sagte Betty Miller. »Du warst so was wie ein Sergeant.«
Miller lächelte. »In den Staaten hatte ich den Rang eines T-4«, erklärte er Brace, »aber das war in Öffentlichkeitsarbeit, also nichts wert, als sie mich in die Infanterie steckten. Ich fuhr als Reservist rüber, als Gefreiter.«
»Ein harter Schlag«, sagte Brace. »Aber wie auch immer …«
»Ist ein T-4 nicht dasselbe wie ein Sergeant?«, fragte Betty.
»Nicht direkt, Liebling«, sagte Miller. »Das hab ich dir doch alles schon mal erklärt.«
»Aber Sie haben gesagt, an jenem Tag hätte schon jemand versucht, den Kanal zu überqueren, und wurde zurückgeworfen? Und Ihre Truppe musste es nachts noch mal probieren? Das muss bitter gewesen sein.«
»Stimmt«, sagte Miller. »Richtig bitter, denn am Nachmittag waren wir wieder ins Hinterland verlegt worden, unser Bataillon sollte ein paar Tage Ruhe kriegen, doch gerade als wir unsere Schlafsäcke ausgerollt hatten, kam der Befehl, wieder an die Front zu gehen.«
»O Gott«, sagte Brace. »Das ist uns auch immer wieder passiert. War das nicht die Hölle? Da war die Moral Ihrer Männer ja schon ruiniert, bevor Sie überhaupt losgelegt haben.«
»Tja«, sagte Miller. »Ich glaube, unsere Moral war sowieso nicht besonders hoch. So eine Truppe waren wir nicht.« Und um bei der Wahrheit zu bleiben, hätte er sagen müssen, dass das Schlimmste an jenem Nachmittag der Verlust eines Regenmantels gewesen war. Kavic, der Truppführer, hager, äußerst befähigt, neunzehn Jahre alt, hatte gesagt: »Okay, kontrolliert eure Ausrüstung. Ich will nicht erleben, dass ihr was liegen lasst«, und Miller hatte mit müden Augen und Fingern seine Ausrüstung kontrolliert. Doch später, unterwegs, legte ihm der stellvertretende Truppführer Wilson, ein korpulenter Farmer aus Arkansas, eine Hand aufs Schulterblatt. »Dein Regenmantel ist nicht an deinem Gurt, Miller. Hast du ihn verloren?«
Und als er nach kurzem Abtasten des Patronengurts den Verlust bemerkte, konnte er bloß sagen: »Ja, scheint so.«
An der Spitze der Kolonne drehte sich Kavic um. »Was ist denn da hinten los?«
»Miller hat seinen Regenmantel verloren.«
Kavic blieb stehen und wartete wütend, bis Miller neben ihm war. »Verdammt, Miller, kannst du denn auf gar nichts achtgeben?«
»Tut mir leid, Kavic, ich dachte, ich hätte ihn.«
»Na prima, dass es dir leidtut. Wenn’s das nächste Mal regnet, wird’s dir erst richtig leidtun. Du weißt verdammt gut, wie die Nachschublage ist – warum kannst du bloß auf nichts achtgeben?«
Ihm blieb nichts anderes übrig, als betreten weiterzumarschieren, mit einem Gesicht, das Scham gewohnt war. Um die Wahrheit zu sagen, war das an jenem Nachmittag das Schlimmste gewesen.
»Wo zum Teufel ist denn das Dienstmädchen?«, fragte Tom Brace. »Siehst du sie, Liebes?«
»Ich glaube, sie ist in der Küche. Ich seh mal nach«, sagte seine Frau und stöckelte, hübsch die Hüften wiegend, in ihrem teuren Cocktailkleid davon.
»Sag, dass wir alle am Verdursten sind«, rief Brace ihr nach. Dann wandte er sich wieder Miller zu. »Und was ist passiert, Lew? Ich finde es wirklich interessant, zu erfahren, was in jener Nacht in eurem Abschnitt gelaufen ist. Hat Ihre Kompanie den Angriff durchgeführt oder was?«
»Nein, eine der anderen Kompanien hat den Kanal zuerst überquert«, sagte Miller, »aber für meine Gruppe, ich meine die Gruppe, in der ich war, lief’s auf dasselbe raus, denn wir mussten für den Fernmeldetrupp des Bataillons Kabelrollen ans andere Ufer bringen und folgten direkt nach der ersten Kompanie.«
»Aha«, sagte Brace.
»Aber eigentlich war das gut, denn wir mussten nur dafür sorgen, dass das Kabel rüberkam und wir nicht in Schwierigkeiten gerieten, und nach der Überquerung saßen wir bloß rum, während der Gefechtsstand des Bataillons errichtet wurde. Wir haben den ganzen nächsten Tag auf der faulen Haut gelegen, ehe wir wieder zu unserer eigenen Kompanie stießen.«
»Moment mal, nicht so schnell«, sagte Brace. »Ich will von der eigentlichen Überquerung hören. Sie haben gesagt, dass Sie dabei unter Artilleriebeschuss standen?«
»Fing schon vorm Kanal an«, sagte Miller. Jetzt kam er aus der Sache nicht mehr heraus. »Soweit ich mich erinnere, begann der Artilleriebeschuss, als wir noch ein paar Hundert Meter entfernt auf der Straße waren.«
»Und es war nachts?«, fragte Betty.
»Ja.«
»Acht-Achter, was?«, sagte Brace.
»Stimmt.« Und plötzlich war alles wieder da. Die sieben Jahre lösten sich in nichts auf, und alles war wieder da – die dunkle, graue, von schwarzen Bäumen gesäumte Straße, die schlurfenden Männerkolonnen auf beiden Seiten. Der vertraute Schmerz der Patronengurte und Gurtbänder erfasste seine Schultern und seinen Hals, und noch ein neuer Schmerz schnitt in das Fleisch seiner Hand: ein geschlungener, verknoteter Kabelstrang, an dem eine große, schwere Stahlrolle hing. Manche Rollen hatten Griffe, doch Miller hatte eine erwischt, die keinen hatte, und beim Tragen schnitt man sich unweigerlich die Hand auf. »Bleibt zusammen«, mahnte Wilson mit heiserem Flüstern, »ihr müsst zusammenbleiben.« Die einzige Chance, im Dunkeln, fünf Schritte voneinander entfernt, zusammenzubleiben, bestand darin, sich auf den schemenhaften Rücken seines Vordermanns zu konzentrieren. Shanes Rücken war kurz und breit, sein Helm hing unterhalb der Schultern. Jedes Mal, wenn der Schemen zu undeutlich wurde, rannte Miller ein paar Schritte, um aufzuholen; und wenn er ihm zu nahe kam, hielt er sich zurück und versuchte, die fünf Schritte Abstand beizubehalten. Plötzlich spürte er einen raschen, flattrigen Luftstrom, und irgendwo auf der anderen Straßenseite machte es Wumm. Wie große zusammenbrechende Tausendfüßler rollten beide Männerkolonnen in die Straßengräben. Miller fiel flach auf den Bauch – es war ein guter, tiefer Graben –, und die Kabelrolle krachte ihm in die Nieren. Dann folgte noch ein flattriger Luftstrom und ein weiteres Wumm – diesmal näher, und in der entsetzlichen Stille vor dem nächsten Geschoss ertönten die unvermeidlichen Stimmen: »Acht-Achter« und: »Weiter, Männer, los, weiter.« Miller hatte den Kopf gerade so weit gehoben, dass er Shanes Stiefel vor sich auf der Erde ausgestreckt sah und sie mit den Fingern hätte berühren können. Wenn die Stiefel sich regten, würde auch er sich in Bewegung setzen. Der nächste Einschlag war viel lauter – Wumm! –, und Miller spürte, wie etwas gegen seinen Helm stieß und auf seinen Rücken spritzte. Von der anderen Straßenseite ertönte eine zittrige, fast reumütige Stimme: »Sani? Sanitäter?«
»Wo? Wo bist du?«
»Hier drüben, hier ist er.«
»Weiter, Männer.«
Shanes Stiefel bewegten sich, Miller rappelte sich auf und folgte ihm vornübergebeugt, das Gewehr in der einen und die Kabelrolle in der anderen Hand. Beim nächsten flattrigen Luftstrom warfen sich Shane und Miller beide rechtzeitig zu Boden – Wumm! –, dann sprangen sie schnell wieder auf und rannten. Alle rannten jetzt. Auf der anderen Straßenseite kippte eine neue Stimme von Bariton in ein wildes Falsett: »Oh-oh-oh! Oh! Oh! Da kommt Blut, Blut kommt raus, es kommt raus, es kommt raus!«
»Ruhe!«
»Bringt den Mistkerl zum Schweigen!«
»Ich blute! Ich BLUTE!«
»Wo? Wo bist du?«
»Weiter, Männer. Los, weiter.«
Shanes Rücken lief im Dunkeln weiter, scherte nach rechts aus, wieder hinauf auf die kahle Straßendecke und rannte dann noch schneller geradeaus. Miller verlor ihn aus den Augen, lief schneller und fand ihn wieder. Aber war das derselbe Rücken? War der hier nicht viel zu groß? Wieder ein flattriger Luftstrom, der Rücken warf sich auf die Straße, Miller fiel neben ihn – Wumm! –, und dann packte er seine Schulter. »Shane?«
»Falscher Mann, Kumpel.«
Miller lief wieder los. Beim nächsten Luftstrom duckte er sich krampfhaft, ohne sich hinzuwerfen – Wumm! –, und rannte dann weiter. »Shane? Shane?« Er wurde langsamer, um mit einem kleinen Mann – einem Lieutenant, wie er an dem weißen Fleck am Helm sah – in Gleichschritt zu fallen, der im Laufen »Weiter, Männer« über die Schulter rief. Mit absurder Höflichkeit fragte er: »Entschuldigung, Sir, können Sie mir sagen, wo der Fernsprechtrupp ist?« »Leider nicht, Soldat. Bedaure.« Wenigstens war auch der Lieutenant so durcheinander, dass er lachhaft höflich war. »Los, weiter, Männer.«
Miller überholte ihn und rannte dann über die Straße. Auf dem Scheitelpunkt kam ein weiterer flattriger Luftstrom, und er warf sich wie ein Baseballspieler, der auf die Homeplate schlittert, gerade noch rechtzeitig auf die andere Seite – Wumm. Jemand lag auf dem Bauch im Straßengraben. »He, Kumpel, hast du den Fernmeldetrupp gesehen?« Keine Antwort. »He, Kumpel …« Immer noch keine Antwort; vielleicht tot, oder vielleicht bloß halbtot vor Angst. Miller rannte wieder, und erst viel später dachte er: vielleicht auch verwundet. Mein Gott, ich hätte dableiben und seinen Puls fühlen, einen Sanitäter rufen sollen. Doch er rannte wieder über die Straße, warf sich jetzt nur noch wegen der Granaten hin – Wumm! –, mitunter lief er auch einfach weiter und dachte: Mein Gott, bin ich mutig – sieh doch, ich bin auf den Beinen, und alle anderen liegen am Boden. Er war sich sicher, dass er noch nie so schnell gelaufen war. Die Straße endete – bog nach rechts ab oder irgendwas –, und er lief mit den anderen geradeaus weiter, einen breiten, schlammigen Abhang hinunter. Das Sperrfeuer war jetzt größtenteils hinter ihm, zumindest schien es so. Dann kam die Brücke, auf der sich Männer drängten – »Immer mit der Ruhe, Leute … immer mit der Ruhe« –, und dann der jähe, kalte Schock von Wasser an seinen Beinen. Direkt vor ihm stürzte ein Mann mit lautem Platschen kopfüber hinein, und zwei, drei andere blieben stehen, um ihm aufzuhelfen. Das Ufer bestand zunächst wie auf der anderen Seite aus Schlamm, doch dann erhob sich eine Stützmauer aus Stein oder Beton fünf, sechs Meter hoch in die Dunkelheit. Jemand murmelte: »Leitern … Leitern«, und mit tastenden Fingern fand Miller die dunklen Holzsprossen an der Mauer. Er schlang sein Gewehr um die Schulter, schob den anderen Arm schwerfällig durch das Tragekabel der Rolle, um beide Hände frei zu haben, und begann dann hinaufzusteigen, sich dunkel weiterer Leitern auf beiden Seiten und weiterer dort hinaufsteigender Männer bewusst. Ein Stiefel trat ihm auf die Finger, und er spürte andere Finger unter seinem eigenen Stiefel. Die Sprossen endeten kurz vor dem oberen Mauerrand, und einen Augenblick geriet er ohne Halt heftig ins Taumeln, ehe sich ihm zwei Hände entgegenstreckten, um ihm hochzuhelfen. »Danke«, sagte er, kniete sich auf den Rand der Böschung, und der Mann lief davon. Miller drehte sich um und griff nach unten, um die Hände des nächsten Mannes zu ergreifen, und der sagte ebenfalls »Danke«. An der ganzen Böschung herrschte aufgeregtes, atemloses Stimmengewirr: »… Hier lang …« »… Wo denn? …« »… Hier drüben …« »… Wo zum Teufel sollen wir jetzt hin? …« Sie waren auf einem gepflügten Acker; der unebene Boden gab unter Millers Stiefeln nach wie ein weicher Schwamm. Er folgte den Geräuschen und Schatten und rannte wieder, während die Granaten über seinen Kopf hinwegflogen, um – Wumm … Wumm … Wumm … – ein gutes Stück hinter ihm am anderen Ufer des Kanals einzuschlagen. Und dort auf dem Acker war es, dass plötzlich Wilsons Stimme fragte: »Miller? Bist du das?«
ENDE DER LESEPROBE