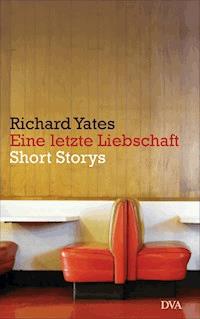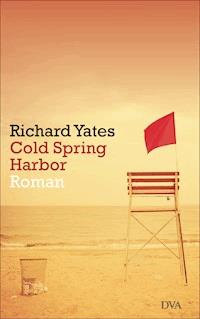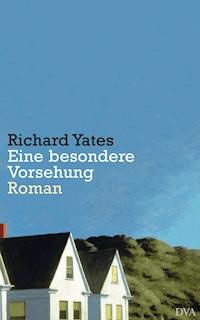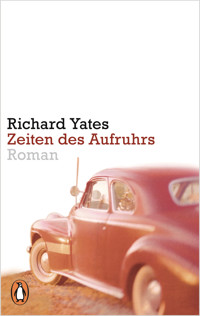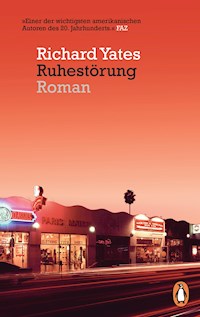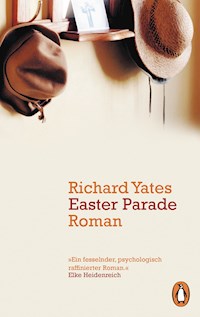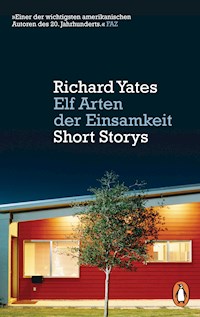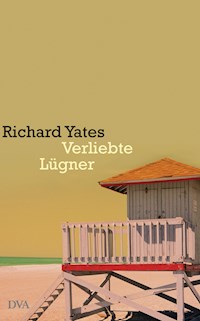
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zeitlose Geschichten von einem der wichtigsten amerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts
Richard Yates, der Meister der klaren Worte, prägte eine ganze Generation von Schriftstellern. Seine Kurzgeschichten gehören zum Besten, was je in diesem Genre geschrieben wurde, und er gilt als der wichtigste literarische Chronist des amerikanischen Durchschnittslebens der 1930er- bis späten 1960er-Jahre. In »Verliebte Lügner« zeichnet Richard Yates mit lakonischer Schärfe die Schattenseiten des amerikanischen Traums. Zutiefst einfühlsam, gleichzeitig ehrlich und unsentimental kreisen seine Geschichten um das Streben nach Glück – und um dessen unvermeidbares Scheitern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Richard Yates
Verliebte Lügner
Short Storys
Aus dem Amerikanischenvon Anette Grube
Deutsche Verlags-Anstalt
Die Originalausgabe erschien 1981 unter dem Titel »Liars in Love« bei Delacorte Press/Seymour Lawrence in New York.
Der Übersetzung lag der 2001 bei Henry Holt and Company, LLC, New York, erschienene Sammelband »The Collected Stories of Richard Yates« zugrunde.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage Copyright © 1978, 1980, 1981 by Richard Yates Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2007 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Alle Rechte vorbehalten Typographie und Satz: DVA/Brigitte Müller
ISBN 978-3-641-24715-7V001
www.dva.de
www.randomhouse.de
Inhalt
Ach, Joseph, ich bin so müde
Nachdem Franklin D. Roosevelt die Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte, muß es in ganz Amerika Bildhauer gegeben haben, die sich die Chance wünschten, er würde ihnen für eine Büste Modell sitzen, meine Mutter jedoch hatte Verbindungen. Einer ihrer besten Freunde und ein Nachbar in dem Hof in Greenwich Village, in dem wir wohnten, war ein liebenswürdiger Mann namens Howard Whitman, der vor kurzem seine Stelle als Reporter bei der New York Post verloren hatte. Und einer von Howards früheren Kollegen bei der Post arbeitete jetzt im Pressebüro von Roosevelts New Yorker Hauptquartier. Dadurch hätte sie leichten Zugang – oder, wie sie es ausdrückte, ein Entree –, und sie war zuversichtlich, daß sie von dort allein weiterkäme. In jenen Tagen war sie bei allem, was sie tat, zuversichtlich, doch damit konnte sie das schreckliche Bedürfnis nach Beistand und allseitiger Anerkennung nicht ganz überspielen.
Sie war keine wirklich gute Künstlerin. Erst seit drei Jahren, seit sie die Ehe mit meinem Vater beendet hatte, bildhauerte sie, und ihre Arbeiten hatten noch etwas Steifes und Laienhaftes. Vor dem Roosevelt-Projekt waren »Gartenstatuen« ihre Spezialität gewesen – ein lebensgroßer kleiner Junge, dessen Beine von den Knien abwärts zu Bocksbeinen wurden, und ein anderer Junge, der zwischen Farnen kniete und auf einer Panflöte spielte; kleine Mädchen, die mit erhobenen Armen Gänseblümchenketten nach sich zogen oder neben einer Gans mit ausgebreiteten Flügeln hergingen. Diese phantasiereichen Kinder, aus grün bemaltem Gips, um alte Bronze zu imitieren, waren in ihrem Atelier auf selbstgezimmerten Holzsockeln so arrangiert, daß in der Mitte genug Platz frei blieb für den Modelliertisch, auf dem sich befand, woran immer sie gerade arbeitete.
Ihre Vorstellung war, daß zahllose reiche Leute, alle elegant und aristokratisch, sie demnächst entdecken würden: Sie würden mit ihren Skulpturen ihre landschaftlich gestalteten Gärten dekorieren und sie als Freundin fürs Leben haben wollen. In der Zwischenzeit würde ein bißchen landesweite Publizität als erste Bildhauerin, die den zukünftigen Präsidenten »machte«, ihrer Karriere bestimmt nicht schaden.
Und, wenn sie auch sonst nichts hatte, so hatte sie doch ein gutes Atelier. Es war das beste aller Ateliers, die sie im Leben haben sollte. Sechs oder acht alte Gebäude gingen auf unserer Seite auf den Innenhof hinaus, die Rückseiten befanden sich in der Bedford Street, und unseres war wahrscheinlich das schönste der Reihe, weil der vorderste Raum im Erdgeschoß zwei Stockwerke hoch war. Man ging eine breite Backsteintreppe hinunter zu dem großen Fenster und der Eingangstür; von dort trat man in das hohe, weite, lichtdurchflutete Atelier. Es war groß genug, um auch als Wohnzimmer zu dienen, und deswegen standen darin neben den grünen Gartenkindern alle Wohnzimmermöbel aus dem Haus, in dem wir mit meinem Vater in dem Vorort Hastings-on-Hudson gelebt hatten, wo ich geboren war. Am anderen Ende des Ateliers führte eine Galerie in Höhe des ersten Stocks zu zwei kleinen Schlafzimmern und einem winzigen Bad; darunter, wo sich das Erdgeschoß zur Seite der Bedford Street fortsetzte, befand sich der einzige Teil der Wohnung, der vermuten ließ, daß wir nicht viel Geld hatten. Die Decke war sehr niedrig, und es war dort immer dunkel; die kleinen Fenster befanden sich unterhalb eines Eisengitters im Gehweg, und der Boden dieses Hohlraums in der Straße war dick mit Müll bestreut. Unsere von Kakerlaken heimgesuchte Küche war kaum groß genug für einen Herd und eine Spüle, die immer verschmutzt waren, und für einen braunen Eisschrank aus Holz mit einem dunklen, ewig schmelzenden Eisblock darin; der Rest des Bereichs war unser Speisezimmer, und nicht einmal der große alte Eßtisch aus Hastings konnte es aufhellen. Aber dort stand auch unser Majestic-Radio, und deswegen war es für meine Schwester Edith und mich ein gemütlicher Ort: Wir mochten die Kinderprogramme, die spätnachmittags gesendet wurden.
Eines Tages schalteten wir das Radio aus und gingen ins Atelier, wo unsere Mutter das Roosevelt-Projekt mit Howard Whitman besprach. Wir hörten zum ersten Mal davon, und wir mußten sie mit zu vielen Fragen unterbrochen haben, denn sie sagte: »Edith? Billy? Jetzt ist es genug. Ich werde euch später alles erzählen. Geht in den Garten und spielt.«
Sie nannte den Hof immer »den Garten«, obwohl dort nichts wuchs außer ein paar verkrüppelten Stadtbäumen und einem Stückchen Rasen, der nie die Chance hatte, sich auszubreiten. Überwiegend war es nackte Erde, hier und da mit Backsteinen gepflastert, dünn mit Ruß gepudert und mit Hunde- und Katzenkot bestreut. Er mag sechs oder acht Häuser lang gewesen sein, aber er war nur zwei Häuser breit, weswegen er eng und freudlos wirkte; das einzig Interessante war ein schiefer Springbrunnen aus Marmor, nicht viel größer als eine Vogeltränke, der nahe bei unserem Haus stand. Ursprünglich sollte das Wasser gleichmäßig über den Rand der oberen Schale in das untere Becken tropfen, aber das Alter hatte den Brunnen aus dem Gleichgewicht gebracht; das Wasser lief in einem einzigen schmalen Strahl über die paar Zentimeter Rand der oberen Schale, die sauber geblieben waren. Das untere Becken war tief genug, um sich an einem heißen Tag die Füße abzukühlen, aber das war kein großes Vergnügen, weil der unter Wasser stehende Teil des Marmors mit braunem Schleim überzogen war.
Meine Schwester und ich fanden während der zwei Jahre, die wir dort lebten, im Hof jeden Tag etwas zu tun, aber nur, weil Edith ein phantasiereiches Kind war. Zur Zeit des Roosevelt-Projekts war sie elf, und ich war sieben.
»Daddy?« sagte sie eines Nachmittags im Büro zu unserem Vater. »Weißt du schon, daß Mommy den Kopf von Präsident Roosevelt macht?«
»Ja?« Er kramte in seinem Schreibtisch auf der Suche nach etwas, von dem er meinte, daß es uns gefallen würde.
»Sie nimmt seine Maße hier in New York«, sagte Edith, »und dann, nach der Amtseinführung, wenn der Kopf fertig ist, bringt sie die Skulptur nach Washington und überreicht sie ihm im Weißen Haus.« Edith erzählte gern dem einen Elternteil von den tugendhafteren Aktivitäten des jeweils anderen; es war Teil ihrer ausdauernden, hoffnungslosen Bemühung, sie wieder zusammenzubringen. Viele Jahre später erzählte sie mir, daß sie sich nie vom Schock ihrer Trennung erholt habe und es auch nie tun würde: Sie sagte, Hastings-on-Hudson sei die glücklichste Zeit in ihrem Leben gewesen, und ich wurde neidisch, weil ich mich kaum daran erinnern konnte.
»Na ja«, sagte mein Vater. »Das ist doch was.« Dann fand er, wonach er in seinem Schreibtisch gesucht hatte, und sagte: »Da sind sie ja. Wie findet ihr sie?« Es waren zwei dünne perforierte Bögen von etwas, was wie Briefmarken aussah, auf jeder Marke befanden sich vor einem gelben Hintergrund eine leuchtend weiße elektrische Glühbirne und die Worte »Mehr Licht«.
Das Büro meines Vaters war eine von vielen kleinen Arbeitsnischen im dreiundzwanzigsten Stock des General-Electric-Gebäudes. Er war stellvertretender Regionalverkaufsleiter in der damals sogenannten Mazda-Lampen-Abteilung – ein bescheidener Job, aber gut genug, um in besseren Zeiten ein Haus in einer Stadt wie Hastings-on-Hudson zu mieten –, und die »Mehr Licht«-Marken waren Souvenirs von einer kurz zurückliegenden Verkaufskonferenz. Wir sagten, die Marken seien toll – und das waren sie –, brachten jedoch Unsicherheit zum Ausdruck, was wir damit anfangen sollten.
»Ach, die sind nur zur Zierde«, sagte er. »Ich dachte, ihr könntet sie in eure Schulbücher kleben oder – na ja – was immer ihr wollt. Fertig?« Und er faltete die Bögen mit den Marken sorgfältig zusammen und steckte sie in die Innentasche seines Jacketts, damit ihnen auf dem Nachhauseweg nichts passierte.
Zwischen dem Ausgang der U-Bahn und dem Hof, irgendwo im West Village, kamen wir stets an einem unbebauten Grundstück vorbei, auf dem Männer um kleine Feuer aus Obstkisten und Müll standen; manche wärmten Essen in Dosen auf, die sie an Kleiderbügeln aus Draht über die Flammen hielten. »Schaut nicht hin«, hatte mein Vater beim ersten Mal gesagt. »Die Männer haben keine Arbeit, und sie sind hungrig.«
»Daddy?« fragte Edith. »Findest du Roosevelt gut?«
»Na klar.«
»Findest du alle Demokraten gut?«
»Die meisten, ja.«
Viel später erfuhr ich, daß mein Vater sich jahrelang auf örtlicher Ebene für die Politik der Demokraten engagiert hatte. Er hatte einigen seiner politischen Freunde – Männer, die meine Mutter als schreckliche kleine Iren aus Tammany Hall beschrieb – einen Gefallen getan, indem er ihnen half, in verschiedenen Stadtteilen Vertriebsagenturen für Mazda-Lampen zu etablieren. Und er liebte ihre Zusammenkünfte, bei denen er immer gebeten wurde zu singen.
»Du bist natürlich zu jung, um dich noch daran zu erinnern, wie Daddy gesungen hat«, sagte Edith einmal zu mir nach seinem Tod 1942.
»Nein, das bin ich nicht. Ich erinnere mich.«
»Aber ich meine, erinnerst du dich wirklich?« sagte sie. »Er hatte den schönsten Tenor, den ich je gehört habe. Erinnerst du dich an ›Danny Boy‹?«
»Klar.«
»Ach Gott, das war was«, sagte sie und schloß die Augen. »Das war wirklich – das war wirklich was.«
Als wir an diesem Nachmittag nach Hause kamen und das Atelier betraten, sehen Edith und ich unseren Eltern zu, wie sie sich begrüßten. Wir beobachteten sie immer genau und hofften, daß sie ein Gespräch beginnen, sich setzen und Dinge finden würden, über die sie lachen könnten, aber das geschah nie. Und an diesem Tag war es noch unwahrscheinlicher als sonst, weil meine Mutter einen Gast hatte – eine Frau namens Sloane Cabot, die ihre beste Freundin im Hof war und meinen Vater mit einem kleinen Ansturm falscher koketter Begeisterung begrüßte.
»Wie geht es dir, Sloane?« sagte er. Dann wandte er sich an seine frühere Frau und sagte: »Helen? Ich habe gehört, du willst eine Büste von Roosevelt machen?«
»Na ja, keine Büste«, sagte sie. »Den Kopf. Ich glaube, es ist wirkungsvoller, wenn ich mit dem Hals aufhöre.«
»Gut. Das ist gut. Viel Glück damit. Okay.« Er wandte seine ganze Aufmerksamkeit Edith und mir zu. »Okay. Bis bald. Wie wär’s mit einer Umarmung?«
Und seine Umarmungen, der Höhepunkt seiner ihm rechtlich zustehenden Besuche, waren unvergeßlich. Einer nach dem anderen wurden wir hochgerissen und fest in den Geruch von Wäsche, Whiskey und Tabak gedrückt; sein Kinn kratzte warm über eine Wange, und er gab uns einen kurzen, feuchten Kuß neben das Ohr; dann ließ er uns wieder los.
Er war schon fast aus dem Hof, schon fast auf der Straße, als Edith und ich ihm nachrannten.
»Daddy! Daddy! Du hast die Briefmarken vergessen!«
Er blieb stehen und drehte sich um, und da sahen wir, daß er weinte. Er versuchte es zu verheimlichen – er steckte das Gesicht nahezu in die Achselhöhle, als könnte er so besser in seiner Innentasche suchen –, aber es ist unmöglich, die geschwollenen und verzerrten Züge eines tränenüberströmten Gesichts zu verbergen.
»Hier«, sagte er. »Hier sind sie.« Und er lächelte so wenig überzeugend, wie ich es nie zuvor gesehen hatte. Es wäre gut, wenn ich sagen könnte, daß wir blieben und mit ihm sprachen – daß wir ihn erneut umarmten –, aber wir waren zu verlegen. Wir nahmen die Marken und rannten damit nach Hause, ohne uns umzublicken.
»Bist du nicht aufgeregt, Helen?« fragte Sloane Cabot. »Daß du ihn triffst und mit ihm redest und alles, noch dazu vor all diesen Journalisten?«
»Natürlich«, sagte meine Mutter, »aber wichtig ist, daß ich die Maße richtig nehme. Ich hoffe nur, daß nicht so viele Fotografen da sind und es nicht dauernd zu albernen Unterbrechungen kommt.«
Sloane Cabot war ein paar Jahre jünger als meine Mutter und auffallend hübsch auf eine Weise, wie man sie oft auf zeitgenössischen Art-déco-Illustrationen sieht: gerader dunkler Pony, große Augen und großer Mund. Auch sie war eine geschiedene Mutter, ihr früherer Mann war allerdings vor langer Zeit schon verschwunden und wurde nur »der Dreckskerl« oder »der feige Kotzbrocken« genannt. Ihr einziges Kind war ein Junge in Ediths Alter namens John, den Edith und ich ungeheuer mochten.
Die beiden Frauen lernten sich ein paar Tage nach unserem Einzug kennen, und ihre Freundschaft war besiegelt, als meine Mutter das Problem von Johns Schulbesuch löste. Sie kannte in Hastings-on-Hudson eine Familie, die das Geld, das sie durch einen Untermieter verdienen würde, gut gebrauchen konnte, und so lebte John bei ihnen und ging dort zur Schule und kam nur an den Wochenenden nach Hause. Das Arrangement kostete mehr, als Sloane sich bequem leisten konnte, aber sie schaffte es und war ewig dankbar.
Sloane arbeitete als Privatsekretärin an der Wall Street. Sie sprach viel davon, wie sehr sie ihre Arbeit und ihren Chef haßte, aber das Gute daran war, daß ihr Chef oft für längere Zeit nicht in der Stadt war: Dann hatte sie Muße, die Büroschreibmaschine zu benutzen, um den Ehrgeiz ihres Lebens zu verfolgen, nämlich Skripte für den Rundfunk zu schreiben.
Einmal vertraute sie meiner Mutter an, daß sie ihren Namen erfunden habe: »Sloane«, weil er männlich klang und die Art Name war, den eine alleinstehende Frau brauchte, um sich in der Welt durchzusetzen, und »Cabot«, weil er – nun ja, weil er eine Spur Klasse hatte. War daran etwas auszusetzen?
»Oh, Helen«, sagte sie. »Das wird wunderbar für dich werden. Wenn du richtig bekannt wirst – wenn die Zeitungen es aufgreifen und die Wochenschauen –, wirst du eine der interessantesten Persönlichkeiten in Amerika sein.«
Fünf oder sechs Leute hatten sich an dem Tag in ihrem Atelier eingefunden, an dem meine Mutter von ihrem ersten Besuch beim gewählten Präsidenten nach Hause kam.
»Holt mir jemand einen Drink?« sagte sie und schaute sich gespielt hilflos um. »Dann erzähle ich euch alles.«
Und mit dem Drink in der Hand und Augen so groß wie die eines Kindes, erzählte sie uns, wie eine Tür geöffnet wurde und zwei große Männer ihn hereinbrachten.
»Große Männer«, betonte sie. »Junge, kräftige Männer, die ihn unter den Armen hielten, und man sah, daß sie sich anstrengen mußten. Dann sah man seinen Fuß mit diesen schrecklichen Metallklammern auf dem Schuh, und dann den anderen Fuß. Und er schwitzte, und er schnappte nach Luft, und sein Gesicht war – ich weiß nicht – ganz glänzend und angespannt und schrecklich.« Sie schauderte.
»Na ja«, sagte Howard Whitman und blickte unbehaglich drein, »er kann nichts dafür, daß er verkrüppelt ist, Helen.«
»Howard«, sagte sie ungeduldig, »ich versuche euch nur zu schildern, wie häßlich alles war.« Und das schien ein gewisses Gewicht zu haben. Wenn sie eine Autorität für Schönheit war – dafür, wie ein kleiner Junge im Farn knien sollte, um Panflöte zu spielen, zum Beispiel –, dann mußte sie doch erst recht eine beglaubigte Autorität für Häßlichkeit sein.
»Wie auch immer«, fuhr sie fort, »sie haben ihn auf einen Stuhl gesetzt, und er hat sich mit einem Taschentuch den Schweiß vom Gesicht gewischt – er war noch immer außer Atem –, und nach einer Weile hat er angefangen, mit ein paar Männern zu reden; dem konnte ich nicht folgen. Dann hat er sich endlich an mich gewandt, mit diesem Lächeln. Ehrlich, ich weiß nicht, ob ich dieses Lächeln beschreiben kann. In der Wochenschau kann man es nicht sehen, man muß leibhaftig dabei sein. Seine Augen verändern sich überhaupt nicht, aber seine Mundwinkel gehen nach oben, als würden sie wie bei einer Marionette an Schnüren gezogen. Es ist ein furchterregendes Lächeln. Man muß unwillkürlich denken: Das könnte ein gefährlicher Mann sein. Das könnte ein böser Mann sein. Na ja, wie auch immer, wir haben angefangen, miteinander zu reden, und ich habe es ihm rundheraus gesagt. Ich habe gesagt: ›Ich habe nicht für Sie gestimmt, Mr. President.‹ Ich habe gesagt: ›Ich bin eine gute Republikanerin und habe für Präsident Hoover gestimmt.‹ Er hat gesagt: ›Warum sind Sie dann hier?‹, oder so etwas Ähnliches, und ich habe gesagt: ›Weil Sie einen sehr interessanten Kopf haben.‹ Dann hat er mich wieder auf diese Art angelächelt und gesagt: ›Was ist interessant daran?‹ Und ich habe gesagt: ›Ich mag die Beulen darauf.‹«
Zu diesem Zeitpunkt muß sie angenommen haben, daß alle Journalisten im Raum in ihre Notizbücher schrieben, und die Fotografen ihre Blitzlichter vorbereiteten. In den Zeitungen von morgen könnte gut stehen:
BILDHAUERIN ZIEHT FDR WEGEN »BEULEN« AM KOPF AUF
Nach dem einführenden Geplauder mit ihm machte sie sich an die Arbeit, die darin bestand, diverse Partien seines Kopfes mit dem Bauchzirkel zu vermessen. Wie sich das anfühlte, wußte ich: Die kalten, zitternden Enden des mit Ton verkrusteten Zirkels hatten mich gekitzelt und gestoßen, als ich ihr als Modell diente für ihre entrückten kleinen Waldbuben.
Aber nicht ein Blitzlicht explodierte, während sie die Maße nahm und notierte, und niemand stellte ihr Fragen; nach ein paar nervösen Dankes- und Abschiedsworten stand sie wieder im Flur zwischen all den verzweifelten, den Hals reckenden Leuten, die nicht hinein durften. Es muß eine große Enttäuschung gewesen sein, und ich denke, daß sie versuchte, sich dafür zu entschädigen, indem sie genau überlegte, auf welch triumphale Weise sie uns davon erzählen würde, sobald sie wieder zu Hause wäre.
»Helen?« sagte Howard Whitman, nachdem die meisten anderen Besucher gegangen waren. »Warum hast du ihm erzählt, daß du nicht für ihn gestimmt hast?«
»Weil es die Wahrheit ist. Ich bin wirklich eine gute Republikanerin, das weißt du doch.«
Sie war die Tochter eines Ladenbesitzers in einer Kleinstadt in Ohio; wahrscheinlich war sie aufgewachsen mit der Phrase vom »guten Republikaner« im Ohr als Sinnbild für Ehrbarkeit und saubere Kleidung. Und sie mochte ihre Wertvorstellungen gelockert haben, es mochte ihr sogar nicht mehr viel an sauberer Kleidung liegen, aber an dem »guten Republikaner« hielt sie fest. Er wäre hilfreich, wenn die Kunden für ihre Gartenstatuen kämen, Leute, deren leise, höfliche Stimmen sie in ihrem Leben willkommen hießen und die höchstwahrscheinlich auch Republikaner wären.
»Ich glaube an die Aristokratie!« rief sie oft und versuchte, sich im Lärm der Stimmen Gehör zu verschaffen, wenn ihre Gäste über den Kommunismus diskutierten, aber nur selten schenkte ihr jemand Beachtung. Sie mochten sie durchaus: Bei ihren Partys gab es viel zu trinken, und sie war eine angenehme Gastgeberin, wenn auch nur aufgrund ihres rührenden Eifers zu gefallen; aber bei Gesprächen über Politik verhielt sie sich wie ein schrilles, nervtötendes Kind. Sie glaubte an die Aristokratie.
Sie glaubte auch an Gott oder zumindest an den Gottesdienst der Episkopalkirche St. Luke’s, an dem sie ein- oder zweimal im Jahr teilnahm. Und sie glaubte an Eric Nicholson, den gutaussehenden Engländer mittleren Alters, der ihr Liebhaber war. Er hatte irgend etwas zu tun mit der amerikanischen Niederlassung einer englischen Gießereikette: Seine Firma goß dekorative Elemente in Bronze und Blei. Die Kuppeln von College- und Highschool-Gebäuden überall im Osten, die Bleirahmen von Flügelfenstern für Häuser im Tudorstil in Orten wie Scarsdale und Bronxville – das waren ein paar der Dinge, die Eric Nicholsons Firma ausführte. Was seine Arbeit anbelangte, war er immer sehr bescheiden, aber er wurde rot und glühte, wenn er vom Erfolg der Firma sprach.
Meine Mutter hatte ihn im Jahr zuvor kennengelernt, als sie Hilfe suchte, um eine Gartenstatue in Bronze gießen zu lassen, um sie dann einer Gartenskulptur-Galerie »in Kommission« zu geben, die sie allerdings nie verkaufte. Eric Nicholson hatte sie davon überzeugt, daß Blei fast so schön wäre wie Bronze und viel billiger; dann hatte er sie zum Abendessen eingeladen, und dieser Abend veränderte unser Leben.
Mr. Nicholson sprach nur selten mit meiner Schwester oder mir, und ich glaube, wir hatten beide Angst vor ihm, aber er überhäufte uns mit Geschenken. Zuerst waren es vor allem Bücher – ein Band mit Karikaturen aus Punch, Teile einer Gesamtausgabe von Dickens, ein Buch mit dem Titel England zu Zeiten der Tudor, das mit Seidenpapier bedeckte farbige Bildtafeln enthielt, die Edith gefielen. Aber im Sommer 1933, als unser Vater dafür sorgte, daß wir mit unserer Mutter zwei Wochen an einem kleinen See in New Jersey verbringen konnten, kamen Mr. Nicholsons Geschenke aus einem Füllhorn voller Sportartikel. Er schenkte Edith eine Angel aus Stahl mit einer so komplizierten Spule, daß niemand von uns ihre Handhabung begriffen hätte, auch wenn wir gewußt hätten, wie man angelt, einen Weidenkorb für die Fische, die sie nie fing, und ein Jagdmesser mit Scheide, das an der Hüfte zu tragen war. Mir schenkte er eine kurze Axt, deren Blatt in einem Lederholster steckte und am Gürtel hing – vermutlich sollte ich damit das Feuerholz hacken, um den Fisch zu braten –, und einen sperrigen Kescher mit einem elastischen Schulterband für den Fall, daß ich ins Wasser waten und Edith dabei helfen müßte, einen schwierigen Fisch an Land zu ziehen. In dem Dorf in New Jersey konnte man nichts tun als lange Spaziergänge machen oder, wie meine Mutter es nannte, gute Wanderungen unternehmen; und jeden Tag, wenn wir in der Sonne durch das insektenverseuchte Unkraut stapften, trugen wir den vollen Staat unserer nutzlosen Ausrüstung.
In diesem Sommer schenkte mir Mr. Nicholson ein dreijähriges Abonnement für Field & Stream, und ich denke, daß diese undurchdringliche Zeitschrift das unangemessenste all seiner Geschenke war, denn es kam lange, lange mit der Post, nachdem alles andere in unserem Leben sich geändert hatte: Nachdem wir von New York nach Scarsdale gezogen waren, wo Mr. Nicholson ein günstiges Haus mietete, und nachdem er meine Mutter in diesem Haus – ohne Vorwarnung – verlassen hatte und nach England zurückgegangen war zu seiner Frau, von der er sich nie hatte scheiden lassen.
Aber all das war später; ich möchte zurückkehren zu der Zeit zwischen Franklin D. Roosevelts Wahl und seiner Amtseinführung, als sein Kopf auf dem Modelliertisch meiner Mutter langsam Gestalt annahm.
Ihr ursprünglicher Plan war gewesen, ihn lebensgroß oder größer zu machen, aber Mr. Nicholson drängte sie, ihn wegen der Kosten für den Guß zu verkleinern, und so machte sie ihn nur ungefähr fünfzehn Zentimeter groß. Und zum zweiten Mal, seitdem sie sich kannten, überzeugte er sie davon, daß Blei nahezu so schön war wie Bronze.
Sie sagte immer, daß sie nichts dagegen habe, wenn Edith und ich ihr bei der Arbeit zusahen, aber wir hatten nie besondere Lust dazu; jetzt war es ein bißchen interessanter, weil wir ihr dabei zuschauen konnten, wie sie zahllose, aus Zeitungen ausgeschnittene Fotos von Roosevelt sichtete, bis sie eins fand, daß ihr dabei half, die heikle Fläche von Wange oder Stirn auszuführen.
Aber den Großteil unserer Zeit beanspruchte die Schule. John Cabot mochte in Hastings-on-Hudson zur Schule gehen, nach dem sich Edith immer sehnte, aber wir hatten es, das mußte sogar Edith zugeben, am zweitbesten getroffen: Wir gingen in unserem Zimmer zur Schule.
In den Jahren zuvor hatte uns meine Mutter in die staatliche Schule in unserer Straße geschickt, aber das begann sie zu bereuen, als wir mit Läusen nach Hause kamen. Dann wurde Edith eines Tages beschuldigt, einem Jungen den Mantel gestohlen zu haben, und das war zuviel. Sie nahm uns beide von der Schule, dem Schulamt zum Trotz, und bat meinen Vater, einen Teil der Kosten für eine Privatschule zu übernehmen. Er weigerte sich. Die Miete, die sie zahlte, und die Rechnungen, die sie anhäufte, belasteten ihn bereits weit über die Scheidungsvereinbarung hinaus; er hatte Schulden; ihr mußte doch klar sein, daß er sich glücklich schätzen konnte, überhaupt Arbeit zu haben. Würde sie denn niemals vernünftig werden?
Es war Howard Whitman, der den toten Punkt überwand. Er wußte von einer günstigen, staatlich anerkannten Fernschule namens Calvert School, die vor allem körperlich behinderte Kinder versorgte. Die Calvert School verschickte wöchentlich Bücher, Unterrichtsmaterial und Lehrpläne; man bräuchte nur jemanden im Haus, der die Lehrpläne umsetzte und als Lehrer fungierte. Und jemand wie Bart Kampen wäre ideal für diese Aufgabe.
»Der dürre Kerl?« fragte sie. »Der junge Jude aus Holland oder wo immer er herkommt?«
»Er ist sehr gut ausgebildet, Helen«, sagte Howard. »Und er spricht fließend englisch und wäre überaus gewissenhaft. Und das Geld könnte er auch gebrauchen.«
Wir waren begeistert, als wir erfuhren, daß Bart Kampen unser Lehrer sein würde. Abgesehen von Howard war Bart wahrscheinlich der Erwachsene im ganzen Hof, den wir am meisten mochten. Er war ungefähr achtundzwanzig, jung genug, daß seine Ohren noch rot anliefen, wenn er von Kindern verspottet wurde; das hatten wir herausgefunden, indem wir ihn ein –, zweimal wegen solcher Sachen wie nicht zusammenpassender Socken aufzogen. Er war groß und sehr dünn und wirkte immer erschrocken, außer wenn er sich wohl genug fühlte, um zu lächeln. Er war Geiger, ein holländischer Jude, der im Jahr zuvor emigriert war in der Hoffnung, in einem Symphonieorchester spielen und schließlich Karriere als Konzertgeiger machen zu können. Aber die Symphonieorchester stellten ihn nicht ein, kleinere Orchester auch nicht, und Bart hatte seit langem keine Arbeit. Er lebte allein in einem Zimmer in der Seventh Avenue, nicht weit von unserem Hof, und die Leute, die ihn mochten, machten sich Sorgen, daß er nicht genug zu essen hätte. Er besaß zwei Anzüge, beide in einem Schnitt, der damals in den Niederlanden modern gewesen sein muß: harte, dick gepolsterte Schultern und stark tailliert; wahrscheinlich hätten sie besser ausgesehen an jemandem, der mehr Fleisch auf den Knochen hatte. In Hemdsärmeln, mit aufgerollten Manschetten, wirkten seine haarigen Handgelenke und Unterarme noch zerbrechlicher, als man erwartet hätte, aber seine langen Hände waren wohlgeformt und kräftig genug, um vermuten zu lassen, daß er ein Meister auf der Geige war.
»Das überlasse ich ganz Ihnen, Bart«, sagte meine Mutter, als er sie fragte, ob sie irgendwelche Anweisungen hinsichtlich seiner Lehrtätigkeit hätte. »Ich weiß, daß Sie mit ihnen Wunder vollbringen werden.«
Ein kleiner Tisch und drei Stühle wurden in unser Zimmer gebracht und ans Fenster gestellt. Bart saß in der Mitte, so daß er die Zeit gleichmäßig zwischen Edith und mir aufteilen konnte. Große, ordentliche, schwere braune Umschläge kamen einmal in der Woche mit der Post von der Calvert School, und wenn Bart ihren faszinierenden Inhalt auf den Tisch gleiten ließ, war es, als würden wir uns setzen, um ein Spiel zu beginnen.
Edith war in jenem Jahr in der fünften Klasse – an ihrer Hälfte des Tisches wurde Unverständliches über Englisch und Geschichte und Sozialkunde gesprochen –, und ich war in der ersten. Ich verbrachte die Vormittage damit, mit Hilfe von Bart die Eröffnungszüge einer Schulbildung auszutüfteln.
»Laß dir Zeit, Billy«, sagte er. »Verlier die Geduld nicht. Wenn du es erst verstanden hast, wirst du sehen, wie einfach es ist, und dann bist du bereit für den nächsten Schritt.«
Um elf machten wir immer eine Pause. Wir gingen hinaus in den Teil des Hofes, wo das bißchen Gras wuchs. Bart legte sein zusammengefaltetes Jackett vorsichtig auf die Seite, stülpte die Manschetten um und erklärte sich bereit für das, was er Flugzeugfliegen nannte. Er faßte einen von uns an Handgelenk und Knöchel; dann hob er uns hoch, drehte sich auf der Stelle und wirbelte uns im Kreis herum, bis der Hof, die Gebäude, die Stadt und die Welt in unserem schwindelerregenden Flug verschwammen.
Nach dem Flugzeugfliegen liefen wir die Stufen hinunter ins Atelier, wo meine Mutter für gewöhnlich ein Tablett mit drei großen Gläsern kalter Ovomaltine für uns bereit gestellt hatte, manchmal lagen Kekse auf der Seite, manchmal nicht. Einmal hörte ich, wie sie zu Sloane Cabot sagte, sie glaube, die Ovomaltine sei das erste, was Bart täglich zu sich nehme – und ich denke, sie hatte wahrscheinlich recht, weil seine Hand zitterte, wenn er nach dem Glas griff. Manchmal vergaß sie, das Tablett vorzubereiten, dann drängten wir uns in die Küche und machten es selbst; ich kann in keinem Lebensmittelladen eine Dose Ovomaltine sehen, ohne an diese Zeit zu denken. Dann ging oben der Unterricht weiter. Und indem er mir schmeichelte, mich antrieb und mir einschärfte, nicht die Geduld zu verlieren, lehrte mich Bart Kampen in diesem Jahr das Lesen.
Es war eine ausgezeichnete Sache, um damit anzugeben. Ich zog Bücher aus dem Regal meiner Mutter – überwiegend Bücher, die Mr. Nicholson ihr geschenkt hatte – und versuchte sie zu beeindrucken, indem ich ihr laut verstümmelte Sätze vorlas.
»Wunderbar, mein Schatz«, sagte sie dann. »Du hast wirklich lesen gelernt.«
Bald klebte auf jeder Seite meines Calvert-Lesebuchs für die erste Klasse eine weißgelbe »Mehr Licht«-Marke, die bewies, daß ich sie gemeistert hatte, und andere sammelten sich, allerdings langsamer, in meinem Rechenbuch. Weitere Marken klebte ich an die Wand neben meinem Platz am Schultisch, arrangiert in einer stolzen, kleinen, weißgelben, von meinem Daumen verschmierten, vertikalen Reihe, die so hoch war, wie ich reichen konnte.
»Du hättest deine Marken nicht an die Wand kleben sollen«, sagte Edith.
»Warum nicht?«
»Weil sie nur schwer wieder abzumachen sind.«
»Wer soll sie denn abmachen?«
An das kleine Zimmer, in dem wir sowohl schliefen als auch lernten, erinnere ich mich deutlicher als an alle anderen Räume unseres Zuhauses. Irgend jemand hätte meiner Mutter vielleicht sagen sollen, daß ein Junge und ein Mädchen in unserem Alter eigentlich getrennte Zimmer haben sollten, aber daran dachte ich erst viel später. Unsere Betten standen Fußende an Fußende an der Wand, es blieb gerade genug Platz, um an ihnen entlang zum Schultisch zu gehen, und wir hatten ein paar gute Gespräche, als wir abends auf den Schlaf warteten. In dem Gespräch, an das ich mich am besten erinnere, erzählte Edith mir von den Geräuschen der Stadt.
»Ich meine nicht nur die lauten Geräusche«, sagte sie, »wie die Sirene, die wir gerade hören, oder die Wagentüren, die zugeschlagen werden, oder das Gelächter und das Geschrei auf der Straße, das ist Krach, der ganz nahe ist. Ich rede von was anderem. Weißt du, in New York leben Abermillionen Menschen – mehr Leute, als du dir jemals vorstellen kannst –, und die meisten von ihnen tun etwas, was ein Geräusch macht. Vielleicht sprechen sie oder haben das Radio eingeschaltet, vielleicht machen sie eine Tür zu, vielleicht legen sie die Gabel auf den Teller, wenn sie gerade zu Abend essen, oder sie stellen ihre Schuhe ab, wenn sie ins Bett gehen – und weil es so viele sind, summieren sich die kleinen Geräusche und ergeben zusammen so eine Art Brummen. Aber es ist so leise – ganz, ganz leise –, daß man es nicht hört, außer man hört eine lange Zeit genau hin.«
»Kannst du es hören?« fragte ich sie.
»Manchmal. Ich horche jeden Abend, aber ich höre es nur manchmal. Manchmal schlaf ich auch ein. Jetzt sind wir still und horchen. Vielleicht kannst du es hören, Billy.«
Und ich bemühte mich, schloß die Augen, als ob es etwas nützen würde, öffnete den Mund, um das Geräusch meines Atems zu verringern, aber schließlich mußte ich ihr mitteilen, daß es mir nicht gelungen war. »Und du?« fragte ich.
»Ich habe es gehört«, sagte sie. »Nur für ein paar Sekunden, aber ich hab’s gehört. Du kannst es auch hören, wenn du es weiter versuchst. Und das Warten lohnt sich. Wenn du es hörst, hörst du ganz New York.«
Der Höhepunkt der Woche war der Freitagnachmittag, wenn John Cabot aus Hastings zurückkam. Er strahlte Gesundheit und Normalität aus und brachte frische Vorstadtluft in unser Bohemeleben. Wenn er da war, verwandelte er die kleine Wohnung seiner Mutter in einen beneidenswerten Ort der Ruhe zwischen lebhaften Begegnungen mit der Welt. Er hatte sowohl Boys’ Life als auch Open Road for Boys abonniert, und allein die Zeitschriften schienen mir wunderbare Dinge, und sei es auch nur wegen der Illustrationen. John kleidete sich auf die gleiche heldenhafte Art wie die Jungen in den Magazinen, Knickerbocker aus Kordsamt und Rippenstrümpfe über den muskulösen Waden. Er sprach viel von der Footballmannschaft der Hastings-Highschool, bei der er zur Probe spielen wollte, sobald er alt genug wäre, und von Freunden in Hastings, deren Namen und Charaktere uns bald so vertraut waren, als wären es unsere eigenen Freunde. Er brachte uns eine erfrischende neue Sprechweise bei, wie zum Beispiel »Na und?« zu sagen statt »Was macht das schon?« Und er war sogar noch besser als Edith, wenn es darum ging, im Hof etwas zu tun zu finden.
Damals konnte man bei Woolworth für zehn oder fünfzehn Cent das Stück Goldfische kaufen, und eines Tages brachten wir drei davon mit nach Hause, um sie in den Brunnen zu setzen. Wir streuten mehr Woolworth-Fischfutter ins Wasser, als sie vermutlich brauchten, und wir benannten sie nach uns: »John«, »Edith« und »Billy«. Ein, zwei Wochen lang rannten Edith und ich jeden Morgen, bevor Bart zum Unterricht kam, zum Springbrunnen, um uns zu vergewissern, daß sie noch am Leben waren und genug zum Fressen hatten, und um sie zu beobachten.
»Ist dir aufgefallen, wie groß Billy geworden ist?« fragte mich Edith. »Er ist riesig. Er ist jetzt fast so groß wie John und Edith. Er wird wahrscheinlich größer als die beiden.«
Und an einem Wochenende, als John zu Hause war, machte er uns darauf aufmerksam, wie schnell die Fische die Richtung wechseln und weiterschwimmen konnten. »Sie haben bessere Reflexe als die Menschen«, erklärte er. »Wenn sie einen Schatten im Wasser sehen oder irgend etwas, was eine Gefahr sein könnte, dann hauen sie schneller ab, als du blinzeln kannst. Schaut.« Und er tauchte eine Hand ins Wasser und faßte nach dem Fisch namens Edith, aber er wich ihm aus und flüchtete. »Habt ihr gesehen?« fragte er. »Das ist Geschwindigkeit. Wißt ihr was? Ich wette, man könnte einen Pfeil reinschießen, und sie würden rechtzeitig entkommen. Wartet.« Und um es zu beweisen, lief er in die Wohnung seiner Mutter und kam mit dem schönen Bogen und einem der Pfeile zurück, die er im Sommerlager gebastelt hatte (daß John jedes Jahr ins Sommerlager fuhr, war ebenfalls bewundernswert); dann kniete er sich an den Rand des Brunnens, der Inbegriff eines Bogenschützen, den Bogen sicher in einer starken Hand und das gefiederte Ende des Pfeils, fest an der Sehne angelegt, in der anderen. Er zielte auf den Fisch namens Billy. »Die Geschwindigkeit des Pfeils«, sagte er mit von der Anstrengung geschwächter Stimme, »ist wahrscheinlich höher als die eines Autos, das hundertdreißig Stundenkilometer fährt. Wahrscheinlich ist er so schnell wie ein Flugzeug oder sogar noch schneller. Okay, schaut zu.«
Der Fisch namens Billy schwamm plötzlich tot an der Oberfläche, auf der Seite, aufgespießt auf den Pfeil, auf dem Teile seiner rosa Innereien klebten.
Ich war zu alt, um zu weinen, aber etwas mußte unternommen werden gegen den Schock und die Wut und den Schmerz, die mich erfüllten, und ich rannte blind vom Brunnen nach Hause und stieß auf halber Strecke auf meine Mutter. Sie stand da, sah sehr sauber aus, sie trug einen neuen Mantel und ein Kleid, das ich nie zuvor gesehen hatte, und hatte sich bei Mr. Nicholson untergehakt. Entweder gingen sie gerade oder sie kamen – es war mir gleichgültig –, und Mr. Nicholson sah mich stirnrunzelnd an (er hatte mir mehr als einmal erzählt, daß in England Jungen in meinem Alter ins Internat gingen), aber auch das war mir gleichgültig. Ich drückte den Kopf gegen ihre Hüfte und weinte noch lange, nachdem ich spürte, wie ihre Hände meinen Rücken streichelten, nachdem sie mir versichert hatte, daß Goldfische nicht viel kosteten und ich bald einen neuen bekäme und John seine gedankenlose Tat bedauerte. Ich hatte entdeckt oder wiederentdeckt, daß Weinen ein Vergnügen ist – daß es ein unvorstellbares Vergnügen ist, wenn man den Kopf gegen die Hüfte seiner Mutter drückt und sie einem die Hände auf den Rücken legt und sie zufälligerweise saubere Kleidung trägt.
Es gab andere Vergnügen. Wir hatten in diesem Jahr in unserer Wohnung einen schönen Weihnachtsabend, oder zumindest fing er schön an. Mein Vater war da, weswegen Mr. Nicholson nicht kommen konnte, und es war nett zu sehen, wie entspannt er zwischen den Freunden meiner Mutter war. Er war zurückhaltend, aber sie schienen ihn zu mögen. Mit Bart Kampen verstand er sich besonders gut.
Howard Whitmans Tochter Molly, ein sanftmütiges Mädchen in meinem Alter, war aus Tarrytown gekommen, um die Feiertage bei ihm zu verbringen, und es waren noch weitere Kinder da, die wir kannten, aber nur selten trafen. John sah an diesem Abend sehr reif aus in einem dunklen Jackett und mit Krawatte und war sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung als ältester Junge deutlich bewußt.
Nach einer Weile zogen sich alle ungeplant in den Eßzimmerbereich zurück und improvisierten Varietéauftritte. Howard war der erste: Er holte den hohen Stuhl vom Modelliertisch meiner Mutter und setzte seine Tochter darauf, das Gesicht dem Publikum zugewandt. Dann schlug er die Öffnung einer braunen Einkaufstüte zwei –, dreimal um und stülpte sie ihr auf den Kopf; als nächstes zog er seine Anzugjacke aus und legte sie mit dem Rücken nach vorn um sie, so daß sie ihr bis zum Kinn reichte; er stellte sich hinter sie, ging in die Hocke, damit man ihn nicht sehen konnte, und fuhr mit den Armen in die Jackenärmel, so daß seine Hände aussahen, als wären es ihre. Und der Anblick eines lächelnden kleinen Mädchens mit Papierhut, das mit riesigen, ausdrucksstarken Händen winkte und gestikulierte, war genug, um alle zum Lachen zu bringen. Die großen Hände wischten ihre Augen, strichen über ihr Kinn und schoben ihr das Haar hinter die Ohren; dann machten sie uns eine kunstvolle lange Nase.
Als nächstes war Sloane Cabot an der Reihe. Sie saß sehr gerade auf dem Stuhl, die Fersen so auf die Sprossen gestützt, daß ihre schönen Beine zur Geltung kamen, aber ihre erste Nummer war kein Erfolg.
»Also«, begann sie, »heute bei der Arbeit – ihr wißt ja, mein Büro ist im vierzigsten Stock – schaute ich zufällig von meiner Schreibmaschine auf und sah diesen großen alten Mann, der draußen auf dem Fenstersims saß, er hatte einen weißen Bart und trug einen komischen roten Anzug. Ich lief zum Fenster, machte es auf und sagte: ›Alles in Ordnung?‹ Es war der Weihnachtsmann, und er sagte: ›Natürlich ist alles in Ordnung, ich bin an große Höhen gewöhnt. Aber hören Sie, Miss, können Sie mir sagen, wie ich zur Bedford Street Nummer fünfundsiebzig komme?‹«
Und so ging es weiter, aber unsere verlegenen Mienen müssen ihr verraten haben, daß es uns nicht behagte, herablassend behandelt zu werden, und sobald sie eine Möglichkeit fand, beendete sie die Geschichte rasch. Nach einer Denkpause versuchte sie es mit etwas anderem, was sich als viel besser herausstellte.
»Habt ihr Kinder schon mal die Geschichte vom ersten Weihnachten gehört?« fragte sie. »Als Jesus geboren wurde?« Und sie begann sie in dem leisen, dramatischen Tonfall zu erzählen, von dem sie gehofft haben muß, daß die Sprecher ihrer ernsteren Radiostücke ihn anschlagen würden.
»… Und sie mußten noch viele Meilen gehen, bevor sie nach Bethlehem kamen«, sagte sie, »und es war eine kalte Nacht. Maria wußte, daß sie sehr bald ein Baby kriegen würde. Sie wußte auch, weil ein Engel es ihr gesagt hatte, daß ihr Baby eines Tages der Erlöser der ganzen Menschheit sein würde. Aber sie war noch ein junges Mädchen« – und an dieser Stelle glitzerten Sloanes Augen, als würden sie sich mit Tränen füllen – »und sie war erschöpft von der Wanderschaft und hatte blaue Flecken vom holpernden Gang des Esels, und alles tat ihr weh, und sie dachte, daß sie niemals ankommen würden, und sie konnte nur noch sagen: ›Ach, Joseph, ich bin so müde.‹«
Die Geschichte ging weiter mit der Zurückweisung im Wirtshaus und der Geburt im Stall, mit der Krippe, den Tieren, der Ankunft der drei Weisen; als es vorbei war, klatschten wir lange, weil Sloane so gut erzählt hatte.
»Daddy?« sagte Edith. »Singst du für uns?«
»Ach, nein, danke, Liebes«, sagte er, »lieber nicht. Ich bräuchte wirklich ein Klavier dafür. Trotzdem danke.«
Als letzter trat Bart Kampen auf, der auf allgemeines Bitten nach Hause ging und seine Geige holte. Niemand war überrascht festzustellen, daß er wie ein Berufsmusiker spielte, daß es klang wie etwas, was im Radio zu hören war; ein Vergnügen war es, ihn zu beobachten, wie er die Stirn seines schmalen Gesichts auf der Kinnstütze in Falten legte und keinerlei Emotion zeigte außer der Sorge um den richtigen Klang. Wir waren stolz auf ihn.
Eine Weile nachdem mein Vater gegangen war, kamen viele andere Erwachsene, von denen ich die meisten nicht kannte, und sie sahen aus, als wären sie an diesem Abend schon auf mehreren Partys gewesen. Es war sehr spät oder vielmehr sehr früh am Weihnachtsmorgen, als ich in die Küche ging und Sloane neben einem kahlköpfigen Mann stehen sah, der mir fremd war. In einer Hand hielt er zitternd einen Drink, und mit der anderen massierte er langsam ihre Schulter; sie lehnte an dem alten hölzernen Eisschrank. Sloane konnte so lächeln, daß kleine Wölkchen Zigarettenrauch zwischen ihren fast geschlossenen Lippen entwichen, während sie einen von Kopf bis Fuß musterte, und das tat sie jetzt. Dann stellte der Mann sein Glas auf den Eisschrank und nahm sie in die Arme, und ich sah ihr Gesicht nicht mehr.
Ein anderer Mann in einem zerknitterten braunen Anzug lag bewußtlos auf dem Boden des Eßzimmers. Ich machte einen Bogen um ihn und ging ins Atelier, wo eine attraktive junge Frau erbärmlich weinend dastand und sich drei Männer, die sie trösten wollten, ständig in die Quere kamen. Dann bemerkte ich, daß einer der Männer Bart war, und ich sah zu, wie er die anderen beiden überdauerte und das Mädchen zur Tür führte. Er legte den Arm um sie, und sie schmiegte den Kopf an seine Schulter; so verließen sie das Haus.
Edith sah erschöpft aus in ihrem zerknitterten Partykleid. Sie saß in unserem alten Sessel aus Hastings-on-Hudson, der Kopf zurückgesunken und die Beine über die beiden Armlehnen geworfen, und John saß im Schneidersitz auf dem Boden neben einem ihrer baumelnden Beine. Sie schienen über etwas gesprochen zu haben, das sie beide nicht sonderlich interessierte, und das Gespräch verstummte, als ich mich zu ihnen auf den Boden setzte.
»Billy«, sagte sie, »ist dir klar, wie spät es ist?«
»Na und?« sagte ich.
»Du solltest schon seit Stunden im Bett liegen. Komm. Wir gehen rauf.«
»Ich hab keine Lust.«
»Na gut«, sagte sie, »ich geh jedenfalls.« Und sie stand mühsam aus dem Sessel auf und verschwand in der Menge.
John wandte sich mir zu und kniff auf unerfreuliche Weise die Augen zusammen. »Weißt du was?« sagte er. »Als sie in dem Stuhl gesessen hat, habe ich alles sehen können.«
»Hm?«
»Ich konnte alles sehen. Ich habe die Spalte gesehen und die Haare. Ihr wachsen Haare.«
Ich hatte meine Schwester schon viele Male nackt gesehen – in der Badewanne oder wenn sie sich umzog – und fand das nicht besonders beeindruckend; dennoch verstand ich sofort, wie beeindruckend es für ihn gewesen sein mußte. Wenn er nur auf verschämte Weise gelächelt hätte, hätten wir zusammen lachen können wie normale Kumpel in Open Road for Boys, aber seine Miene war noch immer geringschätzig.
»Ich habe immer nur hingesehen«, sagte er, »und ich mußte sie zum Reden bringen, damit sie es nicht merkt, aber alles lief glatt, bis du gekommen bist und alles ruiniert hast.«
Wollte er, daß ich mich entschuldigte? Das erschien mir nicht richtig, aber auch alles andere schien nicht richtig. Ich blickte zu Boden.
Als ich endlich ins Bett ging, blieb kaum Zeit, um auf die Geräusche der Stadt zu horchen – ich hatte entdeckt, daß es eine gute Möglichkeit war, um an nichts anderes denken zu müssen –, weil meine Mutter hereinstolperte. Sie hatte zuviel getrunken und wollte sich hinlegen, aber statt in ihr eigenes Zimmer zu gehen, legte sie sich zu mir ins Bett. »Oh«, sagte sie. »Oh, mein Junge. Oh, mein Junge.« Es war ein schmales Bett, und ich konnte unmöglich Platz für sie machen; dann begann sie plötzlich zu würgen, sprang auf und rannte ins Bad, wo sie sich, wie ich hörte, übergab. Und als ich mich auf die Seite des Betts drehte, auf der sie gelegen hatte, schreckte ich sofort, aber nicht schnell genug, zurück vor der glitschigen Kotze, die sie auf ihre Seite des Kissens erbrochen hatte.
In diesem Winter sahen wir ungefähr einen Monat lang nicht viel von Sloane, weil sie, wie sie sagte, »an etwas Großem arbeitete. Etwas wirklich Großem.« Als sie damit fertig war, kam sie damit ins Atelier, müde, aber hübscher als je zuvor, und fragte schüchtern, ob sie es laut vorlesen dürfe.
»Wunderbar«, sagte meine Mutter. »Worum geht es?«
»Das ist das Beste daran. Es geht um uns. Hört zu.«
Bart war schon nach Hause gegangen, und Edith war im Hof – sie spielte oft allein –, und so bestand das Publikum nur aus meiner Mutter und mir. Wir setzten uns aufs Sofa, und Sloane stieg auf den hohen Stuhl, so wie damals, als sie die Bethlehem-Geschichte erzählt hatte.
»In Greenwich Village gibt es einen verzauberten Hof«, las sie. »Es ist nur ein kleiner Platz aus Backsteinen und Gras zwischen den unregelmäßigen Formen sehr alter Häuser, aber er ist verzaubert, weil die Menschen, die dort und in der Nähe leben, einen verzauberten Freundeskreis bilden.
Keiner von ihnen hat genug Geld, und manche sind sogar richtiggehend arm, aber sie glauben an die Zukunft, sie glauben aneinander und an sich selbst.