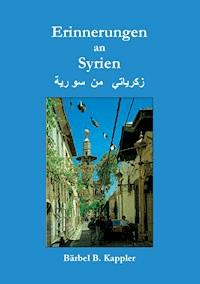
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Angesichts der aktuellen Flüchtlingsproblematik in Deutschland und Europa möchte die Autorin einen Beitrag dazu leisten, Syrer und das Land, das sie in höchster Not verlassen haben, besser kennenzulernen und zu verstehen. Deshalb hat sie ihre Erfahrungen während mehrwöchiger Aufenthalte bei einer syrischen Familie und ihre persönlichen Erkenntnisse über das orientalische Leben vor Beginn des sog. Arabischen Frühlings, der fast überall zur Katastrophe geworden ist, jetzt zu Papier gebracht und interessierten Lesern zugänglich gemacht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Annette
Inhaltsverzeichnis
Erinnerungen an Syrien
Schwierigkeiten des ersten Tages
Unser arabisches Haus und seine Bewohner
Verlaufen
Peinlichkeit im Hamam
Alltag
Im Suk
Apropos Botschafter
Ausflüge
Zu Hause in Damaskus
Gastfreundschaft
In Aleppo
Orientalischer Luxus
Palmyra, Ruinenstadt und Weltkulturerbe
Erinnerungen an Syrien
Die meisten hielten uns für verrückt, wenn sie es auch nicht so deutlich aussprachen. Zwei Frauen allein, nur Annette und ich, in einem muslimisch-arabischen Land, die Jüngere noch dazu hellblond und beide mit sehr geringen Kenntnissen der Sprache! Was hätte da alles passieren können!
Aber es passierte nichts. Allerdings war Iris, zu Recht, anderer Ansicht.
Hätten wir uns denn die einmalige Gelegenheit entgehen lassen sollen, unsere Sprachkenntnisse aufzupolieren, ein Land kennenzulernen, in dem die Sprache, die uns interessierte, gesprochen wurde, wo wir Themen wie den Islam, die Rolle der Frauen – und der Männer –, die jahrtausendealte Kultur des Orients und das Alltagsleben kennenlernen, erleben und leben konnten?
Wir würden mehrere Wochen bei einer arabischen Familie wohnen, mitten in der Altstadt von Damaskus. Wir würden täglich in eine Sprachenschule gehen, dort Deutsche treffen, die uns Rat und Unterstützung geben könnten; und wir würden dort mit Arabern zusammentreffen, die Deutsch lernen wollten.
Durch unseren regelmäßigen Schultag, durch den immer gleichen Weg zum Spracheninstitut entstand schnell so etwas wie Alltag. Wir kannten uns bald aus. Andererseits waren diese Wochen so angefüllt mit Ereignissen, Begegnungen, fremdartigen Eindrücken, ja Abenteuern, dass es später schier unvorstellbar für uns schien, dass wir dieses alles in nur wenigen Wochen erlebt haben sollten.
Diese Wochen, weit eher nahe dem Leben von Syrern selbst als einem Aufenthalt von Touristen, scheinen es mir wert, geschildert zu werden, gerade zu einer Zeit, da viele Syrer als Flüchtlinge in Deutschland sind. Was hat man ihnen bereits jetzt in diesem furchtbaren Bürgerkrieg zerstört, was haben sie hinter sich gelassen, aufgegeben? Wie haben sie sich in ihrem eigenen Land verhalten? Wie fremd muß ihnen Deutschland vorkommen? Wie wahrscheinlich ist es, dass sie sich hier integrieren wollen und können? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass sie, sobald durch einen Frieden oder dauerhaften Waffenstillstand möglich, wieder in ihr Heimatland zurückgehen, um es wieder mit aufbauen zu helfen?
Schwierigkeiten des ersten Tages
Bei unserem Landeanflug auf Damaskus sahen wir aus der Luft, dass die Stadt inmitten einer riesigen Palmenoase (es sollen circa hundertachtzigtausend Bäume sein) am Rande der Syrischen Wüste liegt.
Die Abfertigung bei der Einreise nach Syrien ging am Flughafen von Damaskus trotz langer Warteschlangen überraschend schnell. Wir nahmen uns, da es schon Abend und dunkel war, ein Taxi zu einem der internationalen Hotels, wo wir von Deutschland aus für die erste Nacht ein Zimmer gebucht hatten. Diese eine Hotelnacht war, nebenbei bemerkt, so teuer wie die Unterkunft für die Wochen bei unserer Familie. Am nächsten Morgen fuhren wir, wieder mit einem der im Vergleich zu Deutschland preiswerten Taxis, in die Altstadt, um in der Haupteinkaufsstraße, dem überdachten „Suk Hamidieh“, zu bummeln.
Dieser lebhafte Basar sollte uns bald sehr vertraut werden. Hiervon später.
Am Nachmittag mussten wir uns auf den Weg machen zum Goetheinstitut, Partner der Sprachenschule. Hier sollten wir und die anderen Schüler von unseren jeweiligen Gastfamilien abgeholt werden.
Zunächst aber hatten wir ein alltägliches, aber zu diesem Zeitpunkt schwieriges Problem zu lösen: wir hatten Hunger. Wo konnten wir zwei Frauen in einem islamischen Land alleine essen gehen?
Wir irrten lange herum, bis wir einige Leute vor dem einzigen Restaurant in diesem Stadtteil schlangestehen sahen; es waren auch Frauen dabei. Das war gut. Wir reihten uns ein.
Bald wurden wir an einen der einfachen Holztische mitten im Lokal geleitet. Da saßen wir nun ziemlich ratlos. Die Speisekarte war natürlich nur auf arabisch verfasst. Wir konnten sie zwar einigermaßen lesen, verstanden aber kaum ein Wort. Verstohlen machten wir lange Hälse um zu sehen, was die anderen Gäste aßen. Als der Kellner kam, versuchten wir zu fragen, was die Dame dort neben uns esse oder der Herr dahinten? „Ma‘ hatha hunnak?“ „Was ist das dort?“
Der Kellner sprach ein wenig Englisch. Mittlerweile hatten wir aber die Aufmerksamkeit des gesamten Lokals auf uns gezogen. Es war uns peinlich. Plötzlich redeten alle auf uns ein, arabisch und englisch, machten Vorschläge, was zu essen besonders gut sei.
Wir bestellten irgendetwas, hatten ohnehin keine Vorstellung davon, wie es schmecken würde. Ich erinnere mich daran, dass es köstlich war, würzig und saftig.
Wir waren, Ende September aus den kühlen Temperaturen in Deutschland kommend, plötzlich in einer Gegend, wo es achtundzwanzig Grad hatte, wir hatten eine kurze Nacht und einen aufregenden Vormittag voller neuer Eindrücke hinter uns und waren nun todmüde. Wo konnten wir uns ein wenig ausruhen, bevor wir zum Spracheninstitut aufbrechen mussten? Uns kam die Moschee in den Sinn. Dort konnten wir uns vielleicht hinsetzen und etwas erholen. Wir fanden den Weg zur berühmten Omajjadenmoschee, aber man verweigerte uns den Zutritt. Schließlich verstanden wir, dass wir um die Ecke gehen sollten. Aha, da war ein Nebeneingang, reserviert für Frauen. Wir mussten einen leichten schwarzen Mantel, einen Tschador, anziehen, der für „unverhüllte“ Frauen bereitgehalten wurde, und ein Kopftuch umbinden, das wir wohlweislich bereits und später stets in der Tasche hatten, und die Schuhe ausziehen; dann konnten wir den Innenhof und den weiträumigen Gebetsraum betreten. Niemand hinderte uns jetzt, herumzugehen und uns umzugucken. Die ganze Moschee war mit Teppichen ausgelegt, vielarmige Leuchter hingen von der Decke, ich erinnere mich an eine Reliquie. Männer standen davor und beteten, sie gingen herum, saßen oder lagen einzeln oder in Gruppen auf den dicken Teppichen. Manche waren eingeschlafen. In der Nähe des Fraueneingangs saßen auch einige Frauen auf dem Boden. Wir setzten uns in ihre Nähe und machten ungestört ein Nickerchen.
Das Goetheinstitut zu finden war unser zweites Problem. Es war nicht einfach, sich in dieser Stadt zurechtzufinden. Wen sollten wir mit unserem wenigen Arabisch nach dem Weg fragen?
Natürlich schickt es sich in einem islamischen Land nicht, dass wir Frauen einen Mann auf der Straße ansprechen. Wir fragten mehrere Frauen. Sie alle wussten es nicht oder konnten es nicht erklären, schon garnicht auf englisch. Frauen nach einem Weg zu fragen, brauchten wir auch später garnicht erst zu versuchen.
So blieben uns nur Polizisten und Sicherheitskräfte, irgendwie Uniformierte, Offizielle. Diese fanden sich, in dieser Situation zu unserem Glück, an jeder Straßenecke. Schließlich waren wir zu einer Zeit in Syrien, als der Assad-Clan noch das uneingeschränkte Sagen hatte; da wurde alles und jeder überwacht. Das geschah allerdings ziemlich unauffällig.
„Goethe“ verstanden aber auch die Offiziellen nicht. Später wussten wir, dass unser berühmter Dichter sich auf arabisch „Ruta“ schreibt und auch so ähnlich ausgesprochen wird.
Der Leiter unseres Spracheninstituts, genannt „das Biest“, abgeleitet von seinem Familiennamen und absolut kein Hinweis auf seinen Charakter, war im Gegenteil außerordentlich freundlich und kompetent, sein Programm sehr durchdacht.
Jede Woche würden wir vier Tage Unterricht haben, zwei Tage Ausflüge machen, der Sonntag wäre als Zugeständnis an uns Christen frei. In arabischen Ländern entspricht bekanntlich der Freitag dem christlichen Sonntag. Einmal in der Woche war ein gemeinsames Abendessen vorgesehen, einmal ein Vortrag, ab und zu ein Treffen mit „Tandempartnern“. Das waren Syrer, die im Goetheinstitut Deutsch lernten und an Austausch und Gespräch mit Deutschen interessiert waren.
Jeder von uns würde einem Partner zugeordnet, mit diesem sollten wir uns unterhalten, arabisch und deutsch. Wir würden über die Ausbildung in unseren jeweiligen Ländern berichten, Sprichwörter in den beiden Sprachen vergleichen – das sorgte später für besonderen Spaß und für erhellende Einblicke in die Denkweise der jeweils anderen Kultur –, wir würden über unsere Religionen diskutieren, über die unterschiedlichen Rollen christlicher und muslimischer Frauen und über ähnlich interessante Themen sprechen. Wir waren gespannt darauf.
Die Kursteilnehmer waren meist jüngere Leute, eher im Alter meiner Tochter Annette. Ich war wohl eine der älteren neben Regine, die sich schon bald als Nervensäge entpuppte. Außer dem Gehalt ihres Mannes kannten und wussten wir bald so ziemlich alles von ihr.
Unser arabisches Haus und seine Bewohner
Nachdem alles besprochen war, kamen die Gastgeber all derer herein, die bei Familien wohnen wollten. Annette und ich wurden von einem distinguierten älteren Herrn abgeholt. Er sprach wenig, als er uns zu unserem Hotel begleitete. Wir holten unsere Koffer ab, fuhren dann gemeinsam mit einem Taxi zu seinem Haus. Wir verloren völlig die Orientierung, insbesondere, als der Wagen durch enge Altstadtgassen fuhr. Oh Gott, wie sollten wir das je wiederfinden?
Wir wohnten mitten in der Altstadt in der Nähe des „Bab Tuma“, des Thomas-Tors, nicht in einem Haus in unserem europäischen Sinne, eher in einem kleinen städtischen Anwesen. Wie alle anderen Häuser in diesem Viertel wirkte es von außen abweisend, da fensterlos, mit einer hohen Mauer zur Straße, die keinen Bürgersteig hatte.





























