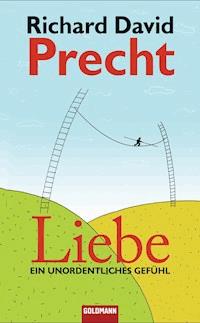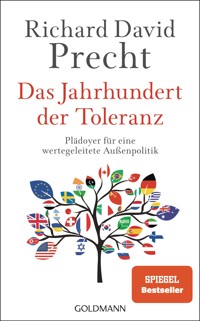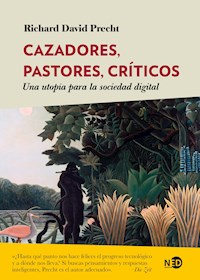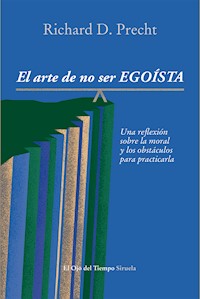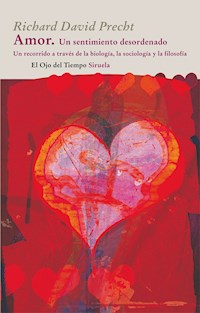19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Geschichte der Philosophie
- Sprache: Deutsch
»Man kann Zeiten an ihrem Gang erkennen, wie Menschen, nicht an ihrem Lauf. Jede historische Zeit hat ihre Eigenart, ihren Rhythmus, ihr eigenes Lebensgefühl. Nicht die Fakten, sondern die politischen Ereignisse von Aufstieg und Niedergang oder die Schlagzeilen der einzelnen Tage bestimmen einen Gang.«
Im zweiten Band seiner fünfteiligen Geschichte der Philosophie entführt Richard David Precht den Leser tief in die Gedankenwelt der Renaissance und der Aufklärung. Dabei geht es wieder um die großen Fragen, die sich die Menschen durch die Jahrhunderte hindurch gestellt haben. Spannend und anschaulich vermittelt Precht die zentralen Konzepte und Ideen der abendländischen Philosophie und beleuchtet sie vor den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Hintergründen ihrer Zeit – ein faszinierender »Ideen-Krimi«, der den Leser eintauchen lässt in die schier unerschöpfliche Fülle des Denkens!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 942
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Text zum Buch
Was bedeutete das Ende des geozentrischen Weltbildes? Warum entwarfen Philosophen einen »Naturzustand«, um ihre Staatsmodelle zu rechtfertigen? Und wodurch entstand die »bürgerliche Gesellschaft«? Im zweiten Teil seiner Geschichte der Philosophie führt uns Richard David Precht durch die Renaissance, das Barock, die Aufklärung und durch das Denken des Deutschen Idealismus. Das Panorama erstreckt sich von den florierenden Kaufmannsstädten Italiens über das frühindustrialisierte England und das vorrevolutionäre Frankreich bis zu den Kleinstädten Thüringens, in denen Philosophen an der Wende zum 19. Jahrhunderts den Weltgeist für sich entdeckten. Im Wechselspiel von Philosophie, Sozialgeschichte und Wirtschaftsgeschichte öffnet sich dem Leser der Blick dafür, wie Liberalismus und Demokratie ihren Siegeszug antraten. Ein Buch, das hilft, das Werden unserer heutigen Gesellschaft zu verstehen!
Weitere Informationen zu Richard David Precht sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buchs.
Richard David Precht
ERKENNE DICH SELBST
Eine Geschichte der Philosophie
Band 2
Renaissance bis
Deutscher Idealismus
Originalausgabe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2017
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Uno Werbeagentur, München
Covermotiv: akg-images/Zug der Heiligen Drei Könige,
Benozzo Gozzoli; 1459 – 1461. Wandgemälde. Florenz,
Palazzo Medici Riccardi, Kapelle, rechte Wand
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-18227-4V006
www.goldmann-verlag.de
Inhalt
Einleitung
Das Geleit der Könige
PHILOSOPHIE DER RENAISSANCE
Die Welt in uns selbst
Neue Perspektiven
Diesseits und Jenseits
Ein neuer Himmel
PHILOSOPHIE DES BAROCKS
Ich denke, also bin ich
Der Gott der klaren Dinge
Gebändigte Gewalten
PHILOSOPHIE DER AUFKLÄRUNG
Der Einzelne und sein Eigentum
Das unbeschriebene Blatt
Das Wohl aller
Einstürzende Altbauten
Die öffentliche Vernunft
PHILOSOPHIE DES DEUTSCHEN IDEALISMUS
Im Kosmos des Geistes
Das moralische Gesetz in mir
Der höchste Standpunkt
Seelenwelt oder Weltseele?
Sein und Schein des Schönen
Das Ende der Geschichte
ANHANG
Anmerkungen
Ausgewählte Literatur
Philosophie der Renaissance
Philosophie des Barocks
Philosophie der Aufklärung
Philosophie des Deutschen Idealismus
Dank
Personenregister
Sachregister
Bildnachweis
… ein philosophisches System ist nicht ein toter Hausrat, den man ablegen oder annehmen könnte, wie es uns beliebt, sondern es ist beseelt durch die Seele des Menschen, der es hat.
Johann Gottlieb Fichte
Einleitung
Man kann Zeiten an ihrem Gang erkennen, wie Menschen, nicht an ihrem Lauf. Jede historische Zeit hat ihre Eigenart, ihren Rhythmus, ihr eigenes Lebensgefühl. Nicht die Fakten, die politischen Ereignisse von Aufstieg und Niedergang oder die Schlagzeilen der einzelnen Tage bestimmen einen Gang. Mit späterem Wissen lässt sich oft vieles deuten, das in der Zeit selbst undeutlich ist. Doch genau diese Undeutlichkeit bestimmt den Gang der Zeiten immer und in jeder Epoche, bis hin zu der unsrigen.
Viel Undeutlichkeit und Ungleichzeitigkeit kennzeichnen auch den Gang der Philosophie. Manche Gedanken aus sehr alter Zeit erscheinen uns heute wegweisend und modern; andere, die erst aus jüngeren Tagen stammen, wirken alt und blass. Und wer weiß, ob sich das Urteil über sie einst bestätigt oder ändert? Philosophiehistoriker nehmen auf diesen Wechsel der Perspektiven und Bewertungen gemeinhin allerdings wenig Rücksicht. Sie neigen dazu, ihre Geschichte immer ähnlich zu erzählen – schon aus Angst vor dem Urteil der Experten. Wie leicht kann es geschehen, dass sie ihre Stammgebiete unzureichend behandelt oder vernachlässigt sehen! Eine andere Gewichtung, eine andere Auswahl und andere Nuancen sind mit Mut und Unerschrockenheit verbunden; ein Kapital, das man lieber sehr vorsichtig einsetzt. Wie im ersten Band dieses Projekts betreffen die neuen Akzente bei mir vor allem die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sowie Fragen nach der Leiblichkeit und der Biologie.
Philosophiegeschichten setzen den Lauf der Dinge und die Abfolge von Menschen hintereinander. Diese Chronologie ist ein Fluss, der sein Bett kaum ändert, aber sie ist mehr Routine als Notwendigkeit. Denn Geschichte zu schreiben ist keine Wissenschaft, die eisernen Regeln folgt. Allerdings ist sie auch keine Kunst oder ein Potpourri an Meinungen. Dabei ist schon das, was Philosophie überhaupt sein soll, wie Friedrich Wilhelm Joseph Schelling in der Einleitung zu seinen Ideen zu einer Philosophie der Natur schreibt, eine philosophische Frage. Die Rolle des Philosophen und der Philosophie wechselt auch, und gerade im hier behandelten Zeitabschnitt vom 15. Jahrhundert bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Zwischen Cusanus und Georg Wilhelm Friedrich Hegel liegen nicht nur Zeiten, sondern Welten. Die eine ist eine Gelehrtenwelt von Eingeweihten in einer christlich-autoritären Weltordnung. Und jeder, der philosophiert, arbeitet sich auf seine Weise an dieser einen großen Ordnung ab. Die andere sieht nach Aufklärung und Revolution die hohe Zeit des Bürgertums heraufdämmern und mit ihr die Schlote der Puddelöfen, das Elend des Proletariats und die Kirche in einer gesellschaftlichen Nische.
Die bürgerliche Arbeitsteilung in der Produktion wird schließlich auch auf die Philosophen überspringen. Am Ende des 18. Jahrhunderts möchte Adam Smith sie in »verschiedene Zweige, deren jeder einer besonderen Abteilung oder Klasse von Philosophen zu tun gibt«, aufgeteilt sehen. Denn die »Arbeitsteilung« vergrößere »ebenso in der Philosophie wie in jedem anderen Beruf die Geschicklichkeit und Zeitersparnis«.1 Dass Zeit etwas ist, das man sparen sollte, wäre den Denkern der Renaissance niemals eingefallen. Uns Heutigen dagegen ist es die fixe Leitidee unseres Lebens geworden. Und dass Philosophen zu Spezialisten der geistigen Produktion werden sollten, hätte noch Hegel missfallen, auch wenn es gegenwärtig tatsächlich überall üblich ist.
Der Generalist hat es heute schwer. Zu erdrückend erscheint die Last des seither angehäuften Spezialwissens. In einer Welt der Fachgebiete und Experten kann er nur kompensieren, was als Orientierungswissen verloren gegangen ist. Und eine Philosophiegeschichte zu schreiben ist dabei eine seiner letzten Domänen. Die großen Fragen, die sich im hier behandelten Zeitabschnitt stellen, sind oft alt, und wir kennen sie schon aus dem ersten Band: Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Woher weiß ich, was ich weiß? Kann ich wollen, was ich will? Warum soll ich moralisch sein? Was ist eine gute und gerechte Gesellschaft? Aber die Fragen erhalten im Laufe der hier behandelten vierhundert Jahre einen anderen Zuschnitt. Sie stellen sich neu im Hinblick auf die sich allmählich entwickelnde bürgerliche Gesellschaft. Die Begriffe der »Arbeit« und der »individuellen Rechte« werden die Vorstellungswelt und den Handlungsrahmen der Menschen entscheidend verändern. Und sie werden jene Gesellschaft formen, die wir– wenn sie möglicherweise auch bald durch die Digitalisierung zu Ende geht– heute für »normal« halten.
Einige Zeiten und Menschen bereiten auf diesem langen Ritt durch die Jahrhunderte spezielle Sorgen. Die erste Schwierigkeit betrifft Formalitäten. Das Buch ist in Renaissance,Barock,Aufklärung und Deutscher Idealismus unterteilt. Fragt man sich bei der Renaissance seit Langem, wo sie beginnt und wann sie endet, so ist »Barock« eigentlich gar keine philosophiegeschichtliche Epoche. Für manche ist sie nicht einmal eine historische Epoche, sondern allenfalls ein Kunststil. Aber gibt es überhaupt Epochen? Je näher man ihnen kommt, umso unübersichtlicher und willkürlicher werden sie. Die Einteilung des Buchs möchte sich an solchen Diskussionen nicht beteiligen. Beabsichtigt ist nur eine gute Übersicht. Insofern muss man sich auch nicht darüber streiten, ob Immanuel Kant nun zum »Deutschen Idealismus« zu zählen ist oder ob er ihn als Aufklärer lediglich entzündet hat. Der Begriff stammt ohnehin erst aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. In den letzten Abschnitt gehört Kant für mich vor allem deshalb, weil mit ihm eine sehr deutsche Denkströmung der Philosophie beginnt. Diese unterscheidet sich stark von der englischen und französischen und begründet eine eigene Tradition.
Was für Zeiten gilt, gilt erst recht für Menschen. Schwierig ist zum Beispiel bis heute der Umgang mit Martin Luther. Obwohl kein Philosoph, gehört er geistesgeschichtlich und politisch in jede Philosophiegeschichte. Doch der historische Luther liegt tief verschüttet unter einem Sediment aus Interpretationen, die das bekannte Positive zeitlos, das viele Negative zeitbedingt sehen möchten. Jahrhundertelange Fanliteratur hat Luther bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Und Geschichten, die tausendmal ähnlich erzählt worden sind, lassen andere Wertungen leicht als Provokation erscheinen, auch wenn das gar nicht beabsichtigt ist – das Luther-Jahr 2017 hat dies eindrücklich bestätigt. Schon der »Mittelweg« zwischen Verehrung und historischer Kritik führt definitiv nicht durch die Mitte. Ein neutrales Urteil sollte sich mit dem Luther der Gläubigen gar nicht erst befassen, um den historischen angemessen zu bewerten.
Manchmal sind es nicht Menschen, sondern Topografien, die sich sperren. Das Buch enthält einige »Achttausender«, mühselig zu besteigende Berge der Philosophie, die zu den schwierigsten auf der Weltkarte gehören. Gleich zu Anfang des Parcours geht es mit Cusanus als erstem hohem Gipfel los, später folgen Baruch de Spinoza und Gottfried Wilhelm Leibniz. Die Darstellung der leibnizschen Philosophie ist grenzenlos undankbar. Es gibt kein leibnizsches System, sondern sehr viele verstreute Gedanken. Und die Edition der hundertbändigen Werkausgabe, die in den Zwanzigerjahren begann, hat bis heute nicht mal ihre Mitte erreicht. Dazu kommen Begriffe in einem gedanklichen Ordnungsrahmen, der Unverständnis auslösen muss. Sie in zeitgemäße Worte zu fassen gelingt nur mit viel sprachlicher Freiheit. So etwa verwende ich bei der Erklärung der Monadentheorie den Begriff »Bewusstsein« – ein Wort, das erst 1711 von Christian Wolff geprägt wurde, fünf Jahre vor Leibniz’ Tod.
Nachdenken verursacht auch die Gewichtung von Thomas Hobbes. Seine philosophiehistorische Bedeutung ist fraglos. Mit ihm beginnen die rationale Staatstheorie und die folgenreiche Idee eines Gesellschaftsvertrags. Vergleicht man ihn jedoch mit seinem Zeitgenossen James Harrington – der in fast allen Philosophiegeschichten fehlt, selbst in den meisten englischen –, so erscheint er weit weniger wegweisend und modern als der arg vernachlässigte Vater der parlamentarischen Demokratie und der Gewaltenteilung.
Bei der bewusst sehr ausführlichen Darstellung John Lockes möchte ich den »Vater der Aufklärung« mit all seinen Widersprüchlichkeiten zeigen. Die Idee der Freiheit und Gleichheit aller Menschen drängt Ende des 17. Jahrhunderts nicht einfach deswegen hervor, weil sie eine gute Idee ist. Vieles, was schon seit der Antike darüber gedacht worden ist, wird erst dadurch politisch relevant, dass mächtige wirtschaftliche Interessen dahinterstehen. Und auch die Doppelmoral liberal-kapitalistischer Gesellschaften ist untrennbar mit Locke verbunden. Die Rechte, die dem englischen Besitzbürger zukommen, müssen für ihn nicht für Schwarze und Indianer gelten. Selbst wenn viele Menschen in Europa dies heute anders sehen als Locke – zu den Spezialtugenden unserer Gesellschaft gehört es noch immer, sich mehr um den eigenen Wohlstand zu sorgen als um den Hunger in der Welt.
Überlegungen ist auch die Frage wert, wie man die britische gegenüber der französischen Aufklärung gewichtet. Wie ausführlich stellt man was dar? Die französische zählt weit mehr Vögel mit schillerndem Gefieder, vorneweg Voltaire, La Mettrie, Diderot und Rousseau – wogegen Berkeley, Hume und Smith auf den flüchtigen Blick leicht amselgrau wirken. Dennoch dürfte die angelsächsische Aufklärung die bürgerliche Gesellschaft weit nachhaltiger geformt haben. In Frankreich treten spätestens mit der Revolution die allgemeine Vernunft und der allgemeine Wille an die Stelle Gottes; in Großbritannien tut dies der heilbringende Markt. Und während der Vernunftabsolutismus nur ein kurzes heftiges Feuer abbrennt, erfreut sich der Marktabsolutismus noch immer zahlreicher mächtiger Anhänger in aller Welt.
Ganz anders dagegen die Lage in Deutschland. Während Großbritannien die Hardware für die Herrschaftsarchitektur des Besitzbürgertums schafft, Frankreich die Software aus hedonistischem Individualismus, waltet Kant auf deutschem Boden als Kanzleibeamter des menschlichen Bewusstseins. Hunderte neuer Begriffe rastern von nun an das »Gemüt«, sortieren es, bewerten und gewichten es. Mit Kant besteigt der Leser den ersten der vier Achttausender im anstrengenden Schlussparcours. Fichte, Schelling und schließlich Hegel werden auf der beschwerlichen Strecke folgen. Ihre herausragende Bedeutung ist in der deutschen Philosophiegeschichte unbestritten, entsprechend erhalten sie ihren Raum. Erwähnt werden sollte aber auch, dass Fichte und Schelling einem englischen Philosophen wie dem Oxford-Professor Anthony Kenny in seiner schönen vierbändigen Philosophiegeschichte gemeinsam nur zweieinhalb Seiten wert sind!2
Der Umschlag von Kants Philosophie in eine protestantische Romantik, eine Geistreligion ohne Gott, ist nichts für allzu nüchterne Gemüter. Und die Überspanntheit und Fruchtbarkeit des Deutschen Idealismus lassen sich höchst unterschiedlich philosophiehistorisch gewichten. In jedem Fall wird das, was um 1800 in Jena, der kargen Kleinstadt in Thüringen, gedacht wird, zum fruchtbaren Boden einer mit Idealismus überschwänglich gedüngten Philosophie. Und je vernünftiger sie sich schließlich bei Hegel aufspreizt, umso mehr mündet sie in der gegenteiligen Einsicht ihrer Hörer– nämlich dass die Welt im Innersten gerade nicht durch die Vernunft zusammengehalten wird…
Philosophie ist, wie man sieht, keine gerade aufsteigende Linie. Sie ist eine Bewegung von vielen Wellen; so wenig zielführend wie Alkohol, aber hoffentlich erhellend. Und der Weg führt beide Male durch abwechslungsreiches und inspirierendes Gelände. Mit dieser Aussicht auf die fantastische Landschaft des Geistes wünsche ich allen Lesern eine gute Reise!
Richard David Precht
Düsseldorf, im Juli 2017
Das Geleit der Könige
Vom irrealen Zauber der Malerei
Ein Zug von der Emilia-Romagna über die Höhen des Apennins in die Toskana. Majestätische Könige und Fürsten hoch zu Ross und in prächtigem Ornat, begleitet von eleganten Bediensteten, edlen Hunden und sogar einem Geparden. Dahinter eine Landschaft wie aus einem Märchenbuch: schroff gezackte Felsen, gefaltet wie aus feinstem Papier, Vögel, getragen von stillem Wind, und stilisierte Bäume mit Paradiesfrüchten und Blättern, adrett wie Straußengefieder. Am Horizont und in die Landschaft gestreut fantasievolle Burgen, aller Zeit enthoben wie das himmlische Jerusalem.
Das Bild ist ein Fresko, ein Wandgemälde in drei Teilen. Noch heute taucht es die Hofkapelle der Medici im Palazzo Medici Riccardi in Florenz in ein zauberhaft entrücktes Licht. Il Viaggio dei Magi lautet sein italienischer Titel, den »Zug der Heiligen Drei Könige« nennt es eine der deutschen Übersetzungen, »Das Geleit der Könige« eine passendere. Denn was das Fresko zeigt, ist weit mehr als der Zug der Heiligen Drei Könige nach Bethlehem. Es hat viele Ebenen, die man ausleuchten kann, und gerade der Geleitzug der Könige hat es in sich. Ausleuchten im wörtlichen Sinne musste es bereits sein Schöpfer Benozzo Gozzoli, als er es vom Sommer 1459 bis ins Frühjahr 1460 in die damals fensterlose Kapelle malte. Gozzoli war um 1420 in Florenz geboren worden und hatte das Goldschmiedehandwerk erlernt. Als Gehilfe des berühmten Fra Angelico hatte er seinem Meister bei Arbeiten in Rom und Orvieto geholfen und seine ersten eigenen Fresken in der Kleinstadt Montefalco gemalt.
Als die mächtigen Medici einen Maler für ihre Hofkapelle suchten, fiel ihre Wahl auf den Nachwuchskünstler. Irgendetwas muss Cosimo den Älteren an Gozzoli fasziniert haben. Vielleicht war es dessen Liebe zum Detail und der genaue Blick des Goldschmieds, mit dem der junge Mann Funkelndes und Glitzerndes zu malen vermochte. Denn was den Stadtherren von Florenz vorschwebte, war kein kirchliches Andachtsbild. Vielmehr dachten sie an die festlichen Umzüge, die die »Bruderschaft der Heiligen Drei Könige« jedes Jahr zum Dreikönigstag auf der Via Larga (der heutigen Via Cavour) mit Glanz und Gloria veranstaltete; ein Ereignis, bei dem sich die Medici gerne selbst ins Gefolge mischten und dabei alles zeigten, was reiche Bankiers aufzubieten hatten, um Königen gleich dahergetrabt zu kommen.
Gozzoli sollte beim Schein seiner Laternen in der Hofkapelle also nicht die Heiligen Drei Könige malen, sondern die Familie Medici. Doch der Auftrag war ungleich komplizierter. Das Thema der Heiligen Drei Könige hatte längst eine allegorische Bedeutung in der Kunst gewonnen. Danach standen die drei Könige symbolisch für die drei Lebensalter des Menschen, Jugend, Lebensmitte und Alter, und entsprechend hatte man sie zu malen. Und noch eine weitere – äußerst wichtige – Bedeutungsebene sollte sich in dem Fresko wiederfinden. Im Winter 1439, zwanzig Jahre bevor Gozzoli seinen Auftrag erhielt, waren tatsächlich »Weise aus dem Morgenland« über den Apennin in die Toskana gezogen. Diese hohen Herren waren Johannes VIII. Palaiologos, der Kaiser von Konstantinopel, und Patriarch Joseph II., das Oberhaupt der Ostkirche. Sie trafen sich dabei mit Papst Eugen IV., dem Oberhaupt der katholischen Kirche. Ein Ereignis von Weltrang: Es ist das letzte Treffen eines Patriarchen der orthodoxen Kirche mit einem Papst bis zum Jahr 1964!
Das gemeinsame Ziel war allerdings nicht Bethlehem und das Jesuskind, sondern Florenz und das Unionskonzil. Im Gefolge der drei »Könige« befand sich das Who is Who der gelehrten Welt der damaligen Zeit. Und die Mission konnte monumentaler nicht sein: die Einheit der Christenheit! Oder genauer: die endgültige und absolute Versöhnung der katholischen Kirche des Westens mit der orthodoxen Kirche des Ostens.
Dieses prestigeträchtige Ereignis sollte nirgendwo anders stattfinden als in Florenz, der aufstrebenden Stadt der westlichen Welt. Ein Mega-Event, vergleichbar weniger mit einem heutigen G8-Gipfel als vielmehr mit einer Olympiade und Fußballweltmeisterschaft zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Dafür hatte Cosimo de’ Medici, der mächtige Oligarch der Kaufmannsstadt, weder Kosten noch Mühen gescheut. Sein Argument war äußerst überzeugend: Er kam für alle Kosten der ungezählten Konzilsmitglieder auf. Der Bankier finanzierte das gesamte halbjährige Ereignis und lockte Kaiser, Papst, Patriarch und die vielen italienischen Fürsten und Stadtpatrone mit ihrem Gefolge vom kleineren Ferrara in die Stadt am Arno. Und genau diesen Gipfel, insbesondere den Weg dorthin von Ferrara nach Florenz, sollte Gozzoli in seinem Fresko abbilden. Dabei musste er dem Motiv der drei Könige einschließlich der allegorischen Deutung der Lebensstufen Rechnung tragen. Und er sollte zugleich die Medici in der Manier der Dreikönigsumzüge von Florenz prunkvoll ins Bild setzen.
Das Thema steht also in einem weiten Horizont und stellte Gozzoli vor gewaltige Herausforderungen. Dass sich fürstliche und weniger fürstliche Auftraggeber in Italien zu Anfang des 15. Jahrhunderts in historische Kulissen hineinmalen lassen, die ihrer tatsächlichen Bedeutung nicht entsprechen, ist nichts Ungewöhnliches. Wer die Macht und die Mittel dazu besitzt, vermischt Geschichte, Allegorie und Propaganda zu seinen Zwecken und lässt dafür die größten Maler seiner Zeit antanzen. Aus reichen Söldnern und Bankiers an der Spitze der toskanischen Stadtstaaten wurden so fast über Nacht bedeutende »Fürstenhäuser« – nicht anders als heute das Herrschergeschlecht der Grimaldis in Monaco. Sie sind kein alter Adel und in Wirklichkeit noch nicht mal »Grimaldis« – doch illustrierte Propaganda und Schlagzeilen lassen sie zu jenen Fürsten zählen, die einem als Erstes einfallen, wenn von europäischem Adel die Rede ist.
Nichts anderes beabsichtigt Cosimo der Ältere. Um dessen Ansprüchen gerecht zu werden, malt Gozzoli drei Fresken, denen genau das fehlt, was seit Kurzem so etwas wie der ungeschriebene Verfassungsauftrag eines jeden hochwertigen Gemäldes ist – die Zentralperspektive! Gozzoli war noch nicht geboren, als der geniale Baumeister Filippo Brunelleschi 1410 seine bahnbrechenden perspektivischen Berechnungen machte. Maler wie Masaccio griffen sie auf und übertrugen sie in die Malerei. Und als Gozzoli Kind war, verfertigte der Universalgelehrte Leon Battista Alberti darüber kunsttheoretische Schriften. Doch Gozzoli, der die Kunst der Perspektive durchaus beherrscht, verzichtet darauf, als er den Königszug malt. Von den Gründen, die später dazu beitragen, ihn nicht zu den ganz Großen der Renaissancekunst zu zählen, ist dies der wichtigste. Zu statisch hat sich die Kunstgeschichte darauf verpflichtet, nur das als bedeutend anzusehen, was auf den ersten Blick innovativ und überraschend erscheint – ein verkürzter Blick, dem neben Gozzoli so viele andere geniale Künstler aller Epochen zum Opfer gefallen sind.
Doch Gozzoli will gar keinen real erscheinenden Raum. Er will ja auch keine real erscheinende Zeit. So wie die Landschaft der Toskana mit ihren idealisierten Federbäumchen nicht der tatsächlichen Vegetation entspricht und die Burgen eher ins Märchenland gehören als nach Mittelitalien, so soll das ganze Bild zwischen Realität und Traum, Geschichte, Gegenwart und Allegorie hin und her flimmern. Nur so nämlich kann der Maler alle Bedeutungsebenen auf einmal im Bild sichtbar machen. Statt an der neuen Zentralperspektive orientiert sich Gozzoli an der Gotik, insbesondere ihren allegorisierenden Stundenbüchern.
Für eine Kulturgeschichte, die die Renaissance auf eine »naturwissenschaftlich« inspirierte Aufbruchsstimmung verengt, steht Gozzolis Fresko jenseits der Idealspur. Doch sind neben dem Neuen das Rückwärtsgewandte, das Mystische, mitunter auch das Mittelalterliche ein wichtiger Bestandteil des Renaissancedenkens. Nicht anders dürften dies Gozzolis Auftraggeber, die Medici, gesehen haben. Als Bankiers für Fürsten und Päpste sind sie die führenden Repräsentanten jener Kaste, die schon seit dem 13. Jahrhundert das Mittelalter dynamisiert. Die christlich wohlgeordnete Welt entzaubern sie durch die seelenlose Rationalität von Geld, Kalkül und Effizienzdenken. Zugleich aber geben die Herren der kalten Münze prachtvolle Umzüge wie am Johannistag des Jahres 1445 in Auftrag, bei dem Laienspieler, Prominente und zweihundert Pferde die Weihnachtsgeschichte opulent nachspielen. Nicht weniger Pomp verwenden sie auf das große Fest für Papst Pius II., den künftigen Herzog von Mailand, Galeazzo Sforza, und den starken Mann von Rimini, Sigismondo Malatesta.
Die Feierlichkeiten finden im Frühjahr 1459 statt. Unmittelbar danach beginnt Gozzoli mit seinem Fresko. Die drei Potentaten – sie haben mit dem Zug von Ferrara nach Florenz gar nichts zu tun – sollen auch zu den etwa dreißig Portraits dazukommen. Für Malatesta und Sforza hält man die beiden Reiter am linken Rand des Hauptbildes. Der Papst steckt vermutlich mitten im Geleitzug, für seine Zeitgenossen gut zu identifizieren anhand der goldbestickten roten Kapuze. Die beiden Reiter auf dem Maultier und dem weißen Pferd zu Anfang des Geleitzugs sind Gozzolis Auftraggeber Cosimo der Ältere und sein Sohn Piero der Gichtige. Wie Gozzolis Briefe verraten, hat Letzterer die Ausgestaltung des Freskos akribisch überwacht. Unterstützt wird Piero dabei von dem befreundeten Bankier Roberto Martelli. Er hat dem Konzil von Florenz 1439 beigewohnt und steuert seine Erinnerungen bei. Auch zwei der drei Könige sind heute ohne Schwierigkeiten als echte Konzilsteilnehmer identifizierbar. Es sind der Patriarch Joseph II. als alter König und Johannes VIII. Palaiologos, der Kaiser von Konstantinopel als König in den besten Mannesjahren. Doch wer blickt als junger König vom Schimmel direkt zum Betrachter (und vom Cover dieses Buchs)? Ist es tatsächlich Lorenzo il Magnifico, der damals zehnjährige Spross der Medici-Familie? Darüber lässt sich bis heute prächtig streiten.
In jedem Fall reiten die Vertreter der katholischen Kirche und ihre Fürsten völlig einträchtig mit den Byzantinern durch die Berge. Von Spannungen und Anspannungen keine Spur. Man erkennt die Vertreter der orthodoxen Kirche schnell an ihren wilden Bärten und ihrer orientalischen Kleidung. Tatsächlich malt Gozzoli einen paradiesischen Frieden in glänzendem Kolorit in das Bild, den es auf dem Konzilszug so nicht gab. Die Vertreter des weltlichen und des geistlichen Byzanz standen 1439 mit dem Rücken zur Wand. Die Türken hatten das Byzantinische Reich erobert und drohten die Hauptstadt Konstantinopel einzunehmen. Wenn die orthodoxe Kirche in dieser Lage gute Miene zu einem bösen Konzil machte, das einer Kapitulation gleichkam und nahezu all ihre geistlichen Traditionen auslöschte, dann nur, weil sie musste. Der Zug der Heiligen Drei Könige in der Hofkapelle der Medici aber zeigt nichts davon. Gozzolis Bilder lassen einen Weihnachtsfrieden aufscheinen, eine märchenhafte Eintracht aller Menschen beider Kulturen. Toskanische Landschaft verschwimmt mit den kargen Felsen des Heiligen Landes. Und gleichsam himmlisch inspirierter »Humanismus« füllt das Bild mit buntem Menschengewusel.
Wenn Zeiten, Glaube und Historie verschmelzen, kommt es auf schnöde Realität nicht mehr an. In welchem Putz windet sich der Konzilszug um die hübschen hellen Felsen? Niemals hätten sich die echten Teilnehmer im winterlichen Apennin in solch einen sommerlichen Festzugszinnober gewandet. Wo bleiben die dunklen schweren Mäntel? Freie Fantasie ist auch, dass Gozzoli sich selbst in den Geleitzug hineingemalt hat. Mit seinem Namen auf der roten Mütze reitet er inmitten von Männern, in denen viele die bedeutendsten Philosophen der Zeit erkennen wollen. Das von einem mächtigen Bart umwölkte Gesicht unter der blau-goldenen Mütze könnte Georgios Gemistos zeigen, der sich Plethon (»der Reichhaltige«) nannte. Als Berater des byzantinischen Kaisers war er auf dem Konzilszug dabei. Plethon trat allerdings als Gegner einer Vereinigung von Ost- und Westkirche auf, womit er seinem Kaiser keinen Gefallen tat. Johannes VIII. wusste, dass er in Florenz zu Kreuze kriechen und dabei die orthodoxe Trinitätslehre opfern musste. Die Einheit der Kirche war für ihn der hohe Preis, um die schnelle militärische Unterstützung der Katholiken für das von den Türken bedrängte Konstantinopel zu gewinnen.
Am 6. Juli 1439 hatten sich die Köpfe des Konzils in der gewaltigsten Kirche der Christenheit, unter der fünf Jahre zuvor fertiggestellten Kuppel der Kathedrale Santa Maria del Fiore, besser bekannt als Dom von Florenz, versammelt. Hier unterzeichneten sie die Bulle Laetentur coeli – »Es freue sich der Himmel«. Mit dabei war auch ein Deutscher von der Mosel: Nikolaus von Kues (1401 – 1464), bekannt als Cusanus. Als Gesandter des Papstes hatte er die Delegation der Byzantiner auf der Schiffsreise von Konstantinopel nach Venedig und dann auf dem Zug nach Ferrara und Florenz begleitet. Wir wissen nicht, ob Gozzoli auch Cusanus auf einem seiner Fresken in der Kapelle verewigt hat. Es wäre erstaunlich, wenn nicht. Das Bild, das er malte, der einträchtige Zug der Weisen in einer von Gottes gutem Willen durchwirkten harmonischen Welt, der Zusammenfall aller Gegensätze in einer höheren Einheit, illustriert auf fast wundersame Weise die cusanische Philosophie.
In ähnlichen Gedanken schwelgt der Florentiner Humanist Giannozzo Manetti (1396 – 1459). 1452, wenige Jahre bevor Gozzoli im Palazzo Medici zum Pinsel greift, rühmt er die Würde und Erhabenheit des Menschen: »Alle Häuser, alle großen und kleinen Städte, überhaupt alle Gebäude des Erdkreises, die ja in so großer Zahl und Qualität vorhanden sind, daß man wegen ihrer ungeheuren Pracht mit Recht zu dem Urteil gelangen müßte, sie seien eher das Werk von Engeln als das von Menschen«3 sind Menschenwerk. »Unser sind die Länder, unser… die Berge, unser die Hügel, unser die Täler, unser… die Orangenbäume, unser die Mispelbäume… unser die Sommereichen, unser die Steineichen… unser die Zypressen, unser die Pinien.« Und unser sind »die Pferde, unser sind die Maultiere, unser die Esel« und »die Vögel, von denen es so viele verschiedene Arten geben muß, daß die göttliche Vorsehung… eine Anhängerin Epikurs gewesen zu sein scheint, weil sie so verschiedene und so unterhaltsame Arten… für den Menschen bereitstellen… wollte«.4 Gottes Erde ist das selbst geschaffene Paradies des Menschen. Sie träumen nicht mehr, zu Engeln zu werden, sie sind selbst Engel, die vom Himmel herabgestiegen sind und die tägliche Gestalt der Menschen angenommen haben.
Im wirklichen Leben aber erwiesen sich die Menschen nicht als Engel. Und die »wunderbaren Dinge«, die sie hervorbringen, halten sich in irdischen Grenzen. Die Welt mochte von Gott weit gedacht sein, aber die Menschen richteten sie weiterhin eng ein. Als die Byzantiner 1439 zurückkehren, lösen ihre Zugeständnisse an die Papstkirche in Konstantinopel Entsetzen aus. Kaum jemand hat vor, sich von nun an Rom unterzuordnen. Unvergessen sind auch die vielen Grausamkeiten, die die westlichen Kreuzritter auf dem Vierten Kreuzzug in der Stadt begangen hatten. Der Klerus zwingt den Kaiser, die Beschlüsse des Konzils zu widerrufen und die orthodoxe Kirche wieder ins Recht zu setzen. Der dritte und letzte Versuch, die christliche Kirche zu einen, ist gescheitert. In der Folge bleibt auch die versprochene Hilfe des Papstes und der italienischen Fürsten gegen die Türken aus. Damit hat sich die Frage nach der Kirchenunion für alle Zeit erledigt. Am 29.Mai1453 sinkt das über tausendjährige Byzantinische Reich für immer dahin. Der osmanische Sultan MehmedII. erobert mit einem 80 000Mann starken Heer das große Konstantinopel…
PHILOSOPHIE DER RENAISSANCE
Die Welt in uns selbst
Eine zersplitterte Welt – Auf der Suche nach dem Universalprinzip –
Die Wahrheit im Inneren – Umsturz der Werte
Eine zersplitterte Welt
Die Überfahrt ist abenteuerlich und stürmisch. Fast zwei Monate braucht die byzantinische Delegation von Konstantinopel bis zur oberitalienischen Ostküste. Aber irgendwann im Spätherbst und Winter 1437 kommt dem Chefunterhändler des Papstes die Erleuchtung. Nikolaus von Kues, genannt Cusanus, wird schlagartig klar, was nicht nur die christliche Kirche spaltet. Was ihm auf dem Meer zwischen Konstantinopel und Venedig aufgeht, lässt fast alle menschlichen und philosophischen Auseinandersetzungen in einem anderen Licht erscheinen.
Von diesen Konflikten gibt es nicht wenige. Cusanus lebt in einer Zeit, so tosend wie das winterliche Mittelmeer. Als Diplomat in päpstlicher Mission weiß er, wie schlecht es um die Macht seines Herrn bestellt ist. Das anstehende Unionskonzil verdeckt kaum, dass die Papstkirche nicht mehr ist, was sie im Mittelalter einmal war. Die Fürsten haben die Stellung des Papstes in der christlichen Welt des Abendlands fast überall geschwächt. Und auch die Kirche selbst durchlebt heftige Turbulenzen. Das Unionskonzil ist kaum mehr als ein Schachzug des Papstes, um die Macht eines anderen Konzils zu brechen, das gleichzeitig in Basel tagt. Die Kirchenvertreter dort betrachten sich selbst als legitime Gegenmacht zur Willkür der Papstherrschaft und wollen den Regenten auf dem Stuhl Petri entmachten. Auch Cusanus ist in Basel gewesen. Er hat dort einen Mittelweg zur Verteilung der Macht zwischen Papst und Konzil vorgeschlagen zugunsten einer neuen Eintracht (De concordantia catholica). Doch der Vorschlag war gescheitert.
Von einer Eintracht ist die Kirche weit entfernt; die abendländische Welt ist zersplittert. Sie ist genau das Gegenteil jenes Engelsfriedens, den Gozzoli zwanzig Jahre später in die Hofkapelle der Medici malen wird. Und was für die politische Lage gilt, gilt für das Denken der ganzen Epoche. Überall erscheint den Menschen die Welt als eine Ansammlung von Widersprüchen. Eine übergreifende Ordnung ist weit und breit nicht in Sicht. Der klare Verstand kann die Widersprüche nur feststellen, aber nicht auflösen.
Auch der christliche Glaube, einschließlich seiner Theologie, besteht aus solchen Unvereinbarkeiten. Schon die Philosophen des Mittelalters hatten sich daran aufgerieben und am Ende manchmal auch ihren Glauben verloren. Ist die Welt ewig? Oder Schöpfung? Wenn sie ewig ist, dann gibt es den göttlichen Schöpfungsakt nicht, denn Handlungen vollziehen sich stets in einer bestimmten Zeitspanne. Ist die Welt dagegen Schöpfung, so fragt sich, was Gott wohl zuvor gemacht hat und was er sich dabei gedacht hat, eine Welt zu erschaffen, in der fehlbare Menschen sich belügen und hintergehen und in Kriegen niedermetzeln. Wer ist schuld daran, Gott oder der Mensch? Ist es der Mensch, wie die Kirche meint, dann muss er einen freien Willen haben. Doch wie soll das gehen, wenn ein unendlich weiser Gott alles vorherbestimmt hat und allwissend die Zukunft kennt? Wie soll der von ihm geschaffene Mensch frei sein, völlig eigene Entscheidungen zu treffen? Warum nimmt Gott manche Menschen in seine Gnade auf und andere nicht? Wäre es für ihn nicht leicht, alle Seelen von vornherein gut und damit selig zu machen?
Fragen wie diese lassen keine guten Antworten zu. Ihre Beantwortung entzieht sich der menschlichen Rationalität. Mit den Waffen der Logik, der Mathematik und des rationalen Beweises kommt der Verstand trotz größter Anstrengung hier nicht weiter. Auch Thomas von Aquin, der die Rationalität des Aristoteles mit der Spiritualität des Christentums zwangsverheiratete, hatte diese Probleme nicht wirklich lösen können. Und seine begriffsakrobatischen Lehrgebäude hatten inzwischen auch viel Rost angesetzt. Die »Scholastik«, die schulmäßigen Disputationen des Hoch- und Spätmittelalters galten Cusanus und vielen seiner Zeitgenossen als abständig und überholt. Doch was sollte man an deren Stelle setzen, wenn die Welt offensichtlich kein Wunderwerk aus einem Guss war? Wenn Dekadenz, Machtmissbrauch, Kriege und Zweifel die Papstkirche, der Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert noch treu gedient hatte, tief erschüttert und zerrüttet hatten?
In dieser Lage überkommt Cusanus nach eigener Aussage auf dem Schiff nach Venedig eine blitzartige Erkenntnis. Warum meinen wir Menschen eigentlich, dass ausgerechnet der Verstand diese großen und augenscheinlich unlösbaren Fragen beantworten soll? In der Tradition des Aristoteles glaubten die Philosophen, dass ihre Aussagen über die Welt widerspruchsfrei zu sein hätten. Genau diese Forderung hatte im Mittelalter die Philosophie von der Theologie getrennt. Während Theologen achselzuckend zugeben konnten, dass Gott barmherzig und gerecht sei, verdammend und erlösend, dass er zeitlos sei und doch in der Zeit wirkte und so weiter, hatten die philosophisch denkenden Gelehrten versucht, diese Gegensätze aufzulösen. Aristoteles ließ keine oppositio zu, sondern nur ein Entweder-oder. Was sich auf diese Weise nicht entscheiden ließ, widersprach der Logik und war damit unwahr. Aristoteles’ Realität war eindeutig und nicht mehrdeutig, sie war widerspruchsfrei und nicht unlogisch.
Doch genau hierin erkennt Cusanus einen großen Fehler. Meint Gott die Welt denn tatsächlich logisch und eindeutig? Wie Platon und Aristoteles unterscheidet der junge Diplomat in päpstlicher Mission zwischen Verstand (ratio) und Vernunft (intellectus). Der Verstand ist das gleichsam technische Hilfsmittel, das es uns ermöglicht, logische Schlüsse zu ziehen. Die Vernunft dagegen ist das umfassendere Einsichtsvermögen, das jene Voraussetzungen erkennt, die allem logischen Schließen zugrunde liegen. Als geistige Besonnenheit ist sie weit mehr als Logik; sie ist Weltklugheit. Diese Vernunft, meint Cusanus, sagt uns, dass die Ratio nicht alles ist. Sie sagt uns, dass der Verstand, wenn er sich bemüht, die Natur zu durchdringen, keine Einheit vorfindet, sondern ein endloses Hin und Her in einer Welt aus Gegensätzen. Aristoteles hatte versucht, diese Gegensätze zu harmonisieren. Selbst wenn er von »Unendlichkeit« redete, betrachtete er sie so, als wäre sie endlich und darum als Unendlichkeit erkennbar. Er hatte Ruhe und Bewegung sorgfältig voneinander getrennt, obwohl sie sich physikalisch bedingen und durchdringen. Er hatte ein statisches System von etwas Dynamischem entwickelt und es dadurch in seinem Wesen verfehlt. Kurz gesagt: Aristoteles hatte die Dinge so voneinander geschieden, dass ihr Zusammenspiel aus Gegensätzen unter den Tisch fiel.
Cusanus, der nicht nur Kirchenfunktionär ist, sondern auch ein begeisterter Naturforscher und Mathematiker, sieht nirgendwo eine geschlossene Einheit. So wie die christliche Kirche aus Gegensätzen besteht – nicht nur als Spaltung von römisch-katholischer und orthodoxer Kirche –, so bilden überall in der Welt erst die Gegensätze ein Ganzes. Coincidentia oppositorum – das Zusammenfallen der Gegensätze – lautet seit der Schiffsfahrt von Konstantinopel nach Venedig der Schlüsselbegriff in Cusanus’ Denken. Wenn alle bisherigen Versuche, die Welt philosophisch zu erklären, gescheitert waren, dann einzig und allein aus diesem Grund: Die Philosophen hatten die Welt nur rational betrachtet und möglichst widerspruchsfrei sortiert. Es komme aber darauf an, die Einheit der Welt als ein Zusammenspiel von Gegensätzen zu verstehen, die sich nicht logisch beseitigen lassen. Damit, so meint Cusanus stolz, stehe die Philosophie vor einem umfassenden Neuanfang.
Im Vergleich zur philosophischen Tradition ist Cusanus’ Denken so etwas wie eine philosophische Quantenmechanik. Ein tief in der Mystik verwurzelter Kirchenmann wird so zum Vordenker der italienischen Renaissancephilosophie. Seine Gedanken sprengen alle bisherige Systematik und formulieren ein neues Universalgesetz der Welt. Doch der Sondergesandte des Papstes, der in Kues an der Mosel geboren wurde und anschließend in Heidelberg an der »Artistenfakultät« ein Studium generale absolviert und in Padua Kirchenrecht studiert hat, ist nicht aus heiterem Himmel auf seinen Einfall gekommen. In Köln, wo er vermutlich kurze Zeit unterrichtet, lernt er den niederländischen Theologen Heymericus de Campo (ca. 1395 – 1460) kennen. Dieser macht ihn mit dem Neuplatonismus und den Schriften eines Mannes vertraut, der sich im 6. Jahrhundert Dionysius Areopagita nannte und sich in seinen Schriften als Schüler des Apostels Paulus aus der Apostelgeschichte ausgab.
Dieser Dionysius hatte die Philosophie des Neuplatonikers Plotin christlich gedeutet und damit maßgeblich das Christentum beeinflusst. Seine wichtigste Leistung ist die Formulierung einer »Negativen Theologie«. Danach steht Gott so weit über allem, dass wir Menschen über ihn nichts Verbindliches aussagen können. Selbst Eigenschaften wie »gut«, »gütig« oder »vollkommen« greifen angesichts der unfassbaren Größe Gottes zu kurz. Viele Denker des Mittelalters hatten zu Dionysios’ Negativer Theologie Zuflucht gesucht, wenn sie an den märchenhaften Geschichten der Bibel oder den allzu menschlichen und allzu willkürlichen Geboten und Dogmen der Papstkirche zweifelten.
Im Zentrum des neuplatonischen Denkens steht eine Annahme: Alles in der Welt ist auf ein ominöses spirituelles »Eines« zurückzuführen! Dieses »Eine« ist die unvorstellbare Quelle, aus der in mehreren Stufen alles entspringt, was in der Welt ist. Dionysius hatte diesen Gedanken Plotins christlich eingefärbt und das »Eine« der Griechen mit dem Gott der Christen gleichgesetzt. Cusanus ist begeistert! Die Vorstellung vom spirituellen »Einen« wird ihn ein Leben lang begleiten. Was ihm allerdings fehlt, ist eine Erklärung dafür, warum sich das »Eine« mithilfe des Verstandes in der Natur nicht entdecken lässt. Wie bringt man die Welt der vielen Dinge und das spirituelle »Eine« sinnvoll in eine einzige Gedankenfigur?
Cusanus hat schon länger darüber nachgedacht, als er auf seiner langen winterlichen Schiffsreise das Prinzip des Zusammenfallens der Gegensätze formuliert. Heymericus war ein klassischer Logiker gewesen, der das gesamte menschliche Wissen aus dem Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch ableitete. Doch Cusanus zweifelt an der überkommenen Logik. Sie ist zu starr und zu eng, um das »Eine« zu begreifen. Als Anhänger des christlich gewendeten Neuplatonismus und der Negativen Theologie sieht er in Gott alles und zugleich sein Gegenteil. Maximum und Minimum sind eins und deshalb mithilfe des Verstandes und seiner Begriffe unbeschreibbar und unerkennbar. Man muss die Welt nicht mit dem Verstand durch und durch logisch ergründen wollen, wie Aristoteles es versucht hatte und mit ihm so viele Philosophen des Mittelalters. Weltklüger ist es, sich die Ohnmacht des Verstands bei höchsten und letzten Fragen ganz einfach einzugestehen!
Cusanus nennt dieses Eingeständnis wissende Unwissenheit(docta ignorantia): Der Vernünftige weiß um die Beschränktheit des Verstands. Für einen Diplomaten des Papstes ist diese Philosophie ziemlich mutig, denn sie verachtet fast das gesamte Wissen der kirchlichen Philosophie. Nur sehr wenige Männer haben diesen Pfad bereits vor Cusanus beschritten. Und der kühnste unter ihnen war ein Gelehrter, dessen Schriften Cusanus sehr gut kennt, hat er sie doch 1428 in Paris ausgiebig studiert und eigenhändig abgeschrieben. Die Rede ist von Ramon Llull (1232 – 1316), dem großen Philosophen Kataloniens.
Auf der Suche nach dem Universalprinzip
Im Hafen von Palma de Mallorca, am Paseo Sagrera, steht das Denkmal eines Philosophen, des bedeutendsten Sohnes der Insel. Mit einem langen Bart, gewandet wie Miraculix der Druide und mit entschlossenem Blick hält er ein aufgeschlagenes Buch in der Hand. Bestimmt und energisch scheint er dem Meer und den Elementen zu predigen.
Ramon Llull war ein Philosoph des Mittelalters; allerdings nur, weil er im 13. Jahrhundert lebte. Was seine Gedanken anbelangt, so war er ein Künder jenes Neuen, das man später als typisches Gedankengut der Renaissance beschreiben wird. Dieses Neue lässt sich in fünf kurzen Sätzen zusammenfassen. Llull setzte, wie später Cusanus, die Vernunft über den Verstand. Er suchte – philosophisch und naturwissenschaftlich beschlagen – das Universalprinzip, das die Welt im Innersten zusammenhält. Dieses Prinzip konnte für ihn in einer Welt des permanenten Werdens und Vergehens kein »Sein« sein, sondern nur ein »Wirken«. Llull fahndete nach dem spirituellen Kern dieses Wirkens und damit nach dem Gemeinsamen aller Religionen; folgerichtig predigte er religiöse Toleranz. Und er setzte den einzelnen Menschen, das Individuum in seiner Besonderheit, ins Zentrum seiner Philosophie. All dies gilt heute als das Denken einer gegenüber dem Mittelalter neuen Epoche.
Llull kam aus der feudalen Oberschicht Mallorcas. In seiner Jugend war er nach eigener Auskunft ein Draufgänger, ein Frauenheld und ein Lebemann. Im Alter von etwa dreißig Jahren wurde er Missionar. Seine hohe Begabung für Sprachen ließ ihn neben Latein schnell Arabisch lernen. Das Katalanische, seine Muttersprache, wurde durch ihn überhaupt erst zu einer Schriftsprache mit klarer Grammatik und reichhaltigem Ausdruck. Llull studierte die jüdische Theologie ebenso wie die islamische. Und er beschäftigte sich intensiv mit Logik. Sollte das Christentum dem Judentum und dem Islam überlegen sein, dann nur, weil es logischer war als die anderen Religionen. Doch um das Christentum logisch zu finden, musste man es von aller orientalischen Poesie entkleiden und seinen spirituellen Kern freilegen.
Als Katalane wächst Llull in die aufblühende Handelskultur des westlichen Mittelmeerraums hinein. Araber, Juden und Christen stehen hier in intensivem Kontakt und tauschen und verkaufen ihre Waren. Im Königreich Mallorca blüht der Handel mit Tuchwaren, Schiffen und Waffen. Als Missionar einer Handelsmacht reist Llull in ungezählten Fahrten auf dem Mittelmeer hin und her. Dabei findet er die Zeit, mehr als 280 Schriften in drei verschiedenen Sprachen zu verfassen. Llulls Ziel ist ehrgeizig: Ihm schwebt eine Allgemeinwissenschaft vor, eine Ars generalis, die alles Wissen in ein neues System bringt. Ambitionierter kann man im 13. Jahrhundert kaum sein. Gibt es ein Universalprinzip, das es erlaubt, die immer weiter auseinanderfallenden Welten der Naturforschung, der Philosophie und der Theologie in einem einzigen großen System zu vereinigen?
In dieser schwierigen Frage kommt Llull ein neuer Einfall. Bislang haben sich Araber, Juden und Christen endlos über zwei Fragen gestritten: Ist Gott dreifaltig oder nicht? Und ist Jesus tatsächlich Gottes Sohn und selbst göttlich? All diese Scharmützel drehen sich auch um die Frage, ob etwas so ist oder nicht. Für Llull aber ist die Frage falsch gestellt, solange man stets nur vom Sein einer Sache spricht. Denn in der Welt, so wie Llull sie beobachtet, gibt es gar kein unveränderliches Sein, sondern nur ein Werden. Alles in der Natur ist in Bewegung, und es ist dynamisch. Wo sich etwas verändert, da muss es eine Kraft geben, die diese Veränderung auslöst und bestimmt. Etwas, das in allem wirkt, in der Natur ebenso wie in jedem einzelnen Menschen. Diese Wirkkraft ist für Llull Gott. Größe, Schönheit, das Gute und so weiter existieren also nicht als etwas Seiendes in der Welt. Sondern Größe, Schönheit und Gutes entstehen, indem eine göttlich inspirierte Energie im Menschen große, schöne oder gute Taten und Dinge hervorbringt. Zu einem solchen Vorgang gehören der, der etwas tut, das Tun selbst und das Ergebnis des Tuns, das Getane.
In einem erstaunlichen geistigen Schachzug bringt Llull diese Dreiteilung allen Geschehens mit der christlichen Lehre von der Trinität zusammen. Seine verwunderten arabischen Gesprächspartner hören nun, dass die christliche Dreifaltigkeit Gottes nicht etwas ist, woran sie glauben sollen. Nein, sie ist etwas, das unweigerlich in ihnen wirkt, wenn sie etwas tun oder hervorbringen! Da diese Wirkkraft göttlich ist, ist es ihr Ziel, Göttliches zu bewirken. So strebt, nach Llull, jeder Mensch prinzipiell danach, dem Göttlichen näherzukommen und sich entsprechend zu vervollkommnen. Richtig zu leben bedeutet, dem dreifaltigen göttlichen Wirken in sich freien Lauf zu lassen und es nicht eigennützig und engstirnig zu drosseln.
Wie muss man sich ein solches Wirken vorstellen? Wie setzt sich die göttliche Dynamik in der irdischen Welt der Dinge um? Es ist, schreibt Llull, wie mit einem Feuer. Das Feuer brennt, weil es brennt. Es ist die göttliche Wirkkraft in Reinform. Sie drängt danach, sich an einem Gegenstand zu entzünden und sich zu vergrößern. Was das brennende Feuer bewirkt, ob es das Wasser oder die Erde erwärmt, ist hingegen eine zweitrangige Frage. Die konkrete Wirkung in der Welt der Gegenstände (Erhitzen oder Verbrennen) ist nur eine unter vielen denkbaren Umsetzungen. Mit anderen Worten: Das Feuer selbst ist das Potenzial oder die Möglichkeit, das Verbrennen und Erhitzen eine von Fall zu Fall erzeugte Wirklichkeit.
Im Urzustand der Welt gibt es, nach Llull, ein Chaos, ein einziges großes Knäuel göttlicher Potenzialitäten. Aus ihnen entstehen die Elemente, die Gattungen und Arten. Weil Gottes Wirkkraft ihr innewohnt, sehnt sich alles in der Welt danach, dem Göttlichen wieder nahezukommen. Es ist der alte Gedanke Plotins, dass alles danach strebt, mit jenem »Einen« zu verschmelzen, dem es entspringt. Doch anders als Plotin spricht Llull nicht nur von den Seelen. Alles in der Natur sehnt sich bei ihm nach Vollkommenheit. Dabei kann ein einzelnes Element, ein Frosch oder eine Distel nur so weit gelangen, wie es einem Element, einem Frosch oder einer Distel halt möglich ist. Die Grenzen ihrer Art und ihrer Gattung sind die Grenzen ihrer Vervollkommnungsmöglichkeit. Llulls Denken enthält so etwas wie ein theologisches Evolutionsmodell. Danach strebt alles in der Natur erstens nach Höherem und zweitens danach, sich auszubreiten.
Der Mensch unterscheidet sich von allem anderen in der Natur nun dadurch, dass er das göttliche Wirken in sich bewusst erspüren, ertasten und ergründen kann. Deshalb ist es die Aufgabe des göttlich inspirierten Menschengeistes, sich zu erkennen und auf diese Weise reflektierend zu sich selbst zurückzukehren. Dieser Gedanke ist ein bahnbrechender Gedanke in der Philosophie. Pathetisch formuliert beginnt hier die philosophische Neuzeit. Zwar hatte schon das Orakel von Delphi die antiken Griechen aufgefordert: »Erkenne dich selbst!« Doch gemeint hatte es, dass man seinen richtigen Platz in der Welt erkennen sollte, nicht aber, dass diese Welt in uns selbst liegt, insofern wir sie mit unserem Geist selbst erschaffen. Dieses neue Denken wird später nicht nur Cusanus inspirieren. Es ist der Anfang der neuzeitlichen Subjektphilosophie, die über René Descartes und den Deutschen Idealismus des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert ausstrahlt.
Was hat Llull getan? Er hatte die Perspektive der Erkenntnis herumgedreht. Danach liegt die Wahrheit nicht in der Welt, sondern in uns selbst. Und, wie später bei Cusanus, ist es nicht der Verstand, der uns einen Zugang zu den höchsten Dingen verschafft, sondern es ist die Vernunft.
Doch nach welcher Methode soll man dabei vorgehen? Für Llull führt der Weg der Erkenntnis von der täuschungsanfälligen Sinneswahrnehmung über den ordnenden Verstand zur hellen Vernunft. All dies ist klassisches griechisches Denken. Auch die Beschreibung der göttlichen Sphäre der Wahrheit ist nicht neu. Es ist jene Welt des Absoluten, in der alle positiven Eigenschaften so sehr ineinanderfallen, dass sie sich nicht mehr als »vollkommen«, »groß«, »gerecht«, »liebend« und so weiter isolieren lassen. Diese Vorstellung ist das Erbe Plotins und des Dionysius Areopagita. Neu ist dagegen die »Logik« des richtigen Vernunftgebrauchs, die Llull in die Philosophie einführt. Für ihn schränken Einbildungskraft und Verstand die Grenzen der menschlichen Erkenntnis ein. Das Tier »Mensch« (homoficans animal) gelangt hier an die Grenzen seiner Art. Wir können nur das sehen, hören, riechen, tasten und schmecken, was unsere Sinne uns ermöglichen. Und unser Verstand kann nur das erfassen, was er mit seiner begrenzten Logik begreifen kann. All das spüren und wissen wir, wenn wir in uns selbst hineinhorchen und grübeln. Um trotzdem zu einer höchsten Erkenntnis zu gelangen, brauchen wir eine Universalmethode (Ars generalis ultima), eine neue Kunst des Denkens. Ihre Grundlage kann nur eine neue erweiterte Logik sein, eine Logica nova. Diese Logik darf nicht in den engen Mauern der Verstandeswelt verharren. Sie muss eine gleitende Logik der Vernunft sein, weiter und höher als unsere Verstandeslogik, eine Logik, die Glauben und Wissen miteinander versöhnt.
Für viele heutige Leser sind solche Gedanken unverständlich und auf eine vorwissenschaftliche Weise einfältig. Es gibt nur eine Logik und eine Rationalität, und die haben mit spirituellen Einsichten nichts zu tun. Doch so einfach ist die Sache nicht. Llull sieht nämlich völlig zu Recht, dass das, was den Menschen antreibt, nicht seine Rationalität ist. Wenn wir nach Güte, Liebe und Wahrheit streben, dann ist dieses Streben nicht logisch erklärbar. Stattdessen wirken Kräfte in uns, die uns überhaupt erst dazu anspornen, nach der Wahrheit zu suchen und dabei logische Gedanken zu entwickeln. Im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit gehen nahezu alle Menschen davon aus, dass diese Kräfte und Energien »von oben«, also göttlich, auf uns einwirken, um uns als Menschen zu erhöhen. Jahrhunderte vor Charles Darwin sieht man sie nicht als sozial hoch verfeinerte animalische Bedürfnisse an, wie es heutige Biologen tun. Streben und Denken, Trieb und Verstand als zwei Seiten einer Medaille zu sehen, wie Llull es tut, ist wegweisend. Und Wirkkraft und Rationalität zusammen in einer »neuen Logik« zu denken ist im 13. Jahrhundert keineswegs ein abwegiger, sondern ein kluger Gedanke.
Doch auch für manchen Philosophiehistoriker fällt Llull mit seiner »Universalmethode« zurück ins frühe Mittelalter; eine Zeit, in der Männer wie Anselm von Canterbury glaubten, sie könnten Glauben und Wissen zusammenführen und sogar Gott beweisen. Hat nicht der Lauf der Philosophie im Mittelalter gezeigt, dass beides nicht zur Deckung gebracht werden kann? Hat nicht Thomas von Aquin Wissen und Glauben weitgehend auseinandergehalten und Wilhelm von Ockham beides rasiermesserscharf geschieden? Doch Llull möchte den Glauben ja gar nicht vollständig rational durchdringen und in Wissen auflösen! Er möchte ihm nur mithilfe der Vernunft näherkommen; einer Vernunft, die für den Glauben ebenso sensibel ist wie für das Wissen. Das Spirituelle im Materiellen zu erkennen ist das Ziel jeder Anstrengung. Und das Kombinieren von höchsten Begriffen soll uns erahnen lassen, was Gott ist. Ein Mensch, der Meerwasser trinkt, begreift auch nicht das ganze Meer. Er spürt nur, dass es salzig schmeckt. Auf gleiche Weise kann der Mensch entscheidende Aspekte des Göttlichen verstehen, ohne doch des Ganzen gewahr zu sein.
Llulls Ruhm in der gelehrten Welt des Mittelalters ist groß. Aber sein monumentales Ziel, die Religionen zu versöhnen und unter der Leitidee des Christentums zu spiritualisieren, scheitert. Zeitgenossen verspotten ihn als »doctor phantasticus«. Er selbst amüsiert sich darüber. Seine Ziele sind in der Tat utopisch, doch soll er sie deswegen nicht haben? Llull streitet gegen die Ausbildung von Nationalstaaten. Und er träumt von einem einigen und einheitlichen Europa ohne Kriege. Er schlägt hart auf. Hochbetagt wird er in Tunis von Muslimen gesteinigt, denen er seine Idee der religiösen Toleranz predigt. Er stirbt auf dem Schiff, das ihn aus Afrika fortführt, und wird in Palma beerdigt. Zu Lebzeiten ein Mann, der mit Fürsten und Päpsten verkehrte und in Paris an der Sorbonne lehrte, wird er der Kirche später verdächtig. In Llulls Philosophie steht der einzelne Mensch in seinem Bemühen um spirituelle Erleuchtung im Zentrum. Die Kirche mit ihren Institutionen und Dogmen ist weniger wichtig. So trifft ihn sechzig Jahre nach seinem Tod die Verurteilung als Ketzer durch Papst Gregor XI. Llulls Schriften werden verboten und verbrannt. Erst im 19. Jahrhundert wird er rehabilitiert. Papst Pius IX. spricht ihn 1847 selig.
Die Wahrheit im Inneren
Ein kühler Raum mit goldgelb verziertem Gewölbe bewahrt die größte erhaltene Privatbibliothek des Mittelalters nördlich der Alpen auf. An den Wänden schlichte dunkle Holzregale, bestückt mit gewaltigen Folianten. Noch heute überkommt den Besucher der Cusanus-Bibliothek in Bernkastel-Kues ein andächtiges Staunen, wenn er das ganze Wissen einer früheren Welt bestaunt: Handschriften über Theologie und Philosophie, Mathematik, Astronomie, Physik und Medizin. Von einem Autor jedoch findet man dort mehr Werke als von allen anderen – Ramon Llull!
Cusanus bewunderte den großen Katalanen sehr. Wie Llull mehr als hundert Jahre zuvor, so will auch er den christlichen Glauben aus der äußeren Welt in die innere Welt holen. Spiritualität ist nichts, was der Mensch in der Außenwelt schlichtweg vorfindet. Sondern Gott zu erfahren bedeutet, ihn in sich selbst zu erfahren durch Meditation und Reflexion. Und vor allem durch eine Vernunft wie jene »neue Logik« Ramon Llulls.
Cusanus wusste, dass er mit seiner »mystischen« Auslegung der christlichen Religion nicht allein dastand. Immer wieder verweist er auch auf den irischen Gelehrten Johannes Scotus Eriugena aus dem 9. Jahrhundert. Und nichts anderes hatte auch schon Eckhart von Hochheim,Meister Eckhart (um 1260 – 1328), ein Zeitgenosse Llulls, gepredigt – und es war ihm äußerst schlecht bekommen! Von der Kurie in Avignon drangsaliert, war er am Hof des Papstes zerknirscht und ermattet gestorben, den Feuertod als Ketzer vor Augen. Cusanus musste entsprechend vorsichtig sein. Wenn er den Glauben spiritualisieren wollte, durfte er es sich nicht mit der Papstkirche verscherzen. Tatsächlich geschieht genau das Gegenteil, er macht eine glänzende Karriere! Nach seiner Diplomatenrolle in Basel, Ferrara und Florenz vertritt er die Interessen Roms auf den Reichstagen in Nürnberg, Mainz und Aschaffenburg und ficht dabei gegen die erstarkten deutschen Bistümer und die in religiösen Fragen immer neutraler werdenden Landesfürsten. 1448 kommt es durch Cusanus’ maßgeblichen Einsatz zum Wiener Konkordat. Damit bleibt der so heftig umstrittene Einfluss des Papstes auf die Bistümer im Heiligen Römischen Reich gewahrt. Ein gewaltiger Erfolg für die Kurie! Cusanus steht nun kurz davor, selbst zum Papst gewählt zu werden. Als sein Freund Tommaso Parentucelli stattdessen als Nikolaus V. den Stuhl Petri besteigt, wird er Kardinal und bald darauf Bischof von Brixen.
Cusanus ist der erste deutsche Kardinal seit zwei Jahrhunderten. Unentwegt reist er in den Folgejahren durch die deutschen und oberitalienischen Lande. Er schlichtet Konflikte, befriedet Fehden, regelt Finanzen, spricht Recht und gerät immer wieder in heftige Scharmützel mit seinen Tiroler Landesfürsten in Brixen, wobei er dem Tod nur knapp entrinnt. 1459 wird Cusanus vom neuen Papst Pius II. zum Legaten und Generalvikar ernannt, das zweithöchste Amt im Kirchenstaat. Dass er bei alledem überhaupt die Zeit findet, nicht nur juristische und theologische Gebrauchstexte, sondern auch philosophische Werke zu schreiben, ist verblüffend. Besonders in der Mitte der 1440er Jahre, als er in Deutschland in diplomatischer Mission unterwegs ist, verfasst er enorm anspruchsvolle Texte in kürzester Abfolge.
Im Zentrum dieser Philosophie steht die große neuplatonische Einsicht: Das Göttliche lässt sich nicht adäquat erkennen, weil es absolut ist! Denkt der Mensch an das Größte, so gibt es doch immer ein noch Größeres, ebenso beim Kleinsten. Unser Verstand kann die wahre Dimension der Welt also nicht erfassen. Und so wie bei Plotin der Intellekt aus dem Einen und die Seele aus dem Intellekt »ausfließt«, so spricht Cusanus davon, dass sich die Welt vom Größten bis zum Kleinsten »ausfaltet«. Dabei illustriert er seine Philosophie durch mathematische, meist geometrische Beispiele. Wie so viele andere vor ihm, versucht sich Cusanus unter anderem an der Quadratur des Kreises. Da das Problem unlösbar ist, setzt er die Quadratur mit Gott gleich, dem Inbegriff des Unvorstellbaren.
Cusanus schreibt auf Latein, nicht auf Deutsch, obwohl er mit seinen Schriften durchaus pädagogische Absichten verbindet. Doch zu gegenwärtig ist ihm die Gefahr, dass seine Spiritualität von Laien aufgegriffen und gegen die Kirche verwendet werden könnte. Denn sagt er nicht Ähnliches wie Eckhart, wenn er die »wissende Unwissenheit« der offiziellen Theologie vorzieht? Schreibt er nicht, dass man die Wahrheit in der Unmöglichkeit, wie der Quadratur des Kreises, suchen sollte, anstatt in kirchlichen Dogmen? Die letzte Wahrheit befindet sich nicht im Besitz der Kirche, sondern sie ist verborgen. Alles, was wir tun können, ist, über sie zu mutmaßen. Wir müssen das unendliche Geflecht der Zeichen ausdeuten, mittels derer unsere Welt verrätselt ist. Und wir müssen dabei das Zusammenfallen der Gegensätze verstehen. Wir müssen aushalten, dass unser Verstand die Welt in letzter Tiefe nicht ergründen kann.
All das kann man Mystik nennen, wenn man möchte. In jedem Fall ist es eine völlig andere Perspektive auf die Welt als jene, die Cusanus in seinen Rollen als päpstlicher Diplomat und Machtpolitiker vertritt. Nüchterner Pragmatismus hier, spirituelle Versenkung dort. Seinen Zeitgenossen, für die er schreibt, bleibt seine Philosophie meist unverständlich. Was will Cusanus ihnen sagen? Was ist richtig und was ist falsch? Wie sollten sie denn nun leben? Der Deutsche an der Seite der Päpste spricht davon, dass die Philosophie des Thomas von Aquin und der Scholastiker nichts mehr gilt. Das aber ist genau die Gedankenwelt, in der die Kleriker auch im 15. Jahrhundert noch leben. Dagegen ist das Universalprinzip der Erkenntnis, das Cusanus ihnen anbietet, reichlich dunkel, ebenso wie die von ihm verkündete neue »allgemeine Wissenschaft«.
In dieser Lage verfasst Cusanus eine kleine Einführungsschrift in sein Denken. Er richtet sie an die befreundeten Mönche des Klosters Tegernsee, die ihn um Aufklärung gebeten haben. Cusanus liefert ihnen einen Text, der als Lupe oder Brille dienen soll (De beryllo). Darin erklärt er den Mönchen, was er mit dem Prinzip vom Zusammenfall der Gegensätze meint. Jede Naturforschung sei im Grunde Mathematik. Diese eröffne uns den verstandesgemäßen Zugang zu allem, was ist. Nun gehört es aber zum Wesen der Mathematik, dass sie auf untrennbare Weise Gegensätze in sich vereine. Wenn ich von Vielem rede, so kann ich das nur, wenn ich das Viele zugleich von einem Einen unterscheide, das es nicht ist. Damit ist das negierte Eine im Vielen mitgedacht. Das Gleiche gilt beim Unendlichen. Nur in Abgrenzung vom Endlichen macht die Rede vom Unendlichen einen Sinn. Vieles und Eines, Unendliches und Endliches gehören also untrennbar zusammen. Der Widerspruch trennt sie und vereint sie zugleich. Und genau so sieht Cusanus die ganze Welt: Sie ist das untrennbare Ineins von Gegensätzen, aufgehoben in Gott.
Dass das Eine zugleich ein Vieles sein muss, unterscheidet Cusanus von Plotin. Inspiriert wird er hier vielmehr von der christlichen Trinitätslehre. Das Eine ist nicht einfach ein Sein, sondern ein Denken! Diese Erkenntnis ist allerdings keine Einsicht des logischen Verstandes, sondern der ihn übersteigenden Vernunft. Sie ist, wie Llulls Logica nova, ein logisches Schließen auf spiritueller Grundlage, das sich vom sicheren Boden der mathematischen Logik hinwegwölbt mit einem Widerlager in der Sphäre des Göttlichen. In dem Moment, wo wir das Universalprinzip vom Zusammenfallen der Gegensätze erkennen und auf alles anwenden, betreiben wir die neue »allgemeine Wissenschaft«. So kann sich jeder einzelne Mensch, wie bei Llull, dem Göttlichen denkend und versenkend nähern.
Je älter er wurde, umso mehr veränderte sich dabei Cusanus’ Interpretation des Neuplatonismus. Für Plotin war das »Eine« etwas kosmologisch Objektives und nur die über den Intellekt daraus ausströmende Seele war psychisch. Für Cusanus dagegen ist das »Eine« in jedem einzelnen Menschen psycho-physisch gegenwärtig als Ziel seines seelischen Strebens. Wie Llull wertet er diesen Erkenntnisprozess als die Chance, sich selbst zu vergöttlichen. Die Unendlichkeit, das Absolute, ist in uns selbst. Es ist nicht Teil der Außenwelt, sondern intime Innenwelt. Nicht »Erkenne die Welt!« lautet der Auftrag, sondern »Erkenne die Welt in dir selbst!« Es ist jener Perspektivwechsel, den Llull vollzogen hatte, und Cusanus denkt ihn konsequent weiter.
Aus heutiger Perspektive ist er damit ein Künder der Neuzeit. Im Gefolge Llulls hat er die entscheidende Wende der Philosophie vorgedacht. Diese Wende lautet: Alles, was ich von der Welt weiß, weiß ich in meinen Gedanken. Folglich muss ich nicht die Welt untersuchen, von der ich außerhalb meiner Gedanken nichts wissen kann. Sondern ich muss meine Gedanken ergründen, um in ihnen die Welt zu erkennen. Modern ausgedrückt ist Cusanus ein früher Vertreter der Bewusstseinsphilosophie. Ihre ältesten Wurzeln reichen zurück zu Parmenides ins 5. vorchristliche Jahrhundert. Dietrich von Freiberg, Meister Eckhart und Ramon Llull hatten ihr im Mittelalter die Tore geöffnet. Und Cusanus transportiert sie in die Neuzeit hinein und öffnet so eine neue Sicht auf den Menschen. Er wird Architekt seines Selbst und Schöpfer seiner Welt.
Doch wie stellt sich der Machtpolitiker im Vatikan die praktische Umsetzung seiner Philosophie vor? Will er die Kirche damit im Inneren reformieren? Glaubt er, dass es ausreicht, die Mönche am Tegernsee und anderswo mit seiner »allgemeinen Wissenschaft« zu bekehren, damit die Kirche und mit ihr die Welt besser wird? Gewiss ist Cusanus kein Revolutionär. Er ordnet sogar an, die wenigen Handschriften, die noch von Meister Eckhart in den Bibliotheken liegen, zu entfernen. Eckhart hatte davon geträumt, die verkommene Papstkirche mit ihren ebenso verkommenen Bistümern zu reformieren. Und er hatte dabei auf die Laienbewegung gesetzt, auf die Spiritualität jedes Einzelnen, sei er nun gebildet oder nicht. Aber Eckhart hatte keinen Erfolg gehabt. Seine spirituelle Erneuerung war von der Kirche im Keim erstickt worden.
Cusanus geht vorsichtiger und behutsamer vor. Er wendet sich nur an die Kleriker und hält sich fern von jedweder öffentlichen Kritik an der Papstkirche. Vielleicht glaubt er, als päpstlicher Berater reformatorisch wirken zu können. Doch Nikolaus V. denkt zumindest im Hinblick auf die Volksfrömmigkeit nicht an Spiritualität. Ganz im Gegenteil. Er stärkt die Papstkirche durch alle erdenklichen Mittel und bietet den Laien das Schauspiel von Kunst, Pracht und Glanz, um sie bei der Stange zu halten. Auch Pius II. verfolgt diesen Kurs. Wenn man das von allen Seiten bedrohte Papsttum retten will, dann gewiss nicht durch eine Hinwendung zum inneren Menschen. Stattdessen bedarf es einer geschickten Politik. Die größte aller Gefahren sind die Türken, die einige Jahre zuvor Konstantinopel erobert haben. In dieser Lage denkt Pius äußerst weltlich und fordert die Christenheit zur militärischen Einheit auf. Er belebt den längst verstaubten karolingischen Begriff »Europa« – allerdings nicht im Sinne einer staatlichen Einheit, wie Llull sie sich erträumt hat, sondern als christliches »Vaterland«, eine Seelenheimat, die gemeinsam gegen den äußeren Feind verteidigt werden soll.
Cusanus dagegen predigt in gleicher Lage Toleranz und betont die gemeinsame Spiritualität aller Religionen einschließlich des Islams: Versöhnen statt spalten! Dabei scheint er sich erneut an Llull zu orientieren. Warum sollen die Türken nicht an denselben Gott glauben wie die »Europäer«? Zwar hält auch Cusanus das Christentum für die »richtigere« Religion und besteht auf der Bedeutung Christi als Mensch gewordenem Gott sowie auf der Trinität. Aber er gesteht den anderen monotheistischen Religionen durchaus zu, dass sie auf ihre Art und Weise ebenfalls von Gott wüssten. Cusanus schreibt ein Buch über den Glaubensfrieden (De pace fidei) und später drei zusammenhängende Werke über den Koran. Er sieht, dass sich die Religionen vor allem durch ihre Gebote und Gebräuche unterscheiden. Diese aber seien nicht göttlich, sondern Menschenwerk. Wer sich über Gebete und Riten, wie die Beschneidung, entzweie, streite im Grunde nicht über den Glauben, sondern über menschliche Zutaten und Interpretationen. Mit Vernunft betrachtet, gibt es gar keine göttlichen »Gebote«. Insofern stehe einer Eintracht, vielleicht sogar einer Einheit der Religionen nichts im Wege.
Während Cusanus dies zu Papier bringt, erobern die Türken die letzten byzantinischen Besitztümer in Griechenland und rücken auf dem Balkan vor. Und im Heiligen Römischen Reich, das Cusanus durch das Wiener Konkordat befrieden wollte, reißen die Konflikte zwischen Kirche und Fürsten nicht ab. Der Niedergang der von der Papstkirche geordneten und beherrschten Welt scheint nicht mehr aufzuhalten …
Umsturz der Werte
Cusanus stirbt im August 1464 in der umbrischen Stadt Todi. Auf seiner letzten Mission soll er sich um ein Kreuzfahrerheer kümmern, das Pius gegen die Türken ausschicken will. Sein überraschender Tod verhindert, dass er ein weiteres Mal gegen seine Überzeugungen handeln muss. Der Leichnam wird in Rom beigesetzt, möglicherweise ohne das Herz. Auf Wunsch des Verstorbenen soll man es in seine Heimat zurückgebracht und in Kues beerdigt haben. Wenn es wirklich stimmen sollte, eine bezeichnende Geste. Denn war Cusanus jemals wirklich in Italien angekommen?