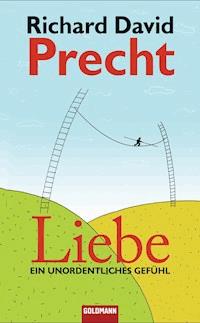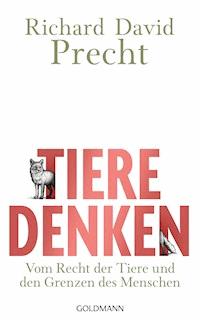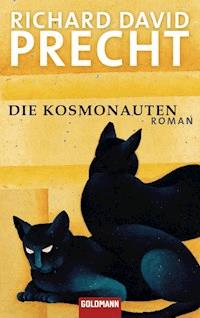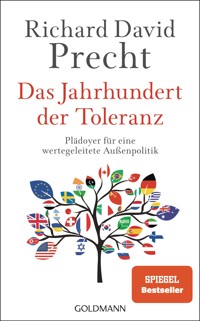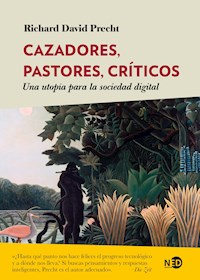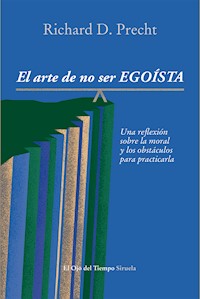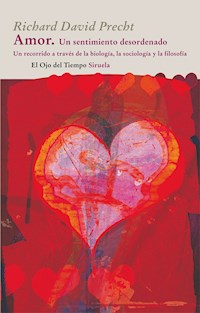Inhaltsverzeichnis
Widmung
EINLEITUNG
Frau und Mann
1. KAPITEL - Ein dunkles Vermächtnis
Eine fast gute Idee
Menschliche Zoologie
Die Liebe und das Pleistozän
Copyright
Für Caroline
Erklär mir, Liebe!
Ingeborg Bachmann
EINLEITUNG
Männer wollen auf die Venus und Frauen ein Mars
Warum es mit Büchern über die Liebe so schwierig ist
Dies ist ein Buch über Frauen und Männer. Und über etwas sehr schönes Seltsames, das zwischen ihnen passieren kann - die Liebe. Die Liebe ist das beliebteste Thema des Menschen. Romane ohne Liebe sind selten, Filme ohne Liebe noch seltener. Auch wenn wir nicht immer über die Liebe reden, so ist sie uns gleichwohl immer wichtig. Möglicherweise war das nicht immer so in der Geschichte der Menschheit. Aber heute, so scheint es, ist dies der Stand der Dinge. Kein Deo wandert ohne Liebesversprechen über den Ladentisch, und keinem Popsong fällt noch ein anderes wichtiges Thema ein.
Das Thema Liebe ist gewaltig. Es umfasst nahezu alles. Von »Warum gibt es überhaupt Mann und Frau?« bis »Was muss ich tun, um meine Ehe zu retten?«. Und es ist uferlos. Man kann Frauen mit schiefergrauen Augen lieben und Vollmondnächte in der Taiga. Man kann seine Gewohnheiten lieben und Männer, die Zahnpastatuben ordentlich ausdrücken. Man kann Siamkatzen lieben und blutige Steaks, den Kölner Karneval und buddhistische Klosterstille, Bescheidenheit, einen Sportwagen und seinen Herrgott. Man kann all dies getrennt lieben. Man kann es parallel lieben. Und manches sogar gleichzeitig.
Von all diesem vielen Lieben und Liebenswerten geht es in diesem Buch nur um das eine: um die geschlechtliche Liebe zu einem Liebespartner. Ein Buch über die Liebe kann man nicht schreiben, und dies ist kein Buch über alles. Das Thema Frau und Mann (auch Frau und Frau und Mann und Mann) ist schwierig genug. Denn die geschlechtliche Liebe ist hoch verdächtig; als ein Sujet nämlich, an dem sich zwar die besten Dichter, aber nur selten die klügsten Philosophen versucht haben.
So wichtig sie uns ist, in der abendländischen Philosophie gilt die geschlechtliche Liebe seit Platon als U-Musik. Solange Philosophen den Menschen über seine Vernunft definierten, war die Liebe kaum mehr als ein Unfall, eine Verwirrung der Gefühle mit bedauerlichen Folgen für den umnebelten Verstand. Gefühle als Herren oder Herrinnen unserer Seele waren lange disqualifiziert. Denn was man nicht als vernünftig ausweisen konnte, darüber wollte man lieber schweigen. Die bekannten Ausnahmen in der Geschichte der Philosophie bestätigen diese Regel. Friedrich Schlegel, Arthur Schopenhauer, Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Michel Foucault oder Niklas Luhmann mögen noch so viel Bedenkenswertes über die Liebe gesagt haben - mit einer Vorlesungsreihe über die Liebe macht sich ein Philosoph in der akademischen Welt bis heute verdächtig, und der Spott seiner Kollegen ist ihm sicher. Die Philosophie ist ein sehr konservatives Fach, und die Vorbehalte sitzen tief. Wahrscheinlich gibt es bis heute weit mehr intelligente philosophische Bücher über formale Logik oder über das Kategorienproblem bei Kant als über die Liebe.
Im Gegenzug allerdings wird niemand allen Ernstes auf die Idee kommen wollen, die Probleme der formalen Logik wichtiger für das Menschsein zu finden als die Liebe. Doch mit den Skalpellen der Philosophie, so scheint es, lässt sie sich schwer sezieren. »Die Liebe ist die unbegreiflichste, weil grundloseste, selbstverständlichste Wirklichkeit des absoluten Bewusstseins«, meinte Karl Jaspers. Sie ist schlüpfrig und schwer zu fassen. Aber haben es die Psychologen leichter? Oder gar, wie es neuerdings scheinen will, die Chemiker und Biologen? Wissen sie, wo sie herkommt, die Liebe, und warum sie so oft dahingeht? Und was macht sie mit uns in der Zwischenzeit?
Die Liebe ist das vielleicht wichtigste Thema an der Schnittstelle von Natur- und Geisteswissenschaft. Sie erschließt sich weder durch Logik noch durch eine philosophische »Letztbegründung«. Aber sollte man deshalb den Statistikern das Feld überlassen, den Meinungsumfragen, den Psycho-Experimenten, den Blutanalysen und Hormontests?
Vielleicht ist die Liebe auch dafür zu kostbar. Zu wichtig und kompliziert auch für die schlauen Ratgeber zum Liebes- und Beziehungsmanagement. Ihre Zahl ist nahezu unbegrenzt, ihr Einfluss schwer abzuschätzen, aber sicher zu fürchten. All die klugen Tipps, die verraten, mit welchem Geheimplan man den richtigen Partner oder die richtige Partnerin findet, wie man seine Liebe jung hält, wie man ein feuriger Liebhaber oder eine feurige Liebhaberin wird und bleibt. All die Techniken über und unter der Bettdecke, das Handwerk und die »Kunst des Liebens« wurden handlich beschrieben. Und die verballhornte Hirnforschung verrät uns in hundert Titeln, warum Frauen mit der rechten Gehirnhälfte denken und Männer mit der linken und weshalb Männer eben nichts im Kühlschrank finden und Frauen nicht einparken können. Männer werden durch Sex glücklich und wollen immer auf die Venus. Frauen dagegen suchen die Liebe oder zumindest ein Mars, denn auch Schokolade macht Frauen glücklich. Man muss also nur das richtige Buch lesen, und man lernt sich und den anderen endlich kennen. Alles wird gut. Und wenn schon nicht im wirklichen Leben, so immerhin auf den Buchseiten.
Tatsächlich wissen wir nicht sehr viel. Und die Frage nach Mann und Frau und ihrer wechselseitigen Anziehung und Zuneigung ist ideologisch verhärteter als jede Politik. So wichtig sie uns ist - gerade bei der Liebe begnügen wir uns gerne mit Halbwissen und Halbwahrheiten. Angesichts der Bedeutung und der Brisanz des Themas ein erstaunlicher Befund. Wir sind froh für jede einfache Erklärung, lassen uns sagen, wie die Männer und die Frauen sind, obwohl wir in unserem täglichen Leben nur Charakteren begegnen und keinen Geschlechtern. Trotzdem sind wir bei den Antworten zumeist weniger wählerisch als beim Klingelton unseres Handys, den wir so lange aussuchen, bis wir meinen, dass er tatsächlich zu uns passt.
Gegen all dies ist es an der Zeit, die Frage nach Mann und Frau und nach der Liebe aus den alten und neuen Würgegriffen und Weltbildern zu befreien. Die Messlatte liegt hoch: »Was Prügel sind, das weiß man schon; was aber Liebe ist, das hat noch keiner herausgebracht«, vermutete bereits Heinrich Heine. Vielleicht muss man es auch nicht selbst herausbringen wollen. Etwa, weil es die Liebe gar nicht gibt. Und vielleicht reicht es schon, den »Wahnsinn der Götter« des Philosophen Platon und das »Gespenst« des Moralisten La Rochefoucauld mit Worten gut zu umzingeln, auf dass sie sich genauer zu erkennen geben.
Die Liebe ist eine Welt, in der starke Emotionen bunte Vorstellungen auslösen. Das teilt sie mit der Kunst und mit der Religion. Auch hier haben wir es mit Vorstellungswelten zu tun, die ihren Wert in der unmittelbaren sinnlichen Erfahrung haben und nicht in Vernunft und Wissen. Man mag also meinen, dass diese gleitende Logik der Liebe ihren eigentlichen Platz nur in der Literatur haben kann, die sie, nach Ansicht mancher Philosophen und Soziologen, sogar erfunden haben soll. Aber sind wir mit den Dichtern wirklich schon am Ende?
In einem Kapitel meines Buches Wer bin ich? hatte ich in einem kleinen Kapitel über die Liebe nur mit der Taschenlampe in den Nachthimmel geleuchtet. Es machte mich selbst neugierig, eine Galaxie zu erkunden und ein Universum zu vermessen, das uns so vertraut ist und so fremd zugleich. Denn erstens hat die Liebe vor allem mit uns selbst zu tun, jedenfalls immer mehr als mit irgendjemandem anderen. Und zum zweiten scheint es zur Liebe dazuzugehören, dass sie sich dem Liebenden selbst in gewisser Weise verbirgt. Die Liebe spielt nicht mit ganz offenen Karten - und das ist natürlich gut so. Unsere Begeisterung und Besessenheit, unsere Leidenschaft und unsere kompromisslose Kompromissbereitschaft gedeihen nicht bei tagheller Beleuchtung. Sie brauchen auch immer das Dunkel, das die Liebe umgibt.
Wie schreibt man darüber ein Buch? Über etwas so Privates, Unenthülltes, wundervoll Illusionäres wie die Liebe? Nun, aus diesem Buch werden Sie nichts lernen, das Ihre Fähigkeiten im Schlafzimmer verbessert. Es hilft Ihnen auch nicht weiter bei Orgasmus-Schwierigkeiten und Eifersuchts-Attacken, Liebeskummer und Vertrauensschwund in den Partner. Es erhöht nicht Ihre Attraktivität. Und es enthält keine Tipps und kaum kluge Ratschläge für den Alltag zu zweit. Vielleicht aber kann es dazu beitragen, dass Sie sich über ein paar Dinge bewusster werden, die Ihnen vorher unklar waren; dass sie Lust haben, dieses so verrückte Reich genauer zu vermessen, in dem wir (fast) alle leben möchten. Und möglicherweise denken Sie gemeinsam mit mir ein wenig über Ihr geschlechtliches und soziales Rollenverhalten nach und über Ihre als selbstverständlich und normal eingeschliffenen Reaktionen. Vielleicht haben Sie Lust, in Zukunft manchmal ein wenig intelligenter mit sich selbst umzugehen - aber natürlich nur, wenn und wann Sie möchten.
Genau darin, so denke ich, liegt heute der Sinn von Philosophie. Sie fördert keine großen Wahrheiten mehr zu Tage, sondern sie macht, bestenfalls, neue Zusammenhänge plausibel. Das ist nicht wenig. Als Sachwalter der Liebe allerdings haben die Philosophen heute starke Konkurrenz. Bücher zum Thema werden von Psychologen geschrieben, von Anthropologen und Ethnologen, von Kulturhistorikern und Soziologen und in letzter Zeit vermehrt von Chemikern, Genetikern, Evolutionsbiologen, Hirnforschern und Wissenschaftsjournalisten.
Aus alledem erwachsen viele interessante Einsichten. Normalerweise allerdings leben sie alle brav nebeneinander wie verschiedene Tierarten in einem Biotop, die sich nur selten einmal direkt begegnen. »Der Mensch ist ein Tier«, »Der Mensch ist Chemie«, »Der Mensch ist ein kulturelles Wesen« - in jedem Fall fällt die Antwort darauf, was Liebe ist, ganz anders aus. Und die Frage nach der Treue, nach Bindungen, nach Gefühlsschwankungen, nach der Faszination der Geschlechter füreinander werden jedes Mal völlig anders erklärt.
Das ist umso erstaunlicher, als niemand bestreiten wird, dass sie im wahren Leben doch irgendwie alle ineinanderspielen. Verrät nicht die Tatsache, dass jeder von »Liebe« redet, dass es um das Gleiche gehen soll? Doch wie schlägt man da die Brücke zwischen dem Spanisch der Soziologen und dem Chinesisch der Genetiker? Wo liegt zwischen Testosteron und Phenylethylamin, Selbstbespiegelung und Fortpflanzungsdrang, Gesamtfittness und Erwartungserwartungen das Gemeinsame? Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Gibt es eine Hierarchie? Sind es parallele Welten? Oder ist alles auf etwas anderes rückführbar?
Der Blick in die Fachliteratur offenbart ein Nebeneinander von Definitionen und Hoheitsrechten. Soziologen lassen die Chemie der Liebe achtlos beiseite, Liebes-Chemiker dagegen die Soziologie. Vielleicht gibt es gerade noch ein elementares Verständnis der Naturwissenschaftler untereinander und im Club der Geisteswissenschaftler. Dazwischen liegt eine schier unüberbrückbare Kluft.
Diese Kluft ist es, die mich interessiert, weil es sie meines Erachtens nämlich nicht geben müsste. Seit Kindertagen bewegt mich eine nicht nachlassende Faszination für die Zoologie. Stärker als jede andere Wissenschaft schlägt sie für mich den mystischen Funken aus unserem Dasein. Und ein großer Teil meiner quasi-religiösen Erlebnisse ist zoologischer Natur. Gleichwohl lese ich biologische Erklärungen heute oft kritisch. Die meisten ihrer Voraussetzungen sind ungeklärt, ihre Axiome ohne festen Halt. Gerade die Nähe zum Fach erzeugt in mir großen Verdruss, wenn Biologen seltsame Dinge behaupten. Und über kein Thema haben Biologen so viel Seltsames geschrieben wie über Mann und Frau. Viele Aussagen über die Biologie unseres Begehrens gehören ohne Zweifel zu den Tiefpunkten der Zunft, unterstützt und popularisiert von Psychologen, die im Namen der Biologie zu sprechen glauben.
Bei der Kritik daran hilft die philosophische Schulung. Man kann sagen: Ich interessiere mich für den Geist aus naturwissenschaftlicher Perspektive und aus geisteswissenschaftlicher Perspektive für die Natur. Ich mag den schnörkellosen Drang nach Klarheit in den Naturwissenschaften und das intelligente »Gleichwohl...« der Geisteswissenschaften gleichermaßen. Ich gehöre keiner Fraktion an und muss niemanden verteidigen. Ich glaube nicht, dass es nur einen privilegierten Zugang zur Wahrheit gibt. Ich bin kein Naturalist, der den Menschen naturwissenschaftlich für erklärbar hält, und kein Idealist, der meint, dass man auf das Wissen der Naturwissenschaften verzichten kann. Ich glaube, dass es beides braucht: Philosophie ohne Naturwissenschaft ist leer. Naturwissenschaft ohne Philosophie ist blind.
Es gibt keine zuverlässige Wissenschaft von der Liebe. Allen Versprechen zum Trotz. Auch die neuerdings so häufig angeführte Hirnforschung ist es nicht. Denn natürlich denken Frauen nicht mit anderen Hirnregionen als Männer, sondern mit den gleichen. Selbst Schimpansen denken mit den gleichen Hirnregionen. Die Gehirne von Frauen und Männern sind anatomisch nahezu ununterscheidbar und physiologisch sehr ähnlich. Ansonsten wären Frauen mit typisch »männlichen« Eigenschaften, die hervorragend einparken können, gestört. Und Männer, die gut zuhören können, wären krank.
Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage nach der Liebe werde ich versuchen, Disziplinen ganz verschiedener Couleur fruchtbar zu machen und sie aufeinander beziehen. Die Leser von Wer bin ich? werden dabei einigen Philosophen wiederbegegnen wie vertrauten Gesichtern. Aber sie lernen auch neue kennen, wie Judith Butler, Gilbert Ryle, William James oder Michel Foucault. Ausführlicher noch fällt der Blick auf Biologen wie William Hamilton, Desmond Morris, Robert Trivers und Richard Dawkins. Und auch einzelne Soziologen geraten ins Visier, etwa Erich Fromm und Ulrich Beck. Wieder einmal geht es dabei nicht um eine Auswahl der »wichtigsten« Denker und Denkerinnen der Liebe. Die genannten Personen, so bedeutend sie sind, sind nicht repräsentativ, sondern treten auf und ab im Dienst unseres Themas.
Um die Biologie der Liebe zu verstehen, muss man eine Vorstellung davon haben, was die Evolution ist und wie sie sich vollzogen haben könnte. Es bedeutet, die Fundamente zu untersuchen, auf denen die heute so populären Theorien von den verschiedenen biologischen Interessen und Ausrichtungen von Mann und Frau stehen. Die Kapitel 1 bis 5 fragen nach den biologischen und kulturellen Grundlagen unserer Geschlechterrollen. Wo kommen diese Merkmale und Eigenschaften her? Aus unserem tierischen Erbe, aus der Steinzeit oder aus der Gegenwart? (1. Kapitel) Welches Programm verfolgen unsere Gene, und wie wirkt sich das auf uns aus? (2. Kapitel) Was ist typisch weibliches Sexualverhalten, und was ist typisch männlich? Und was weiß man wirklich darüber? (3. Kapitel) Funktionieren weibliche Gehirne anders als männliche? (4. Kapitel) Und wie groß ist der Anteil der Kultur an unserem Selbst- und Weltverständnis als Frau oder Mann? (5. Kapitel)
Der zweite Teil mit den Kapiteln 6 bis 10 handelt dann tatsächlich von der Liebe selbst. Zunächst geht es dabei um die Liebe im biologischen Sinn. Warum gibt es sie überhaupt? Könnte es vielleicht sein, dass die Liebe ursprünglich gar nicht für das Verhältnis von Frau und Mann »gedacht« war? (6. Kapitel) Wir versuchen zu fassen, was dieses unordentliche Gefühl eigentlich ist. In jedem Fall ist die Liebe nicht einfach eine Emotion. Aber was ist sie dann? Was passiert eigentlich in unseren Gehirnen, wenn wir lieben? Und was stellt sich um, wenn aus Verliebtheit Liebe wird? Wir erfahren, warum Präriewühlmäuse treu sind im Gegensatz zu ihren rattenscharfen Verwandten aus den Bergen und was das bei Wühlmäusen wie bei Menschen mit Chemie zu tun hat. Zugleich allerdings wird deutlich, dass die wichtigsten Unterschiede zwischen Männern und Frauen insgesamt weniger mit Chemie zu tun haben als mit Selbstkonzepten (7. Kapitel) und frühen Prägungen in der Kindheit (8. Kapitel). Wir lernen dabei, dass der Liebeswunsch nicht nur Nähe und Bindung bekundet, sondern auch Aufregung und sogar zeitweilige Distanz. Dass Liebe also nicht völlig selbstlos ist und auch etwas ganz anderes als nur Partnerschaft. (9. Kapitel) Die Liebe bündelt sehr verschiedene Sehnsüchte und Vorstellungen. Im alltäglichen Umgang miteinander gewinnen sie das Format eines ziemlich festen »Codes«. Liebe ist ein Spiel mit Erwartungen oder genauer mit erwartbaren und deshalb auch erwarteten Erwartungen. (10. Kapitel) Im dritten Teil des Buches geht es dann um die persönlichen wie um die gesellschaftlichen Möglichkeiten und Probleme mit der Liebe heute. Warum ist uns die romantische Liebe so wichtig geworden? (11. Kapitel) Und gibt es eigentlich überhaupt noch »echte« Liebe, wo nahezu alle Romantik längst zur Konsumware verkommen ist? (12. Kapitel) Ein Blick auf die heutigen Schwierigkeiten im Familienleben zeigt, wie schwer es ist, Realität und Ideal miteinander zu verbinden (13. Kapitel). Und am Ende folgt eine kleine Bilanz über den Ursprung und die Schwierigkeiten im Umgang mit diesem unordentlichsten aller Gefühle (14. Kapitel).
Ville de Luxembourg Richard David Precht im Dezember 2008
Frau und Mann
1. KAPITEL
Ein dunkles Vermächtnis
Was Liebe mit Biologie zu tun hat
Eine fast gute Idee
Die Biologen kennen sich aus: Frauen lieben vermögende, gesunde, große, symmetrisch gebaute Männer mit breiten Schultern und dichten Brauen; Männer lieben junge, schlanke Frauen mit großen Brüsten, gebärfreudigen Becken und zarter Haut. Ganz Gallien also ist besetzt mit Ausnahme eines kleinen tapferen Dorfes, das dem Eindringling bis heute Widerstand leistet.
Wenn alles so einfach ist mit unserem sexuellen Geschmack, warum ist die Wirklichkeit dann so kompliziert? Warum suchen sich Männer wie Frauen Partner, die diesen Traumkriterien nicht entsprechen? Warum verlieben sich erwachsene Menschen nicht immer nur in die Schönste und den Schönsten, vom Heiraten ganz zu schweigen? Warum gibt es Männer, die korpulente Damen lieben, und Frauen mit einem Hang zu filigranen, feinnervigen Männern? Warum gibt es eigentlich nicht nur noch schöne Menschen, wenn diese Eigenschaft so beliebt ist, dass sie uns einen großen evolutionären Vorteil verschafft? Und warum, zu guter Letzt, kriegen die Schönen und Reichen nicht die meisten Kinder?
Seit vielen Jahren schon erklären uns die Biologen unseren sexuellen Geschmack und seine weitreichenden Folgen. Und sie kennen seine evolutionsbiologische Funktion. Wen wir schön finden, wen wir begehren, mit wem wir uns paaren und an wen wir uns binden ist eine Sache eindeutiger Naturgesetze, erklärbar durch drei ineinandergreifende Disziplinen der Biologie: die Biochemie, die Genetik und die Evolutionsbiologie.
Die Verführungskraft dieser biologischen Erklärungen ist immens. Die seelenlosen Kräfte der Evolution treiben uns an. Endlich räumen wir das Chaos der Liebe auf, finden die versteckte Logik im ewig Irrationalen und entdecken objektive Gründe für unser seltsames Verhalten. Nicht nur die Forscher geraten ins Schwärmen. Eine ganze Armada von Wissenschaftsjournalisten wirft ihre gut verkäuflichen Bücher auf den Markt. Titelgeschichten für seriöse Magazine verraten den »Liebes-Code« oder die »Liebesformel«. »Gefesselt an sein evolutionäres Erbe, gesteuert vom Diktat der Gene und Hormone, irrt der Mensch in seinem Triebleben umher«, bilanziert der SPIEGEL 2005 in seiner Titelgeschichte vom »liebenden Affen«.1 Längst ist das Thema »Liebe« keine blumige Angelegenheit des Feuilletons mehr, sondern knallharter Stoff für die Wissenschafts-Ressorts der Tagesund Wochenzeitungen. Sie übernehmen heute die Deutungshoheit auf naturwissenschaftlich früher eher abwegigem Gebiet. Als Grundlage täglich neuer Meldungen dienen ihnen die Evolutionsbiologie, die Hirn- und die Hormonforschung. Und mit allen drei Disziplinen Tausende naturwissenschaftlicher Studien. Ist der Code der Liebe damit geknackt?
Die Wissenschaft, die all dies zusammendenkt, nennt sich »evolutionäre Psychologie«. Sie möchte uns erklären, wie sich die vielen Facetten der menschlichen Natur und Kultur aus den Erfordernissen unserer evolutionären Geschichte entwickelt haben. Wenn Bestseller uns erzählen, warum Männer nicht zuhören können und Frauen nicht einparken, dann lesen wir darin die lustige Aufbereitung von Erkenntnissen der evolutionären Psychologie. Eine Stufe ernsthafter erzählen uns US-amerikanische, aber inzwischen auch deutsche Wissenschaftsjournalisten, warum wir Mammutjäger in der Metro sind und unter unserem Anzug ein Rentierfell steckt. Lust und Liebe, so die Idee, sind funktionale Chemie im Dienste der menschlichen Fortpflanzung. Und hinter allem verbirgt sich die dunkle Seite unserer Ohnmacht - das geheime Wirken der Gene.
Die Ankündigung ist faszinierend. Ist es nicht zu schön, für alles menschliche Verhalten eine plausible Erklärung oder doch zumindest einen passenden Rahmen zu finden? Vielleicht ja, vielleicht aber auch nicht. Die einen wünschen sich einen Blick in die Rezeptur unserer Seele, für die anderen hingegen ist dies ein Gräuel! Denn wenn alles naturwissenschaftlich passend gemacht werden kann, wo bleiben da die Geistes- und Kulturwissenschaften? Dürfen wir die Philosophie, die Psychologie und die Soziologie der Liebe mit vier minus in die Ferien verabschieden, oder dürfen wir ihren Formenschatz doch zumindest einschmelzen zum neuen Gold der evolutionären Psychologie?
Geht es nach dem US-amerikanischen Liebes- und Paarforscher David Buss, dann ist die evolutionäre Psychologie die »Vollendung der wissenschaftlichen Revolution« und bildet »die Grundlage für die Psychologie des neuen Jahrtausends.«2 Was immer wir als Fragen der menschlichen Kultur verstanden haben, Attraktion, Eifersucht, Sexualität, Leidenschaft, Bindung und so weiter, wäre nichts anderes als ein spezieller Fall unter vielen speziellen Fällen im Tierreich. Ob es um das Paarungsspiel von Elefantenrüsselfischen im Niger geht oder um die Brautwerbung in deutschen Großstädten - das Beschreibungs-Vokabular und die Erklärungsinstanzen wären die gleichen. Und wo Anthropologen überall ethnische Besonderheiten von Völkern und Kulturen sehen, entzaubert die evolutionäre Psychologie mit David Buss den »Mythos unendlicher kultureller Vielfalt« zugunsten einer globalen »Gleichheit von Sex und Liebesverhalten«.3
Der Mann, der das Wort »evolutionäre Psychologie« erfand, ist heute ein vergleichsweise wenig bekannter Forscher an der California Academy of Sciences. Im Jahr 1973, als Michael T. Ghiselin den Begriff das erste Mal in einem Fachaufsatz für das Wissenschaftsmagazin Science verwendete, war er Professor an der University of California in Berkeley. Ghiselin war der festen Meinung, dass die Idee, die gesamte menschliche Psychologie mit den Mitteln und Methoden der Evolutionsbiologie zu durchleuchten, eine Idee Darwins war.
In seinem zweiten Hauptwerk Die Abstammung des Menschen (1871) hatte der Vater der modernen Evolutionstheorie nicht nur die Entstehung des Menschen, sondern auch die Ursprünge seiner Kultur biologisch erklärt. Moral, Ästhetik, Religion und Liebe hatten demnach einen natürlichen Ursprung und einen klaren Sinn. Darwins Zeitgenossen und Nachfolger griffen den Ball begierig auf und übertrugen die Begriffe der neuen Evolutionstheorie vom Überleben der Fittesten im Kampf mit der Umwelt auf die Gesellschaft und die Politik. Der »Sozialdarwinismus« trat seinen Siegeszug an, vor allem in England und in Deutschland. Vom »Überleben der Fittesten« bis zum »Recht des Stärkeren« war es nur ein kleiner Schritt. Sein Werdegang ist bekannt. Die Ideologie überschlug sich im angeblichen »Naturrecht der Völker« im Ersten Weltkrieg und, als wäre dies noch nicht genug gewesen, in der Rassentheorie, dem Holocaust und in den Eugenik-Programmen der Nazis zur Tötung sogenannten »lebensunwerten Lebens«.
Die Katastrophe hatte Folgen. Mehr als zwanzig Jahre lang herrschte Ruhe an der Front. Die biologische Erklärung der menschlichen Kultur versank in den Dornröschenschlaf. Doch in der Mitte der 1960er Jahre rüttelte der Evolutionsbiologe Julian Huxley die Massen in England wach. Und in Deutschland und Österreich meldete sich der frühere Rassentheoretiker und Nationalsozialist Konrad Lorenz unerschrocken wieder zu Wort. Ende der 1960er Jahre war die Zeit reif für einen Neuanfang. Überall fanden sich mit einem Mal Biologen, die die alte Biologie des Sozialen für eine fast gute Idee hielten. Man befreite die verdächtige Forschung von aller Rassentheorie. Und auch über Politik wollte man sich nach dem Sündenfall fortan nur noch bescheiden äußern. Ghiselin prägte das Wort »evolutionäre Psychologie« und der Evolutionsbiologe Edward O. Wilson die »Soziobiologie«. In den 1970er und 1980er Jahren setzte sich Wilsons Begriff durch, seit den 1990er Jahren aber das unverdächtigere und modernere Wort von Ghiselin.
Der Gedankengang der Soziobiologen und evolutionären Psychologen ist in etwa wie folgt: Wenn man verstehen will, wie sich der Konkurrenzkampf aller Lebewesen in der Evolution zugetragen hat, dann ist die Maxime vom »Überleben der Fittesten« die bis heute beste Erklärung. Fit sind vor allem jene Lebewesen, die sich besonders gut an veränderte Umweltbedingungen anpassen konnten und können. Die am besten angepassten Arten gaben ihr wertvolles Erbgut weiter und setzten sich gegenüber vielen anderen, weniger fitten Arten durch.
Diese Ansicht wird heute in ihren wesentlichen Grundzügen kaum bestritten. Sie ist die vorherrschende Erklärung der Evolution. Evolutionäre Psychologen folgern daraus, dass die wichtigsten Merkmale des menschlichen Körpers einen Vorteil in der Evolution gebracht haben müssen. Aber bezeichnenderweise nicht nur die Merkmale des Körpers. Auch unsere Psyche soll so sein, wie sie ist, weil sie uns Vorteile verschaffte. Unsere Wahrnehmung, unser Gedächtnis, unsere Problemlösungsstrategien und unser Lernverhalten müssen sich positiv ausgewirkt haben auf unsere Überlebenschancen. Wäre das nicht der Fall, wären sie wahrscheinlich ganz anders beschaffen oder der Mensch wäre ausgestorben. Da dies aber nicht zutrifft, könne man getrost davon ausgehen, dass sich die besten unserer geistigen Eigenschaften durchgesetzt haben. Unsere Psyche sei sehr fein auf die Umwelt abgestimmt. Diese Umwelt aber - und dies ist der springende Punkt - ist nicht unsere heutige Zeit, sondern jene Epoche, in der der moderne Mensch biologisch entstand: die Steinzeit!
Unsere heutige Zeit mit ihrer modernen Umwelt dagegen besteht erst so kurz, dass sie in der biologischen Entwicklung unserer Psyche keine Rolle gespielt haben kann. Die »Module« im Gehirn, die unser Verhalten steuern, sind demnach ziemlich alt. Aber sie bestimmen uns gleichwohl. Wenn Männer und Frauen sich in bestimmten Situationen mehrheitlich stark unterscheiden, halten Soziologen und Psychologen dies gemeinhin für Lernprozesse, kulturelle Prägung und Sozialisierung. Nach Ansicht von evolutionären Psychologen aber stammen solche unterschiedlichen Denkweisen bei den Geschlechtern aus nichts anderem als dem entwicklungsgeschichtlichen Vermächtnis unserer frühmenschlichen Vorfahren. Grundsätzliche Unterschiede, etwa in der Einstellung zur Sexualität, ließen sich demnach nur begreifen, wenn man sich mit den in der Evolution entstandenen »Denkmechanismen« auseinandersetzt. Mit den Geschlechtern, meint William Allman, ist es deshalb in etwa wie mit Fahrzeugen. Denn »den Unterschied zwischen einem Taxi und einem Rennauto« kann man »nur dann begreifen, wenn man zuvor die Grundelemente beider Wagentypen kennt, wie etwa Motor und Federung«.4
Dass wir die Wagentypen heute kennen, all die modernen Frauen und Männer in unserer Umwelt, ist klar. Aber wie gut kennen wir eigentlich unseren steinzeitlichen Motor und die Federung?
Menschliche Zoologie
Malta ist eine schöne, etwas karge Insel im Mittelmeer. Wer dort an der malerischen Steilküste der Dingli Cliffs wandert, dem kann es passieren, dass er in den Hügeln einen 80-jährigen Herrn trifft mit einem braunen Hut auf der Stirnglatze. Es könnte der Mensch sein, der wie kein zweiter im 20. Jahrhundert die Idee verbreitete, alles menschliche Verhalten sei nichts als Biologie.
Desmond John Morris wurde 1928 in England geboren. Er studierte Zoologie in Birmingham und in Oxford, aber lange blieb ihm unklar, was er eigentlich werden wollte: Zoologe oder Künstler. In gewisser Weise sollte er beides werden oder genauer: beides ein bisschen. Seine Doktorarbeit schrieb er über die Fortpflanzungsrituale von Stichlingen, einem heimischen Süßwasserfisch. Als 30-jähriger ließ er Schimpansen Leinwände bemalen und stellte sie im Londoner Institut für zeitgenössische Kunst aus. Für das Fernsehen entwickelte er fortan Sendungen über das Verhalten der Tiere. 1959 wurde Morris Kurator für Säugetiere am Londoner Zoo. Hier schrieb er an seinem Buch, das ihn zu einem Star seiner Zunft machen sollte.
Der nackte Affe erschien genau zur richtigen Zeit. Das Umschlagbild der englischen Originalausgabe nahm bereits das berühmte Foto aus der Berliner Kommune 2 vorweg: drei nackte Menschen von hinten fotografiert, ein Mann, eine Frau und ein Kind. Auf dem deutschen Umschlag kommt noch ein Menschenaffe hinzu. Abbildungen dieser Art standen 1967 noch unter dem Verdacht der Pornografie. Kein Wunder, dass Der nackte Affe zu einem Kultbuch wurde, vor allem in der jüngeren Generation. Bereits der Klappentext verrät, warum: »Dieses wahrhaft revolutionäre Buch verwandelt unser Denken von Grund auf. Wer es gelesen hat, wird alles rundum mit neuen Augen sehen: Nachbarn und Freunde, Frau und Kinder und sich selbst. Und er wird vieles Alltägliche ebenso wie vieles bisher Unbegreifliche nun mit jener lächelnden Nachsicht verstehen, die ihn dieses Buch lehrt.«
Fast über Nacht wurden Morris und seine flotte Frau Ramona zu Popstars der Rock’n’Roll-Kultur. Der durch die Zoologie flanierende Künstler oder künstlerisch ambitionierte Zoologe verkaufte sein Buch über 10 Millionen Mal - einer der größten Weltbestseller aller Zeiten. Und der nüchtern provozierende Hohepriester der sexuellen Revolution legte gleich noch einmal nach. 1969 folgte Der Menschen-Zoo. Der Mensch, so Morris, habe sich durch seine Kultur heute selbst eingesperrt, er sei degeneriert zu einem verhaltensgestörten Zootier. Und nur ein rebellierendes kreatives Zurück zu seiner Biologie verhindere den totalen Kollaps unserer Zivilisation.
Auf den ersten Blick betrachtet erschien Morris als ein Revolutionär. Mit Der nackte Affe entzauberte er die konservative Sexualmoral der 1960er Jahre. Und mit Der Menschen-Zoo nahm er lange zuvor die Bewegung der Grünen vorweg. Doch auf den zweiten Blick steckt hinter der großen Freizügigkeit und dem Lob der Kreativität eine uralte Ideologie: die Vorstellung von der biologischen Vorherbestimmtheit des Menschen. Man konnte Morris’ Bücher mit feuriger Lust den kirchlichen Sittenwächtern und bürgerlichen Moralaposteln unter die Nase reiben. Aber der Gedanke, dass der Mensch ganz und gar biologisch vorherbestimmt sei, war kein optimistischer oder gar progressiver: Ganz im Gegenteil erklärte er den Menschen seinem »Wesen« nach als gierig, geil, machtbesessen, brutal, egoistisch und triebgesteuert.
Mit seiner Ansicht, dass alles wesentliche Verhalten des Menschen erstens angeboren und zweitens ein Relikt aus der Steinzeit sei, wurde Morris zum genialen Sprachrohr einer fundamental biologischen Weltauffassung. 1973 kehrt er an die Universität Oxford zurück, um über die angeborenen Grundlagen des Verhaltens der Menschen zu forschen. Sein Mentor, der Niederländer Nikolaas Tinbergen, ist einer der seinerzeit bedeutendsten Verhaltensforscher. Und die »Ethologie« erlebt zu dieser Zeit einen beispiellosen Boom. Tinbergen erhält im gleichen Jahr den Nobelpreis, gemeinsam übrigens mit Konrad Lorenz, der soeben seine philosophische Bilanz veröffentlicht hat. Wie Morris’ Bücher, so ist auch Die Rückseite des Spiegels ein ehrgeiziger Versuch, die menschliche Kultur biologisch auszudeuten und zu erklären. Hat Lorenz recht, so gelten für die Kultur die gleichen Gesetze wie für die Biologie, und alles menschliche Verhalten ließe sich durch Instinkte und biologisches Lernverhalten erklären. Dass Lorenz es am Ende sogar wagt, die weitere kulturelle Evolution - und zwar zutiefst pessimistisch - vorherzusagen, erhöht freilich nicht unbedingt das Zutrauen des Lesers zu den vielen kühnen und unerschrockenen Thesen. Denn wo Morris letztlich vor Vertrauen in das Schicksal seines nackten Affen strotzt, sieht Lorenz den Untergang der Zivilisation heraufdämmern, nicht zuletzt durch die Schamlosigkeit des Minirocks.
Vermeintlich überzeitliche und nüchterne Analysen der menschlichen Natur haben oft nur eine erstaunlich kurze Halbwertszeit. Der Grund dafür ist leicht benannt. Um bestimmen zu können, wie der Mensch »von Natur« aus ist, muss man seine Natur sehr gut kennen. Und diese Kenntnis wird dadurch stark erschwert, dass sowohl Lorenz wie Morris die Ausbildung der menschlichen Natur nicht in der Gegenwart, sondern allein in der Vergangenheit ansiedeln. Der Mensch soll sein, was er in der Steinzeit war, und zwar im Sexuellen wie im Sozialen, in unseren Aggressionen und Neigungen, in unserer schöpferischen Neugier, in den Gewohnheiten des Essens und der Körperpflege, ja selbst in unseren Glaubensvorstellungen. Da uns die Steinzeit aber nicht gerade bestens bekannt ist, sind künstlerischen Phantasien und wilden Improvisationen keine Grenzen gesetzt. Und hier zeigt sich Desmond Morris geradezu als ein Meister des paläolithischen Surrealismus.
Ein großes Rätsel in der Evolutionsbiologie des Menschen ist die weibliche Brust. Im Vergleich mit anderen Säugetieren und auch mit Menschenaffen sind die Brüste vieler Menschenfrauen auffallend groß. Für die Milchproduktion, das wusste auch Morris, ist diese Größe weder notwendig, noch steht sie zu ihr überhaupt in einem Verhältnis. Mit kühnem Pinselstrich entwirft Morris dazu folgende Vision: Busen und Lippen der Frau sind auf die Vorderseite der Frau projizierte Sexualsignale! Als Affe im Urwald reagierte der frühe Mensch vor allem auf Sexualsignale von hinten. »Fleischig halbkugelige Hinterbacken und ein Paar hochroter Schamlippen« beim Weibchen verführten das Männchen zum Aufsitzen. Mit dem aufrechten Gang in der Steppe aber kam es - nach Morris - zur frontalen Begattung, und die auslösenden Reize wanderten von hinten nach vorne. Deshalb stünde es »so fest wie der Busen«, dass Frauen »Duplikate von Hinterbacken und Schamlippen in Form von Brüsten und Mund« haben. Die frontale Begattung als Folge verführerischer Irreführungssignale, so Morris weiter, brachte Mann und Frau nun auch seelisch näher. Man schaute sich in die Augen, intensivierte die »Paarbildung« und entschied sich für die Monogamie. 5
Diese amüsante Geschichte aus der Steinzeit ist natürlich blanker Unsinn. Man muss nicht erst fragen, warum auch Männer mitunter volle Lippen haben, um stärkste Zweifel an Morris’ unumstößlicher Zoologie zu haben. Man kann damit anfangen, dass der einzige monogame Menschenaffe, der Gibbon mit seinen fünfzehn Arten, ausgesprochen zierliche Brüste hat. Bonobos dagegen, die sich in allen erdenklichen Stellungen, darunter auch gerne in der »Missionarsstellung«, vergnügen, sind ausgesprochen polygam und gehen keinerlei ernsthafte Paarbindung ein. Und auch Bonobo-Weibchen haben keine großen Brüste.
Morris’ Theorie des Busens ist also kaum mehr als eine lustige Fußnote aus den Kindertagen der evolutionären Psychologie. Doch auch heute noch geht es dort oft genug lustig zu. In Unkenntnis der Vorzeit sind der schöpferischen Phantasie von Evolutionsbiologen oft wenige Grenzen gesetzt. Der US-amerikanische Wissenschaftsjournalist William Allman, der sich über Morris’ Theorie herzlich amüsiert, tischt gleich darauf seine eigene Phantasie auf: »Große Brüste entstanden viel wahrscheinlicher als Teil einer weiblichen Taktik, um ihre Sexualpartner >bei der Stange zu halten<. Da angeschwollene Brüste Symptome einer Schwangerschaft sind, signalisieren sie dem Mann, dass seine Partnerin nicht mehr empfängnisbereit war; daher konnte er sich nun auf die Suche nach anderen Frauen machen, während die von ihm >begattete< Frau ungeschützt und auf sich selbst gestellt zurückblieb. Mit ganzjährig vergrößerten Brüsten signalisieren Frauen ständig >Ich bin schwanger<, selbst wenn das nicht zutrifft, so dass dieses Signal seinen Wert für den Mann verliert. Als Folge halten die Männer ihren Teil des >Reproduktionsabkommens< ein, bleiben bei ihren Frauen und helfen ihnen bei der Aufzucht.«6 Wie eine »Taktik« sich entwicklungsgeschichtlich zu einem körperlichen Merkmal ausprägen soll, bleibt wohl auf immer Allmans Geheimnis, denn »Taktiken« können sich nach gegenwärtigem Stand der Genetik weder vererben noch irgendwie körperlich niederschlagen. Auch dass große Brüste die Treue fördern und zur Aufzucht von Kindern motivieren, ist eine ziemlich drollige Idee.
Es ist schon ein kurioser Sport der evolutionären Psychologen, überall steinzeitliche Verkehrsschilder aufzustellen und zu interpretieren. Als kleiner Einwand sei nur gefragt: Wer sagt eigentlich, dass jedes Merkmal von Lebewesen eine Funktion haben muss? Reicht es denn nicht aus, dass bestimmte, mitunter zufällige Merkmale ihre Träger einfach nur nicht gestört und ihr Überleben nicht beeinträchtigt haben, so dass sie bis heute erhalten geblieben sind? Dieser Gedanke wird uns im Folgenden noch beschäftigen. Was die weibliche Brust anbelangt, so könnte zum Beispiel der gegenüber der frühen Vorzeit erhöhte Fleischverzehr durchaus eine Rolle gespielt haben. Fleischessen regt bekanntlich die Hormonproduktion an. Durchaus möglich also, dass es eine Verbindung gibt zwischen den im Durchschnitt größeren Brüsten von Frauen in regen Fleischfresser-Gesellschaften (wie beispielsweise in den USA) gegenüber durchschnittlich weniger Busen in stärker vegetarisch ausgerichteten Kulturen (wie beispielsweise in Südasien). Mit Sexstellungen, Monogamie und anderen evolutionsbiologischen Funktionen hätte das absolut gar nichts zu tun.
Wer den heutigen Menschen erklären will, indem er ihn auf »einfachere« Formen reduziert, auf Fixpunkte in der Vergangenheit, steht allgemein vor vier großen Schwierigkeiten: Er muss sich fragen, ob alles, was die Natur hervorbringt, und damit auch der Mensch, tatsächlich bio-logisch erklärt werden kann. Biologen, Naturwissenschaftler allgemein, suchen überall in der Natur nach Logik. Aber Logik selbst ist keine Eigenschaft der Natur, sondern eine Fähigkeit des menschlichen Denkens. Man darf also fragen: Ist es eigentlich logisch, hinter allem in der Natur eine logische Erklärung zu vermuten?
Die zweite Schwierigkeit betrifft die genaue Kenntnis der Umweltbedingungen des Menschen in der Steinzeit. Waren diese überall gleich? Standen Vormenschen im Regenwald vor den gleichen Herausforderungen wie in der Steppe oder am Meer?
Der dritte Punkt ist die enorme Schwierigkeit, biologisches von kulturellem Verhalten überhaupt trennen zu können, und das auch noch bei einem Zeitraum vor zigtausend Jahren, von dem wir nicht allzu viel wissen.
Die vierte Schwierigkeit schließlich besteht darin zu zeigen, dass jene Merkmale und Verhaltensweisen, die wir für angeboren halten, tatsächlich als Folge von Anpassungen an die Umwelt der Steinzeit entstanden sind, wie die evolutionären Psychologen meinen. Wir müssen also im Rahmen unseres Themas die Frage beantworten: Wie war’s denn so mit der Liebe in der Steinzeit?
Die Liebe und das Pleistozän
Die Zeit, mit der wir es bei der biologischen Entstehung des Menschen zu tun haben, ist das Pleistozän, der vorletzte Abschnitt der Erdneuzeit. Gemeint ist die Zeit von vor etwa 1,8 Millionen Jahren bis vor 11500 Jahren. Bekannter ist der Name Eiszeitalter, denn im Pleistozän ereigneten sich gleich mehrere Eiszeiten.
In der Frühzeit des Pleistozäns erschienen in Ost- und in Südafrika zwei frühe Vormenschen, Homo habilis und Homo rudolfensis. Allem Anschein nach hatten sie sich aus den Australopithecinen entwickelt, auch wenn die Verwandtschaft unklar ist. Zu einem späteren Zeitpunkt trat in den Savannen Homo erectus auf den Plan, der sich von Afrika aus nach Europa und Asien ausbreitete. Sein mutmaßlicher Nachfolger in Europa war der bekannte Neandertaler, ein robuster, aber durchaus nicht tumber Geselle. Er starb vor etwa 30000 bis 40 000 Jahren aus bislang noch immer ungeklärten Umständen aus. Von allen Homo-Arten weiß man, dass sie in langsam aufsteigender Linie Werkzeuge, wie etwa Faustkeile, benutzten. Und irgendwann lernten sie auch mit dem Feuer umzugehen.
Die Lücke zwischen dem Aussterben des Homo erectus in Afrika vor etwa 300000 Jahren und dem ersten Erscheinen des modernen Menschen Homo sapiens vor etwa 100 000 Jahren schließt seit 1997 der Fund des Homo sapiens idaltu in Äthiopien, unser ältester bekannter direkter Vorfahr. Noch zu seiner Zeit lebten insgesamt wohl nur wenige zehntausend Vormenschen. Nach und nach breiteten sich die Homo sapiens von Afrika immer weiter über die Erde aus. Wie lange vor ihnen schon Homo erectus, erschlossen sie nach und nach völlig andere, zumeist kältere Lebensräume. Sie waren Jäger und Sammler und ernährten sich von Pflanzen, Früchten, Samen, Wurzeln, Pilzen, Eiern, Insekten, Fisch und Aas. Erst in der letzten Phase ihrer Entwicklung mauserten sie sich in mehreren Regionen ihres Verbreitungsgebiets zu echten Großwildjägern. Wie die Neandertaler machten sie in Mitteleuropa Hatz auf das Wisent, auf Mammuts und Wollnashörner.
Vermutlich mit dem Aussterben der beiden letztgenannten Arten wurden unsere Vorfahren in Mitteleuropa sesshaft. Die letzte Eiszeit ging zurück, und die Steinzeitmenschen sattelten nach und nach um auf Ackerbau und Viehzucht. In anderen Regionen ihres Verbreitungsgebiets dagegen galten andere Spielregeln. Die Beutetiere waren andere und auch das Klima. Manche unserer Vorfahren zum Beispiel lebten jahrtausendelang vom Fischfang, andere blieben Jäger und Sammler.
So unterschiedlich ihre Lebensweise war, so verschieden entwickelte sich auch ihre Kultur. Manche lebten in Höhlen, andere in Hütten oder Wohngruben. Sie besiedelten Steppen und Wüsten, Täler und Gebirge, Küsten und Inseln. Wenn das Sein das Bewusstsein bestimmt, wie die evolutionären Psychologen meinen, dann waren die Herausforderungen des Seins an das Bewusstsein sehr verschieden. Früchte im Regenwald zu sammeln oder Fische aus einem Gebirgsbach zu fangen ist nicht ganz das Gleiche, wie etwa Mammuts im Schnee zu jagen. Für die einen war die Kälte die größte Bedrohung, die anderen dagegen froren fast nie. Manche mussten sich vor wilden Tieren schützen, andere hatten in ihrer Umgebung kaum Feinde. (Man denke etwa an die Orang-Utans auf Borneo, die gerne auf den Urwaldboden hinabsteigen, was ihre Kollegen auf Sumatra niemals wagen - denn auf Sumatra gibt es Tiger, auf Borneo dagegen nicht.) Manche Urmenschen lebten möglicherweise immer im selben Umkreis, andere wanderten Tausende von Kilometern hinter den Tierherden her. Manche mochten Kannibalen gewesen sein, und andere begruben in aufwändigen Ritualen ihre Toten. Und während sich die Gehirne der einen auf die Orientierung im dichten Wald spezialisierten, blickten andere hinaus in die unendliche Steppe.
Kurz gesagt: Das Pleistozän ist ein unglaublich großer und völlig uneinheitlicher Zeitraum. Mehrere verschiedene Menschenarten lebten in dieser Zeit in immer neuen und sehr verschiedenen Lebensräumen. Wahrscheinlich lebten sie wie die meisten Affen in kleinen Trupps oder Familienverbänden. Über die genaueren Spielregeln dieser Gemeinschaften wissen wir allerdings sehr wenig. Wenn es richtig sein sollte, dass, wie Leda Cosmides und John Tooby von der University of California in Santa Barbara meinen, »unsere modernen Schädel einen steinzeitlichen Geist« beherbergen, dann stehen wir in der Tat vor einem kaum lösbaren Rätsel. Denn wie der berühmte kenianische Paläoanthropologe Richard Leakey sagt: »Die harte Wirklichkeit, vor der die Anthropologen stehen, ist die, dass es auf solche Fragen möglicherweise keine Antwort gibt. Wenn es schon schwer genug ist zu beweisen, dass ein anderer Mensch über dieselbe Bewusstseinsebene verfügt wie ich, und wenn die meisten Biologen den Versuch scheuen, den Grad des Bewusstseins bei Tieren zu bestimmen, wie sollen wir dann die Anzeichen eines reflexiven Bewusstseins bei Kreaturen aufspüren, die seit langem tot sind? Das Bewusstsein ist in der archäologischen Überlieferung sogar noch weniger sichtbar als die Sprache.« 7
Das ist aus Sicht der evolutionären Psychologen eigentlich eine deprimierende Nachricht. Umso erstaunlicher ist es, dass es ihren Elan bei der Erklärung unseres steinzeitlichen Verhaltens kaum zu bremsen scheint. In Fragen von Mann und Frau, von Sex und Bindungsverhalten gehen sie mit größter Selbstverständlichkeit von unterschiedlichen »Denkorganen« aus. »Zu Zeiten der Urmenschen sahen sich beide Seiten in Sachen Sexualität grundverschiedenen Problemen ausgesetzt. Daher entwickelte sich das Gehirn bei Männern und Frauen anders, so dass die Kriterien für Partnerwahl, Reaktionen auf Untreue und sexuelles Begehren ebenfalls bei beiden Geschlechtern verschieden sind«, schreibt William Allman.8 Wäre das richtig, so wären auch die Gehirne von Männchen und Weibchen bei Tieren sehr unterschiedlich. Eine Löwin, die sich von morgens bis abends um ihre Jungen sorgt, hätte ein anderes Gehirn als ein Löwe, der das Rudel anführt und sich um seinen Nachwuchs nur sehr gelegentlich kümmert. Auffallende Unterschiede zwischen den Gehirnen der Geschlechter im Tierreich sind aber nicht bekannt. Mit den »Geschlechtsorganen im Gehirn«, wie Allman sie nennt, ist das also so eine Sache. Und dass neben dem Fortpflanzungstrieb auch unsere »Liebe und Libido« aus der Steinzeit stammen, bleibt eine mutige Behauptung.
Mit Liebe, so scheint es, befasst sich ein evolutionärer Psychologe auch nur ungern. Allmans Buch über die »Mammutjäger in der Metro« enthält zwar ein Kapitel über die »Evolution der Liebe«, aber von Liebe redet er darin nicht - es geht nur um Sex. Denn Sex, so Allman, war in der Steinzeit das Allerwichtigste: »Diejenigen, die nicht so handelten - und beispielsweise ihre gesamte Zeit und Energie dafür verwandten, Rezepte für Mammuteintopf zu entwickeln oder ihren Sexualtrieb an Bäumen abreagierten -, hinterließen keine Nachkommen.«9
Während sich ein evolutionärer Psychologe die Sexualität unserer Vorfahren recht einfach vorstellen kann, macht er um die Liebe gern einen Bogen. Doch wenn es richtig ist, dass wir heute ein steinzeitliches Programm abspulen und uralte »Module« im Kopf tragen, ist dann nicht auch die Liebe ein solches »Programm«? Gibt es ein »Liebesmodul« in unserem Gehirn? Und wenn ja - zu welchem Zweck?
Ganz gewiss, versichert der evolutionäre Psychologe, gibt es ein »Liebesmodul« für den Umgang mit dem Nachwuchs ebenso wie zwischen den Geschlechtern. Aber was will man schon darüber sagen und wissen? Immerhin haben wir bis heute keine Liebesgedichte aus dem Neandertal und auch keine versteinerten Liebespaare gefunden.
Doch haben wir denn andererseits tatsächlich aussagekräftige Zeugnisse von den sexuellen Vorstellungen und Neigungen unserer Ahnen? Ein paar grobschlächtige dicke Damen aus der Jungsteinzeit, aus Stein gemeißelt oder aus Ton geformt, haben große Brüste und breite Becken. Sie tragen malerische Namen wie die »Venus von Willendorf«, aber über ihre Funktion können wir nur spekulieren. Im Gegensatz zu den vielen tollen und erstaunlich präzisen Tierfiguren aus dieser Zeit verraten die Künstler hier auffallend wenig Geschick. Und Ähnlichkeiten mit real existierenden Steinzeitfrauen scheinen weder gemeint noch beabsichtigt. Überdies entstanden sie erst im Holozän, dem Abschnitt der letzten zehntausend Jahre; einer Zeit also, die gemäß evolutionärer Psychologie für die Ausprägung unserer Biologie nicht mehr wirklich interessant ist.
Über Funde aus der Steinzeit kommen wir an die Sexualität,
Verlagsgruppe Random House
5. Auflage
Copyright © 2009 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
eISBN : 978-3-641-02570-0
www.goldmann-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de