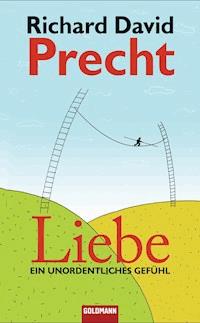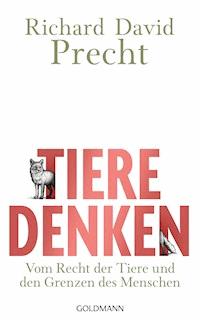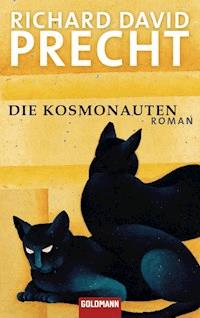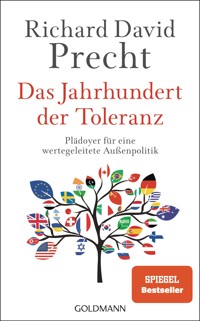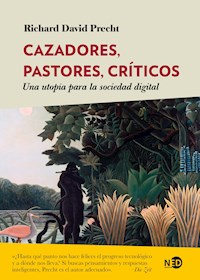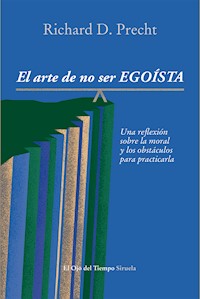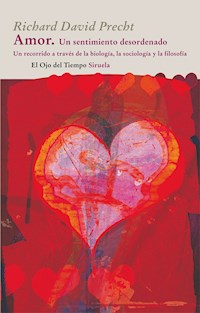19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Geschichte der Philosophie
- Sprache: Deutsch
Der lang erwartete dritte Band von Prechts fünfteiliger Philosophiegeschichte
Das 19. Jahrhundert revolutioniert die Philosophie! Während aus der Industrialisierung die bürgerliche Gesellschaft hervorgeht, verlieren die Philosophen den Boden unter den Füßen. Ist es überhaupt noch möglich, ein geschlossenes System der Welt zu errichten? In einer Welt ohne Gott und ohne natürliche Ordnung? Vor allem die Naturwissenschaften fordern die Philosophie heraus und beanspruchen die alleinige Deutungshoheit über Wahrheit und Sinn. Denker wie Auguste Comte, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Ernst Mach und Charles Sanders Peirce versuchen die Philosophie methodisch auf das Niveau der Physik und der Biologie zu bringen. Doch genau dagegen rührt sich Protest. Für ihre Gegenspieler Arthur Schopenhauer, Sören Kierkegaard und Friedrich Nietzsche ist die Philosophie gerade keine Wissenschaft, sondern etwas ganz anderes: eine Haltung zum Leben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 822
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Das 19. Jahrhundert revolutioniert die Philosophie! Während aus der Industrialisierung die bürgerliche Gesellschaft hervorgeht, verlieren die Philosophen den Boden unter den Füßen. Ist es überhaupt noch möglich, ein geschlossenes System der Welt zu errichten? In einer Welt ohne Gott und ohne natürliche Ordnung? Vor allem die Naturwissenschaften fordern die Philosophie heraus und beanspruchen die alleinige Deutungshoheit über Wahrheit und Sinn. Denker wie Auguste Comte, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Ernst Mach und Charles Sanders Peirce versuchen die Philosophie methodisch auf das Niveau der Physik und der Biologie zu bringen. Doch genau dagegen rührt sich Protest. Für ihre Gegenspieler Arthur Schopenhauer, Søren Kierkegaard und Friedrich Nietzsche ist die Philosophie gerade keine Wissenschaft, sondern etwas ganz anderes: eine Haltung zum Leben!
Richard David Precht
SEI DU SELBST
Eine Geschichte der Philosophie
Band 3
Von der Philosophie nach Hegel bis zur Philosophie der Jahrhundertwende
Originalausgabe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © Bridgeman Images: Caspar David Friedrich:
Der Wanderer über dem Nebelmeer, 1818
(Öl auf Leinwand) / Hamburger Kunsthalle
Redaktion: Regina Carstensen
JT ∙ Herstellung: KW
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-15990-0V003
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Inhalt
EINLEITUNG
Der Wanderer über dem Nebelmeer
PHILOSOPHIE NACH HEGEL
Eine sinnlose Welt
Die Erforschung der Seele
Ordnung und Fortschritt
Das Glück der größten Zahl
Die Wissenschaft der Erfahrung
Der einzig wahre Kommunismus
Klassenkampf ums Dasein
Wozu Philosophie?
Zurück zu Kant!
PHILOSOPHIE DER JAHRHUNDERTWENDE
Der Sinn des Lebens
Evolution und Ethik
Wer ist Ich?
Auf der Suche nach Klarheit
Leben ist Problemlösen
Individuum und Gesellschaft
ANHANG
Ausgewählte Literatur
Philosophie nach Hegel
Philosophie der Jahrhundertwende
Dank
Personenregister
Sachregister
Bildnachweis
Dem unbekannten Schwebebahnschaffner
Wir werden nicht den Weg von der Utopie zur Wissenschaft zurücklegen. Denn das führt uns zur Endstation, deren gesamte technische Raffinesse uns bis ins Jenseits verfolgen wird!
Ein Wuppertaler Schwebebahnschaffner, am 25. Mai 19711
Einleitung
Was für ein Jahrhundert! Am Anfang steht der Staatsstreich des achtzehnten Brumaire des Jahres VIII. Napoleon, der Rückkehrer seines ägyptischen Feldzugs, wird Erster Konsul und damit Alleinherrscher Frankreichs. In wenigen Jahren wird er die Geografie des Alten Europa umpflügen und eine politische Dynamik auslösen, die jahrzehntelang mehr als den halben Kontinent in Atem hält. Als wären die politischen Umbrüche nicht schon genug, schwankt auch bei allen anderen Gewissheiten der Boden. Mitreißender, zerstörerischer und verheißungsvoller noch als die Galionsfiguren der Weltgeschichte sind die Wissenschaften. War das 18. Jahrhundert das Jahrhundert der Physik, so ist das 19. Jahrhundert das der Biologie. Das Leben hat nun nicht nur eine Naturgeschichte wie im Jahrhundert zuvor. Es bekommt eine Entwicklungsgeschichte. Die Welt, im Jahr 1800 nur wenige tausend Jahre alt, dehnt sich nach rückwärts aus in immer schwindelerregendere Tiefe. Am Ende des Jahrhunderts zählen die Jahre in Milliarden.
Aus einfachen dunklen Anfängen zum Menschen und dann – wohin? Die Zukunft wird vom Menschen geschrieben, so viel steht fest. Doch wer bestimmt den Text? Gehorcht die Kulturgeschichte den gleichen Gesetzen wie die Natur? Schreitet sie überhaupt gesetzmäßig voran? In »Stadien« wie bei Auguste Comte? Oder als dialektische Abfolge von Klassen wie bei Karl Marx? Worin genau liegt dann die Rolle der Menschen? Sind sie dienstfertige Werkzeuge einer Vorsehung ohne Gott? Glieder einer programmierten Maschinerie? Oder ist am Ende doch alles ungeschrieben, unklar, unsicher? Irrt die Menschheit vorwärts ohne Plan?
Ob der Lauf der Welt nun vorherbestimmt ist oder nicht, in jedem Fall liegt der Weg im Dunkeln. Kein Allmächtiger und kein Licht der Vernunft leuchten den Pfad aus, der vor der Menschheit liegt. Philosophieren im 19. Jahrhundert bedeutet fast immer: Philosophieren nach Gott! Und Philosophieren nach Gott heißt, in eine Welt hinein zu grübeln, die ganz offensichtlich nicht für den Menschen geschaffen worden ist. Eine verstörende Erkenntnis! Genau zu diesem Zweck hatten sie früher den Allmächtigen immer wieder in ihre Systeme gemogelt: Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Kant und Hegel. Hier formen die Bedürfnisse des Menschen noch das Universum und bestimmen den Gang einer wohlprogrammierten Geschichte. Das 19. Jahrhundert aber erkennt die exzentrische Stellung des Homo sapiens. In der Geschichte der Natur steht er nicht im Zentrum, sondern genau daneben, allein, verloren und ohne Obdach. Wer jetzt von »Gesetzen« der Natur und der Gesellschaft redet, erkennt sie nicht mehr als durchdachte Regeln für eine komfortable Heimstatt, sondern als unpersönlich und fremd. Und wer weiterhin das Wort »Gott« niederschreibt, wie Søren Kierkegaard, kennt keinen Gott als Weltbaumeister mehr und kein göttliches System. Niemand und nichts fügt sich irgendwo passend ein. Übrig bleibt allein der persönliche, der subjektive Gott.
Der Umbruch ist radikal. Wahrheiten kommen nun nicht mehr von der Kanzel, sondern stehen in Zeitungen oder ticken im Takt der Telegrafie. Wer die Bibel bisher wörtlich nahm, muss lernen, sie ernst zu nehmen: als Literatur von Unwissenden (David Friedrich Strauß), als menschliche Wunschprojektion (Ludwig Feuerbach) oder als epische Verkleidung dunkler Triebe (Sigmund Freud).
Gott ist tot und mit ihm alle alte Metaphysik. Auf diese nackte Leinwand malt das 19. Jahrhundert nach und nach die Koordinaten der Moderne. Vielleicht braucht die Gesellschaft noch den Kitt der Religion, wie für den späten Henri de Saint-Simon und seinen Schüler Comte. Aber diese »Zivilreligion« betet keinen Schöpfer mehr an, sondern die erlesensten unter den menschlichen Geschöpfen. Sie mögen genial sein, kreativ und vorausblickend, wie die besten der Wissenschaftler. Aber sie sind keine Engel und fallen nicht vom Himmel. Geschaffen wurden sie wie alle Menschen aus einfachen Keimen. Der Gedanke, im 18. Jahrhundert geboren, bei Pierre Louis Moreau de Maupertuis und Denis Diderot, wird 1811 zum ersten Mal systematisch: in Jean-Baptiste de Lamarcks Philosophie zoologique (Zoologische Philosophie). Sie bietet die neue Blaupause für eine evolutionäre Gesellschaftstheorie, lange bevor Darwins Selektionstheorie dazukommt. Gesellschaften und ihre Ziele lassen sich von nun an ohne Gott erklären. Aber damit zugleich ihre »optimale« Ordnung und ihre »richtige« Moral?
Was auch immer diese passende Ordnung ist, sie muss vor allem mit dem Fortschritt vereinbar sein, mit stetigem Wirtschaftswachstum und neuer Technik. Denn deren Wunderwerke machen die Menschen schneller gottlos als alle Philosophen der Aufklärung zusammen es vermocht hatten. Die Technik zaubert Neues in die Welt und ersetzt damit Glaube, Aberglaube und Magie. In kürzester Zeit wird sie selbst zum wild umtanzten Fetisch. Auf der Leinwand erscheinen Höllenmaschinen; Eisenbahnen und Dampfschiffe zuerst, am Ende des Jahrhunderts noch Flugzeuge und das Automobil. Hochöfen schwärzen den Himmel der immer schneller wachsenden Großstädte. Die Technik ist überall. Uhren messen in der Anzugweste die Zeit nahe beim Herzen. Die Elektrifizierung beleuchtet und beschleunigt die Welt seit den 1880er-Jahren. Das Leben wird getaktet, Fahr- und Arbeitspläne bestimmen den Rhythmus. Auf den Feldern explodieren derweil die Erträge, die Nahrungsmittelchemie bereitet den Weg, Kunstdünger befeuert den Ertrag. Mehr, schneller, höher, weiter. Die Bevölkerung Europas steigt, trotz Krankheiten und Epidemien, von unter zweihundert Millionen im Jahr 1800 auf über vierhundertzwanzig Millionen im Jahr 1900. Es ist das einzige Jahrhundert, in dem sich die Bevölkerung des Kontinents mehr als verdoppelt.
Es scheint, als sei die Welt eine einzige Maschinerie geworden. Was Georg Wilhelm Friedrich Hegel ein Weltprozess zum Höheren war, ist nun das Werk von Maschinen. Fortschritt wird in Fabriken fabriziert. Aber ersetzen sie wirklich den dialektischen Fortschritt zu einer immer besseren Gesellschaftsordnung? Stehen Maschinen für ein gelingendes Leben? Die Frage treibt die Maschinisten der historischen und naturalistischen Logik hervor. Die einen sehen das Gute im Kapitalismus gleichsam verkörpert, von den Klassikern der britischen Nationalökonomie bis zu Herbert Spencer. Die anderen dagegen fordern seine zügige Überwindung, wie William Godwin, Saint-Simon, Charles Fourier und Marx und Engels. Sie skizzieren, jeder auf seine Weise, einen zwingenden Weg in eine alternative Zukunft. Wenn moderne Fahrzeuge Zeit und Raum überwinden, die moderne Kommunikation alle mit allen verbindet, wenn Umwälzung das Zeichen der Zeit ist – warum überwindet man nicht auch die bisherigen Besitzverhältnisse, verbindet die Menschen als Gleiche unter Gleichen und wälzt nicht die Gesellschaftsordnung um?
Revolutionen in der Technik und in der Wirtschaft sind überall. Und in den Köpfen? Tatsächlich befeuern Wandel, Disruption und Fortschritt das Denken in alle Himmelsrichtungen, nach rechts und nach links. Was der Mensch ist, seine wahre Natur, ist nach dem Tod Gottes unergründlich. Es gibt keine »Universalien« mehr, keine feste Definition des Humanen. Wo früher »Natur« drüberstand, steht jetzt »Kultur«. Was der Mensch ist, erklärt sich durch die Antworten, die er auf seine Umwelt findet. Menschen leben nicht in einer vorgefundenen Welt, sondern sie stellen sie her, von Kontext zu Kontext verschieden. Braucht es da noch eine alles ergründende Philosophie? Die Frage nach dem Was beantwortet eine neue Disziplin, die Soziologie, die Frage nach dem Warum eine andere – die Psychologie.
Die Soziologen streben nach ganz oben: Sie schwingen sich auf zur Vogelschau der Gesellschaft, wie bei Georg Simmel, Émile Durkheim und Max Weber. Die Psychologen dagegen blicken nach unten in die Tiefe der Seele: Friedrich Eduard Beneke, Johann Friedrich Herbart, Carl Gustav Carus, Wilhelm Wundt, William James und Sigmund Freud. Die Perspektiven, die sie eröffnen, und die Theorien, die sie entwerfen, beschäftigen ihre Wissenschaften bis heute. Dabei ist ihr politischer Blick oft seltsam verengt. Wie so viele ihrer Zeitgenossen bewegen sich die Pioniere der empirischen Geistes- und Gesellschaftswissenschaften in einem weiten Feld bis heute nicht ausgestorbener Ismen: dem Nationalismus, dem Kommunismus, dem Sozialismus, dem Konservativismus, dem Liberalismus, dem Rassismus. Die Ismen springen ein, wo sich der Mensch des 19. Jahrhunderts seiner philosophischen Wesensbestimmung nicht mehr sicher sein kann. Sie sind »Ideologien«. Mochte Antoine Louis Claude Destutt de Tracy, der Vater des Begriffs, in der idéologie noch den Zauber einer »einheitlichen Wissenschaft der Vorstellungen und Wahrnehmungen« sehen – ihre Unmöglichkeit macht sie zum Schimpfwort. Als zweckdienliche Verkürzungen stecken die Ismen das Terrain ab, bündeln das zunehmend überfordernde Leben zu Überzeugungen, legitimieren Hass, Angst und Wut und rastern dadurch die Leinwand des 19. Jahrhunderts. Das Dynamit, das sie in sich tragen, wird bald hochgehen, fast jede dieser »Weltanschauungen« im 20. Jahrhundert eskalieren.
Das Schema von rechts und links, Restauration und Revolution, Pessimismus, Kulturpessimismus und Fortschrittsglaube – die DNA des 20. und noch des frühen 21. Jahrhunderts wird hier festgelegt. Und die neue Lohnarbeits- und Leistungsgesellschaft bildet vom frühen 19. Jahrhundert an für mindestens zweihundert Jahre die Matrix des Lebens und Zusammenlebens in Europa und Nordamerika. Erst jetzt, im nicht mehr ganz so jungen 21. Jahrhundert, werden Auflösungserscheinungen sichtbar. Ein neues Maschinenzeitalter, jenes der künstlichen Intelligenz, macht sich auf, das alte abzulösen. Sollte die Betrachtung des Werdens der alten Matrix nicht helfen, die Gegenwart besser zu verstehen und durchzustehen? Sollte sie uns nicht das Zeitbedingte der Denkmuster, der Symbole und der Legitimation des Kapitalismus zu erkennen lehren, die uns heute oft so zeitlos wie alternativlos erscheinen?
Das 19. Jahrhundert selbst erlebt noch nicht die Dauer einer fundamentalen Alternative. Die Zeitläufte treiben viele politische Spielarten, Fortschritte und Rückschritte hervor, besonders in Frankreich: von der großen Revolution über Napoleon, die Restaurationszeit, die Revolutionen von 1830 und 1848, Napoleon III. und die kurze Phase der Pariser Kommune bis zur Dritten Republik. Aber sie schaffen keine radikal neue Wirtschaftsordnung. In Deutschland kann davon ohnehin nicht die Rede sein. Solange das Jahrhundert reicht, schafft man es nicht einmal zur Staatsform der Republik. Und in England blüht von 1837 an bis zur Jahrhundertwende das Viktorianische Zeitalter mit seinem wirtschaftlichen Erfolg, seiner imperialen Größe und seinem Sozialdarwinismus.
Fundamental dagegen ist die Veränderung in der Philosophie. Von nun an marschieren ihre avanciertesten Vertreter in eine neue Himmelsrichtung. Der Weg, die Welt zu erklären, hat sich umgekehrt. Wer nichts mehr von Gott herleiten kann, der kennt auch sonst keinen Anfang, von dem aus sich die Welt denkend enträtselt. Wo Prinzipien herrschten, bleiben nur Beobachtungen. Die Deduktion tritt zurück, die Induktion wird zur neuen Methode. Von Comte über John Stuart Mill bis zu Ernst Mach treten die Positivisten ihren Siegeszug an. Die Metaphysik der Philosophen ist ihnen ein Graus, philosophieren sollen die Fachleute: wie in den Naturwissenschaften, so in den neu definierten »Geisteswissenschaften«. »Materialisten« ohne Metaphysik gab es schon lange zuvor. Aber sie deduzierten fleißig aus der Himmelsphysik für das Menschenleben, wie Claude Adrien Helvétius und Paul Henri Thiry d’Holbach. Die Positivisten dagegen möchten Empiriker sein, exakte Buchhalter der Realität, und sei sie uns auch oft durch falsche Begriffe und Traditionen verstellt. Sie sind die großen Entzauberer. Was wir für die Dinge der Welt halten, oder gar für ein »Ich«, existiere nicht objektiv. Sind das nicht alles nur »Anpassungen« unseres Bewusstseins, eine selbst konstruierte Welt aus Symbolen, damit das Menschentier sich orientieren kann? Nicht anders sehen es die Väter des »Pragmatismus« in den USA, insbesondere Charles Sanders Peirce. Für ihn enträtseln allerdings nicht die Empiriker die Welt, sondern die Logiker, sofern sie das Gehäuse ihrer Zunft gründlich überarbeiten.
»Philosophen, schärft euren Realitätssinn!« So lautet die Losung des Jahrhunderts. Was der Technik zu ihren schwindelnden Erfolgen verhilft, soll auch die Philosophie wieder bedeutsam machen. Wie die Mathematiker und die Techniker hat sie es nun mit der schlichten Frage nach »Problem« und »Lösung« zu tun. Und welches scharf umrissene Problem sollte sich so nicht zügig lösen lassen? Der Optimismus, der Comte, Mill, Spencer und die US-amerikanischen Pragmatisten beseelt, scheint schier grenzenlos. Alles wird erkannt werden, und alles wird auf seine Tauglichkeit für die Zukunft überprüft. Was nützt der Gesellschaft? Und was kann weg?
Doch hat die Philosophie dabei nicht gleichzeitig ungeheuer viel zu verlieren? Wenn es nur noch um »Nutzenwissen« geht, was leisten Philosophen dann noch, was andere nicht besser können? In der Mitte des Jahrhunderts verliert die Philosophie die empirisch arbeitenden Psychologen aus ihren Reihen und parallel dazu die ebenso empirisch orientierten Soziologen. Das Fundament schrumpft im Eiltempo. Was soll der verbliebene Rest noch sein? Wissenschaftstheorie? Geschichtsphilosophie? Moralwissenschaft?
Je wissenschaftlicher die Philosophie wird, umso weniger weiß sie noch, was ihr Gegenstand sein soll. In die Enge treiben sie ein Geodät (Peirce), ein Physiologe (William James) und ein Physiker (Mach). Sind die Naturwissenschaftler die wahren Philosophen? Doch was wissen sie von der enormen Breite der Kulturen, den menschlichen Eigenarten und der Besonderheit eines jeden, die man nach den deutschen Hochschullehrern Wilhelm Dilthey, Wilhelm Windelband und Heinrich Rickert nur verstehen, aber nicht erklären kann? Das Ringen um Objektivität tut der Besonderheit und dem Individuellen Abbruch. Sagt nicht der klare Verstand, dass das, was in Menschen vorgeht, trübe und dunkel ist? Weltanschauungen, das Modewort der zweiten Jahrhunderthälfte, lassen sich nicht rationalisieren, sondern nur einkreisen und ausdeuten. Und gilt das Gleiche nicht auch für den individuellen »Lebensstil«, den die Soziologen des Fin de Siècle beschreiben?
Doch wenn der Gegenstand der Philosophie das »subjektive Erleben« ist, das den Naturwissenschaftlern und allen Empirikern verborgen bleibt, wie geht man damit um? Die Antwort kommt früh, schon in der Reaktion auf die Romantik. Arthur Schopenhauer und stärker noch Kierkegaard sehen das Wesen des Menschen in dem, was er tut. Leben ist nicht mit Begriffen fassbar und nicht denkend zu begreifen. Es ist das, was geschieht, während wir dabei sind zu verstehen, was geschieht. Die Sphäre des Lebens ist Empfindung und Selbstempfindung. Sie ist in erster Linie ästhetisch und deshalb auch nur ästhetisch zu beschreiben. Texte über das Leben müssen leben als lebendiger Dialog oder Monolog, Anklage, Rechtfertigung oder Predigt. Die Lebens- und die Existenzphilosophie nehmen von hier aus ihren Anfang. Ihre Themen sind das persönliche Glück und der »Sinn« einer jeden Existenz – Fragen, von denen die Empiriker aller Couleur nichts verstehen. Denn der Sinn des Lebens wird nicht vorgefunden, er wird ihm gegeben.
Zu Hochform läuft diese Gegenströmung auf, wenn Friedrich Nietzsche sie mit äußerstem Pathos auskleidet: als gnadenlose Kritik an der Vernunftphilosophie und an der Kultur des Abendlands. Doch sollte Existenzphilosophie nicht auch bedeuten, über die materielle Existenz der Menschen nachzudenken? Kierkegaard und Schopenhauer mussten nie arbeiten. Und Nietzsche ist Frührentner. Für die Sozialisten sind deren Sorgen Luxussorgen. »Sei du selbst!« – heißt das nicht, überhaupt die Möglichkeit einer Wahl zu haben, um seine Lebensform selbst zu bestimmen?
Das 19. Jahrhundert ist nicht nur die Kontroverse zwischen wissenschaftlicher und Existenzphilosophie, Psychologie und Logik. Es ist auch der Kampf elitärer ästhetischer Lebensausdeutung gegen die Ansprüche aller auf ein selbstbestimmtes Leben. Nietzsches Verachtung der Arbeiter spricht Bände. Endet die Vernunftphilosophie der Aufklärung mit ihren universalen Rechten für jeden in der »Massenkultur«, dann will das vornehme Bürgertum nichts damit zu tun haben. In diesem Spannungsfeld denken auch Simmel und Weber, die Soziologen der Jahrhundertwende. In gleichem Maße, in dem der Fortschrittsoptimismus der Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie steigt, wächst der Kulturpessimismus der bürgerlichen Soziologen, nehmen sie, vor allem Simmel, Zuflucht zur Lebensphilosophie.
Zu Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Philosophie tot; stattdessen gibt es Dutzende neuer unvollständiger Ansätze, der eine radikaler als der andere. Das »Ich« ist dekonstruiert, die Objektwelt subjektiviert. Werte stehen, trotz allem Ringen der Neukantianer, als irrational und beliebig da. Und die »Wahrheit« weist niemandem mehr den Weg. Sie wird nach der Nützlichkeit bemessen, um sich der Umwelt geschmeidig anzupassen. Vor allem anderen aber steht ein Scheitern: Der Anspruch der Philosophie, strenge Wissenschaft zu sein, hat sich nicht einlösen lassen! Und eine neue rationale Moral ist nicht in Sicht. Am Ende kommt das Fiasko. Die ganze Leinwand wird geschwärzt und blutrot getränkt: Soziologen wie Simmel und Weber, der Neukantianer Paul Natorp, die Anhänger der Lebensphilosophie und andere bejubeln, auf die große Erlösung hoffend, den Ersten Weltkrieg …
Der Wanderer über dem Nebelmeer
Vom irrealen Zauber des Seins
Ein Mann in dunkelgrünem Rock steht einsam im Gebirge. Der Fels ist abschüssig, die Füße des Wanderers stehen versetzt, ein Stock gibt ihm Halt. Nebel zieht vom Tal herauf, in gleichem Blaugrau vermischt er sich mit dem fahlen Himmel; Atemzüge eines Sommermorgens. Im Dunst sind Felsen erkennbar, bizarr geformte Spitzen, spärlich besetzt mit Nadelholz. Zwei Hänge fallen von beiden Seiten sanft herab und scheinen sich im Wanderer zu treffen, genau auf der Höhe seines Herzens. »Ich muss allein bleiben und wissen, dass ich allein bin, um die Natur vollständig zu fühlen und zu schauen«, wird der Maler des Bildes von sich sagen. »Ich muss mich dem hingeben, was mich umgibt, mich vereinigen mit meinen Wolken und Felsen, um das zu sein, was ich bin.«2
Dieser Maler ist Caspar David Friedrich (1774 –1840), ein Mann aus Vorpommern, der sein Erwachsenenleben in Dresden verbringt. Doch Wolken hin, Felsen her – weder er selbst noch ein Zeitgenosse berichten von dem Bild, das hier beschrieben ist. Erst 1939 taucht es bei einem vierschrötigen Berliner Galeristen auf, wahrscheinlich aus jüdischem Eigentum. Reiche Industrielle besitzen es in den Vierziger- bis Sechzigerjahren. Im Dezember 1970 kauft es die Hamburger Kunsthalle. Und ein jeder vermutet, dass es sich eigentlich nur um ein Werk Friedrichs handeln kann, gemalt um das Jahr 1818. Zwei Skizzen von Felsformationen, gezeichnet von der Hand des Meisters, finden sich ausgesprochen ähnlich auf dem Bild wieder. Ein verschollenes Werk Friedrichs, den »Adler über dem Nebelmeer« zitierend, erhält es den Titel »Der Wanderer über dem Nebelmeer«.
Friedrich hat sich die Landschaft, die auf dem »Wanderer« gemalt ist, mit eigenen Füßen erlaufen und erklettert. Mit Wanderstock und Zeichenmappe ist er durch die Sächsische Schweiz gestreift, angezogen vom Elbsandsteingebirge, jener sächsischen Fantastenlandschaft und Traumkulisse, die sich später für Karl May in die Schluchten des Balkans und in die Felsformationen am Silbersee verwandeln wird. Friedrich ist gerne gewandert, wenn auch selten in große Ferne. Die deutsche Ostseeküste, seine Heimat, war ihm seelisch immer am nächsten. Nicht mal die Alpen, die er nach Skizzen anderer gemalt hat, wollte er persönlich sehen.
Doch der Maler, der die Stimmungen im Gebirge festhält, ist kein romantisch gestimmter Wanderer unter vielen. Als Friedrich im Mai und Juni 1813 durchs Elbsandsteingebirge spaziert und Landschaftsskizzen für den »Wanderer« anfertigt, befindet sich Sachsen im Brennpunkt der napoleonischen Kriege. Dresden ist von den Franzosen besetzt, die umgebende Landschaft gleicht einem Heerlager. Selbst im Gebirge ist Napoleon persönlich gewesen, um strategische Orte für militärische Operationen zu sichten. In Dresden leidet die Bevölkerung unter Hunger und Seuchen. Im August verteidigen die französischen Besatzer die Stadt bei der Schlacht um Dresden gegen die Heere Österreichs, Preußens und Russlands und verwüsten dabei das vor Dresden gelegene Räcknitz bis auf die Grundmauern. Erst nach der Völkerschlacht bei Leipzig gelingt es den Russen im November 1813, die Franzosen zu vertreiben.
Friedrich ist nicht aus Zeitvertreib in der Sächsischen Schweiz, sondern um den Kriegswirren zu entgehen. Doch kein Krieg, nicht einmal die feinsten Spuren von Menschenwerk und -unwerk, sind auf seinem Bild zu sehen. Die Landschaft des Elbsandsteingebirges erscheint unbeschrieben, eine leere Seite im Buch der Weltgeschichte, wie Hegel deren wenige glückliche Tage beschreibt. Seltsam stillgestellt, ereignet sich auf Friedrichs Bildern nie Geschichte, nur Naturgeschichte.
Erstaunlich ist das schon. Denn der Maler ist politisch hoch interessiert. Er ist überzeugter Demokrat. Und der Feudalismus, der nach der französischen Besetzung in Sachsen wieder erstarkt, ist ihm ein Gräuel. Zugleich denkt Friedrich wie so viele deutsche Republikaner seiner Zeit antifranzösisch und deutschnational. Von einem geeinten Deutschland erhofft er sich die Republik. In Zeiten der Restauration, die nach dem Wiener Kongress 1815 einsetzt, eine gefährliche Überzeugung! Doch Friedrich lässt sich nicht einschüchtern. Von nun an tragen die Gestalten auf seinen Bildern allesamt die von Ernst Moritz Arndt so bezeichnete »teutsche Kleidertracht«: einen schlichten Leibrock, kein Halstuch und ein Samtbarett – die Kluft der Patrioten und Demokraten. Auch der Wanderer über dem Nebelmeer steht dort in altdeutscher Tracht. Nur das Samtbarett fehlt, wie man es von den Männern kennt, die auf Friedrichs Werken der gleichen Zeit das Meer betrachten oder den Mond. Stattdessen zausen dem Wanderer die Morgenluft und die unruhigen Zeitläufte das blonde Haar. Seine »teutsche« Kleidung weist ihn als »Demagogen« aus, wie der Maler bei einem anderen seiner Bilder halb ironisch bemerkt – frei nach dem in den Karlsbader Beschlüssen von 1819 sogenannten Straftatbestand der »demagogischen Umtriebe«.
Doch nicht nur der Wanderer, keine von Friedrichs Bildfiguren tut je etwas Konspiratives. Sie tun überhaupt nichts. Stets stehen oder hocken sie und starren mehr oder weniger stumm in eine unermessliche Ferne. Die politischen Verhältnisse sind der Horizont, aber nicht das Thema der Bilder. Nur abwesend sind sie anwesend. Man ahnt sie, wenn die altdeutsche Tracht – nicht nur ein Bekenntnis, sondern auch eine Vermummung – die Identifizierung der Figuren im Hier und Jetzt vernebelt. Als Rückenfiguren ohne erkennbares Antlitz sind Friedrichs Gestalten vor der Polizei und den Spitzeln der Restauration sicher; man muss sie in Frieden lassen.
Friedrich hat die Rückenfigur nicht erfunden. Auf den Veduten, den Architekturbildern des 18. Jahrhunderts, finden sich ungezählte kleine Figuren. Dem Betrachter abgewandt, stehen sie winzig auf Plätzen und in Hallen herum, um die Architektur großartiger wirken zu lassen. Doch so, wie Friedrich Rückenfiguren ins Zentrum seiner Bilder rückt, hat das niemand zuvor getan. Und keine stand jemals so groß und wuchtig in der Landschaft wie der Wanderer über dem Nebelmeer.
Warum tut er das? Zunächst macht Friedrich mit seinen dem Bildbetrachter abgewandten Betrachtern aus einer Not eine Tugend. Er ist Landschaftsmaler, kein Porträtmaler. Seine malerischen Mittel haben nicht die Qualität der bedeutenderen Zeitgenossen Francisco de Goya, Eugène Delacroix, Théodore Géricault oder William Turner. Friedrichs Ambitionen halten sich im Rahmen seiner malerischen Möglichkeiten. Auch von einer größeren künstlerischen Entwicklung kann nicht die Rede sein. Vom Frühwerk bis zum Spätwerk erkennt man kaum eine »Reifung«, keine auffällige Verbesserung der malerischen Mittel, was die Datierung der stets unsignierten Bilder außerordentlich erschwert.
Friedrich ist kein allzu facettenreicher Maler. Stattdessen verfolgt er ein Leben lang eine ganz bestimmte Konzeption. Er möchte den Betrachter in eine irgendwie immer gleiche Stimmung versetzen, nicht in völlig verschiedene. Seine Bilder, lebloses Leben, gleichen Dioramen in einem Naturkundemuseum. Sind Rückenfiguren darin zu sehen, so stehen sie herum wie ausgestopfte Tiere. Äußerlich meist unbewegt, starren sie in die verschleierte Ferne. Alle Bewegung kommt nur durch den Betrachter ins Bild. Soll im Museum das gemalte Abend- oder Morgenlicht die Tiere konturieren, so ist es bei Friedrichs menschlichen Exponaten umgekehrt; sie bringen den gemalten Hintergrund zur Geltung, in den sie so versunken schauen. Gemeinsam bleibt, dass das Tier im Diorama und das Menschentier bei Friedrich niemals als konkrete Individuen gemeint sind. Wie der präparierte Hirsch, so ist die Rückenfigur eine charakterologische Leerstelle – der Mensch im Bild wird zum »Menschen«, zum stellvertretenden Gattungswesen.
Dazu passt, dass Friedrich die Natur völlig der Stimmung unterwirft. Seine Landschaften sind frei von Launen. Stattdessen gehorchen sie dem Kalkül einer festgelegten Geometrie, die sie stets ein wenig unwirklich macht. Theatralik und strenge Komposition schaffen kein realistisches Szenario, sondern eine Bühne für ein Naturschauspiel. Seine Kunst will, frei nach Paul Klees berühmtem Satz über die Kunst, nicht das Sichtbare wiedergeben, sondern sichtbar machen. Oder mit Friedrich selbst gesagt: »Schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem geistigen Auge zuerst siehest dein Bild. Dann fördere zutage, was du im Dunkeln gesehen, daß es zurückwirke auf andere von außen nach innen.«3 Auf diese Weise philosophiert der Künstler mit Farben und Formen, Licht und Schatten. Wie ein dunkles Dreieck steht der Wanderer im Vordergrund auf dem Felsen, genau in der Mitte einer hellen Landschaft, die auf seinen Brustkorb zentriert ist. Plakativer kann man die Geometrie in der Landschaftsmalerei kaum einsetzen, Hell und Dunkel kaum scheiden.
Friedrichs Landschaftsbilder sind artifizieller als die seiner meisten Vorgänger. Und auch der Standpunkt des Wanderers im weglosen Gelände ist kein zufälliger. Als Zentrum in der Bildmitte lenkt er den Blick des Betrachters auf den blickenden Betrachter; als stünde man selbst hinter dem Mann im dunkelgrünen Rock und sehe ihm beim Sehen zu. Der Betrachter außerhalb des Bildes ist damit zugleich im Bild. Sehend versetzt er sich in den Sehenden hinein. Doch was sehen wir da? Wozu und zu welchem Endpunkt komponiert Friedrich seine Bilder? In welchen Zustand will er uns versetzen und warum?
Die Kunsthistoriker haben den sich in die Landschaft erstreckenden Seeleninnenraum höchst unterschiedlich interpretiert. So fällt es nicht schwer, Friedrichs in Selbstzeugnissen vielfach dokumentierte Religiosität heranzuziehen und die Bilder christlich zu deuten. Andererseits konnte es der Maler mit seinen Bildern wie dem Tetschener Altar gerade strenggläubigen Christen nicht recht machen. Der konservative preußische Diplomat Basilius von Ramdohr hatte Friedrichs Altarbild mit dem »Kreuz im Gebirge« wegen seiner unchristlichen Naturmystik übel verrissen: »In der Tat ist es eine wahre Anmaßung, wenn die Landschaftsmalerei sich in die Kirchen schleichen und auf Altäre kriechen will.« Ramdohrs Gegner ist »jener Mystizismus, der jetzt überall sich einschleicht und wie aus Kunst wie aus Wissenschaft, aus Philosophie wie aus Religion gleich einem narkotischen Dunste uns entgegenwittert!«.4
Ramdohr stört, dass seit Mitte des 18. Jahrhunderts das Erhabene kein Alleinbesitz der christlichen Kunst mehr ist. Philosophen wie Edmund Burke, Immanuel Kant und Friedrich Schiller haben es als eine neue Kategorie der Ästhetik definiert. Nach Schiller ist das Erhabene das, was unsere Fassungskraft und unsere Lebenskraft übersteigt. Wir betrachten den erhabenen Gegenstand »als eine Macht, gegen welche die unsrige in Nichts verschwindet«.5 Doch gerade dieses Aufzeigen von Grenzen zieht uns, nach Schiller, »mit unwiderstehlicher Gewalt« an. Aus dem Spannungsfeld von überforderter Vernunft und überwältigten Sinnen ergreife ein »Zauber« unser »Gemüth«. Er entspringt aus der Macht unserer Fantasie, die dort ganz bei sich ist, wo Sinne und Vernunft kapitulieren.
Schiller hat diese Sätze geschrieben, als Friedrich neunzehn Jahre alt ist. Und das Erhabene darzustellen ist das ästhetische Ausdrucksbedürfnis der Zeit. Die Ergriffenheit im Angesicht des Unermesslichen wird der Hoheitsgewalt der Kirche entzogen und in der Natur wiedergefunden. Und auch die »Versunkenheit« gilt seit Mitte des 18. Jahrhunderts nicht mehr als rein religiöses Gefühl, sondern findet sich, angestiftet durch Diderot, als häufiges Motiv in der französischen Salonmalerei. Was ehedem als Haltung gegenüber Gott verstanden wurde, wird nun zur ästhetischen Leerstelle. Ob Friedrichs Wanderer über dem Nebelmeer tatsächlich von Gottes Schöpfung ergriffen ist oder von der Schönheit der Natur an sich, bleibt der Interpretation des Bildbetrachters überlassen. Der Maler legt die Deutung nicht fest, sondern in die subjektive Empfindung desjenigen, der vor dem Gemälde steht. Statt einfach nur Transzendenz auszustrahlen, sind seine Bilder transzendental – sie verweisen zurück auf den Seeleninnenraum des Betrachters, der in der Natur sehen darf, was er sehen will.
Friedrichs Gemälde sind Räume für Subjektivität. Sie geben Anlass zu vielerlei philosophischen Spekulationen. Nicht schwer, im Nebelmeer das Walten eines vom Menschen unabhängigen Natur-Willens zu sehen, wie Arthur Schopenhauer ihn zur genau gleichen Zeit in Die Welt als Wille und Vorstellung beschreibt. Friedrich hat Schopenhauer, der 1818 in Dresden sein Hauptwerk vollendet, nicht gekannt; getroffen hat er nur dessen weithin als Salondame bekannte Mutter. Und wenn der Maler das helle Nebelmeer, bewegt vom Willen der Natur, der dunklen Vorstellungswelt des Wanderers entgegensetzt, vor dessen Augen sich das Naturschauspiel vollzieht, so spiegelt sich darin keine philosophische Lektüre. Gleichwohl gestaltet Friedrich mit künstlerischen Mitteln, was Schopenhauer mit dem Sezierbesteck der Philosophie scheidet. Und so wenig der Maler den Philosophen studierte, so intensiv der Philosoph den Maler. Im Jahr 1815 rühmt er ihn, neben anderen, dafür, dass seine Bilder den Betrachter zu »reinobjektiver Betrachtung« zwingen und damit »eine sehr bedeutende viel sagende Idee ausdrücken«.6
Friedrich musste Schopenhauer nicht lesen, um aus der gleichen Quelle zu trinken. Sein seelisches Bedürfnis und sein Verhältnis zur Natur sind dem vierzehn Jahre jüngeren Philosophen ähnlich, selbst wenn der Maler sich dabei nicht von Gott verabschieden muss wie der Philosoph. Schopenhauers Natur ist erhaben und grausam zugleich, Friedrichs Morgen- und Abendstimmungen fehlt jegliche Gewalt. Sie spiegeln jene friedliche Versöhnung von Menschenwelt und Naturschauspiel, die Schopenhauer allein der Kunst zugesteht, nicht aber dem wirklichen Leben. Und doch kommen sie philosophisch im Wesentlichen überein: Was der Mensch ist, sich selbst und der Natur gegenüber, kann nicht mit Worten, mit überhaupt keinen Mitteln der Vernunft gesagt werden, sondern nur empfunden und in Kunst gezeigt. Die Worte versagen vor dem Sein. Die Wahrheit ist keine Eigenschaft von Gedankengebäuden, sondern von schönen Sommerabenden und Morgenstunden im Nebelgebirge. Man denke noch einmal an Friedrichs Zitat vom Anfang: »Ich muss mich dem hingeben, was mich umgibt, mich vereinigen mit meinen Wolken und Felsen, um das zu sein, was ich bin.«
Die Zwiesprache mit der Natur ist still und stumm; ihr Ziel kein System des vernünftigen Denkens, gebaut aus dem eisernen Draht der Logik, den Backsteinen der Begriffe und dem Mörtel der Kausalität. Das eigentliche Sein ist der Vernunft gegenüber »irreal«, weil nicht zu fassen. Die Forderung des 19. Jahrhunderts, »Sei du selbst!«, die von Søren Kierkegaard zu Friedrich Nietzsche führt, kennt diesen irrealen Zauber des Seins. Von hier aus misstraut sie gründlich aller Vernunftphilosophie. In dieser Absage an objektive Erkenntnis liegt Friedrichs Modernität. Die Philosophie wird diesen Gedanken der Romantik weiterentwickeln zur Lebens- und Existenzphilosophie. Leben steht immer vor den Worten und Gedanken. Du bist du selbst, lange bevor du versuchst, dein Leben gedanklich einzuholen und dich zu dir selbst in ein diskursives Verhältnis zu setzen.
Überholt dagegen wird der Maler noch zu Lebzeiten vom zweiten Hauptstrang der Philosophie des neuen Jahrhunderts: einer Philosophie nach der Blaupause der Naturwissenschaften. Sie wird im Nebelmeer nicht mehr sehen als Luft reflektierendes H2O. Während der Existenzphilosophie alles subjektiv wird, wird der Philosophie nach naturwissenschaftlichem Zuschnitt alles objektiv. Anders als im 18. Jahrhundert, insbesondere im System Kants, ist zwischen beiden Polen nicht mehr zu vermitteln. Wie schnell der Wind sich in diese Richtung dreht, erkennt auch der Laie. In Friedrichs Bildern macht er auf den ersten Blick Zeugnisse der Romantik aus: rückwärtsgewandt in ihrem altdeutschen Habitus, hoffnungslos sentimental im Fernblick auf eine fortschrittslose Zukunft. Wie ein Denkmal aus den Befreiungskriegen steht der Wanderer in der bedeutungstragenden Landschaft; ein Memorial der Romantik, stillgestellt in der Vergangenheit.
Die Zeitläufte dagegen verändern sich rasant. Friedrich malt das Bild mutmaßlich im Geburtsjahr von Karl Marx. In Sachsen hat gerade ein beispielloser industrieller Aufschwung eingesetzt; im Erzgebirge, im Vogtland, in der Oberlausitz und in Westsachsen ersetzen Spinnmühlen menschliche Arbeitskraft. Seit 1807 werden sie nicht nur in England, sondern auch in Chemnitz gebaut, dem »sächsischen Manchester«. Die Bevölkerungszahl Sachsens verdoppelt sich in kurzer Zeit. Nirgendwo in Deutschland schreitet die Industrieproduktion so schnell voran. Zwanzig Jahre nachdem Friedrich seinen Wanderer in die Einsamkeit über dem Nebelmeer schickt, fahren die ersten Dampfschiffe auf der Elbe, zerschneidet die erste deutsche Eisenbahn-Fernverkehrsstrecke zwischen Leipzig und Dresden die vormals fast menschenleere Friedrich’sche Mondlandschaft. Beobachter in altdeutscher Kluft gibt es nicht mehr, die Zeit hat sie aus der Geschichte entfernt, der Dampf der Lokomotiven sie vernebelt, der Rauch der Schlote sie geschwärzt. Das neue sächsische Lumpenproletariat, das der Maler noch erlebt, findet in dessen Bildern keinen Platz. Die drängenden sozialen Probleme passen nicht in sein Weltbild.
Die strenge Geometrie und die Koordinaten haben sich verändert. Sie orientieren sich nicht an der Frage Frankreich oder Deutschland, Einheit oder Flickenteppich, bürgerliche Freiheit oder feudaler Obrigkeitsstaat. Der Blick ins Unermessliche hat sich mit Messbarem gefüllt, mit Zahlen und Kurven des industriellen Fortschritts. Nicht Transzendenz, sondern Effizienz lautet das Zauberwort der neuen Zeit; nicht Leere, sondern Fülle, statt Nebel – Durchblick. Die Dynamik erfasst alle und alles. Auch die Philosophen verlieren ihren Gott in gleichem Maße wie sie den Naturwissenschaften die Wahrheit überlassen. Zum neuen Gott aber wird der wirtschaftliche Fortschritt. Und dessen Dampfschiffe und Eisenbahnen machen selbst vor dem Elbsandsteingebirge nicht Halt. Als Friedrich 1840 in Dresden stirbt, ein fast vergessener Mann, beginnt in der Sächsischen Schweiz der planmäßige Tourismus …
PHILOSOPHIE NACH HEGEL
Ein Albtraum an Transparenz.Jeremy Benthams Entwurf für ein Panopticon (1791), ein vom Aufseher jederzeit vollständig einsehbares Gefängnis.
Eine sinnlose Welt
Der Rächer der Philosophie – Wille und Vorstellung –Mitleid und Entsagung – Die Kunst zu leben –Der Spion – Der Sprung – Drei Lebensformen –Ein fruchtbares Erbe
Der Rächer der Philosophie
An Selbstbewusstsein fehlt es dem jungen Mann nicht. Als er von Dresden aus seine Vorlesung an der Universität Berlin ankündigt, will er über die »gesammte Philosophie« lehren, »die Lehre vom Wesen der Welt und dem menschlichen Geiste«. Und die passendsten Stunden dafür seien »die, wo Herr Prof. Hegel sein Hauptkollegium liest«.7
Arthur Schopenhauer (1788 –1860) ist einunddreißig Jahre alt und in den Fachkreisen der Philosophie gänzlich unbekannt. Doch tollkühn traut er sich im Herbst 1819 zu, den berühmtesten deutschen Philosophen seiner Zeit durch eine Konkurrenzveranstaltung in die Knie zu zwingen. Als »Rächer« möchte er mit dem »Windbeutel« Hegel abrechnen. Möge der Bessere gewinnen! Dabei kann Schopenhauer froh sein, dass man ihn in Berlin überhaupt an der Universität lesen lassen will. In Heidelberg und in Göttingen, wohin er sich zunächst gewandt hatte, reagierte man ablehnend. Dass der Berliner Zoologe Martin Hinrich Lichtenstein (1780 –1857) sich seiner annimmt, ist bereits ein großer Glücksfall. Aber Schopenhauer sieht die Sache anders herum. Welch ein Glück für die Berliner Universität, dass sie ihn als Dozenten bekommt!
Sein übersteigertes Sendungsbewusstsein, seine Überheblichkeit und sein Jähzorn begleiten Schopenhauer früh. Als Sohn eines wohlhabenden Danziger Kaufmanns bereist er schon in jungen Jahren halb Europa. Während um ihn herum die Revolutions- und die napoleonischen Kriege zwischen Frankreich und den Mächten Europas wüten, zieht die begüterte Familie mit ihrem Sohn nach Hamburg, England und Frankreich. In den französischen Alpen begeistert er sich für die Gletscher am Mont Blanc, in Paris sieht er Napoleon bei einer Parade auf einem prächtigen Schimmel an sich vorbeireiten, in Westminster Abbey steht er an Shakespeares Grab. Tiefer noch treffen ihn andere Eindrücke. Der halbwüchsige Schopenhauer sieht Bettler und Kriegsversehrte in Londons Straßen. Mit Grausen wohnt er einer öffentlichen Hinrichtung bei. Und in Toulon entsetzt er sich über das trostlose Schicksal der Galeerensträflinge – Bilder, die sich eingraben. Die Melancholie, die er empfindet, wird ihn nie mehr verlassen: Was für ein schreckliches Elend ist das menschliche Leben, und wie flüchtig sind dagegen die Ablenkungen und das Schöne! Der Jugendliche hat den »Boden der Schwermut« entdeckt, wie er an seine Mutter schreibt, und wird sich nie mehr wirklich davon lösen.
Schopenhauer ist siebzehn, als sein depressiver Vater sich in Hamburg aus dem Fenster stürzt. Der junge Mann bleibt orientierungslos zurück. Eine Zeit lang sucht er Halt und Trost in Romanen und philosophischer Lektüre. David Hume fasziniert ihn ebenso wie Voltaire und Jean-Jacques Rousseau. Auch das Theater und das Ballett begeistern ihn und am allermeisten die Musik. Die vorgezeichnete Karriere als Kaufmann dagegen ödet ihn an. Als seine Mutter nach Weimar zieht und dort rasch zur führenden Salondame avanciert, folgt Schopenhauer ihr später nach. Doch das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn ist schlecht. Während die Mutter aufblüht als schriftstellernde Freundin Goethes und anderer Geistesgrößen, zieht Schopenhauer sich mehr und mehr zurück. Auch sein Medizinstudium in Göttingen bricht er nach zwei Semestern ab. Sein neues Berufsziel ist Philosoph!
Bei Kants klugem Kritiker Gottlob Ernst Schulze (1761–1833) lernt er, sich für Platon und Immanuel Kant zu begeistern. Am antiken Philosophen fasziniert ihn die Vorstellung, dass die Erfahrungswelt »uneigentlich« sei. Die wirkliche Wirklichkeit ist etwas Verborgenes, die Wirklichkeit unseres täglichen Lebens nur ein Schein. Wie Platon so sucht auch der junge Schopenhauer nach einem Ausweg, einer Erlösung aus der unvollkommenen Welt der Illusionen. An Kant gefällt ihm, dass er die Grenzen der Vernunft so klar gezogen hat. Alles, was Menschen erkennen, erkennen sie nach Maßgabe ihres Bewusstseins. Es ist nicht die Welt »an sich«, die ich erlebe, sondern nur die Welt »für mich«. Der Gedanke wurde schon von den britischen Empiristen gedacht, von John Locke, von Hume und am konsequentesten von George Berkeley. Raum und Zeit und auch die Kausalität von Ursache und Wirkung sind nicht »an sich« vorhanden. Sie sind Raster, mit denen unser Bewusstsein arbeitet, um sich in der Welt zurechtzufinden.
Nun hatte Kant allerdings neben unserer Erfahrungswelt noch ein »Reich der Freiheit« skizziert, in dem die Dinge »an sich« sind. Dieses Reich der Freiheit ist das, was jenseits unserer Erfahrung liegt und das wir nur ahnen können. Der Gedanke gefällt Schopenhauer. Aber ist es wirklich die Vernunft, die dieses Reich der Freiheit erahnt? Könnten es nicht auch die Gefühle sein?
Auch Kants Nachfolger Johann Gottlieb Fichte (1762 –1814), Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775 –1854) und Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 –1831) hatten nach dem der Erfahrung entzogenen »Absoluten« gefahndet. Sie suchten es, jeder auf seine Weise, in der Vernunft. Doch ist das richtig? Kurz entschlossen reist Schopenhauer nach Berlin, um sich Fichtes Vorlesungen persönlich anzuhören. Im Wintersemester 1811/1812 schreibt er sich an der Universität ein. Er erwartet »in Fichten« einen »echten Philosophen und großen Geist kennen zu lernen«.8 Fichtes Philosophie, seine »Wissenschaftslehre«, hat die Welt der »Dinge an sich« verabschiedet. Es gibt keine Wirklichkeit, von der mein Bewusstsein nichts weiß. Stattdessen ist alle Wirklichkeit eine Leistung meines Gehirns. Oder mit Fichte gesagt: Alles, was ist, ist in meinem »Ich«. Von diesem absoluten und vernünftigen Ich aus, das sich der Welt entgegensetzt (einschließlich der Vorstellung meiner selbst), entwickelt Fichte seine ganze Philosophie über die Moral bis zum Recht und zu seinen politischen und ökonomischen Vorstellungen.
Schopenhauer braucht elf Vorlesungsstunden, bis sein vernichtendes Urteil gefällt ist. Fichte ist maßlos überschätzt! Er vermutet, dass der gefeierte Geist am Katheder nur deswegen so dunkel spricht, weil er nichts Klares zu sagen hat. Was soll denn Fichtes reines und absolutes »Ich« sein? Wenn sich das »Ich« die Welt entgegensetzt, so haben wir es mit einer Ursache und einer Wirkung zu tun. Das »Ich« ist die Ursache dessen, dass wir lauter Dinge »setzen«. Ich und Welt treten damit in einen Kausalzusammenhang. Doch was der Kausalität unterliegt, ist, wie Hume und später Kant meinten, Produkt meines begrenzten Bewusstseins. Es betrachtet alles kausal, weil es sich ohne Kausalität nichts erklären kann. Damit aber ist Fichtes »Ich« gerade nicht absolut! Es ist bedingt durch die Spielregeln des Bewusstseins. Die ganze Konstruktion eines unendlich freien »Ichs« ist also zutiefst widersprüchlich und damit Unsinn.
Die Konsequenz ist eindeutig: Wenn es etwas Absolutes, Unmittelbares und völlig Wahres gibt, dann ist es nicht die Vernunft, die etwas darüber weiß. Alle Vernunft ist nur ein Nebenprodukt unseres Bewusstseins und gefangen in der menschlichen Vorstellungswelt. Den Begriff »Vorstellung« entlehnt Schopenhauer von Fichte in feindlicher Übernahme. Auch von Schelling, dem zweiten großen Idealisten, der in München lehrt, übernimmt er einen Baustein. Für Schelling ist alle Natur von einer irrationalen Kraft durchwirkt – und ebenso sieht das Schopenhauer. Gleichwohl verachtet er Schelling zutiefst.
Als der junge Mann seine Gedanken ordnet, ist er vierundzwanzig Jahre alt. Einen Universitätsabschluss hat er nicht, aber auch keine ernsthaften Existenzsorgen. Anders als Kant, Schelling, Hölderlin oder Hegel droht ihm kein Schicksal als Hauslehrer, um sich notdürftig durchs Leben zu schlagen. Wie Platon, Pico della Mirandola, Montaigne, Shaftesbury, Montesquieu, d’Holbach, Helvétius und später Georg Simmel, Max Weber und Ludwig Wittgenstein gehört er zu den wenigen Philosophen, die frei und unabhängig waren. Unbeschwert kann der Sohn aus reichem Hause seinen starken Neigungen zu schönen Künsten und feurigen Schauspielerinnen nachgehen. Schon in seiner Jugend weit gereist, erzogen zum vielsprachigen Mann von Welt, hätte er ein Gunter Sachs seiner Zeit werden können. Doch seine Schwermut (an der auch Sachs litt) ist lähmend und lässt sich nur kurzzeitig ablenken. Fieberhaft sucht Schopenhauer sein Heil nicht im Diesseits, sondern in jener Welt, die hinter allen menschlichen Illusionen liegt.
Was für Platon das Reich der Ideen war, für Kant das Reich der Freiheit, für Fichte das höhere Bewusstsein des absoluten Ich und für Schelling die intellektuelle Anschauung des Absoluten – genau das will Schopenhauer auf einem ganz neuen Weg finden. Denn alle Vorstellungen der wirklichen Wirklichkeit waren bislang ebendies – Vorstellungen! Sie sind Behelfskonstruktionen, um irgendwo noch etwas anderes als die Erfahrungswelt gelten zu lassen. Denn Menschen empfinden es ja. Das Wort liefert Schopenhauer zugleich den Schlüssel. Das »bessere Bewusstsein«, wie er es zunächst nennt, ist etwas, das nicht gedacht, sondern empfunden wird! Mag unser »empirisches Bewusstsein«, die Welt des Alltags und der Naturwissenschaften, auch in einer verderbten Welt des Leidens leben – irgendwo in uns spüren wir eine Realität, die tiefer und wahrer ist als alles, was wir sehen, hören, messen und ergrübeln. Und dieses »Andere« ist nicht nur wahrer, es ist zugleich moralisch »besser« als die tägliche Erfahrungswelt. Denn dass das Wahre zugleich das Gute sei – darüber beschleichen den jungen Platon-Fan zunächst keine Zweifel.
Wille und Vorstellung
Schopenhauer zweifelt auch nicht daran, dass sein eigenes Werk der ganz große Wurf wird. Das beste philosophische Buch des Jahrhunderts, auf Augenhöhe mit Platon und Kants Kritik der reinen Vernunft – darunter tut er es nicht. Doch Berlin steht inmitten der Wirren der Freiheitskriege, und der stets ängstlich besorgte Schopenhauer flüchtet ins beschauliche Rudolstadt nach Thüringen. In seinem Zimmer in der Gastwirtschaft Zum Ritter schreibt er seine Doktorarbeit: Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. Sein Lebensthema, die wirkliche Wirklichkeit, schiebt er noch auf. Zunächst einmal untersucht er die menschliche Vorstellungswelt. Der Mensch ist ein Tier, das sich die Welt durch »Gründe« erklärt. Doch was sind Gründe? Warum akzeptieren wir sie? Worin besteht ihre Gesetzmäßigkeit, die sie gültig macht?
Schopenhauer knüpft an Hume und an Kant an. Beide hatten die Kausalität als ein Ordnungsschema des menschlichen Bewusstseins beschrieben. Aber die Mechanismen der Kausalität lassen sich viel gründlicher analysieren. Und genau das tut Schopenhauer. Er untersucht vier verschiedene Arten von Begründungsverhältnissen. In den Naturwissenschaften ist die Kausalität zeitlich. Etwas entsteht aus etwas anderem und ist dessen zeitliche Folge. Weil es friert, wird aus Wasser Eis. In der Logik ist die Kausalität unabhängig von Zeit und Raum, sie ist logisch. Zwei plus zwei ist immer und völlig zeitlos vier. In der Geometrie und der Arithmetik dagegen spielen Logik und Räumlichkeit zusammen. Denn dass die Summe der Winkel im Dreieck 180 Grad ergibt, ist logisch-räumlich evident. Mit diesen Unterscheidungen sagt Schopenhauer letztlich nichts Neues. Entscheidend ist, dass er noch eine vierte Begründungsform einführt, nämlich das Motiv oder den »Handlungsgrund«. Wenn Menschen etwas tun, dann haben sie dafür keinen logischen, sondern einen psychologischen Grund. Wir tun etwas, weil wir es wollen. Der Wille ist die Ursache unserer Handlung und gibt ihr einen Grund. Aber diese Ursache unterscheidet sich grundlegend von den anderen drei Ursachen. Der Wille ist nämlich nicht demonstrierbar. Evident ist er nur für mich selbst, nicht für andere. Ein »innerer Sinn«, jenseits von Zeit, Raum und Logik, ist es, der mich antreibt.
Was zunächst harmlos klingt, öffnet Schopenhauer bald darauf den Weg zu seiner wirklichen Wirklichkeit. Denn etwas, was jenseits von Zeit, Raum und Logik ist, ist das nicht das, was Kant das »Reich der Freiheit« genannt hat, in dem die Dinge »an sich« sind? Doch dieses Reich der Freiheit ist nicht vernünftig und intelligibel – es ist der irrationale dunkle Wille, den wir mit innerem Sinn spüren und der uns und die gesamte belebte Natur beseelt und motiviert!
Frisch promoviert und in Vorfreude auf sein großes Hauptwerk kehrt Schopenhauer im Herbst 1813 nach Weimar zurück. Bei seiner Mutter, die mittlerweile einen neuen Mann in ihr Leben eingeschlossen hat, kann er mit seiner Doktorarbeit nicht punkten. Johanna Schopenhauer, inzwischen bekannte Reiseschriftstellerin und im Goethe-Kreis gefeiert, hält das Werk ihres Sohnes für literarisch wertlos: eine Lektüre »für Apotheker«. In kürzester Zeit zerstreiten die beiden sich heillos. Besonders empfindlich trifft die Mutter, wie der Sohn mit ihrem Intimus Goethe umgeht. Schopenhauer empfindet durchaus Respekt vor der Lichtgestalt der Weimarer Szene; aber ihn zu zeigen, ist seine Sache nicht. Als Goethe ihm stolz seine Farbenlehre präsentiert, um sich dafür von dem aufstrebenden jungen Herrn Doktor rühmen zu lassen, fällt Schopenhauer nichts anderes ein, als den Grandseigneur zu rüffeln. Dessen Farbenlehre möchte die beseelte Welt Spinozas und Schellings gegen die nüchterne Physik Newtons retten. Nicht schlecht, befindet sein junger Kritiker, aber eine »eigentliche Theorie … ist nicht in Göthe’s Farbenlehre erhalten«.9 Unerschrocken greift er zur Feder und zeigt Goethe, wie eine richtige Farbenlehre auszusehen hat. Was Goethe für eine Übereinstimmung des menschlichen Bewusstseins mit der Natur hält, etwa die »Sonnenhaftigkeit« des Auges, sei doch im Grunde nur eine Projektion. Wir halten das Auge für sonnenhaft, weil wir uns die Sonne nach unseren Vorstellungen bilden. Als guter Kant-Schüler gibt Schopenhauer Goethes Farbenlehre ein transzendentalphilosophisches Fundament.
Dass Goethe, der mit Schopenhauer zusammen forschen wollte, davon nicht angetan ist, bedarf keiner langen Rede. Das Verhältnis wird auch nicht dadurch besser, dass Schopenhauer in einem Brief darauf besteht, dass einzig er selbst »die erste wahre Theorie der Farbe geliefert« habe.10 Strategisch klug ist das nicht. Niemand in Deutschlands Kulturleben hat so viele Karrieren ermöglicht und Schützlinge protegiert wie Goethe; Schopenhauer wird definitiv nicht dazugehören. Verbittert zieht er ins schöne Dresden, um endlich sein Hauptwerk zu schreiben. Dafür liest er viel indische und fernöstliche Philosophie, die bei den Romantikern stark in Mode ist. Doch Schopenhauer geht gründlicher vor als alle anderen. 179 Bücher leiht er aus der Dresdner Bibliothek aus, die ihm das Denken der Hindus und Buddhisten nahebringen. Vor allem die Upanishaden, eine Sammlung altindischer Texte, bestätigen ihn in seinem Glauben an eine Zwei-Welten-Theorie. Die uneigentliche, verderbte und leidende Welt hier – die wirkliche und wahre Welt dahinter. Zugang zur wahren Welt verschafft nicht der Verstand, sondern der Leib. Das Ewige und Wahre in der Welt erfahren wir in unserer biologischen Lebensenergie, unserem Wollen. Und wir erspüren es, wenn wir fühlen, wie wir als Teil der Natur mit ihr zusammenhängen.
»Eigentlichkeit« gibt es nur in der sinnlichen Erfahrung – ein Gedanke, den vor Schopenhauer schon der französische Sensualist Étienne Bonnot de Condillac (1714 –1780) gedacht hat: Ich fühle mich, also bin ich! Doch Schopenhauer sieht in Condillac nur einen geistlosen Materialisten. Sich selbst dagegen hält er für jenen Mann, der als Erster das Beste des Abendlands (Platon und Kant) mit dem Besten der östlichen Philosophie zusammendenkt. Und der »Wille« wird dabei zum Schlüsselbegriff.
Im März 1818 ist das große Werk abgeschlossen: Die Welt als Wille und Vorstellung. Vorstellung ist alles das, was Menschen denken. Die ganze Welt erscheint uns als Vorstellung, ob tägliche Dinge, die Natur oder unser Handeln und unsere Ideale. Stets bewegen wir uns in einer typisch menschlichen Vorstellungswelt, geformt durch unser Bewusstsein. Wären unser Gehirn und unsere Sinnlichkeit anders, so wäre auch unsere Vorstellungswelt anders. Stärker als die meisten deutschen Philosophen vor ihm sieht Schopenhauer den Menschen als ein Tier unter Tieren, gefangen im Käfig seines biologischen Erkenntnisapparats.
Für viele Menschen ist ihre Vorstellungswelt »die Welt«. Auch der hochgeschätzte Hume hatte hier Schluss gemacht. Außerhalb unserer Vorstellungswelt gibt es nichts, von dem wir etwas wissen können. Aber Schopenhauer widerspricht energisch: Doch es gibt etwas! Fühlen wir nicht die Regung des Willens in uns als eine natürliche Kraft jenseits unseres Verstandes? Ein Wille, der so mächtig, deutlich und klar in uns wirkt, dass wir nicht abstreiten können, dass es ihn »an sich« gibt? Unser Wille ist keine Vorstellung unter anderen. Er ist von kosmischer Kraft, er durchwirkt die ganze natürliche Welt von der Elektrizität über die Pflanzen und Tiere bis zu den Menschen. Er ist das Naturereignis schlechthin, das in allem waltet, alles hervorbringt und als Antrieb und Motiv in allen intelligenten Wesen spürbar wird. Hatte Schelling gemeint, dass der Mensch das Wesen ist, in dem die Natur sich ihrer selbst bewusst wird, so stimmt Schopenhauer dem zu. Aber nicht in unserer Vernunft, sondern im gespürten und begriffenen Willen kommt die Natur zu sich selbst! Denn was sind unsere Vorstellungen mehr als Produkte eines Verstandes, der von nichts anderem gelenkt und geleitet wird als von ebendiesem Willen? Selbst die vermeintlich objektiven Naturwissenschaften vermessen nur den engen Rahmen einer Welt, die unser Gehirn mit Vorstellungen möbliert. Doch eine Erscheinung zu vermessen oder mit einer anderen Erscheinung zu vergleichen schafft noch lange keine wirkliche, sondern nur eine menschliche Objektivität.
Schopenhauer kehrt die alte Hierarchie um. Nicht die Vernunft weiß um die wahre Welt, sondern das Gefühl. Hier ist er meilenweit von Kant entfernt. Was aber folgt aus der neuen Einsicht? Ist der Wille nun gut oder schlecht? Was sagt er uns über unsere Sterblichkeit oder Unsterblichkeit? Wie sollen wir uns eingedenk unseres Wissens um die Macht des Willens verhalten? Diese Fragen behandeln das dritte und vierte Kapitel von Die Welt als Wille und Vorstellung. Sie enthalten Schopenhauers Ansichten über Ästhetik und Ethik.
Die Künste, insbesondere die Musik, haben Schopenhauer von Kindesbeinen an fasziniert. Aber warum? In seinem Buch gibt er dem Reiz des Ästhetischen eine philosophische Deutung, die stark an den von ihm geschmähten Schelling erinnert. Doch überall, wo Schelling vom Absoluten spricht und von intellektueller Anschauung, redet Schopenhauer vom Willen und vom Fühlen. Die Aura der Kunst liegt darin, dass sie die alltägliche Welt entrückt. Wenn ich einer Symphonie lausche oder mich in ein Gemälde versenke, scheint die Zeit stillzustehen – jene vermaledeite Zeit des Werdens und Vergehens, des Leidens und Sterbens. Die Kunst »reißt das Objekt ihrer Betrachtung heraus aus dem Strome des Weltlaufs und hat es isoliert vor sich«.11 Sie versetzt uns in einen sphärischen Zustand jenseits von Zeit und Raum. Sie trägt einen Hauch jener wirklichen Wirklichkeit jenseits unseres Bewusstseins. Sie berührt unser fühlendes Inneres, indem sie den schicksalhaften Weltenlauf aussetzt und uns ganz bei uns selbst sein lässt. In der Versenkung fühle ich mich in einem Zustand, als ob es die alltägliche Welt nicht gäbe. In diesem Sinne ist die Kunst »wahr«, denn sie lässt uns ahnen, dass wahre Bedeutung nicht in der Erfahrungswelt liegt. »Das Wesen … aller Kunst besteht im Auffassen der platonischen Idee, d. h. des Wesentlichen und daher der ganzen Art Gemeinsamen, in jedem einzelnen.«12 Und sie lässt uns entspannt gegenüber unserem Willen sein und macht ihn dadurch vom Treiber zum Objekt unserer Betrachtung. Doch die Kunst ist zugleich flüchtig. Sie überwindet die Welt nur zum Schein oder im Spiel und nur für kurze Dauer. Die wirkliche Überwindung kann sie damit nicht leisten. Dies ist und bleibt die Aufgabe der Ethik.
Mitleid und Entsagung
Wie bei Platon und Kant ist Schopenhauers Ethik die Konsequenz aus seiner Metaphysik. Wie soll ich leben, wenn alles Leben Ausdruck eines dunklen und irrationalen Willens ist? Wenn das, was wir Individualität nennen, einzig ein Schein, eine Illusion ist, weil der Wille nur an der Gattung und nicht am einzelnen Menschen interessiert ist?
Theoretisch lassen sich aus einer solchen Prämisse viele verschiedene Konsequenzen ziehen. Ich kann völlig amoralisch leben, weil es der Natur und dem Willen auf Vernunft, Einsicht und Moral ja ohnehin nicht ankommt und es kein anderes moralisches Gesetz in mir und in der Welt gibt. Ich kann mich dabei an meinem Willen erfreuen und alles daransetzen, meine Triebe zu befriedigen, selbst wenn sie unersättlich sind. Aber ich kann auch ganz anders reagieren; etwa die Verpflichtung in mir spüren, mich trotz der Sinnlosigkeit allen Lebens mit Kräften dafür zu engagieren, dass die kurze Zeit auf Erden für viele Menschen besser und erträglicher wird.
Doch Schopenhauer wählt weder den ersten noch den zweiten Weg, sondern einen dritten: Ich muss lernen, meinen Willen zu erkennen und ihn so weit es geht überwinden, um zwar nicht glücklich, aber zumindest zufrieden zu werden. Erstaunlicherweise hält er diese Konsequenz für logisch, was sie nicht ist. Nicht die Logik, sondern das melancholische Temperament zeichnet diesen Weg vor. Denn wer nicht allzu stark an der Welt leidet, wird ihr nicht entsagen wollen. Entsprechend willkürlich erscheint Schopenhauers Ethik. Sie ist eine nicht weiter begründbare Haltung, etwas, was man seit Beginn des 19. Jahrhunderts eine Weltanschauung nennt.
Am Anfang steht die Einsicht in das Leiden, den Schmerz und erstaunlicherweise »die Schuld« allen Lebens. Es sind Dinge, die jeder sensible Mensch in sich spürt. In durchschnittlichen Menschen äußert sich das Wissen um das traurige und schuldhafte Leben in der Reue über begangene Taten. Ein Mann von Charakter hingegen – den es außer Schopenhauer selbst leider nur sehr selten gibt – erkennt den großen Zusammenhang der Welt, die irrationale Kraft seines Willens und alle damit verbundenen Schwächen. Unaufhörlich arbeitet er daran, sie zu überwinden. Er sieht, dass das Leben immer nur zwischen Schmerz und Langeweile, Not und Überdruss hin- und herpendelt und dass es in der Welt kein dauerhaftes Glück gibt. Folglich bleibt ihm nur, den eigenen Egoismus zu bezwingen.
Kein moralisches Gesetz in mir, wie bei Kant, und keine Weltklugheit, wie bei Hume, befiehlt oder rät mir, ein guter Mensch zu sein. Es ist die Einsicht in das Leiden aller Kreatur und die Überwindung meines egozentrischen Willens, die mich moralisch gut machen. Wer sieht, dass andere Menschen und auch andere Tiere in der gleichen Mühle des Leidens stecken wie man selbst, der wird Mitleid empfinden. Jeder moralische Fortschritt besteht in der Ausweitung des Mitleids. Denn wer »nicht mehr den egoistischen Unterschied zwischen seiner Person und der fremden macht, sondern an den Leiden der anderen Individuen ebenso viel Anteil nimmt, wie an seinen eigenen, und dadurch nicht nur im höchsten Grade hilfreich ist, sondern sogar bereit, sein eigenes Individuum zu opfern, sobald mehrere fremde dadurch zu retten sind; dann folgt von selbst, dass ein solcher Mensch, der in allen Wesen sich, sein innerstes und wahres Selbst erkennt, auch die endlosen Leiden alles Lebenden als die seinen betrachten und so den Schmerz der ganzen Welt sich zueignen muss«.13
Ist das wirklich Arthur Schopenhauer, der das schreibt? Jener dreißigjährige Querulant, der sich mit seiner Familie, seinem Verleger und in Wirtshäusern bei jeder Gelegenheit heillos zerstreitet? Jener unnachgiebige Rechthaber, der jeden anderen Denker gnadenlos für minderwertiger abstempelt als sich selbst? Und selbst seine berühmte Tierliebe hält ihn nicht davon ab, weiterhin Fleisch zu essen. Die Begründung, dass ja nur das Leiden, nicht der Tod elend sei, ist hanebüchen. Von dieser Einsicht beseelt, dürfte man auch wahllos Menschen schmerzlos töten. Wenn der Elsässer Theologe und Philosoph Albert Schweitzer (1875 –1965) ein Jahrhundert später Schopenhauers Mitleidsethik zu einer »Ehrfurchtsethik« ausbaut – »Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will« –, wird er sie sorgfältig von der Person ihres Urhebers ablösen.
Nicht anders verhält es sich mit Schopenhauers Ideal von Entsagung und Askese. Im Laufe seines Lebens wird der Philosoph nur wenige Gegenstände besitzen und meist möbliert wohnen. Aber er bleibt ein Genießer guten Essens und der schönen Künste. Statt freigiebig zu sein, ist er sorgsamst auf sein Geld bedacht und zeigt sich meist geizig. Und statt gelassen der Welt und ihren Händeln zu entsagen, ist er ängstlich, zänkisch, unnachgiebig und für andere Menschen meist schwer zu ertragen. Ein Philosoph – so findet er für sich ein Schlupfloch – müsse kein Heiliger sein. Aber müsste er es, seiner Einsicht gemäß, nicht zumindest ein wenig versuchen?
Zu den Widersprüchen in seinem Leben gesellen sich die Widersprüche seiner Philosophie. Für Schopenhauer ist der Mensch unfrei. Unser Wille bestimmt uns durch und durch, sodass sich unsere zukünftigen Taten vorhersagen ließen wie eine Sonnen- oder Mondfinsternis. Könnte man die Zeit zurückdrehen, so würde jeder Mensch sich immer wieder genauso verhalten, wie er es getan hat. Denn ich kann nicht wollen, was ich will. Das Gleiche hatte schon Hume festgestellt, und auch viele Neurobiologen sehen das heute ähnlich. Doch wenn das so ist, woher kommt dann mein freier Wille, meinen Willen zu überwinden? Schopenhauers Einsicht in die zwingende Kausalität eines eigenmächtigen Willens und seine fernöstliche Lehre von der Überwindung des Willens passen äußerst schlecht zusammen. Ich kann meinen Willen nicht freiwillig verneinen, wenn niemand und nichts sich dem Willen entgegenstellen kann. Die Entscheidung, meinen Willen verneinen zu wollen, muss immer durch meinen Willen programmiert sein. Und wenn das so ist, dann erfolgt sie nicht freiwillig. Sie ist keine Verneinung meines Willens, sondern geschieht auf dessen Wunsch. Wer meint, seinen Willen zu verneinen, folgt ihm nur nach.
Die Freiheit, einen unfreien Willen zu überwinden, ist nicht der einzige Widerspruch in Schopenhauers Philosophie. Ein weiterer betrifft die Hoffnung. Als scharfer Kritiker des jüdischen und des christlichen Glaubens hält er den einzelnen Menschen, das Individuum, für sterblich. Unsterblich dagegen sei der Wille, der in uns wirkt. Denn im Grunde ist es nicht unser Wille, sondern der Wille – eine Kraft der Natur. In seiner späteren Schrift Ueber den Tod und sein Verhältniß zur Unzerstörbarkeit unsers Wesens an sich stellt er die Unsterblichkeitstheorie von Aristoteles auf den Kopf. Für den antiken Philosophen war die Seele sterblich, weil die Lebensenergie mit dem Tod erlischt. Unsterblich war nur der unpersönliche Intellekt, der in uns waltet und der unvergänglich weiterlebt. Wo Aristoteles vom Geist oder Intellekt redet, spricht Schopenhauer vom Willen. Für ihn ist der Wille das Unsterbliche in uns. Stirbt das Individuum, so kehrt er in ein anderes ein; für Schopenhauer eine tröstliche Vorstellung. Doch worin soll hier ein Trost liegen? Wenn der Wille nichts anderes als Leiden (und bei Befriedigung Langeweile) schafft, wie soll seine ewige Fortdauer dann tröstlich sein?
In diesem Licht wirkt Die Welt als Wille und Vorstellung, ja Schopenhauers gesamte Philosophie, wie eine Selbstüberredungsphilosophie. Gegen die eigenen Ängste und seine schier maßlose Egozentrik scheint sich ihr Urheber damit selbst therapieren zu wollen. Die Worte, die er wählt, und die Sätze, die er formuliert, gehören dabei zum Schönsten, was Philosophen bis dahin in deutscher Sprache geschrieben haben. Geschult an der englischen, französischen und spanischen Hochliteratur schreibt er elegant und verständlich, flammend und eindringlich. Mit diesem von ihm selbst als Meisterwerk betrachteten Buch bewaffnet, zieht er gegen Hegel in Berlin zu Felde, um den größten seiner Charakterwidersprüche auszuleben: seine maßlose Gier nach Anerkennung und Ruhm im alltäglichen Leben – ebenjenes Lebens, dessen Nichtigkeit er so eitel zu beweisen sucht …
Die Kunst zu leben
Die geplante Vorlesung, parallel zu Hegel, kann Schopenhauer zunächst nicht halten. Erst muss er habilitiert werden, mit Hegel, dem »Unsinnsschmierer«, als Kopf der Prüfungskommission! Im März 1820 kommt es zum ersten und einzigen Showdown, als Schopenhauer seine Thesen vom vierfachen Satz vom Grund vorträgt. Hegel mäkelt an dem Prüfling herum, weil er den Begriff des Motivs nicht versteht, den Schopenhauer Tieren als Beweggrund ihres Verhaltens unterstellt. Nur die Unterstützung des Zoologen Lichtenstein hilft Schopenhauer zu zeigen, dass nicht er, sondern Hegel auf diesem Gebiet unkundig ist.
Zu einem Durchbruch verhilft das nicht. Als Schopenhauer im Sommersemester 1820 endlich seine Vorlesung parallel zu Hegel hält, verirren sich gerade fünf Studenten zu ihm. Die Zahl ist so gering, dass von nun an über die nächsten zehn Jahre keine weitere angekündigte Vorlesung an der Berliner Universität mehr zustande kommt. Auch die Universitäten in Würzburg und Heidelberg verzichten auf seine angebotenen Dienste. Schopenhauer bleibt Privatgelehrter wider Willen. Seine Depressionen nehmen zu, die vielen Pläne für Übersetzungen englischer und italienischer Literatur bleiben meist unverwirklicht.
1832 zieht er nach Mannheim und ein Jahr später nach Frankfurt. In drei Hinsichten wird er seine Philosophie weiter ausbauen und vervollständigen. Schopenhauer sucht einen Anschluss an die Naturwissenschaften, insbesondere an die Biologie. Er beschäftigt sich mit Mystik, Spiritismus und anderen Grenzwissenschaften, um seine Zwei-Welten-Theorie abzusichern. Und er studiert alle erdenklichen Weltklugheitslehren von der Antike über die spanischen und französischen Moralisten des Barocks und der Aufklärung bis zur fernöstlichen Philosophie. Sie sollen helfen, die Frage zu beantworten, wie sich ein sinnloses Leben gleichwohl sinnvoll leben und ertragen lässt.
Das Ergebnis sind zahlreiche Manuskriptbücher und mehrere Essays. In