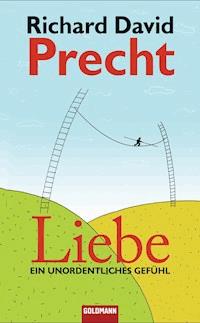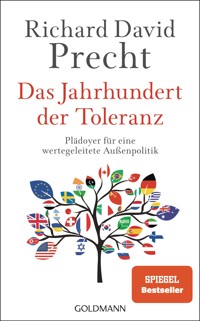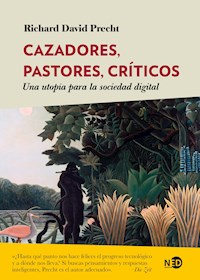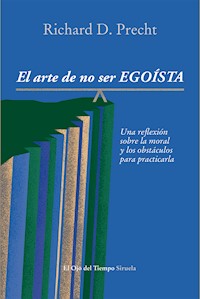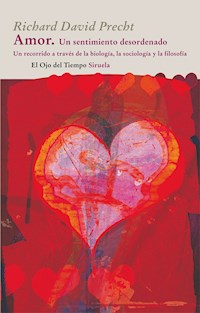19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Geschichte der Philosophie
- Sprache: Deutsch
Im vierten Band seiner Philosophiegeschichte widmet sich Richard David Precht den großen Ideen der Moderne.
Die Moderne provoziert die Philosophie! Der Raum als feste Größe der Physik verliert an Bedeutung, die Frage, was Materie ist, erscheint auf einmal erstaunlich unklar. Ebenso unklar ist die Frage, was Leben ist, und auch das Bewusstsein wird zunehmend zum Rätsel. Mit Sigmund Freuds Psychoanalyse übernimmt das Unbewusste die Herrschaft über den Menschen und fordert die altehrwürdige Vernunftphilosophie heraus.
Und auch der Blick auf das große Ganze scheint versperrt zu sein: Die Soziologie, ein neuer Konkurrent, beansprucht das Terrain für sich. Relevant bleibt die Philosophie nur dann, wenn sie einen Mehrwert schafft, der über die Perspektive der Naturwissenschaften, der Psychologen und Soziologen hinausgeht. Sie muss näher an die Dinge heran, tiefer ins Leben blicken und sehr viel genauer beschreiben als sie es traditionell getan hat. Muss die Philosophie das Fernrohr nach innen richten, tief in sich hineinsehen, dorthin, wo die experimentelle Psychologie nie hingelangt? Auf diese Weise entstehen Edmund Husserls Phänomenologie und die neuen Ontologien Martin Heideggers, Alfred North Whiteheads und Nicolai Hartmanns. Soll sie bei der Logik der Sprache ansetzen? So tun es die analytischen Philosophen im Anschluss an Ludwig Wittgenstein und Bertrand Russell. Oder ist Philosophie ein Denken in Bildern, Metaphern und Zwischenräumen wie bei Ernst Bloch und Walter Benjamin?
Parallel zur Selbstverständigung der Philosophen radikalisieren sich die Zeitläufte. Der Erste Weltkrieg erschüttert die abendländische Zivilisation und fordert zum radikalen Neudenken auf. Ein Gedankenfestival der Ideen mit einem jähen Ende: dem Zweiten Weltkrieg.
Kenntnisreich und elegant zeichnet Richard David Precht die Wege des Denkens in der Moderne nach – mit ihren weitreichenden Folgen bis hinein in unsere Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Die Moderne provoziert die Philosophie! Der Raum als feste Größe der Physik verliert an Bedeutung, die Frage, was Materie ist, erscheint auf einmal erstaunlich unklar. Ebenso unklar ist die Frage, was Leben ist, und auch das Bewusstsein wird zunehmend zum Rätsel. Mit Sigmund Freuds Psychoanalyse übernimmt das Unbewusste die Herrschaft über den Menschen und fordert die altehrwürdige Vernunftphilosophie heraus.
Richard David Precht
MACHE DIE WELT
Eine Geschichte der Philosophie
Band 4
Die Philosophie der Moderne
Originalausgabe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Diese Formulierungen umfassen gleichermaßen weibliche und männliche Personen; alle sind damit selbstverständlich gleichberechtigt angesprochen und mitgemeint.
Copyright © 2023
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Regina Carstensen
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Caziel, Women with ball / Bridgeman Images
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
JT · Herstellung: cf
ISBN 978-3-641-25437-7V002
www.goldmann-verlag.de
Inhalt
Einleitung
Die Demoiselles d’Avignon
Philosophie Der Moderne
Zeit und Lebensschwung
Die große Ent-Täuschung
Zu den Sachen selbst!
Das symbolisierende Tier
Das Rätsel der Existenz
Der Boden der Tatsachen
Menschen und Mächte
Kunst und Erlösung
Der Kampf mit der Sprache
Die Fliege im Glas
Anhang
Anmerkungen
Ausgewählte Literatur
Bildnachweis
In Erinnerung an Markus Weber, mit dem ich die Welt erschloss, von der dieses Buch handelt; an den unendlichen Strom gemeinsam gedachter und gefühlter Gedanken, für den Tage wie Nächte nie lang genug waren.
Die Wahrheit ist kein Kristall,
den man in die Tasche stecken kann,
sondern eine unendliche Flüssigkeit,
in die man hineinfällt.
Robert Musil
Einleitung
© Saul Steinberg, Untitled, 1952, detail Private Collection. The Saul Steinberg Foundation, New York. Originally published in The New Yorker, November 1, 1952.
Die Exposition universelle des Jahres 1900 ist ein Weltereignis, eines der ersten überhaupt. 76 000 Aussteller und fast fünfzig Millionen Besucher aus aller Herren Länder kommen zur Weltausstellung nach Paris, und das Ausstellungsgelände hat sich gegenüber der ersten Weltausstellung von 1855 in der Hauptstadt mehr als verzehnfacht. Wunderschöne Bauten der Belle Époque sind entstanden, das Petit Palais und das Grand Palais. Ein rollender Fußweg, elektrisch angetrieben und dreieinhalb Kilometer lang, bringt die Besucher einmal ums Gelände. Die Welt schaut zurück in der »Bilanz eines Jahrhunderts« – so das Motto –, aber sie tut es mit den Mitteln der heraufdämmernden Moderne. Gleich drei neue Großbahnhöfe werden eingeweiht. Die Elektrifizierung der westlichen Zivilisation hat begonnen, sieben Betreibergesellschaften schicken nun elektrische Straßenbahnen durch die Straßen und über die großen Plätze. Das Tempo steigt, Statisches wird dynamisch, und das Spektakel nimmt seinen Lauf: Ein Riesenrad mit hundert Metern Durchmesser lockt zum Vergnügen, auch die zweiten Olympischen Sommerspiele finden in Paris statt. Und die Gebrüder Lumière begeistern die Welt mit ihrem ersten 75-Millimeter-Langfilm.
Im Schatten der Sensationen huschen Philosophen durchs Bild. Sie treffen sich zum ersten internationalen Kongress der Philosophie. Wie lässt sich die neue Zeit in angemessene Gedanken fassen? Die meisten sind Franzosen, darunter Henri Bergson und Maurice Blondel, und viele sind zugleich Mathematiker wie Louis Couturat, Henri Poincaré, Giuseppe Peano und Bertrand Russell. Diese Phalanx ist kein Zufall, die Mathematik und die Naturwissenschaften durchleben revolutionäre Zeiten. Im Jahr 1895 hat Wilhelm Conrad Röntgen die Röntgenstrahlen beschrieben, das Ehepaar Marie und Pierre Curie entdeckt 1898 das Radium, zwei Jahre später, pünktlich zur Weltausstellung, formuliert Max Planck die Quantentheorie, und weitere fünf Jahre später wird Albert Einstein die Spezielle Relativitätstheorie aufstellen. Das rutherfordsche Atommodell (1909 bis 1911) und Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie (1915) werden folgen.
All das hat philosophische Konsequenzen. Der Raum als feste Größe verliert an Bedeutung, die Frage, was Materie ist, erscheint auf einmal erstaunlich unklar. Ebenso undeutlich ist, was eigentlich Leben ist. In der Biologie bekämpfen sich die »Vitalisten« und die »Mechanisten«. Die einen nehmen eine »Lebenskraft« an, die anderen glauben dagegen, dass das Leben physikalisch-chemisch erklärbar ist, ohne dass es dafür einer speziellen Zutat bedarf. Und was für das Leben gilt, gilt auch für das Bewusstsein. Was soll das sein?
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die neu entstandene Psychologie in das heilige Zimmer der Philosophen eingedrungen und hatte den Geist versachlicht – als Gegenstand von Experimenten. Mit Sigmund Freuds Psychoanalyse wird es nun noch drastischer. Das Bewusstsein wird entmachtet; das Unbewusste übernimmt die Herrschaft über den Menschen und fordert die altehrwürdige Vernunftphilosophie brutal heraus. Psychoanalyse wird zur Modedisziplin der Zeit, und aus Erkenntnistheorie wird Selbsterkenntnistheorie. Bleibt, wenn Psychologie und Psychoanalyse das einzelne Individuum, die konkrete Person, gründlicher ausleuchten als die Philosophen, nur noch der Blick auf das große Ganze? Aber auch hier ist seit Ende des 19. Jahrhunderts ein mächtiger Konkurrent entstanden. Mit Émile Durkheim, Ferdinand Tönnies, Georg Simmel und Max Weber begründet sich die Soziologie. Sie sprengt sich aus der Philosophie wie aus einem zu engen Kokon. Und sie findet ganz neue Worte und Modelle, um das Ornament der Gesellschaft zu beschreiben, ihr Muster, ihre sozialen Techniken, ihre Statik und ihre Dynamik.
An alldem kann die Philosophie nicht mehr vorbeisehen. Relevant bleibt sie nur dann, wenn sie einen Mehrwert schafft, der über die Perspektive der Naturwissenschaften, der Psychologen und Soziologen hinausgeht. Sie muss näher an die Dinge heran und sie sehr viel genauer beschreiben, als sie es traditionell getan hat. Die Philosophie muss das Fernrohr nach innen richten, tief in sich hineinsehen, dorthin, wo die experimentelle Psychologie nie hingelangt. Und sie wird es versuchen: Der Aufstand der philosophischen Selbstbeobachtung gegen die psychologische Fremdbeobachtung wird zum Jahrhundertthema.
Auf diese Weise entsteht mit Franz Brentano, Theodor Lipps und mehr noch durch Edmund Husserl die Phänomenologie. Parallel dazu deutet auch die schärfste Konkurrenz, die Lebensphilosophie, das wirkliche Leben aus. Henri Bergson, Wilhelm Dilthey, Simmel, José Ortega y Gasset, Benedetto Croce und Robin George Collingwood begnügen sich nicht mehr mit Psyche und Bewusstsein, sondern blicken beim menschlichen Leben stets auf das schicksalhafte Ganze. Der Mensch ist ein Natur-, aber mehr noch ein Geschichts- und Kulturwesen, das sich sein Leben selbst ausdeutet. Leben bedeutet zu interpretieren, wer man ist, was man ist und wer man sein will. Die Vernunft mag dabei helfen, die Naturwissenschaften mögen ihr Wissen beisteuern, aber am Ende kann Leben aus nichts anderem heraus begriffen werden als – aus dem gelebten Leben selbst!
Der Stolz der Philosophen ist also noch da. Am Anfang des Jahrhunderts stehen Denker, die den Anspruch erheben, die neuen empirischen Fachwissenschaften besser zu verstehen als diese sich selbst. Bergson lässt kaum einen Zweifel daran aufkommen, dass die Philosophie die Wissenschaften, die neu aufkommende Hirnforschung und die boomende Evolutionsbiologie, metaphysisch »tiefer« legen kann. Wenn es ums Tieferlegen ging, so pflügt sich Sigmund Freud mit dem gleichen Anspruch durch die Ethnologie, die Anthropologie, die Religions- und die Kultursoziologie. Und Edmund Husserls Rede »Die Krisis der europäischen Wissenschaften« reklamiert noch 1936, die Philosophie stehe über allen anderen Wissenschaften und fundiere diese überhaupt erst.
Der hohe Anspruch ist umso bemerkenswerter, als er schon lange nicht mehr selbstverständlich ist. Doch das philosophische Selbstbewusstsein zu Anfang des 20. Jahrhunderts erstarkt. Hatten es die idealistischen Philosophen in der Nachfolge Hegels im 19. Jahrhundert immer schwerer gehabt, sich zu rechtfertigen – der Siegeszug der Naturwissenschaften machte auch die Welt des Geistes zu einem Terrain des exakten Messens –, findet das neue Jahrhundert in seiner ersten Hälfte zur Metaphysik zurück. Was auch immer exakt gemessen wird, es beschreibt nur Dinge. Aber taugt es wirklich zur Erklärung des Unbedingten? Und woher nehmen die Naturwissenschaften ihre Begriffe? Schwankt nicht auch unter ihnen der Boden? Wenn seit Ende des 19. Jahrhunderts die Physik eine »Grundlagenkrise« beklagt und niemand mehr definieren kann, was Raum und Materie sind, sollen Philosophen sich dann wirklich auf sie stützen?
Die Krise der Physik lässt die Philosophie Abschied vom Raum nehmen. Er ist keine Gegebenheit mehr. Die Zeit ist jetzt der eigentliche und einzige Urgrund des Daseins. Und sie ist der Physik nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar über eine Bewusstseinsleistung – das Messen – zugänglich. Aber diese gemessene Zeit ist eben nur die gemessene Zeit und nicht die Zeit. Vor aller Messung liegt das Zeiterleben. Es ist subjektiv, aber gleichwohl intersubjektiv gültig. Denn am Erleben von Zeit kommt kein gesundes menschliches Bewusstsein vorbei.
Ist das Erleben von Zeit die eigentlichste aller Erfahrungen? Die Zeit als eine Art »schwebende Entität« scheint das Subjektive objektiver zu machen als alle Objektivitätsansprüche der Naturwissenschaften. So jedenfalls sehen es Bergson und Husserl; Martin Heidegger und Alfred North Whitehead werden ihnen folgen. Das neue Zauberwort der modernen Philosophie heißt Prozess. Sowohl der kritische Rationalismus als auch der skeptische Realismus fußen auf diesem Konzept: Sie sind Philosophien in einer Zeit, die das Aufkommen des Films feiert gegenüber der Statik der Fotografie. Philosophische Konzeptionen müssen von nun an zeigen, dass sie dynamisch sind, ob bei Bergson, bei Georges Santayana, Whitehead oder Nicolai Hartmann.
Viele suchen nun neue Synthesen zwischen Idealismus und Materialismus – und zwar in Form dynamischer Ontologien. Wenn Leben ein »Prozess« ist, dann ist eine Substanzontologie ebenso falsch wie ein transzendentaler Idealismus. Auf Unveränderliches lässt sich nichts mehr gründen. Was William James Ende des 19. Jahrhunderts vorgemacht hat, findet nun Nachfolger: eine Philosophie, die sich bei der Biologie absichert und aus ihr Konsequenzen zieht; so bei Bergson und bei Whitehead. Manche Philosophen gehen sogar direkt auf Tuchfühlung mit einflussreichen philosophierenden Biologen: Bergson mit Hans Driesch und Ernst Cassirer mit Jakob Johann von Uexküll. Und einer, Santayana, sieht den einzig verlässlichen Quell der Erkenntnis im animal faith, in unserem tierischen Vertrauen auf die Realität der Realität.
Wenn die Vernunft allein keinen verlässlichen Zugang zur Wirklichkeit liefert, wird Wahrheit subjektiver, als sie es in der Geschichte der Philosophie je war. Das hat große Konsequenzen. Der Neukantianismus – die dominierende Philosophie in Deutschland – gerät stark in die Defensive. Seine letzten wichtigen Vertreter, Cassirer und Richard Hönigswald, können sich noch so viel Mühe geben, die neukantianische Denksystematik zu einer Kulturtheorie zu erweitern (Cassirer) oder sie systemisch zu perfektionieren (Hönigswald) – die Zeichen der Zeit sprechen gegen jede auf strenge Rationalität gegründete Systematik. Der Hunger nach einer neuen Metaphysik ist zu groß, und die wissenschaftliche Rationalität erscheint vielen nur noch als eine Zugangsweise zur Realität unter anderen. In diesem Sinne hat Hermann Lotze in der Mitte des 19. Jahrhunderts verschiedene Einstellungen zur Welt unterschieden mit je eigenen Spielregeln. Statt mit einem hierarchisch geordneten System habe es die Philosophie mit Perspektiven zu tun. Aus der Wahrheit werden Wahrheiten, in der Kunst andere als in der Physik. Und die unmittelbarste aller Wahrheiten teilt sich nur intuitiv mit als die Evidenz des eigenen Selbst im erlebten Augenblick. Das sich selbst erkennende Subjekt der cartesianischen Tradition und der Aufklärung dankt damit ab zugunsten unmittelbarer Selbstvergegenwärtigung. Der heilige Gral der Philosophie in den ersten drei Jahrzehnten des neuen Jahrhunderts heißt Selbstpräsenz. Ihn zu suchen machen sich Denker auf unterschiedlichsten Wegen auf: Brentano, Max Scheler, Husserl, Heidegger, Karl Jaspers und Ernst Bloch.
Doch wo findet sich der unmittelbarste aller Zugänge zum Selbst und zur Welt? Bergson macht den Auftakt mit seiner Philosophie der Intuition. Heidegger behauptet für seine Philosophie eine allem tiefer liegende Ebene, jene der Eigentlichkeit. Croce, Collingwood, Miguel de Unamuno, Georg Lukács, Bloch, Siegfried Kracauer und Walter Benjamin sehen alles Wesentliche des menschlichen Lebens jenseits von Logik und Rationalität. Was im Leben zählt, lässt sich nicht erkennen, sondern nur aufspüren, ausgraben und ausdeuten, als Vorannahme, tragischer Schmerz, als »Noch-nicht Sein«, als Zwischenraum oder als »Denkbild«, besonders eindrücklich in der Erfahrung der Kunst.
Dies ist die eine Seite der Medaille. Die andere zeigt sich in Österreich und England. Während die Metaphysik auf dem Kontinent ihren letzten großen Höhenflug erlebt, legen Bertrand Russell, George Edward Moore und Ludwig Wittgenstein das Fundament einer analytischen Philosophie, die allein das als Philosophie anerkennt, was sich logisch ausweisen lässt. Der Kontrast zu den Metaphysikern könnte größer nicht sein. Und die jeweilige Philosophie wird von jeder der beiden Fraktionen als das genaue Gegenteil dessen definiert, was das andere Lager dafür hält. So sieht Robert Musil, der geniale philosophisch-literarische Vivisekteur seiner Epoche, die beginnende Moderne durch zwei einander völlig widerstrebende »Geistesverfassungen« charakterisiert: dem Logisch-Rationalen und dem Ästhetisch-Irrationalen; Geistesverfassungen, »die einander nicht nur bekämpfen, sondern die gewöhnlich, was schlimmer ist, nebeneinander bestehen, ohne ein Wort zu wechseln … Die eine begnügt sich damit, genau zu sein, und hält sich an die Tatsachen; die andere begnügt sich nicht damit, sondern schaut immer auf das Ganze und leitet ihre Erkenntnisse von sogenannten ewigen und großen Wahrheiten her. Die eine gewinnt dabei an Erfolg, und die andere an Umfang und Würde. Es ist klar, daß ein Pessimist auch sagen könnte, die Ergebnisse der einen seien nichts wert und die der anderen nicht wahr.«1
Schon Sprachstil und Denkstil halten beide Richtungen weit auseinander. Während die am Feuilleton geschulten Denker einer neuen Metaphysik oft Essays schreiben, angesiedelt im Niemandsland zwischen Philosophie und Literatur, kondensieren die Logiker ihre Einsichten in nüchtern deduzierenden papers, eine Art Mathematik mit Worten. Und wo den einen Philosophie vor allem eine Frage der Wahrnehmungssensibilität ist, ist sie den anderen die größtmögliche Abstraktion und Reduktion. Wahrheit liegt für sie nicht in den Zwischenräumen des Daseins, wie bei Bloch, Kracauer und Benjamin, sondern allein in empirischer Tatsächlichkeit und unabweisbarer Logik. Was bei Husserl und Scheler lediglich Baustein und Anspruch ist, rückt in der analytischen Philosophie ins alleinige Zentrum allen Philosophierens. Jede Verbindung von Logik und Psychologik, die der Phänomenologie und dem späten Neukantianismus so wichtig ist, wird von den neuen Logikern gekappt. Der große Grabenbruch zwischen den »Verstehern« des menschlichen Lebens und den »Erklärern« von Sprache und Logik ist tief und hält bis in die Gegenwart des 21. Jahrhunderts an. In der Terminologie der analytischen Philosophen als Trennung von continental philosophy und philosophy, in der Sichtweise der anderen als Trennung von Philosophie und Sprachlogik. Der Unterschied ist unübersehbar und ein Brückenschlag zwischen beiden kaum möglich. Die analytische Philosophie fragt: Was bedeutet das alles? Die Lebens- und Bewusstseinsphilosophie dagegen fragt mehr und mehr: »Was bedeutet das alles für mich?«
Der Preis, den die analytische Philosophie für ihre strenge Wissenschaftlichkeit bezahlt, ist hoch. Leben erscheint in ihr radikal reduziert und gleichsam geschichtslos. Völlig aus dem Blick gerät ihr zudem alles Pathologische sowie alles Politische – zwei ganz große Themen in der Zeit ihres Entstehens. Die furchtbare Katastrophe des Ersten Weltkriegs hat die Normalität aufgesprengt. Denker wie Lukács, Bloch oder Benjamin erwarten nun eine ganz neue, bisher unvorstellbare Gesellschaft. Was tatsächlich siegt, sind der Bolschewismus in Russland und der Faschismus in Italien. In Spanien, Portugal und Polen ergreifen reaktionäre Generäle die Macht, und auch Litauen wird zur Diktatur. Das Radikale, Extreme und Gewalttätige verlangt danach, philosophisch begriffen zu werden. Antonio Gramsci skizziert im Gefängnis völlig neue Perspektiven auf »Macht« und »Hegemonie«. Neu ist auch die Bedeutung der Massen in den immer autoritäreren Massenkonsumgesellschaften der Zwanziger- und Dreißigerjahre. Die Philosophie der Massen entsteht und beleuchtet ein eindrückliches Jahrhundertphänomen, ob bei Gustave Le Bon, Freud, Ortega y Gasset, Gramsci, Kracauer oder Benjamin.
Die radikalen Wirren einer irrationalen Politik steigern das Interesse am Pathologischen. Philosophie, will sie das Leben tatsächlich verstehen, darf sich nicht mehr allein am vermeintlich Normalen orientieren. Wie die avantgardistische Kunst, die Dadaisten, Kubisten und Surrealisten, entdecken auch die Philosophen ihr Interesse an der Fragilität, der Unselbstverständlichkeit und den Grenzen von »Sinn«. Ist nicht auch der Wahn menschliches Dasein? Und die Subjekt-Objekt-Bezüge der Normalen sind eben dies – jene von Normalen unter vielen denkbaren anderen. Benjamin experimentiert mit Drogen, um die Fülle des »Daseins« zu erkunden, sein Freund Georges Bataille philosophiert literarisch über Tod und Impotenz, über Langeweile und Exkremente. Jaspers analysiert die Schizophrenie und die Kreativität bei August Strindberg und Vincent van Gogh.
Die Welt ist aus den Fugen und muss, je nach Mentalität und Perspektive, tiefer gelegt oder höher geträumt werden. In diesem Sinne lässt sich bei den in den 1880er- und 1890er-Jahren Geborenen von der Generation Y des 20. Jahrhunderts sprechen,2 bei den Philosophen nicht anders als bei den zeitgenössischen Literaten und Künstlern. Ihre Urerfahrung ist die Ungleichzeitigkeit von alter und neuer Welt, 19. Jahrhundert und Moderne bei völliger Unvereinbarkeit des Fühlens und Denkens. Vor diesem Horizont können die stets wiederkehrenden Themen nicht verwundern: Zerrissenheit und Entfremdung, Tod und Apokalypse, Sehnsucht, Hoffnung und Utopie. Die Gemütskonservativen unter den Philosophen, Jaspers und Heidegger, horchen ins Innere. Ihnen stellt sich die Frage nach dem Existieren. Sie fordern mehr Sinn für die Wirklichkeit des Lebens. Den Utopisch-Sehnsüchtigen, Musil, Lukács, Bloch, Kracauer, Benjamin, Martin Buber und Gramsci, stellt sich die pathetisch-essentielle Frage nach dem besseren Existieren. Sie fordern mehr Sinn für die Möglichkeit des (Zusammen-)Lebens.
Gekittet werden kann hier nichts. Die Zeit der großen philosophischen Systeme ist vorbei – auch gerade und obwohl sie niemals so zahlreich projektiert werden wie in den Zwanzigerjahren. Doch vieles bleibt Fragment. Lukács’ monumentale Ästhetik wird von den Zeitläuften überrollt; Heideggers Sein und Zeit erweist sich als nicht vollendbar; Benjamins Passagen-Werk wechselt mit der Zeit seine philosophische Fundierung und mäandert ins Uferlose, und der späte Wittgenstein von den Philosophischen Bemerkungen bis zu den Philosophische Untersuchungen beschreibt Zettel und füllt Hefte mit Notizen, aber aus alldem entsteht im traditionellen Sinne kein Werk.
Je steiler die vielen Neuanfänge, Neubegründungen und Tieferlegungen sind, umso schroffer klaffen sie auseinander. Zwischen Denkern wie Wittgenstein und Benjamin, Gramsci und Hartmann, Rudolf Carnap und Heidegger ist keine Verständigung möglich, nur eine Entscheidung für die eine oder andere Perspektive. Der Streit um die Wissenschaftlichkeit der Philosophie, die nach Hegels Tod begann, führt zu keiner Versöhnung. Für die analytische Philosophie ist nur das Wissenschaft, was exakt und logisch ist. Nicht Bewusstseinsvorgänge ließen sich ausleuchten, sondern nur sprachliche Manifestationen. Ihre Kontrahenten jeder Couleur schütteln darüber bis heute den Kopf: zu eng, zu begrenzt, zu banal und letztlich zu unphilosophisch. Die logische Seite der Welt sei nicht die Welt, es ist die logische Seite der Welt. Und doch kommen alle Philosophien der Moderne in einem entscheidenden Punkt zusammen: Die Welt, die wir erleben, ist etwas von uns Gemachtes. Wir mögen uns in der Welt vorfinden, wie bei Heidegger, oder uns ihr entgegensetzen, wie bei den Neukantianern, wir mögen mit Fiktionen hantieren, wie bei Hans Vaihinger, mit Urteilen, wie bei Hönigswald, oder mit Sprachspielen, wie bei Wittgenstein, wir mögen die Welt fein konstruieren, wie bei Husserl, oder von den Dingen in den Bann geschlagen werden, wie bei Benjamin – Streit gibt es nur um das Baumaterial für unser Bewusstseinszimmer. Dass es aber von uns selbst erbaut und möbliert wird – an dieser Erkenntnis führt in der Moderne kein Weg vorbei.
Die Demoiselles d’Avignon
Vom irrealen Zauber der Erfahrung
© Bridgeman Images: Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, 1907 (oil on canvas) / Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn
Das Bild ist groß, sehr groß. Fast zweieinhalb mal zweieinhalb Meter. Fünf nackte oder leicht bekleidete Frauen sind darauf zu sehen, überlebensgroß, die Gesichter reduziert und zu Fratzen überzeichnet auf der linken, zu exotischen Masken verfremdet auf der rechten Seite. Vier der Damen stehen, zwei von ihnen präsentieren sich, die fünfte sitzt, den Kopf verdreht, in unnatürlicher Pose. Jede scheint aus einem anderen Blickwinkel gemalt zu sein. Mal seitlich, mal schräg, mal frontal. Im Vordergrund ist eine Obstschale mit Melone, Apfel, Birne und Weintrauben. Im Hintergrund scheinen Vorhänge das Bild und die Damen zu umhüllen, rotbraun der rechte, beige und blau der linke. Was sonst noch zu sehen ist, ist ein Blau in verschiedenen Tönungen. Das ganze Gemälde wirkt archaisch, es ist blockhaft, kalt, hart und ohne Schatten. Die Frauenfiguren stehen starr, ohne Anmut und Grazie. Die Gesichter sind verzerrt, mal Flächen, mal kubisch, die übergroßen Augen schräg gestellt, von gar keinem oder von tristem, wenn nicht debilem Ausdruck. Keine Beziehung scheint zwischen den Frauen zu bestehen, keine Geste scheint von Bedeutung, und keine Geschichte wird erzählt. Was für ein Bild ist dies?
Den Anstoß dazu gibt ein Besuch im ethnografischen Museum des Palais du Trocadéro im Jahr 1906. Eigentlich findet der junge Spanier die Masken und Fetische afrikanischer Kunst »abscheulich«. Aber irgendetwas hält ihn gleichwohl magisch fest. Es ist das Aggressive, Wehrhafte der Masken: »Die Negerstücke waren … gegen alles, gegen unbekannte bedrohliche Geister.« Sie »waren Waffen, sie sollten … schützen, sollten zur Unabhängigkeit verhelfen«. Und genau dies trifft den Nerv des Rebellen. »Auch ich«, wird er später sagen, »war gegen alles.« Auch er will seine Unabhängigkeit erlangen. »Die Demoiselles d’Avignon müssen mir an eben diesem Tag eingefallen sein, aber nicht wegen der Formen (der dort ausgestellten Masken), vielmehr weil dies mein erstes exorzistisches Gemälde war.«3
Der Name des jungen spanischen Malers ist Pablo Picasso (1881 – 1973). Und die Geister, vor denen er sich 1906 schützen will, sind die Dämonen der eigenen Unsicherheit. Im Jahr 1900 war er das erste Mal nach Paris gekommen und hatte dort die Weltausstellung besucht. Seitdem ist er unstet hin und her gezogen, von Paris nach Madrid, von dort nach Barcelona und wieder nach Paris, nach Barcelona zurück und dann ein drittes Mal nach Paris. Er malt viel, birst fast über vor Schaffenskraft, aber er ist selten zufrieden. Das Niveau, das seine neuen Freunde, der französische Dichter Guillaume Apollinaire (1880 – 1918), die US-amerikanische Schriftstellerin und Kunstsammlerin Gertrude Stein (1874 – 1946) und der französische Maler Henri Matisse (1869 – 1954) von sich selbst und von anderen erwarten, ist äußerst hoch. Besonders der Letzte ist für Picasso eine große Herausforderung. Als der von allen gefeierte Paul Cézanne im Jahr 1906 in Aix-en-Provence stirbt, ist Matisse der berühmteste lebende Künstler in Frankreich. Und die Bewegung der Fauves, der »Raubkatzen« oder »Wilden«, die das mediterrane Lebensgefühl mit Pinsel und Farben feiern, steht im Zenit.
Lebensfreude und Harmonie hingegen sind das Letzte, wonach dem höchst unruhigen Picasso der Sinn steht. Sein Temperament ist unbändig, aber sein Geist ist unglücklich. Fast verrückt macht ihn die Frage, wie und wo er in der Kunst seinen Platz finden soll. Der Besuch im ethnologischen Museum mit seinen Masken der »Unabhängigkeit« weist ihm eine neue Richtung. Sich mit der Kunst der »Primitiven« und »Wilden« zu beschäftigen ist allerdings nicht sehr originell, sondern en vogue. Unmittelbar vor Picassos Augen revolutioniert sich gerade die Ethnologie. Hatte man im Gefolge von Charles Darwins (1809 – 1882) Evolutionstheorie die »Primitiven« im späten 19. Jahrhundert als Vorstufen modernen Menschseins studiert, so entdecken Ethnologen, Philosophen und Künstler daran nun eine ganz andere Seite. Die »Wilden«, die von europäischen, auch französischen Kolonialherren brutal unterdrückt und ausgebeutet werden, sind nicht nur ursprünglicher als der Zivilisationsmensch. Könnten sie nicht auch Vorbilder sein? Leiden die Großstadtmenschen nicht an kraftloser Degeneration, haben sie nicht ihren natürlichen Sinn verloren? Werden sie, anders als die »Naturvölker«, nicht Opfer ihrer Orientierungslosigkeit und Entfremdung?
Naturbelassenheit, Ursprünglichkeit und ein magisches Verhältnis zur Welt sollen die Gegenwart in den Großstädten neu beleben. Die Südseebilder Paul Gauguins (1848 – 1903) erfreuen sich größter Beliebtheit als Kritik an der westlichen Gesellschaft. Als belebende Zufuhr von außen sind sie Sauerstoff gegen die Zivilisationsmüdigkeit. Die jungen Ethnologen, der Deutsch-Franzose Arnold van Gennep (1873 – 1957) und der Franzose Marcel Mauss (1872 – 1950), erkennen das Andere der indigenen Kulturen nicht als primitiv, sondern als vollwertig an. Der Österreicher Sigmund Freud (1856 – 1939) wird sich mit Totem und Tabu bald in die Völkerpsychologie stürzen, der französische Soziologe Émile Durkheim (1858 – 1917) umfassend indigene Religionen studieren. Und nicht zuletzt das Interesse seiner Clique an afrikanischer Stammeskunst, allen voran jenes von Matisse, Apollinaire und Gertrude Stein, hat Picasso ins ethnologische Museum geführt.
Jetzt, im Herbst 1906, sollen die Masken und Fetische Picassos Psyche unabhängig machen. Artistisch kombiniert er sie mit Formen aus seiner Heimat, mit altspanischen Skulpturen und den viel zu großen Augen der Figuren katalanischer Wandmalerei. Das Thema, eine Bordellszene, ist ebenfalls ein Modethema der Zeit. Aber Picasso möchte nicht Lust und Verruchtheit, falschen Glanz, Tristesse und Elend zeigen wie so viele andere Maler. Und die prominenten Vorbilder, Das Urteil des Paris von Peter Paul Rubens und Das fünfte Siegel der Apokalypse von El Greco, auf denen sich ebenfalls nackte Frauen zur Schau stellen, dienen nur zur Anregung. Picasso möchte etwas gänzlich Neues erschaffen, außerhalb aller bekannten Konventionen. Und sein Bild soll jeder Idee davon, »schön« zu sein, widersprechen, die sich noch immer mit der Gegenwartskunst verbindet. In einer Zeit, in der der Maler mit seiner Lebensgefährtin Fernande Olivier feurige Kleinkriege führt, kann die künstlerische Lösung nur etwas Radikales, Wütendes, Unerbittliches sein. Die Inspiration aus dem ethnografischen Museum bringt Picasso nicht dazu, in den Masken und Fetischen irgendeine positive Gegenwelt zu sehen. Die Gesichter der Demoiselles werden von ihm entstellt und deformiert, teilweise überschraffiert. Sie wirken karikaturhaft wie bei den just in dieser Zeit aufkommenden US-amerikanischen Comicstrips, die er liebt. Aus Mündern werden Striche und Kreise, aus Nasen Dreiecke. Die Darstellung pfeift ebenso auf die Wiedergabe der Realität wie auf jeden Symbolismus. Eine Zeichensprache im Bild gibt es nicht, nichts verweist auf etwas oder steht für irgendetwas anderes.
Die lange Zeit, in der Picasso an den »Demoiselles« arbeitet, sucht ihresgleichen. Ein Dreivierteljahr, vom Herbst 1906 bis zum Sommer 1907, werkelt er daran herum. Der Ehrgeiz des Malers ist unübersehbar. Über 800 Skizzen und Vorstudien sind heute erhalten, darunter großformatige Blätter mit deutlich realistischerer Darstellung. Doch nach und nach verschwindet das Bordellhafte aus dem Bild, darunter die zunächst skizzierten Männerfiguren, ein Student und ein Matrose. Das Thema wird undeutlicher, und das ursprünglich beabsichtigte Allegorische schwindet dahin, während sich die Formensprache immer weiter radikalisiert: ein brachiales Bild des Umbruchs für eine Welt im Umbruch. Die in der Einleitung zu diesem Buch genannten Innovationen sprengen auch in Picassos Pariser Welt die Formeln der Erfahrung. Die Stadt elektrifiziert und illuminiert sich, Straßenbahnen ersetzen Pferdefuhrwerke, der Film kommt auf, und Albert Einstein begründet, ein Jahr bevor Picasso mit den »Demoiselles« beginnt, die Spezielle Relativitätstheorie. Raum und Zeit, wie man sie bisher kannte, Entfernung und Tempo verlieren ihren altbekannten Rhythmus. Auch die Kunst ist reif für einen Umbruch, der sich bei Cézanne, Matisse und den Fauves längst angekündigt hat. Mehr Surrealismus wagen! Mehr Traum, mehr Wahn, mehr Absurdität, die Sigmund Freud zeitgleich zu bestimmenden Elementen der menschlichen Psyche erklärt. Kunst darf nicht mehr verdrängen, Harmonie erzeugen, wie bei den Fauves, sie muss das Verdrängte selbst zum Gegenstand machen.
Im Juli 1907 ist es so weit. Der Ausfall gegen die kulturelle Norm der Malerei ist vollendet. Der erste Kunsthändler, der das Bild in Picassos Atelier in Montmartre zu sehen bekommt, ist der Deutsche Wilhelm Uhde. »Assyrisch«, mutet ihn das Gemälde an, mit dem er nichts anzufangen weiß. Uhde informiert einen besseren Kenner, den jungen deutsch-französischen Galeristen Daniel-Henry Kahnweiler, der gerade eine kleine Galerie in Paris eröffnet hat und Nachwuchskünstler wie André Derain (1880 – 1954) und Georges Braque (1882 – 1963) unter Vertrag hat. Kahnweiler weiß das Bild nicht einzuordnen. Die Figuren scheinen ihm »wie mit Axtschlägen zurechtgehauen« zu sein. Er sieht ein »verzweifeltes, himmelsstürmendes Ringen mit allen Problemen zugleich« und damit vor allem eine Überforderung.4 Auch die Freunde und Kollegen, so werden sie es Jahre später selbst erzählen und kolportieren, reagieren nicht besser.5 Derain hätte, so erzählt Kahnweiler, über die »Demoiselles« gelästert, »Picasso werde sich bestimmt eines Tages hinter seinem großen Bild aufhängen«, so aussichtslos sei ihm das Unternehmen erschienen. Braque soll gesagt haben, das Bild sei gemalt, als habe »jemand Petroleum getrunken, um Feuer speien zu können«.6 Apollinaire erinnert sich an die »Ermordung der Anatomie«, er habe das Bild im Gegensatz zu den Werken von Matisse für ein »maßlos übertriebenes Experiment« gehalten.7 Auch Matisse sei nicht angetan gewesen, er habe darin, nicht zu Unrecht, einen Angriff gegen die Fauves und seine eigene Kunst gesehen.8 Sogar der französische Dichter und Kunstkritiker André Salmon (1881 – 1969), der viel gebildete gleichaltrige Vordenker der Avantgarde, will ablehnend reagiert haben: »Das Ergebnis der Suche nach dem Ursprünglichen war entmutigend. Von Grazie keine Spur … Aktfiguren entstanden, deren Deformation uns kaum noch überraschen konnte … Die Häßlichkeit der Gesichter war es …, die auch die schon halb Überzeugten vor Abscheu vereisen ließ.9 Und dem russischen Sammler Sergej Schtschukin, einem großen Kenner der Fauves, wird von Gertrude Stein der Stoßseufzer zugesprochen: »Welch ein Verlust für die französische Kunst!«10
Picasso ist konsterniert, aber nicht gebrochen. Er dreht das großformatige Bild mit der bemalten Fläche zur Wand und zeigt es keinem mehr. Andererseits bleibt er sich sicher, etwas Bedeutendes geschaffen zu haben. Seine Zeit wird kommen. Er zielt eben nicht auf Harmonie, wie Matisse, den er von nun an als Rivalen ansieht, sondern auf Dissonanz. Und er schafft auch keine Einheit, sondern er will fragmentieren. Nicht das Gemachte fasziniert ihn, sondern das Entstehen und Zerbrechen. Seine Bilder sollen Erfahrungskonstruktion sein. Unsere Welt ist etwas von uns Gemachtes, und der tiefer liegende Rhythmus unserer Erfahrungswelt ist noch nicht entdeckt und freigelegt.11
Der Philosoph der Fauves ist Friedrich Nietzsche (1844 – 1900). Der französische Essayist Jules de Gaultier (1858 – 1942) hat den deutschen Philosophen im Januar 1900, kurz vor dessen Tod, in Frankreich bekannt gemacht durch eine Hymne auf Also sprach Zarathustra. Der Apologet des Dionysischen wird für Gaultier und mit ihm für zahlreiche Intellektuelle und Künstler in Frankreich zu dem Philosophen des mediterranen Lebensgefühls und einer ihm entsprechenden Kunst: »Diese ist eine Lust, ein neuer Appetit, eine neue Gabe, Farben zu sehen, Klänge zu vernehmen und Gefühle zu empfinden, die bisher weder gesehen, noch vernommen oder empfunden wurden.«12 Individualität, Kraft, Leidenschaft, Unbändigkeit, Beschwingtheit, Rausch, atheistischer Stolz und Pathos des Ausdrucks – das Leben bricht sich ungehemmt Bahn gegen alle bürgerlichen Konventionen, gegen brüchige Rationalität und dürre Moral.
Auch Picasso ist von Nietzsche fasziniert, selbst wenn nicht ganz klar ist, ob er ihn wirklich gelesen oder nur in den ergiebigen Erzählungen seiner Freunde studiert hat. Der Gedanke jedenfalls, dass alle Werte umgewertet werden müssen und dass die Kunst gar nicht radikal genug sein kann, trifft genau sein Lebensgefühl. Nietzsches Ansicht, dass den Künstler zwar der »Flor des unreinen Denkens« umgibt, er aber gleichwohl oft Wesentlicheres über die Welt zu sagen hat als der Philosoph, gefällt ihm so sehr, dass er sie sich zu eigen macht. Anfang der Zwanzigerjahre wird Picasso in einem Interview sagen: »Wir wissen alle, dass Kunst nicht Wahrheit ist. Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit begreifen lehrt, wenigstens die Wahrheit, die wir als Menschen begreifen können.«13 Und als der konservative französische Kunstkritiker Louis Vauxcelles im November 1908 Picassos Gefährten Braque in der Zeitschrift Gil Blas abkanzelt – »Herr Braque … löst alles, Orte, Personen, Häuser, in geometrische Figuren, in Kuben auf« –, ist auch der Name für die neue Form radikaler künstlerischer Wahrheitsfindung vorgezeichnet: Kubismus!14
Zum Philosophen der neuen Kunst aber wird am Ende doch nicht Nietzsche, sondern ein anderer. Seit 1908 beschäftigt sich zunächst Matisse sehr intensiv mit dem Superstar der französischen Philosophie der Zeit – mit Henri Bergson.15 Und auch unter den Intellektuellen in Picassos Umfeld steht der Denker der Intuition hoch im Kurs. Der Dichter Tancrède de Visan, seit Jahren andächtiger Zuhörer in Bergsons Vorlesungen am Collège de France, führt den Meister im November 1911 sogar ganz persönlich an die neue Kunstrichtung heran.16 Ist der Kubismus nicht die genau passende Antwort auf eine Philosophie der Intuition, die aller rationalen Objektivität misstraut und das wahre Sein hinter den Dingen sieht als ein Kontinuum, das wir spüren, aber nicht in Formen und auf Begriffe bringen können? Der Kubismus zerlegt die Objektwelt, macht ihre Perspektivität sichtbar und verweist so auf ein »Mehr« in der Welt, das die konventionelle Malerei nicht zeigen kann. Bergson, zweiundfünfzig Jahre alt, zögert. Die mehr als zwanzig Jahre jüngeren Künstler und Kritiker, die ihn umgarnen, bleiben ihm suspekt. Ohne Zweifel ist er kunstinteressiert und Ästhetik eines seiner großen Themen. Einige Jahre zuvor hatte er Leonardo da Vincis »Mona Lisa« als ein Meisterwerk der künstlerischen Intuition gelobt. Doch vergleichbare Aussagen über den Kubismus bleiben aus. Und das Vorwort, das sich André Salmon 1912 für die Ausstellung der Section d’Or von Bergson erhofft, wird nie geschrieben.
Doch auch wenn das Werben um den Kultautor der französischen Philosophie erfolglos bleibt, die Bewegung wird mehr und mehr durch Bergsons Philosophie getränkt. Das Manifest Du cubisme der beiden Maler Albert Gleizes und Jean Metzinger, das der neuen Stilrichtung 1912 endgültig ihren Namen gibt, ist eine ausführliche Anwendung des bergsonschen Denkens auf die Kunst. Wenn es richtig ist, dass, wie Bergson sagt, unsere Begriffe von Zeit und Raum nur Behelfskonstruktionen des Geistes sind, um das unbegreifliche Zeitkontinuum begreifbarer zu machen, dann muss der Raum in der Malerei so zerlegt werden, dass das Konstruierte unserer Welterfahrung sichtbar wird. Statt nur eines Blickwinkels werden mehrere angeboten, und statt eines einzigen Standpunkts der Betrachtung gibt es viele. Da der Blick nie zur Ruhe kommt, bilde der Kubismus die natürliche Dynamik der Erfahrung ab. Kubistische Kunst, so die Idee, steht nicht still, sondern sie bewegt sich im Blick des Betrachters und bewahrt damit das Unstete und Fließende der Zeiterfahrung, das andere Kunstwerke bewusst oder notgedrungen in einen einzigen Moment einfrieren.
Kurze Zeit darauf ist der Kubismus in Paris groß in Mode. Kahnweiler nimmt Picasso unter Vertrag, und dieser avanciert, neben Braque, zum prominentesten Kubisten. Doch anders als bei Braque, der kein großer Zeichner ist, beschränkt die kubistische Malweise Picassos künstlerische Mittel enorm. Die »dämonische Leichtigkeit« seines künstlerischen Talents bleibt weitgehend unentfaltet,17 und auch der Maler selbst erkennt ziemlich schnell die Sackgasse. Tatsächlich haben sich wohl nur wenige große Stilrichtungen in einem solchen Tempo ästhetisch abgenutzt wie der Kubismus – die Kehrseite des Plakativen. Den »Demoiselles« hingegen tut der kurze Höhenflug gut. Im Jahr 1916 wird das Bild – Salmon nennt es »Le bordel philosophique«18 – das erste Mal öffentlich ausgestellt. Auch der Titel »Les Demoiselles d’Avignon« stammt von Salmon, benannt nicht unmittelbar nach der französischen Stadt, sondern nach dem Rotlichtviertel Carrer d’Avinyó in Barcelona. Noch acht weitere Jahre vergehen, bis das Werk einen Käufer findet, den Couturier Jacques Doucet. Er erwirbt es für 24 000 Franc. Kurz darauf, im April 1925, wird es das erste Mal mit dem Namen des Malers versehen abgebildet – und zwar in der Zeitschrift La Révolution surréaliste. Inzwischen ist der Kubismus fast schon historisch und die radikale Avantgarde-Kunst in aller Munde.
Im gleichen Jahr veröffentlicht der spanische Philosoph José Ortega y Gasset seinen viel gelesenen Essay La deshumanización del arte (Die Vertreibung des Menschen aus der Kunst). Die neue Kunst der Avantgarde definiert er als bewusst unpopulär und unzugänglich, sodass viele, auch in den gebildeten Schichten, sie ablehnen. Doch diese Spaltung, so Ortega, sei durchaus beabsichtigt, denn die neue Kunst wolle ja auch gar nicht mehr gefallen. Ihre Rolle in der Gesellschaft ist eine andere geworden. Die Kunst der Avantgarde verabschiedet sich ganz bewusst vom Menschlichen. Sie deformiert ihre Objekte, um sie unidentifizierbar zu machen, sie irritiert den Betrachter, und sie fällt dadurch auf, dass sie sich in ihren Bildern selbst reflektiert. Jedes Kunstwerk der Avantgarde ist eine Frage nach der Funktion der Kunst in der Gesellschaft.
Spätestens nach dem Ersten Weltkrieg ist Picasso, neben Matisse, der Superstar dieser Avantgarde. Der radikale Wandel, den er mit den »Demoiselles« beschwor, ist selbst zu einer kulturellen Norm für die Kunstproduktion geworden. Von nun steht sie, wie Ortega schreibt, unter einem enormen Modernitätsdruck, der das ganze Jahrhundert anhalten wird: Kunst ist soziale Provokation durch formale Innovation. Erst das nahezu völlige Ausschöpfen der formalen Möglichkeiten – bei gleichzeitigem gesellschaftlichem Bedeutungsverlust – wird den Modernitätszwang zur Gegenwart hin langsam aushöhlen.
Dass seine Kunst während der eigenen Lebenszeit historisch wird, braucht Picasso nicht zu beunruhigen. Es steigert nur seine Bedeutung und seinen schwindelerregenden Marktwert. Als das neu gegründete Museum of Modern Art in New York die Hände nach den »Demoiselles« ausstreckt, spricht die Ankaufskommission von »einem von wenigen Bildern in der Geschichte der modernen Kunst, welche tatsächlich epochemachend genannt werden können«.19 Im Mai 1939 wird das Werk tatsächlich für 28 000 US-Dollar nach New York verkauft; viele halten es heute für das mutmaßlich wertvollste Bild des 20. Jahrhunderts. Als »Schlüsselbild der Moderne« gefeiert, ist es das Sinnbild schlechthin für die Erfahrungskonstruktion des Menschen in einer brachial zerrütteten und fragmentierten Welt. Vier Monate nach dem Kauf beginnt der Zweite Weltkrieg …
Philosophie Der Moderne
Zeit und Lebensschwung
Das betäubte Herz – Das Wesen der Zeit –Das Gespenst der Freiheit – Das doppelte Gedächtnis –Élan vital – Der Kultphilosoph
© Saul Steinberg, 1900s, Ink on paper. Originally published in Vogue, January 1950, p. 97.
Das betäubte Herz
Am Anfang des 20. Jahrhunderts steht das Lachen. Gewiss, man könnte es auch mit dem Geld anfangen lassen mit Georg Simmels Philosophie des Geldes. Oder mit dem Traum mit Sigmund Freuds Traumdeutung. Oder mit dem Leben in Ernst Haeckels Die Welträtsel. Alle vier Texte erscheinen fast gleichzeitig in den Jahren 1899 und 1900. Alle sind sie Ouvertüren einer neuen Zeit. Und von allen vier ist Le rire (Das Lachen) eines gewissen Henri Bergson (1859 – 1941) der kürzeste.
Simmel hatte auf ein 20. Jahrhundert verwiesen, in dem der »objektive Geist« des Geldes alle Lebensbereiche durchdringt und alle anderen Werte relativiert; Freud auf eine Zeit, in der das Unbewusste in seiner wahren unkontrollierbaren Macht erkannt wird; Haeckel hatte das Jahrhundert der Biologie ausgerufen, die alle Rätsel des Lebens löst. Aber was hatte Bergson gesagt? Was war es, das seinen Essay in der Revue de Paris und sein anschließendes Buch zu einer solchen Sensation unter den Intellektuellen und Künstlern machte?
Humor ist gemeinhin kein Lieblingsthema der Philosophie, gerne verweist man es an die Psychologen. Doch in seinem Essay mit dem vollständigen Titel Le rire. Essai sur la signification du comique will Bergson durchaus etwas Philosophisches klären. Er will wissen, warum Menschen überhaupt das Bedürfnis nach Humor haben und von welcher enormen Bedeutung die Komik für die Gesellschaft, für die Kunst und das Leben ist. Dabei liegt es ihm fern, »das Wesen des Komischen in eine Definition zu zwängen. Wir sehen in ihm vor allem etwas Lebendiges. Wir werden es, sei es auch noch so unwichtig, stets mit der Achtung behandeln, die man Lebendigem schuldet.«20
Die Komik ist das, was Menschen von allen anderen Dingen und Lebewesen unterscheidet. Landschaften sind nicht komisch, und Tiere sind es nicht untereinander, sondern nur im Blickwinkel des Menschen. Damit einem etwas komisch vorkommen kann, muss man in der Lage sein, eine ausgesuchte Haltung einzunehmen. Man kann nur dann über etwas lachen, wenn man die Dinge mit einem gewissen Mangel an Ernsthaftigkeit und an Einfühlung betrachtet. Das »Komische scheint seine durchschlagende Wirkung nur äußern zu können, wenn es eine völlig unbewegte, ausgeglichene Seelenoberfläche vorfindet. Seelische Kälte ist sein wahres Element … In einer Welt von reinen Verstandesmenschen«, schreibt Bergson klug, »würde man wahrscheinlich nicht mehr weinen, wohl aber noch lachen.«21
Nichts ist von sich aus komisch, aber in nüchterner Distanz zu allem, aus der Perspektive eines »unbeteiligten Zuschauers«, kann fast alles komisch werden. Denn »das Komische setzt, soll es voll wirken, so etwas wie eine zeitweilige Anästhesie des Herzens voraus, es wendet sich an den reinen Intellekt«.22 Doch warum tun Menschen dies überhaupt? Lachen? Und worüber? Nach Bergson gibt es in allen Spielarten der Komik immer die gleiche Quelle. Wir lachen, wenn menschliches Leben seine Geschmeidigkeit (souplesse) verliert, wenn die Anpassung an die Erfordernisse des Alltags und der Gesellschaft misslingt. Eine Geste, ein Stolpern, ein Aussehen oder eine Verhaltensweise werden plötzlich auffällig. Wir sehen sie mit unserem betäubten Herzen amüsiert aus der Distanz. Und isoliert und stillgestellt erscheinen sie uns so komisch wie die Bewegungen eines Tänzers ohne Musik. Statt natürlich erscheinen uns die Dinge, die Menschen tun, künstlich, statt normal sind sie seltsam, grotesk und verzerrt. Das Flüssige versteinert zur Fratze, und was sonst unauffällig und organisch ist, wirkt steif und maschinenhaft. Mit einem Wort: Ein bestimmtes Aussehen oder Verhalten wird zum Ausfall gegen die kulturelle Norm. Und die anderen stellen es durch Lachen bloß und bestrafen es. Das klingt zunächst grausam, aber es hat auch eine positive soziale Komponente. Wer über etwas lacht, distanziert sich nicht nur von dem, worüber er lacht, zugleich sucht er dabei die Nähe zu anderen. Man lacht leichter in Gesellschaft und erzeugt so eine gewisse Komplizenhaftigkeit. Ohne die anderen, ihr mutmaßliches oder reales Mitlachen, ist das Lachen selten und ziemlich sinnlos. Auf diese Weise fördert das Zusammenspiel von Komik und Lachen das gesellschaftliche Miteinander. Es motiviert Menschen dazu, sich unauffällig zu verhalten und anzupassen. Um bloß nicht komisch zu wirken, adaptieren sich Menschen normalerweise, so gut sie können, an ihre Lebensumstände und ihre Mitmenschen.
Für einen Soziologen wäre hier Schluss, die Funktion des Lachens ist erklärt. Aber Bergson bohrt noch tiefer. Wahrscheinlich, so vermutet der Philosoph, ist das Verhalten von Ausfall, Lachen und Anpassung nicht nur kulturell erlernt. Denn hätte uns die Natur den Sinn für Komik nicht eingepflanzt, könnten Menschen nicht so gut miteinander klarkommen, wie sie es meistens tun. Bergson fahndet deshalb nach einem existenziellen Grund für das Komische. Und er findet diesen Grund im Gegensatz von Leben zu seiner mechanischen Wiederholung. Echtes Leben ist einmalig und fließend, es kennt keine genauen Wiederholungen. Stellt man es aber still und isoliert einzelne Momente, wirkt es plötzlich verzerrt und komisch. Je mechanischer und automatenhafter uns das Leben erscheint, umso absurder finden wir es. Das betäubte Herz spürt eine stillgestellte Welt. In der Komik wird das Leben zum toten Mechanismus verdinglicht. Und dieser steht im völligen Kontrast zu dem, was, nach Bergson, echtes Leben ausmacht.
Die Leser sollen verstehen, dass es hier nicht einfach um eine Theorie des Komischen unter vielen anderen geht. Und die, die Bergson schätzen, wissen bereits, was von ihm zu erwarten ist. Denn mit seiner Analyse des Lachens stützt der Philosoph seine Theorie der zwei Welten. Einmal gibt es die Welt des Bildes und der Oberfläche, in der die Phänomene zu Objekten werden. Und auf der anderen Seite gibt es die Welt des eigentlichen Lebensflusses, die spürt, wenn etwas in der Objektwelt nicht stimmt oder komisch erscheint. In Bergsons Denken sind diese Welten ziemlich streng getrennt: in die objekthafte Außenwelt und in die eigentliche unmittelbare Realität der Innenwelt. Und weil diese Trennung jeden Menschen durchschneidet, korrespondieren Menschen nie eins zu eins mit der Welt. Es gibt keine ungetrübte Verbindung zwischen Erleben und Objektwelt. Stattdessen werfen wir Perspektiven auf die Welt. Im Alltag passen wir uns geschmeidig und nahezu automatisiert an. Und in der Wissenschaft ziehen wir künstliche Grenzen um die Phänomene, um sie möglichst eindeutig als Objekte zu identifizieren.
Die intensivste Verbindung zwischen innerem Erleben und Objektwelt aber stiften die Künstler. »Wenn die Wirklichkeit unsere Sinne und unser Bewusstsein unmittelbar träfe, wenn wir mit den Dingen und mit uns selbst unmittelbar in Verbindung treten könnten, ich glaube, dann wäre die Kunst überflüssig, oder vielmehr, wir wären dann alle Künstler, denn unsere Seele würde in beständigem Einklang mit der Natur stehen.«23 Da sie es aber nicht tut, brauchen wir die Kunst. Sie tränkt die Objektwelt ganz bewusst mit unserem subjektiven Erleben und macht damit all die Facetten des Lebens sichtbar, die im Alltag und in der Wissenschaft unsichtbar bleiben.
Bergsons Worte werden in Paris zur Jahrhundertwende gerne gehört. Die Dritte Republik ist nach der Niederlage gegen das Deutsche Reich 1870/1871 außenpolitisch stark geknebelt. Dafür aber erlebt Frankreich eine enorme kulturelle Blüte. Während der Einfluss der katholischen Kirche rasant schwindet, experimentieren die Bürger, vor allem in der fast Drei-Millionen-Metropole Paris, mit neuen Lebensstilen. Und Bergson ist der Philosoph des Zeitgeistes der Belle Époque. In der heftigen Diskussion zwischen den »Naturalisten« und den »Impressionisten« nimmt er eindeutig Partei. Die Kunst hat sich mitnichten an den Naturwissenschaften zu orientieren, wie die Naturalisten meinen. Modern zu sein heißt nicht, sich an den Rockzipfel der Biologen, experimentellen Psychologen und Mediziner zu hängen – sondern es bedeutet, Kunst als einen ganz eigenen und viel intensiveren Zugang zur Realität zu sehen, als das, was die Naturwissenschaften mit ihren künstlichen Verobjektivierungen anzubieten haben. Nicht Exaktheit, sondern Intuition ist die Stärke des Künstlers, nicht Sachverhalte soll er zeigen, sondern Leben.
Nicht das Sichtbare wiedergeben, sondern echtes Leben sichtbar machen – unter den Künstlern am Montmartre ist das selbstverständlich. Genauso malen die Impressionisten, wenn sie die Farbe vor die Linie stellen, die Pointillisten mit ihrer Punktiertechnik und die Cloisonisten und Synthetisten mit ihren perspektivlosen Flächen. Sie bringen nicht nur das Tragische und Schicksalhafte der Naturalisten auf die Leinwand, sondern auch das Flatterhafte, das Alberne, das Groteske und das Komische. Prostitution, Alkohol, Rausch und das Leben am Rande des Absturzes sind nicht programmatisch festgelegt. Sie sind mehr als nur sozialkritische Studien zur Natur des Menschen oder Anklagen an die Gesellschaft. Sie sind Phänomene einer gierigen, ungebändigten und überschäumenden Lebensenergie. Kein Wunder, dass Bergson zum Kultphilosophen der Avantgarde aufsteigt. Edgar Degas, Kees van Dongen, Louis Anquetin, Henri de Toulouse-Lautrec und, wie geschildert, Matisse, Picasso und Braque leben und malen, was Bergson in kluge Worte fasst. Auch Marcel Proust lebt hier, Rainer Maria Rilke kommt 1902 nach Paris; Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns, Claude Debussy und Maurice Ravel prägen die Musik. Und vielen von ihnen spricht Bergson mit seiner Auffassung vom unmittelbaren, vom subjektiven und unbegreifbaren Leben aus dem Herzen. Wer ist er?
Das Wesen der Zeit
Henri Bergson wurde 1859 in Paris geboren. Sein Vater war ein polnischstämmiger jüdischer Pianist und Komponist. Seine Mutter stammte aus einer englisch-jüdischen Familie. Die Bergsons wohnen im Stadtzentrum unmittelbar in der Nähe der Oper. Und der begabte Schüler besucht eines der renommiertesten Traditionsgymnasien der Stadt, das Lycée Condorcet, das zwischenzeitlich Lycée Fontanes heißt. 1877 gewinnt er den Schulpreis für die Lösung eines mathematischen Problems. Schon als Schüler beschäftigt er sich mit Darwins Evolutionstheorie und geht zum jüdischen Glauben auf Distanz. Unschlüssig, ob er lieber Natur- oder Geisteswissenschaften studieren sollte, entscheidet er sich schließlich für Letztere. Er besucht die École normale supérieure und qualifiziert sich 1881 im Wettbewerb an der Sorbonne für das Amt eines Gymnasialprofessors im Fach Philosophie.
Besonders gut steht es um die Philosophie in Frankreich in dieser Zeit nicht. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts hatte der Ingenieur und Philosoph Auguste Comte (1798 – 1857) die »Lehre von der Weisheit« durch eine Art soziale Ingenieurstechnik ersetzt. Und die berühmtesten Philosophieprofessoren in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wendeten die »positivistische« Methode auf alle Geisteswissenschaften an. Paradefigur dieser Richtung ist der Philosoph und Historiker Hippolyte Taine (1828 – 1893). Unermüdlich historisiert, klassifiziert und nationalisiert er die Kulturgeschichte. Taines Welt- und Menschenbild ist schlicht und streng orientiert an den Naturwissenschaften. Menschen seien gesetzmäßig beschreibbar und ihr Handeln durch ihre Anlagen und ihr Umfeld klar vorherbestimmt. Ähnlich denkt der Altertumsforscher und Religionswissenschaftler Ernest Renan (1823 – 1892). Für ihn ist sogar die künftige Entwicklungsgeschichte der Menschheit eindeutig vorherbestimmt. Sie schreitet planmäßig voran und mündet in einem streng (natur-)wissenschaftlichen Zeitalter.
Der Lehrer, dem Bergson an der Sorbonne lauscht, ist anders. Doch er ist keine Berühmtheit seines Metiers. Émile Boutrouxs (1845 – 1921) Denken ist ein lebenslanger Versuch, den Einfluss der Naturwissenschaften auf die Philosophie abzuwehren. Spätestens wenn es um die Biologie gehe, greife der klassische Mechanismus der Physik nicht. Betrachtet man das Leben oder gar das Bewusstsein, so könne von strenger Kausalität nicht die Rede sein. Denn hier geschehe vieles keineswegs mit naturwissenschaftlicher Notwendigkeit. Geprägt ist Boutroux von seinem Lehrer Félix Ravaisson-Mollien (1813 – 1900). Auch er will von einer Philosophie nach dem Gusto der Naturwissenschaften nichts wissen. Als Schüler von Victor Cousin (1792 – 1867) ist er einer von wenigen Philosophen im Frankreich seiner Zeit, die sich intensiv mit dem deutschen Idealismus beschäftigt haben, mit Hegel und insbesondere mit Friedrich Schelling (1775 – 1854), dessen Vorlesungen er 1839 in München gehört hatte. Und wie für Schelling, so wird auch für Ravaisson-Mollien die Natur von etwas überzeitlich Geistigem bewegt und nicht schlichtweg durch Gesetze der Materie.
Der Einfluss dieses Denkens auf Bergson ist groß. Im Hinblick auf Anregungen, die er von anderen bekommt, hält er sich in seinen Werken und Selbstbekundungen weitgehend zurück. Aber über Ravaisson-Mollien schreibt er später einen Aufsatz. Erwähnen wird er auch seine Lektüre Herbert Spencers (1820 – 1903), des Starphilosophen des Viktorianischen Zeitalters. Spencer hatte den jungen Bergson durch seinen Umgang mit der Evolutionstheorie beeindruckt. Aus natürlichen Grundprinzipien heraus entwickelt sich aus der Physik die Biologie, aus der Biologie die Psychologie und aus dieser schließlich Soziologie und Ethik; ein monumentaler Gesamtentwurf wie ihn sich nach Darwin kaum noch jemand zutraut. Doch Spencers strenger Determinismus und unbedingter Materialismus gehen Bergson zu weit. Wo bleibt die Freiheit? Und wirken denn tatsächlich nur mechanische Kräfte in der Natur, wie Spencer behauptet, Boutroux und Ravaisson-Mollien hingegen bezweifeln?
Als Bergson sich die Frage stellt, ist das Lager der Idealisten in Europa schwach, die Materialisten sind in der Überzahl – mit Ausnahme von Deutschland, wo beides sich in etwa die Waage hält. Der Glaube an etwas Ideelles in der Evolution steht nur noch auf sehr schwachen Beinen. Kausal-mechanische Erklärungen der Entwicklungsgeschichte dominieren. Doch Bergson hat sich auf dieser Karte früh verortet: auf der Seite der Idealisten! Nur muss dieser Idealismus nach Darwin völlig neu fundiert werden. Nicht gegen, sondern mit der modernen Evolutionstheorie muss man argumentieren; man muss sie gezielt übersteigen, und zwar dort, wo ihr die Erklärungen ausgehen.
Als Gymnasiallehrer in Angers und von 1883 an in Clermont-Ferrand geht Bergson zunächst zurück zu den Wurzeln des Materialismus und der Logik in der altgriechischen Philosophie. Er veröffentlicht eine Textsammlung von Lukrez mit eigenem Kommentar und studiert die berühmten Paradoxa des Zenon von Elea. Doch sein Ziel ist ehrgeiziger, als es seine ersten Texte vermuten lassen. Mitte der 1880er-Jahre reflektiert Bergson sehr genau, was die Naturwissenschaften seiner Zeit erklären können und was nicht. Überall werden zwar physikalische Begriffe, wie »Kraft«, »Energie« und »Gesetz« verwendet. Sie hängen aber merkwürdig in der Luft, weil man sie nur auffallend schwer definieren kann. Die klassische Mechanik scheitert daran, alles auf Bewegungsgesetze zurückzuführen. Physiker, wie der Österreicher Ernst Mach (1838 – 1916), stellen sogar den Begriff der »Materie« infrage. Physik und Chemie greifen äußerst ungelenk ineinander und erscheinen irgendwie als getrennte Welten. Das Verhältnis von Physiologie und Psychologie steckt voller Rätsel und Ungereimtheiten. Fragen nach Zeit und Raum stellen sich völlig neu und münden später in der Relativitätstheorie.
Kein Zweifel: Die Naturwissenschaften, an denen sich die Philosophie orientieren soll, bilden gar keinen festen Halt. Überall schwankt der Boden. Sicher ist nur, dass alles Wissen durch Messen gewonnen werden soll. Aber im Ungesicherten und Ungefähren zu messen erzeugt keine großen Wahrheiten. Im Jahr 1889 legt Bergson das Ergebnis dieser kritischen Reflexion der Sorbonne als Doktorarbeit vor: Essai sur les données immédiates de la conscience (Zeit und Freiheit).
Das Werk des Dreißigjährigen ist ein Meilenstein in der Philosophiegeschichte und eine der erfolgreichsten Doktorarbeiten überhaupt. Und seine steile These lautet: Zeit ist wirklich – der Raum dagegen nicht! Er ist nur etwas Nachgeordnetes, etwas vom menschlichen Bewusstsein Konstruiertes. Der Mensch richtet sich die Welt in seinem Bewusstsein so ein, dass er sich in ihr möglichst gut zurechtfindet. Dafür stellt er sich die Dinge räumlich vor und erfindet dazu auch eine Zeit, die er wie den Raum einteilen und zergliedern kann, indem er sie misst. Doch diese Zeit ist in Wahrheit gar nicht die wirkliche Zeit, sondern ein Hilfsmittel, eine künstliche Welt, die einzig und allein der Orientierung dient. Die wirkliche Zeit dagegen ist das, was spürbar in uns vergeht, während wir versuchen, die Dinge unseres Lebens durch Verstandeskonstruktionen zu ordnen und zu begreifen.
Es gibt also, nach Bergson, zwei Zeitbegriffe. Eine ursprüngliche gefühlte Zeit, die uns bewusst wird, wenn der Alltag von uns abfällt, wenn wir aus der zweiten, der von uns konstruierten Zeit herausfallen. In solchen Momenten spüren wir, dass wir existieren, dass wir Teile sind eines stillen Fließens. Wir werden dabei unseres tiefen Ichs (moi profond) gewahr. Unser oberflächliches Ich (moi superficiel) tritt zurück und erlaubt uns, uns als das zu spüren, was wir wirklich sind. Einen präzisen Begriff für diese eigentliche und wesentliche Zeit hat Bergson nicht. In seiner Verlegenheit nennt er sie durée. Das Wort bedeutet nicht einfach nur »Dauer«. Es meint das, was wir erleben, wenn wir spüren, dass wir uns in der Zeit durchhalten als derjenige oder diejenige, die wir sind. Wir erfahren dabei die Intensität und Qualität des Lebens – ganz im Gegensatz zu den vielen flüchtigen Erlebnissen, bei denen unser weitgehend automatisierter Verstand die Welt quantitativ erfasst: als vor- und nachgeordnet, viel und wenig, weit weg und nah dran, schnell und langsam usw.
Bergsons Welt der Dauer, der Intensität und Qualität steht nun allerdings vor einer Krux: Sie entzieht sich dem Zugriff der Wissenschaften. Sie kann nur empfunden, nicht durch wissenschaftliche Theorien untermauert oder gar gemessen werden. Der Philosoph sieht dies als Stärke, nicht als Schwäche. Gleich zu Anfang seines Essais erteilt er allen Versuchen der Psychologie, Bewusstseinszustände messen zu wollen, eine Absage. Die Disziplin der »Psychophysik«, die der kurz zuvor verstorbene Leipziger Physiker und Philosoph Gustav Theodor Fechner (1801 – 1887) im Jahr 1860 aus der Taufe gehoben hatte, ist für ihn weitgehend wertlos. Gefühlsintensität ist niemals quantitativ! Man empfindet nicht mehr oder weniger Trauer, so wie man eine Dosis senkt oder erhöht. Die Trauer verändert nicht ihre Quantität, sondern ihre Intensität, und zwar durch Gedanken, Umstände und Erlebnisse. Sie färbt sich damit je anders ein. Wo es um Qualität und Intensität geht, ist die quantitative Erfassung, das Messen der Naturwissenschaftler, völlig fehl am Platz.
Auf diese Weise erteilt Bergson dem Optimismus der zu seiner Zeit boomenden experimentellen Psychologie eine harsche Absage. So wird das nichts! Das Bewusstsein lässt sich nicht mit den Methoden des oberflächlichen Ichs aufschlüsseln, sondern nur vom tiefen Ich erahnen. Abständig und überholt ist diese Sicht auch heute nicht. Wie sich das, was ich fühle, für mich anfühlt, weiß ich nur selbst. Mag der Zahnarzt keinen Grund für meine Zahnschmerzen finden, wenn ich trotzdem Zahnschmerzen empfinde, dann empfinde ich sie. Um wie viel mehr gilt dies für komplexe Gefühlszustände wie Trauer, Sehnsucht, Weltschmerz, Nostalgie, Liebeskummer usw.? Bergson wirft damit das vom US-amerikanischen Mathematiker und Philosophen Charles Sanders Peirce (1839 – 1914) im Jahr 1866 sogenannte Qualia-Problem (von lat. qualis, »wie beschaffen«) auf. Bis heute ist es für die Psychologie wie für die Philosophie des Geistes eine dauerhafte Herausforderung.
Dass die Wissenschaften mit ihren Begriffen und Messungen auf die Qualität des Empfindens nicht zugreifen können, ist für Bergson der Beweis, dass sie sich in einer anderen – nämlich einer konstruierten und konstruierenden – Sphäre aufhalten statt in der des unmittelbaren Erlebnisses. Die Welt der durée und die Welt des ordnenden Verstandes sind damit säuberlich getrennt; die erste ist eigentlich, die zweite ein zweckdienliches Hilfsmittel und »uneigentlich«, weil nachgeordnet.
Aber wie erhält nun der Philosoph einen Zugriff auf die erlebnisintensive Welt des tiefen Ich? Wie kommt er an das heran, was den Naturwissenschaften methodisch verschlossen bleibt? »Wir empfinden eine unglaubliche Schwierigkeit, uns die Dauer in ihrer ursprünglichen Reinheit vorzustellen«, schreibt Bergson, »und das liegt zweifellos daran, daß nicht allein wir dauern. Die äußeren Dinge, scheint es, dauern wie wir, und die Zeit, von diesem letzten Standpunkt aus betrachtet, hat ganz den Anschein eines homogenen Mediums.«24 Daraus entstehen für den Philosophen zwei Probleme. Weil unser Verstand unausgesetzt mit der Orientierung in der Außenwelt beschäftigt ist, sind wir kaum jemals wirklich bei uns. Doch wie soll man dann diesen Zustand der durée gedanklich erschließen? Zumal, und dies ist das zweite Problem, Philosophen das, was sie erkennen, in Worte fassen müssen. Doch die Sprache ist ebenso ein Orientierungsmittel des Verstandes wie unsere Alltagsvorstellungen von Zeit und Raum. Die Sprache schafft eine räumliche Ordnung, die es so nur im Verstand gibt, aber nicht in der Realität. Die Sätze zergliedern unsere Erlebnisse, die Worte schränken sie auf bestimmte Bedeutungen ein und grenzen sie von anderen ab. Wo in Wirklichkeit ein grenzenloser Fluss fließt, entsteht ein räumliches Raster und werden tote Gräben angelegt. Doch Etiketten auf flüchtige Zustände zu kleben verdunkelt mehr, als dass es erhellt.
Das Problem ist Bergson bewusst. Was soll seine Philosophie aus Worten und Sätzen wert sein, wenn Worte und Sätze die wirkliche Wirklichkeit nicht treffen? Wenn die Erkenntnisse der Naturwissenschaftler relativ sind, weil sie die wahre Zeit nicht erfassen können und mit ihren Theorien in der Luft hängen – gilt das nicht auch für die schönen Worte der Philosophen? Bergson rettet sich aus der Verlegenheit durch einen zweiten Behelfsbegriff neben dem der durée, nämlich dem der intuition. Wenn das wirkliche unmittelbare Leben sich nur wortlos mitteilt, so erfahren wir es intuitiv. Allerdings sind Worte nicht völlig vergebens. Man kann die Erfahrung der durée nämlich so mit Worten einkreisen, dass das, was gemeint ist, intuitiv erfahrbar wird. Es fragt sich allerdings, welche Sprache dafür besonders geeignet ist; die trockene Sprache der Wissenschaft eher nicht. Zeit seines Lebens wird sich Bergson deshalb um eine besonders schöne, geschmeidige und elegante Sprache bemühen. Was rational schwer zu beschreiben ist, teilt sich viel leichter ästhetisch mit.
Mit dieser Antwort handelt sich Bergson das Etikett ein, ein »Dichterphilosoph« zu sein; ein Wort, das ebenso auch zu Søren Kierkegaard (1813 – 1855) und Nietzsche passt.25 Und tatsächlich ist Bergson ein »Dichterphilosoph« im doppelten Sinne. Wie Schelling, Schopenhauer und Nietzsche sieht er im literarischen Schreiben, im Malen und im Komponieren eine ausgezeichnete Erkenntnisquelle für das Leben und formuliert gern mit poetischen Worten. Zum anderen dürfte kaum ein philosophischer Denker, wiederum mit Ausnahme von Schopenhauer und Nietzsche, die Literatur und Malerei dermaßen beeinflusst haben wie Bergson. Auf jeden Fall liefert keiner den Künstlern der Jahrhundertwende so wichtige Begriffe für ihre Poetik und Ästhetik: die »Intuition«, das »tiefe Ich«, die »Kreativität« und vor allem anderen: das »Leben«.
Das Gespenst der Freiheit
Das Subjektive ist wirklich, das Objektive nur äußerlich – mit dieser Feststellung reiht sich Bergson in die Tradition der Existenzphilosophie Kierkegaards ein sowie in jene der Lebensphilosophie Schopenhauers und Nietzsches. Deren wichtigster Denker in Frankreich, Jean-Marie Guyau (1854 – 1888), ist ein Jahr vor Erscheinen von Bergsons Essai im Alter von nur dreiunddreißig Jahren gestorben. Seine Werke, die er in erstaunlichem Tempo schrieb, behandeln die natürliche Veranlagung des Menschen zur Moral, zur Kunst und zur religiösen Spiritualität. Und sie versuchen nichts anderes als Bergson: Sie wollen zeigen, dass das Leben eine ungebändigte Urkraft ist, die den Menschen dazu drängt, sich selbst zu überschreiten. Doch wo Nietzsche in Deutschland das Leben mit einem bösen Willen zur Macht gleichsetzt, erkennt Guyau in der überschäumenden, sich auf alles ausdehnenden Kraft des Lebens die Wurzel des Sozialen, des Altruismus und der Spiritualität.
Das Verhältnis zwischen Bergson und Guyau ist einigermaßen unklar. Im Jahr 1885 veröffentlicht Zweiter einen längeren Essay über die Zeit: La genèse de l’idée de temps (Die Entstehung des Zeitbegriffs) in der Revue philosophiques. Obwohl Guyaus Betrachtung der Zeit stärker psychologisch und weniger metaphysisch ist als diejenige Bergsons, sind die Parallelen erstaunlich, und einiges ist fast wortwörtlich übernommen. Doch das hält Bergson nicht davon ab, den 1890 posthum in Buchform erschienen Essay so zu rezensieren, als ob er auf ihn keinerlei Einfluss ausgeübt hätte.
Nicht anders geht er mit William James (1842 – 1910) um, dem Star der US-amerikanischen Philosophie. Bereits 1880 hatte James einen Aufsatz in La Critique philosophique über die französischen Philosophen Charles-Bernard Renouvier (1815 – 1903) und François Pillon (1830 – 1914) geschrieben. Beide hatten James zutiefst beeindruckt und ihn von seinem als bedrückend empfundenen naturwissenschaftlichen Materialismus befreit. Denn beide Franzosen verteidigen mit klugen Argumenten die Willensfreiheit. Das Bewusstsein wird zwar materiell erzeugt, aber der Cursor des Bewusstseins ist nicht streng kausal determiniert, sondern frei, seine Aufmerksamkeit darauf hinzulenken, wo er will. Der naturwissenschaftlich geprägte James lässt sich davon überzeugen. In seinem Aufsatz On Some Omissions of Introspective Psychology, der 1884 in Mind, der renommierten Zeitschrift des University College London, erscheint, führt er zum ersten Mal einen Begriff ein, der später auf immer mit ihm verbunden wird. Das Bewusstsein sei keine Kette von Ereignissen, sondern ein wilder, unbändiger Strom, der fortwährend fließt als stream of consciousness (Bewusstseinsstrom). Die »Konzepte« unseres Verstandes, mit denen wir die Welt und uns selbst begreifen wollen, werden dieser sich ständig verändernden Bewusstseinswelt nie wirklich gerecht.
Obwohl Bergson in seinem Essai auf James verweist, lässt er die berühmte Quelle über das nicht fixierbare, fließende Bewusstsein weg. Die Idee der durée erscheint als Bergsons ganz eigene Vorstellung, ebenso die Welt des oberflächlichen Ich, in der der Verstand die Welt im Rahmen seiner immer defizitären Möglichkeiten ordnet. Bergsons Idee, dass der menschliche Geist frei ist und nicht in die Welt der naturwissenschaftlich determinierten und kausal bestimmten Ereignisse fällt, ist also so originell nicht. Aber genau hier, im Beweis der Freiheit, liegt das selbst erklärte Ziel seines Essais