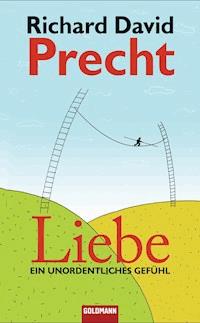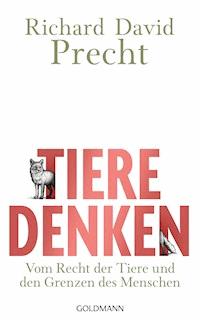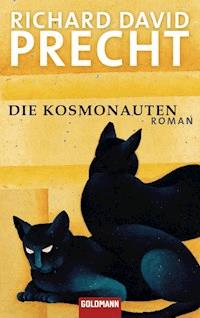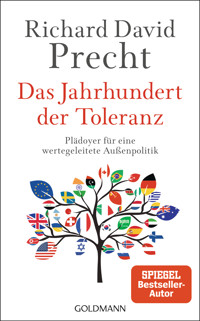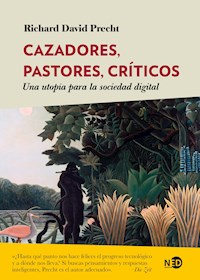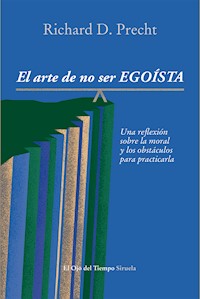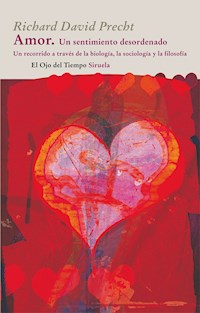11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dass unsere Welt sich gegenwärtig rasant verändert, weiß inzwischen jeder. Doch wie reagieren wir darauf? Die einen feiern die digitale Zukunft mit erschreckender Naivität und erwarten die Veränderungen wie das Wetter. Die Politik scheint den großen Umbruch nicht ernst zu nehmen. Sie dekoriert noch einmal auf der Titanic die Liegestühle um. Andere warnen vor der Diktatur der Digitalkonzerne aus dem Silicon Valley. Und wieder andere möchten am liebsten die Decke über den Kopf ziehen und zurück in die Vergangenheit.
Richard David Precht skizziert dagegen das Bild einer wünschenswerten Zukunft im digitalen Zeitalter. Ist das Ende der Leistungsgesellschaft, wie wir sie kannten, überhaupt ein Verlust? Für Precht enthält es die Chance, in Zukunft erfüllter und selbstbestimmter zu leben. Doch dafür müssen wir jetzt die Weichen stellen und unser Gesellschaftssystem konsequent verändern. Denn zu arbeiten, etwas zu gestalten, sich selbst zu verwirklichen, liegt in der Natur des Menschen. Von neun bis fünf in einem Büro zu sitzen und dafür Lohn zu bekommen nicht!
Dieses Buch will zeigen, wo die Weichen liegen, die wir richtig stellen müssen. Denn die Zukunft kommt nicht - sie wird von uns gemacht! Die Frage ist nicht: Wie werden wir leben? Sondern: Wie wollen wir leben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
»Die Zukunft kommt nicht – sie wird von uns gemacht! Die Frage ist nicht: Wie werden wir leben? Sondern: Wie wollen wir leben?« – Richard David Precht
Dass unsere Welt sich gegenwärtig rasant verändert, weiß inzwischen jeder. Doch wie reagieren wir darauf? Die einen feiern die digitale Zukunft mit erschreckender Naivität und erwarten die Veränderungen wie das Wetter. Die Politik scheint den großen Umbruch nicht ernst zu nehmen. Sie dekoriert noch einmal auf der Titanic die Liegestühle um. Andere warnen vor der Diktatur der Digitalkonzerne aus dem Silicon Valley. Und wieder andere möchten am liebsten die Decke über den Kopf ziehen und zurück in die Vergangenheit.
Richard David Precht skizziert das Bild einer wünschenswerten Zukunft im digitalen Zeitalter und stellt die Frage, ob das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten, überhaupt einen Verlust darstellt. Für Precht enthält es die Chance, in Zukunft erfüllter und selbstbestimmter zu leben. Denn zu arbeiten, etwas zu gestalten, sich selbst zu verwirklichen, liegt in der Natur des Menschen. Von neun bis fünf in einem Büro zu sitzen und dafür Lohn zu bekommen nicht!
Mit diesem Buch entwirft Richard David Precht eine humane Zukunft – eine Zukunft, in deren Mittelpunkt nicht die Technik steht, sondern der Mensch.
Richard David Precht
Jäger, Hirten, Kritiker
Eine Utopie für die digitale Gesellschaft
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2018
by Wilhelm Goldmann Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: © Bridgeman Images / Die Schlangenbeschwörerin, 1907 (La charmeuse de serpents), (Öl auf Leinwand), Rousseau, Henri J. F. (Le Douanier) (1844 – 1910) / Musée d’Orsay, Paris, France
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
JT · Herstellung: Han
ISBN 978-3-641-23069-2V005
www.goldmann-verlag.de
Inhalt
Der erste Kontakt
DIE REVOLUTION
Das Ende der Leistungsgesellschaft, wie wir sie kannten
Die Umwälzungen
Wir dekorieren auf der Titanic die Liegestühle um
Die große Überforderung
Der Palo-Alto-Kapitalismus regiert die Welt
Die Dystopie
Das Vergangene ist nie tot
Die Retropie
DIE UTOPIE
Die Maschinen arbeiten – die Arbeiter singen
Eine Welt ohne Lohnarbeit
Frei leben
Grundeinkommen und Menschenbild
Gute Ideen für den Tag
Neugier, Motivation, Sinn und Glück
Betreutes Leben?
Vom Reiz des Unvorhergesehenen
Geschichten statt Pläne
Die Rückkehr des Politischen
Regeln für die Menschlichkeit
Von schlechten und guten Geschäften
Eine andere Gesellschaft
Abschied vom Monetozän
NACHTGEDANKEN
Wir und die anderen
Die Digitalisierung trifft die ganze Welt
ANHANG
Anmerkungen
Literaturempfehlungen
Dank
Der erste Kontakt
»Die Wirtschaft der Zukunft funktioniert ein bisschen anders. Sehen Sie, im 24. Jahrhundert gibt es kein Geld. Der Erwerb von Reichtum ist nicht mehr die treibende Kraft in unserem Leben. Wir arbeiten, um uns selbst zu verbessern – und den Rest der Menschheit.«[1]
Mehr als zwanzig Jahre ist es her, da prognostizierte Captain Jean-Luc Picard, Kommandant der USS Enterprise, aus der Zukunft des Jahres 2373, was auf die Menschheit zukommt: eine Gesellschaft ohne Geld und Lohnarbeit! Für das 24. Jahrhundert ist nämlich völlig undenkbar, was 1996 noch gängiger Menschheitsalltag ist – sich durch materielle Entlohnung motivieren zu lassen, um etwas für sich und die Gesellschaft zu tun.
Was in Star Trek VIII– Der erste Kontakt in der Maske der Zukunft erscheint, ist mehr als eine Science-Fiction-Fantasie. Es ist ein alter Menschheitstraum, geträumt seit dem Heraufdämmern des Kapitalismus und der Lohnarbeit im 16. und 17. Jahrhundert. Schon die Utopien des englischen Gentlemans Thomas Morus, des kalabrischen Mönchs Tommaso Campanella und des technikbegeisterten Lordkanzlers Francis Bacon kennen weder Geld noch goldenen Lohn. Die Frühsozialisten des 19. Jahrhunderts schwärmten von einer Zeit, in der die Maschinen arbeiten und die Arbeiter singen – erreicht durch clevere Automaten. Das »eigentliche Ziel ist der Versuch und Aufbau der Gesellschaft auf einer Grundlage, die die Armut unmöglich macht«[2], gibt Oscar Wilde dem 20.Jahrhundert als Auftrag mit auf den Weg. Erträumt wird das Ende der Lohnarbeit durch »Automation«. Denn nur die freie Zeit ermögliche es den Menschen, sich zu vervollkommnen. Wer die Hände frei hat, kann endlich das leben, worauf es vor allem anderen ankommt: seinen Individualismus!
Berühmter noch ist das Urbild, das Karl Marx und Friedrich Engels entwarfen. Besoffen von ihren Ideen, ihrer noch jungen Freundschaft und reichlich gutem Wein definieren sie 1845 in ihrem Brüsseler Exil das erste Mal, was »Kommunismus« sein soll: eine Gesellschaft, die es jedem ermögliche, »heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden«.[3] Die »klassenlose Gesellschaft«, träumen die beiden jungen Männer, werde den »totalen Menschen« schaffen. Und aus gesellschaftlicher Arbeit wird »freie Tätigkeit«.
Kommunismus als Individualismus, Pflege des eigenen Bewusstseins, liebevolle Sorge und echte Verantwortung? Wie weit entfernt ist Marx’ und Engels’ Utopie von den Zerrbildern des stalinistischen Staatskapitalismus! So lange schon hat dieser das Wort »Kommunismus« als Geisel genommen und den Traum vom »totalen Menschen« durch ein totalitäres System ersetzt! Und wie schillernd und zeitbedingt sind die Farben, in denen Menschen sich die passenden Exterieurs einer wahrhaft freien Gesellschaft ausmalten: die weißen Gewänder der im Sonnenkult aufgehenden Solarier beim Dominikanermönch Campanella; der Samtjacken-Dandyismus Oscar Wildes; die Schäferromantik der vergangenen Feudalzeit bei Marx und Engels, geträumt im Anblick der Industrieschlote. Und manchmal ist es ein steriles Raumschiff ohne jedes Grün, fantasieverlassen wie ein Atombunker bei Captain Picard.
Wir stehen heute, im Jahr 2018, vor einem Epochenumbruch. Die »Automation«, lang ersehnt, könnte nun zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit tatsächlich ein erfülltes Leben ohne Lohnarbeit für sehr viele ermöglichen. Die alte Arbeitswelt der oft gleichförmigen Dienstleistungsberufe, auf die uns die Schule noch immer abrichtet, bröckelt dahin; nicht anders als in der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts die schweren körperlichen Arbeiten in Bergwerken und an Stahlkochern. Was lockt, ist ein Leben in selbstbestimmtem Tun ohne Entfremdung, ohne Konditionierung und Eintönigkeit. Doch wie genau werden die Hirten, Jäger und Kritiker der Zukunft leben? Wer sorgt dafür, dass die fantastischen Gewinne, erwirtschaftet von sozialkostenfreien Automaten, ihnen zugutekommen? Wer fördert ihr Talent und ihre Neugier auf ein selbstbestimmtes Leben? Und in welchen Farben werden wir die lebenswerten Räume der Zukunft malen?
Für viele Menschen in Europa, insbesondere in Deutschland, erscheint die Vorstellung einer solch lebenswerten Zukunft bizarr. Befinden sich unsere Welt, unsere Zivilisation und Kultur nicht in der größtmöglichen Krise? Der Klimawandel lässt die afrikanische Steppe verdorren. Während wir uns so oft um unseren eigenen sorgen, übersehen wir den Burn-out des Planeten in sengender Sonne. Die Meeresspiegel steigen, überschwemmen fruchtbares Land und verschlucken ganze Atolle. Der rasante Zuwachs der Bevölkerung lässt Megacitys entstehen und Müllberge hoch wie Wolkenkratzer. Ströme von Geflüchteten fließen wie ein Delta ins Mittelmeer und unterspülen von dort die maroden Bollwerke des europäischen Schutzwalls gegen die Armut, bis dieser eines Tages bricht. Die Tier- und Pflanzenwelt stirbt dahin, überleben wird nur, was nützlich ist oder possierlich für den Zoo. Im Kampf um die Ressourcen Erdöl, Lithium, Kobalt, Coltan, Seltene Erden und Trinkwasser toben Handelskriege, getarnt als Glaubenskämpfe oder humanitäre Interventionen. Die Großmächte aus der Zeit der fossilen Energien bäumen sich ein letztes Mal auf, begleitet von Endzeiterscheinungen wie Donald Trump, und schlagen die Welt in Scherben, statt sie zu heilen– ein idealer Nährboden für eine Utopie des selbstbestimmten Lebens? Eine Wendezeit? Oder nicht vielmehr eine Endzeit?
Die Lage ist verstörend. Während die Enthusiasten von Technik und Umsatz davon schwärmen, wie »faszinierend« die kommende Revolution sei, fehlt den meisten Menschen in der westlichen Welt der Glaube. »Die Begriffe Zukunft und Kapitalismus klingen, wenn man sie in einem Atemzug nennt, fremd, als gehörten sie nicht zusammen«, schrieb der Schriftsteller Ingo Schulze schon vor zehn Jahren. Wir träumen nicht mehr von Kolonien auf Mars und Mond und riesigen Städten unter Wasser wie in den Sechzigern und Siebzigern. Die Gesellschaften des Westens haben sich der Gegenwart und dem »Weiter so« verpflichtet, nicht einer verheißungsvollen Entwicklung in der Zukunft. Und doch – während Politiker überall in Europa ihre Wähler in einen Schlafsack aus schönen Worten wie »gemeinsam«, »zuversichtlich« und »uns geht’s gut« betten – reißt die Technik gerade den Boden auf und wälzt alle Lebensverhältnisse um. Die gesellschaftsverändernden »Automaten«, so lange erträumt, sind nun da: vernetzte Computer und Roboter, ernährt von Daten, deren Zahl jedes menschliche Vorstellungsvermögen übersteigt, und eine immer autonomer handelnde künstliche Intelligenz. Sie sind das genaue Gegenteil eines »Weiter so«.
Doch wer entwirft die Bilder dieser neuen Gesellschaft? Wer zeigt auf, was und wie sie zu gestalten ist? Überlassen wir die Zukunft den zu kurz denkenden Gewinnoptimierern wie Google, Amazon, Facebook und Apple? Den unbedarften Trittbrettfahrern der deutschen Liberalen: »Digitalisierung first – Bedenken second«? Verfallen wir den Apokalyptikern, die eine Diktatur der Maschinen voraussagen; Endzeitpropheten, die in den USA den Optimisten längst die Deutungsherrschaft über die Zukunft streitig machen? Oder den Öko-Pessimisten, die den Planeten ohnehin dem Untergang geweiht sehen, weil alles längst zu spät ist?
Utopie und Resignation, Menschheitsversprechen und Menschheitsversagen liegen heute wieder so nahe beieinander wie im späten Mittelalter. Die einen erwarteten das Tausendjährige Reich Christi auf Erden, die anderen die große Auslöschung durch den nächsten Krieg und die Pest. Und gerade jene Gleichzeitigkeit war, wie wir heute wissen, der Anfang eines Neuen, einer Wiedergeburt der Menschlichkeit, der Renaissance. Wenn wir uns heute selbst aus der Vogelschau betrachten, so sehen wir die Menschheit an einem ebensolchen Wendepunkt. Das Verhängnis abwenden aber kann nur, wer an die Chance dazu glaubt; wenn man ausbricht aus der vermeintlichen Logik von Sachzwängen und Alternativlosigkeiten, aus dem Kleinmut und dem verheerenden Wunsch, für das, was man tut, von allen gemocht zu werden. »Politik« und »Utopie« scheinen heute so unvereinbar, als gehörten sie nicht zusammen, wie Schulzes Begriffspaar »Kapitalismus« und »Zukunft«. Doch nur zu wissen, was man nicht will, führt im Leben nicht weiter und die Gesellschaft ins Verderben.
Dieses Buch möchte einen Beitrag dazu leisten, aus dem Fatalismus des unweigerlichen Werdens aus- und zu einem Optimismus des Wollens und Gestaltens aufzubrechen. Es möchte helfen, ein Bild einer guten Zukunft zu malen. Und es möchte zeigen, dass das Heil niemals in der Technik selbst liegt, wie viele Geeks im Silicon Valley glauben, sondern in der Art und Weise, wie wir mit ihr umgehen, ihre Möglichkeiten nutzen und ihre Gefahren rechtzeitig in die Schranken weisen. Mit einem Wort: Nicht die Technik wird über unser Leben entscheiden – was sind schon ein Smartphone oder eine künstliche Intelligenz, die keiner benutzt? –, entscheidend ist die Frage der Kultur. Wir müssen uns fragen, mit welchem Vorverständnis vom Menschen wir die Technik entwickeln und gebrauchen. Soll sie uns helfen oder ersetzen? Haben Menschen tatsächlich einen Optimierungsbedarf? Müssen wir uns nicht an den wahren Bedürfnissen von Menschen orientieren, statt diese der Technik anzupassen? Ökonomie ohne Kultur ist inhuman. Und Kultur ist nicht Kino, Theater, Musik und schmückendes Beiwerk für Besserverdienende, sondern eine Frage von Orientierungen über das, was das Leben lebenswert macht. Kolonien auf Mars und Mond und riesige Städte unter Wasser waren es offensichtlich nicht. Ein Leben, eingesponnen in die Matrix einer Daten-Cloud, wird es auch nicht sein.
Man wird, frei nach T. S. Eliot, die Digitalisierung nicht nur mit dem Gehirn lesen müssen, sondern auch »mit den Eingeweiden und Nervenenden«.[4] Die digitale Zukunft ist nicht algorithmierbar, nur ihre Maschinen. Und segensreich wird sie nicht dann sein, wenn ihre technischen Prophezeiungen sich erfüllen– sondern wenn sie das Leben auf der Erde für so viele Menschen wie möglich tatsächlich lebenswerter macht!
DIE REVOLUTION
Die Techniker haben den Menschen noch nie verstanden, und den Finanzspekulanten ist er egal. Warum also sollten wir die Zukunft ausgerechnet ihnen überlassen?
Das Ende der Leistungsgesellschaft, wie wir sie kannten
Die Umwälzungen
Ein Gespenst geht um in der globalisierten Gesellschaft – das Gespenst der Digitalisierung. Alle Welt sieht das Gespenst, mit frohen Hoffnungen die einen, mit Ängsten und Befürchtungen die anderen. Wo sind die Industrie oder die Dienstleister, die sich nicht von der Digitalisierung betroffen fühlen? Wo die Menschen, die nicht schon jetzt an ihren zweischneidigen Beglückungen und Bespaßungen teilhaben? Zweierlei geht aus dieser Tatsache hervor: Die Digitalisierung wird bereits von allen Volkswirtschaften als Macht anerkannt. Und es ist hohe Zeit zu zeigen, wo die Weichen liegen, die wir jetzt richtig stellen müssen, damit sie sich in einen Segen und nicht in einen Fluch verwandelt. Denn die Zukunft kommt nicht! Mögen die »Zukunftsforscher« noch so selbstsicher von den Podien orakeln – die Zukunft wird von uns gemacht! Und die Frage ist nicht: Wie werden wir leben? Sondern: Wie wollen wir leben?
Der große Barockphilosoph Gottfried Wilhelm Leibniz ahnte nicht entfernt, was er tat, als er Ernst August von Hannover, Herzog von Braunschweig, vorschlug, die ganze Welt in einer Universalsprache zu codieren – einer Sprache aus Einsen und Nullen –, dass diese mathematische Darstellungsweise einst unsere Lebens- und Arbeitswelt revolutionieren würde, die Art, wie wir uns verständigen und wie wir denken. Dass sie zu selbstständig miteinander agierenden Maschinen führen würde, einem Internet der Dinge, zu Robotern und zu einer künstlichen Intelligenz (KI), deren Programmierer davon träumen, jede menschliche Gehirnleistung zu übertreffen.
Vieles davon klingt wie die Erfüllung alter Menschheitsträume. Wir gleiten und surfen durch Zeit und Raum, den Engeln gleich, wir befreien uns von harter und langweiliger Arbeit, wir basteln uns virtuelle Welten, wir überwinden Krankheiten und werden irgendwann uralt, vielleicht sogar fast unsterblich. Doch was passiert eigentlich, wenn man auf diese Weise Wirklichkeit gewinnt und Traum verliert? Was wird aus all den nicht-technischen, geistigen Lebensdimensionen, die vielen Menschen so wichtig sind, dem Irrationalen, dem Unergründlichen, dem Zufälligen, dem Lebendigen? Ruiniert das technische Weltbild nicht all jene Leute, »die von der Seele etwas verstehen müssen, weil sie als Geistliche, Historiker und Künstler gute Einkünfte daraus beziehen«? Und wird die Mathematik, »die Quelle eines bösen Verstandes«, die »Menschen zwar zum Herren der Erde, aber zugleich zum Sklaven der Maschine« machen?[5]
Es ist ein Ingenieur, der diese Fragen stellt, ein aufrichtiger Bewunderer der Mathematik. Der österreichische Schriftsteller Robert Musil bringt mehrere tausend Seiten zu Papier, um zu beschreiben, was die Revolution der Technik mit dem Seelenleben der Menschen macht. Verwandelt sie uns, wie der Titel seines großen Romans nahelegt, in Männer (und Frauen) »ohne Eigenschaften«? Die Zeit, als Musil seinen Roman beginnt, ist geprägt von einer Revolution, die man heute die zweite industrielle Revolution nennt– die Zeit der industriellen Massenproduktion, eingeläutet an den Fließbändern der Ford-Werke. Doch schon Mitte der Zwanzigerjahre sieht Musil eine Entfesselung auf die Menschheit zukommen, die keine Grenzen kennt. Den Weg nämlich zur funktionalen Differenzierung von allem, »zu einer inneren Dürre«, einer »ungeheuerlichen Mischung von Schärfe im Einzelnen und Gleichgültigkeit im Ganzen«, zu einem »ungeheuren Verlassensein des Menschen in einer Wüste von Einzelheiten«. »Welche Verluste«, so fragt er, »fügt das logisch scharfe Denken der Seele zu?«
Wie gleichen sich die Zeiten und die Fragen! Auch heute, am Anfang der vierten industriellen Revolution, werden nahezu alle Lebensbereiche des Menschen umgewälzt. Und wieder ist es innovative Technik, die dies auslöst. Was wird sie, mit Musil gefragt, mit unserem Seelenleben machen? Und was mit unserem Zusammenleben? Wird sie unser kapitalistisches Wirtschaftssystem intensivieren, oder wird sie es durch etwas anderes ersetzen? Die Umwälzungen werden vergleichbar sein mit der ersten und zweiten industriellen Revolution. Die erste verwandelte im 18. und 19.Jahrhundert Agrar- in Industriestaaten, die zweite schuf Anfang des 20.Jahrhunderts die moderne Konsumgesellschaft. Beide Revolutionen wirkten sich langfristig segensreich für sehr viele Menschen aus und legten die Grundlagen für den Erfolg der bürgerlichen Gesellschaft und die spätere soziale Marktwirtschaft. Doch auf dem Weg dorthin gab es die Kollateralschäden unvorhergesehener und völlig unkontrollierter Umbrüche– die Kinder, die in den Kohleschächten Englands ihre Kindheit und oft ihr Leben verloren; die lichtlosen Londoner und Berliner Hinterhöfe des 19.Jahrhunderts mit tuberkulosekranken Menschen, die starben wie die Fliegen auf den Plumpsklos; das Fehlen von Unfall-, Arbeits- und Krankenversicherungen für Menschen, gestrandet in der Großstadt, deren Eltern noch sämtlich Bauern und kleine Handwerker waren. Nicht weniger dramatisch auch die Folgen der zweiten Revolution mit ihrem Kubismus des Lebenswandels. Hochhäuser, Aufzüge, Elektrifizierung und motorisierter Straßenverkehr mochten der Moderne ihren atemlosen Takt vorgegeben haben. Aber sie befeuerten zugleich Überforderung, Abwehrbewegungen und nationalistischen Hass, eskaliert in zwei Weltkriegen.
Einzig die dritte, die mikroelektronische Revolution der Siebziger- und Achtzigerjahre, ging vergleichsweise glimpflich über die Bühne. Doch die vierte wird, so viel scheint gewiss, erheblich größere Ausschläge auf der Richterskala verzeichnen. Denn nicht die Produktionsmaschinen ändern sich diesmal, sondern vor allem die Informationsmaschinen. Die Geschwindigkeit, in der jetzt und in Zukunft Informationen ausgetauscht und vernetzt werden, ist beispiellos in der Geschichte der Menschheit. Die Speicherkapazität von Computerchips hat sich in den letzten zehn Jahren vertausendfacht und wird in den nächsten Jahrzehnten weiter explodieren.
Jeder Bereich unseres Wirtschaftens wird gegenwärtig digitalisiert, von der Beschaffung der Rohstoffe über die Produktion, das Marketing, den Vertrieb, die Logistik bis hin zum Service. Neue Wirtschaftszweige ersetzen alte Domänen. Der sogenannte Plattform-Kapitalismus lässt Kunden ihre Geschäfte selbst führen, auf eBay und mithilfe von Uber, über Airbnb und zukünftig mehr und mehr über Blockchains und FinTechs. Die Dynamik der vielen neuen Geschäftsmodelle ist disruptiv – das Zauberwort der digitalen Revolution. Statt alte Technologie und altbewährte Serviceleistungen Schritt für Schritt zu verbessern, werden sie schlichtweg ersetzt. Der Taxiverkehr weicht Uber, das Hotelgewerbe wird von Airbnb untergraben, das selbstfahrende Auto ersetzt die Höchstleistungsprodukte der konventionellen Autoindustrie. Erhebliche Teile der Fertigung werden in Zukunft additiv durch den 3D-Drucker bewerkstelligt. Das klassische Kundengeschäft der Banken könnte bald hinfällig sein, weil digitalisierter Zahlungsverkehr keine Mittelsmänner und Institutionen mehr braucht. Ein erheblicher Teil der Wertschöpfung ist damit dezentralisiert.
All diese Entwicklungen unterliegen keinem naturgesetzlichen Fortschritt, sondern einer bestimmten Art zu denken und zu wirtschaften: dem Effizienzdenken! Dass Menschen bei allem, was sie herstellen, stets das Ziel verfolgen, ihr Geld zu vermehren, ist keineswegs Teil ihrer biologischen Natur. Wäre dies so, hätte die Menschheit bis in die Renaissance weitgehend gegen ihre eigene Natur gelebt und täte es in manchen Teilen der Welt, etwa im Ituri-Urwald, bei den Massai oder den Mangyan auf den Philippinen noch heute. Zur Leitkultur wird das Kosten-Nutzen-Kalkül erst unter den italienischen Kaufleuten im 14. und 15. Jahrhundert. Noch das Mittelalter kannte das statische Ordnungssystem der Zünfte, feste Preise und Preisabsprachen und einen starken Vorbehalt gegen Dynamik, Wandel und Fortschritt. Veränderungen des Altbewährten waren verhasst, und mächtige Männer der Kirche, wie Thomas von Aquin, gaben sich viel Mühe, sie zu verteufeln. Das Geld hatte einen schlechten Leumund, die Gier danach galt als Sünde, und das Zinsnehmen war verboten. Und selbst wenn Päpste und Fürsten die Regeln oft genug brachen, so war doch der Stillstand und nicht der Fortschritt die Leitideologie der Zeit.
Wenn wir heute mit der vierten industriellen Revolution unser Wirtschaften effizienter machen, so folgen wir dabei einer Logik, die mit dem Ausstellen von Wechseln und der Explosion des Kreditwesens im 15. Jahrhundert begann. Doch erst die Erfindung der industriellen Produktion und später der Massenproduktion hat sie zur Leitkultur gemacht. Seitdem sind Effizienz, Effektivität und Optimierung die Antreiber unserer Ökonomie. Wir nutzen fossile Stoffe wie Erdöl und Kohle und verfeuern sie für den Augenblick. Und dieser ist nie mehr als das neue Gestern. Der Kapitalismus kennt kein Endstadium, sondern immer nur neue Grenzen, die er überwinden muss. Doch nicht nur physische Stoffe, auch metaphysische Stoffe werden ihm zur Ressource. Spätestens seit der zweiten industriellen Revolution gilt uns die Zeit als Geld. Was die Fließbänder bei Ford anschaulich vorführten – die unerbittliche Taktung der Zeit in der Produktion –, gilt heute für unser aller Leben. Die Zeit wird vermessen, sie ist ein kostbares Gut, das wir nutzen sollen und nicht vergeuden. Das Effizienzdenken – oder wie die Philosophie seit Max Horkheimer und Theodor W. Adorno sagt: die »instrumentelle Vernunft« – folgt einer unerbittlichen Verwertungslogik. Und sie wird gnadenloser und immer schneller.
Doch etwas ist ganz neu am Effizienzdenken der vierten industriellen Revolution. Sie wendet die Aufforderung zur Optimierung nicht nur auf Produktionsprozesse an. Nein, sie hält den Menschen selbst für optimierungsbedürftig! Die Propheten des Silicon Valley künden davon, Mensch und Maschine zu verschmelzen. Nur mit einem Chip im Gehirn erscheint ihnen Homo sapiens optimal. Der gegenwärtige jedenfalls gilt als defizitär. Doch wer definiert eigentlich, dass der Mensch optimiert werden muss? Nun gut, die Ansicht, dass dem Menschen etwas fehlt, das er finden oder wiederfinden muss, hat seit Platon in der Philosophie Tradition. Gemeint war jedoch, dass er gerechter und einsichtiger werden sollte. Etwas rücksichtsvoller, bescheidener, friedlicher und liebevoller zu sein könnte unserer Spezies auch nicht schaden. Und die Bedürfnisse nach Geld, Ruhm und Macht könnten besser gezügelt sein – aber all das will die digitale Revolution gar nicht optimieren! Sie möchte Gewinne optimieren! Und »Optimierung« beim Menschen bedeutet, ihn maschinenähnlicher zu machen – also nicht etwa humaner, sondern weniger human!
Infrage gestellt sind also nicht nur ungezählte als ineffektiv gebrandmarkte Wirtschaftsformen, Geschäftsmodelle und Unternehmen. Infrage gestellt ist unser menschliches Selbstverständnis, die »ineffektive« Weise, wie wir leben und zusammenleben und wie wir Politik betreiben. Doch wird der Mensch »besser« und glücklicher, wenn er »smarter« ist und wir »optimierter« miteinander umgehen? Wer sagt eigentlich, dass das Optimum stets in einer Zeitersparnis liegt und in kurzen, unverstellten Wegen? Und werden wir umso individueller, je mehr wir uns der Technik ausliefern? Wer stellt solche Gleichungen auf und zu welchem Zweck? Ist ein transparentes, jederzeit abrufbares Leben lebenswerter als ein undurchsichtiges und unberechenbares?
Bislang, so scheint es, gibt es kein humanes Gegenmodell zu den sterilen und zutiefst inhumanen Fortschrittswelten des Silicon Valley. Und dessen Freiheitsversprechen durch Technologie ist eher ein Weniger an Freiheit gefolgt: die Ausplünderung der persönlichen Daten, die unbemerkte Überwachung und Kontrolle durch Firmen und Geheimdienste, der Druck auf jeden Einzelnen, sich zu optimieren. Je mehr die Benutzeroberflächen unserer Lebenswelt aufpoliert und optimiert werden, umso defizitärer müssen sich die zu Usern verkommenen Menschen tatsächlich fühlen. Irgendwann werden sie in ihren eigenen Augen so dysfunktional, wie sie es aus der Sicht der Maschinenfreunde ohnehin sind. Nicht nur Technologien wie Diafilme, Autos und Platten, Kassetten, Disketten und CDs sterben aus, nicht nur Firmen wie Nokia, Kodak, VW, die Commerzbank und die HUK-COBURG. Und nicht nur Firmen- und Verwaltungsgebäude bleiben als sichtbare Ruinen des Fortschritts zurück wie einstmals Kohlegruben und Stahlwerke – auch unsere Lebenserinnerungen, unsere Lebensstile und viel zu altmodischen Biografien scheinen nicht mehr in die Technosphäre der Zukunft zu passen.
*
Noch beschränkt sich die öffentliche Diskussion vor allem auf die Arbeitswelt. Politprofis, Popstars, Poeten, Propheten und Professoren debattieren auf Bühnen und Foren, Kongressen und »Summits« über die Zukunft der Arbeit. Zwei Lager stehen einander gegenüber, deren Prognosen konträrer kaum sein könnten. Die einen sehen Zeiten der Vollbeschäftigung voraus. Hat nicht der technische Fortschritt immer die Produktivität erhöht und die Produktivität die Anzahl der Arbeitenden? Sie könnten dabei auf den US-amerikanischen Nobelpreisträger Robert Solow verweisen. Nach seinem Aufsatz »A Contribution to the Theory of Economic Growth« von 1956 hat der technische Fortschritt stets eine gewaltige Produktivitätssteigerung ermöglicht. Nicht Arbeit und Kapital, sondern vielmehr die Technik sei der entscheidende Wachstumsfaktor. Was also spricht dagegen, auch diesmal von mehr Produktivität, mehr Wachstum und mehr Beschäftigung auszugehen?
Untermalen lässt sich diese Haltung gut mit einem wissenden Lächeln. Sagte nicht der britische Ökonom John Maynard Keynes im Jahr 1933 voraus, der Fortschritt in den Industrieländern würde zu einer Massenarbeitslosigkeit führen? Weil »wir schneller Möglichkeiten erfinden, die Arbeit effizienter zu gestalten, als dass uns neue Beschäftigungsfelder für die überflüssig gewordenen Arbeitskräfte einfallen«? Und ist es nicht ganz anders gekommen? Man kann auch ein hübsches Bild dazu zeigen, den Titel des Spiegel vom 17. April 1978: »Fortschritt macht arbeitslos. Die Computer-Revolution.« Ein unfreundlicher Roboter hält einen schlaffen Bauarbeiter an der Hakenhand. »Winzige elektronische Bausteine bedrohen Millionen von Arbeitsplätzen in Industrie und Dienstleistungsgewerbe«, heißt es im Text. Doch wieder war es nichts mit der düsteren Prophezeiung. Und 1995 verhieß der US-amerikanische Soziologe und Ökonom Jeremy Rifkin »das Ende der Arbeit«, das immer noch auf sich warten lässt.
Dampfmaschine, Spinnmaschine, Elektrifizierung und Elektronik – nie wurde die Arbeit langfristig weniger, sondern immer wurde sie mehr. Der optimistische Zukunftsfreund lässt sich heute von Nüchternheit beseelen und misstraut den Propheten. Visionen hält er für überflüssig, weil man beim Thema Zukunft ohnehin nie aktuell sein kann und niemand eine Glaskugel hat. So gibt man sich dem Lauf der Welt unhinterfragt hin, spottet über die Vordenker von übermorgen und glaubt an nichts außer an die vielen kleinen Fakten, Zahlen und Kurven, die der technische Fortschritt täglich schafft.
Die Propheten von gestern sind die Deppen von heute. Also, alles nur falscher Alarm, wenn das Weltwirtschaftsforum in Davos 2016 verkündete, die digitale Revolution werde die Industrieländer in den kommenden fünf Jahren fünf Millionen Jobs kosten? Oder gar jene gespenstischen Zahlen, mit denen der Oxford-Professor Carl Frey operiert, wenn er für die USA die Hälfte aller derzeitigen Jobs im radikalen Wandel oder abgeschafft sieht? Zum gleichen Ergebnis kommt seine umfangreiche mit Michael Osborne verfasste Studie über die Zukunft der Arbeit. Danach verlieren die am weitesten entwickelten Länder der Erde in den nächsten fünfundzwanzig Jahren 47 Prozent ihrer Jobs.[6]
Keine dieser Zahlen, das wissen ihre Urheber auch, ist verlässlich. Aber ist es denn nicht naheliegend oder sogar äußerst wahrscheinlich, dass Millionen von Buchhaltern, Finanzbeamten, Verwaltungsfachleuten, Juristen, Steuerberatern, Lkw-, Bus- und Taxifahrern, Bankangestellten, Finanzanalysten, Versicherungsagenten und so weiter schon bald nicht mehr gebraucht werden? Jede Tätigkeit, deren Routinen algorithmierbar sind, ist prinzipiell ersetzbar. Semantische Suchmaschinen wie »Watson« von IBM fertigen Filmtrailer an oder drucken medizinische und juristische Expertisen aus. Selbstfahrende Autos sind längst Realität und werden unseren herkömmlichen Straßenverkehr mit selbstfahrenden Fahrern in absehbarer Zeit weitgehend ersetzen. Ob Fahrer- oder Schreibtischberuf, Frey und Osborne listen mehr als siebenhundert Tätigkeiten auf, die teilweise oder ganz von Computern übernommen werden können.
Was früher Ausbildungsberufe waren, erledigen in Zukunft Roboter. Und vieles, was ehedem Fachkräfte machten, erledigen die Kunden an ihren Flachbildschirmen selbst. Die Entwicklung zum »Prosumenten«, zum produzierenden Konsumenten, ist älter als die Digitalisierung. Man erinnere sich, wie in Deutschland seit den Sechzigerjahren Supermärkte den Einzelhandel mit Lebensmitteln ersetzten. Der Discounter war nicht nur billiger, weil er größer war, sondern auch, weil Kunden sich nun selbst bedienten und damit Personal eingespart wurde. Das Gleiche gilt für den Kaffee- wie den Fahrkartenautomaten in den Achtziger- und Neunzigerjahren und für die Selbstbaukünste des IKEA-Käufers. Das Prinzip des »arbeitenden Kunden« im digitalen Zeitalter ist nichts als die konsequente Fortführung dieser »Selbstbedienung«: Reisen buchen, am Flughafen einchecken, Kleider und Bücher bestellen, Überweisungen ausführen und so weiter.
Doch wo auch immer jemand in Zukunft auf die Rückseite eines Flachbildschirms guckt, auf dessen Vorderseite jemand etwas ausführt, was man selbst kann, verschwindet dessen Berufsprofil. »Flachbildschirmrückseitenberatungsjobs«, so der Mathematiker und ehemalige IBM-Manager Gunter Dueck, sterben aus. Und der Plattform-Kapitalismus kann mit allem handeln: mit Gegenständen, Übernachtungen, Kommunikation, Verkehr, Energie, Finanztransaktionen, Ernährung, Lebensberatung, Partnersuche und Bespaßung– und all das ohne Fachpersonal. Der Siegeszug der »Automaten«, von Oscar Wilde erträumt, scheint unaufhaltsam.
Aber werden nicht auch gleichzeitig neue Beschäftigungsverhältnisse geschaffen? Zumindest eine Zeit lang könnten die UPS-Fahrer von heute in Zukunft Drohnen bestücken, statt Pakete auszufahren. Aber nur so lange, bis auch solche Tätigkeiten robotisiert sind. Die Niedriglohnjobs der digitalen Revolution dürften vielleicht noch ein bis zwei Jahrzehnte bestehen– doch auch ihre Zeit läuft ab.
Als Berufe der Zukunft dagegen gelten heute Informatiker und Techniker. Derzeit sind sie heiß begehrt und werden von den Firmen händeringend gesucht. Wer der deutschen Wirtschaft Mut machen will, der sieht Heerscharen von IT-Experten heraufziehen und Deutschland in die Vollbeschäftigung führen. Doch auch hier lohnt sich der genaue Blick. Beileibe nicht jeder besitzt für solche anspruchsvollen und spezialisierten Tätigkeiten die Befähigung, und die Studienabbruchquote in der Informatik ist enorm. Des Weiteren werden langfristig nicht flächendeckend Informatiker gesucht, sondern nur die besten. Denn wenn die künstliche Intelligenz eines in Zukunft mit Sicherheit können wird, dann ist es Programmieren. Nur besonders hoch qualifizierte Spezialisten werden in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) dauerhaft gebraucht: Webdesigner für virtuelle Welten oder Menschen, die Roboter bauen, warten und reparieren und neue Geschäftsideen entwickeln. Der »normale« Informatiker hingegen ist mittel- bis langfristig wahrscheinlich ersetzbar.
In solcher Lage beruhigen auch die Expertisen wie jene der MIT-Technologie-Experten Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee nicht. Beschwichtigend weisen sie darauf hin, dass »über kurz oder lang« das automatische Google-Auto noch nicht auf allen Straßen fahren kann und dass es »noch jede Menge menschliche Kassierer, Kundenbetreuer, Anwälte, Fahrer, Polizisten, mobile Pflegekräfte, Manager und andere Arbeitnehmer« gibt.[7] »Und sie laufen keinesfalls alle Gefahr«, hinweggeschwemmt zu werden. Kurz gesagt, es wird »nicht alle Beteiligten treffen«.[8] Ein bisschen Arbeit für Menschen bleibt noch übrig. Doch wen soll das beschwichtigen? Dass die Arbeit noch nicht für alle ausgeht, dürfte keinen Politiker zur Ruhe ermuntern. In Ländern wie Deutschland dürfte es vermutlich ausreichen, wenn bereits ein Zehntel aller für Geld Beschäftigten ihre Erwerbsarbeit verlieren, und die sozialen Folgen wären katastrophal. Die MIT-Experten aber raten dazu, einfach seelenruhig weiter aufs alte Wirtschaftsmodell zu setzen und zu versuchen, so viel Wachstum wie möglich zu erzeugen.
Wer Brynjolfssons und McAfees Buch The Second Machine Age gelesen hat, kann über solche Empfehlungen nur staunen. Immerhin erklärt es der Welt, dass die Digitalisierung unser gesamtes Wirtschaftsmodell aushebelt und durch ein neues ersetzt. Die Autoren geraten ins Schwärmen, wenn sie von den neuen Maschinen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz berichten. Keine Fantasie scheint auszureichen, sich diese völlig veränderte Welt vorzustellen. Doch wenn es um Menschen geht, um Gesellschaft und Politik, ist mit der Fantasie sofort Schluss. Hat nicht die erste industrielle Revolution das Leben der Menschen völlig umgekrempelt und ein ganz neues Gesellschaftsmodell, die bürgerliche Demokratie, hervorgebracht, wo vorher Kirche und Adel herrschten? Die MIT-Experten dagegen meinen, trotz eines vergleichbar großen Umbruchs ginge es ewig mit unserem gegenwärtigen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell weiter. Der Arbeitsmarkt ließe sich mit mehr Investitionen in Bildung, höheren Lehrergehältern, Impulsen für Start-ups und schnelleren Netzen ausgleichen. So etwas hören Arbeitgeberverbände gern. Tatsächlich aber erinnert die Niedlichkeit solcher Vorschläge an die Zivilschutzfilme der Sechzigerjahre, als man Menschen empfahl, sich im Falle eines Atomkriegs mit Sandsäcken zu verbarrikadieren, sich flach auf den Boden zu legen und die Aktentasche über den Kopf zu halten.
Selbstverständlich wird es auch neue Berufe in der Zukunft geben. Es fragt sich nur, wie viele? Und sie entstehen wohl weniger im Niedriglohnsektor als in der Hochleistungs-IT und in drei anderen Bereichen: Das eine ist der quartäre Sektor der höherrangigen Dienstleistungsberufe. Einen Flughafen rechtzeitig fertig zu bauen bleibt offenbar auch im Digitalzeitalter eine spannende Herausforderung. Projektmanagement und Logistik sind Zukunftsberufe. Zu bunt das Leben, zu widrig die Umstände, zu unberechenbar die Menschen, als dass solche Aufgaben allein Maschinen übertragen werden können. Immerhin kommt auch die Enterprise im 24. Jahrhundert nicht ohne Personal aus …
Der zweite Bereich betrifft all jene Berufe, in denen Menschen auch in Zukunft Wert darauf legen, mit realen Menschen zu tun zu haben. Sicher ist es technisch möglich, Kindergärtnerinnen und Lehrer irgendwann durch Roboter und Computerprogramme zu ersetzen. Aber es ist weder wünschenswert noch wahrscheinlich. Authentische Ansprache, Teilnahme und Fürsorge bleiben ein wertvolles Gut. Das Gleiche gilt für Sozialarbeiter, Bewährungshelfer und Therapeuten. Ein echter Mensch an der Rezeption eines Hotels, als Animateurin im Urlaub, als charmanter und kompetenter Verkäufer, als Landschaftsarchitekt, Innenausstatter, Friseur und so weiter ist kaum ersetzbar. Nicht anders bei unserer Gesundheit. Gewiss, ein intelligentes Messgerät am Handgelenk, verbunden mit einem Universitätsklinikum, kann das Leben eines Diabetikers schützen und retten. Und es kann jedermann und jeder Frau den Blutdruck messen, weit zuverlässiger als die Momentaufnahme des Hausarztes. Aber brauchen wir nicht doch einen Menschen, mit dem wir über unsere körperliche und psychische Befindlichkeit reden möchten? Einen Menschen, der uns nackt ansieht, ohne rot zu werden oder betreten zur Seite zu schauen? Jemand, der uns nicht danach bewertet, ob wir gut aussehen, sondern der sich auch dann unserer annimmt, wenn wir es nicht tun? Was der Hausarzt an technischer Überlegenheit verliert, wächst ihm auf der menschlichen Seite an Verantwortung zu. Vielleicht wird der Life Scout der Zukunft tatsächlich wieder ein »Hausarzt« – ein Mensch, der zu Ihnen nach Hause kommt, Ihr Biotop kennt, Ihnen zuhört und sich um Sie kümmert – psychisch wie physisch. Freizeit, Erholung und Gesundheit sind jene Felder, in denen der Bedarf an guten Kräften hoch bleibt.
Zu den Gewinnern der Zukunft dürfte ebenso das Handwerk gehören. Denn je weniger Dienstleistungen es noch gibt, für die bislang ein Abitur oder ein Studium erforderlich waren, umso stärker wird all das aufgewertet, das solche akademischen Bescheinigungen nicht braucht. Produkte von der Stange liefert in Zukunft der 3D-Drucker und bedroht damit Geschäftsmodelle wie das von IKEA. Gutes Handwerk, ein von einem Menschen gewerkelter Tisch oder ein gut verlegter Steinfußboden, wird in Zukunft wertvoller und teurer denn je. In den 3D-Shops, in denen man seine fremd- oder selbst gebastelten Güter ausdruckt, werden geschickte Handwerker benötigt, die alles zusammensetzen oder abändern. Und auch die Roboter in den Haushalten der Zukunft brauchen jemanden, der sie repariert.
Nichtsdestotrotz dürfte die Tendenz klar sein. Sehr viele Berufe fallen in Zukunft weg. Von den »Jobs« des Niedriglohnsektors über einfache bis zu vergleichsweise anspruchsvollen Dienstleistungsberufen. Und selbst wenn wir viele Berufe des neuen Arbeitsmarkts noch nicht kennen – daran zu glauben, dass die Beschäftigung konstant bleibt oder gar steigt, ist fahrlässig bis irrsinnig. Denn die Digitalisierung – und das unterscheidet sie von früheren industriellen Revolutionen – erobert kein neues Terrain, sondern sie macht bestehendes effektiver. Das Solow-Modell, wie alle ökonomischen Weisheitslehren, ist kein Naturgesetz. Sehr wahrscheinlich ist, dass die Digitalisierung die Produktivität gewaltig beflügeln wird – auch wenn Solow hier persönlich skeptischer war als sein Theoriemodell. Aber was die Beschäftigung anbelangt, so muss diese nicht zwangsläufig dann steigen, wenn die Produktion sich erhöht.
Mindestens zwei Gründe sprechen stark dagegen. Die drei bisherigen industriellen Revolutionen gingen einher mit der Globalisierung. Als James Hargreaves 1764 die Spinnmaschine erfand, fuhren die englischen und niederländischen Ost- und Westindiensegler bereits seit hundertfünfzig Jahren über die Weltmeere und handelten mit Gewürzen, Sklaven und – Baumwolle. Was die neue Technologie effektiv machte – das Spinnen von Baumwolle –, versorgte der globale Handel mit gewaltigem Nachschub. Noch waren die weit entfernten Länder nur Rohstofflieferanten, doch der Imperialismus entdeckte davon immer mehr. Was wäre der Kraftfahrzeugbau der zweiten industriellen Revolution ohne den Kautschuk, den Rohstoff für Gummi, den die Belgier unter barbarischen Umständen aus dem Kongo heranschafften? Die dritte industrielle Revolution machte Südostasien zur verlängerten Werkbank der Textilindustrie, Brasilien und Argentinien zu Tierfutterproduzenten. Billige Fertigung und neue Absatzmärkte für Autos, Maschinen und Unterhaltungselektronik gingen Hand in Hand.
In gleichem Maße wie die Wirtschaft effektiver produzierte, vergrößerte sich das verfügbare Volumen von Rohstoffen und Absatzmärkten. Doch genau dieser Prozess gerät heute ins Stocken. Der Kampf um die letzten natürlichen Ressourcen wird aktuell vom sogenannten Westen und von China gleichzeitig geführt. Wo früher wenige Länder unter sich waren, konkurrieren heute die Volkswirtschaften von mehr als zwei Milliarden Menschen. Und dass völlig unterentwickelte Länder wie der Kongo, die Zentralafrikanische Republik, der Südsudan, Somalia oder Afghanistan künftig zu Tigerstaaten werden, denen die westlichen und fernöstlichen Hochleistungsländer ihre Produkte in Massen verkaufen werden, dürfte keiner glauben. Anders als bei den früheren technischen Revolutionen ist der Kuchen heute verteilt – es kommt nichts hinzu, was bei effektiverer Produktion zu mehr Beschäftigung führt!
Apropos Produktion – der besondere Reiz vieler digitaler Geschäftsmodelle liegt darin, dass sie im herkömmlichen Sinne gar nichts produzieren! Dies ist der zweite Einwand. Geschäfte über eine Plattform zu machen, statt über herkömmliche Firmen oder Banken, erzeugt keinen Mehrwert. Das Gleiche gilt für das gezielte Bewerben des Konsumenten durch Ausschlachten von Personendaten. Unternehmerische Gewinne und volkswirtschaftlicher Nutzen von Maschinen, Autos, Flugzeugen, Bahntrassen, Straßen, Gebäuden und so weiter lassen sich zueinander in Bezug setzen. Die Gewinne von Facebook und Google zu ihrem volkswirtschaftlichen Nutzen nicht. Große Datenbestände maschinell zu verknüpfen und Entscheidungen aufgrund automatisierter Algorithmen zu treffen ist ein Riesengeschäft – fragt sich nur, für wen. »Wohlstand für alle« schafft das nicht unbedingt, auch frappierend wenig Arbeitsplätze. Bei eBay in Deutschland arbeiten bei drei Milliarden Euro Umsatz gerade mal achtzig Beschäftigte, bei YouTube sind es noch viel weniger!
Die Folgen wurden oft genug beschrieben: Ohne staatliche oder – besser noch – überstaatliche Ordnungspolitik und kluge politische Entscheidungen verstärkt die Digitalisierung vor allem Armut und Reichtum! Unreguliert vertieft sie den Keil in die Gesellschaft, den Soziologen seit Jahren ohnehin diagnostizieren und bemängeln: die Teilung der Mittelschicht in eine obere und eine untere Mittelschicht – fein geschieden durch Kapitalerträge, Erbschaften und ungleiche Bildungschancen ihrer Kinder. Und bereits die böse Vorahnung auf das Kommende wirbelt gegenwärtig viel braunschwarzen Bodensatz auf.
Doch wer nimmt die Lage tatsächlich entsprechend ernst? Auf den Podien der Wirtschaftsforen tummeln sich Zukunfts- und Trendforscher und fordern zum ganz schnellen Umdenken auf. Sie predigen die Berufe der Zukunft: Storyteller, Networker und Coaches, also Märchenerzähler, Strippenzieher und Betreuer – so als wenn eine Volkswirtschaft tatsächlich davon leben könnte! Nicht unberechtigt ermahnen sie junge Menschen zum Mut, »Entrepreneure« zu werden und ihr Boot nicht im vermeintlich sicheren Hafen großer Unternehmen zu vertäuen. Sie beklagen zu Recht, dass es in Deutschland an einer »Fehlerkultur« mangele, weil niemand scheitern dürfe. Ebenso richtig ist, dass wir zu sehr auf exzellente Noten und auf immer mehr Studien- und Fachabschlüsse setzen, statt zu fragen, was jemand wirklich kann. Und doch fehlt denen, die eine Inventur deutscher Gepflogenheiten fordern, viel zu oft das politische Denken. Ohne dieses ist alles, was in fast jedermanns Ohr wohl klingt, nicht mehr als ein Versuch, mit der Luftpumpe die Windrichtung zu ändern.
Politiker müssen mehr und anderes tun, als nur Bürokratie abzubauen. Was nützt es, wenn viele junge Deutsche den Mut zum Start-up aufbringen, wenn die sehr wenigen, die damit Erfolg haben, sofort von einem der fünf großen US-amerikanischen Softwareunternehmen gekauft werden? Was tatsächlich fast überall passiert. Welches volkswirtschaftliche Problem ist damit gelöst, welche Arbeitsplätze werden damit geschaffen oder gesichert? Ein kurzer Blick über den Atlantik belehrt unmissverständlich darüber, dass eine hochinnovative Digitalwirtschaft von sich aus keine Volkswirtschaft rettet. Während das Silicon Valley boomt, stirbt die klassische Industrie überall dahin und produziert Arbeitslosigkeit, Resignation und Trump-Wähler. Des Weiteren wird auch der kühnste Optimist nicht glauben, dass deutsche Unternehmen (mit Ausnahme vielleicht von SAP) in der Softwareentwicklung oder in sozialen Netzwerken dem Silicon Valley unter gegenwärtigen politischen Bedingungen ernsthaft Konkurrenz machen können, ohne sofort einverleibt zu werden.
*
Fast ein Jahrhundert hat es gebraucht, bis der ausgebeutete Hinterhof-Proletarier des 19. Jahrhunderts zum abgesicherten Arbeiter mit mehr als nur bescheidendem Wohlstand wurde. Nicht allein Unternehmergeist, sondern auch die auf Druck neu eingeführte Sozialgesetzgebung hat maßgeblich dazu beigetragen. Doch wer die Politik der Bundesregierung in den letzten Jahren, insbesondere des sozialdemokratisch geführten Arbeitsministeriums betrachtet, fahndet vergeblich nach guten Ideen. Sicher gibt es Menschen, die sich über einen Mindestlohn freuen, und ja, Flächentarifverträge nutzen vielen Arbeitern und Angestellten. Doch sie werden nichts davon haben, wenn es ihre Arbeitsplätze in ein bis zwei Jahrzehnten nicht mehr gibt. Was folgt auf die Gewerkschaften, wenn immer weniger Menschen angestellt arbeiten, sondern stattdessen gegeneinander ihre Arbeitskraft auktionieren? Wer steht ihnen bei und stiftet gute alte Solidarität in einer völlig neuen Welt?
Was heute und morgen ökonomisch dahinschmilzt, betrifft psychologisch das Selbstwertgefühl von Millionen Menschen. Noch definieren sie ihre Leistungsfähigkeit als Tugend, genauer als »Tüchtigkeit« im Sinne einer strebsamen Arbeitsethik. Doch wir gehen Zeiten entgegen, in denen möglicherweise für sehr viele Menschen keine Arbeit mehr existiert – jedenfalls keine, für die jemand Lohn in Form von Geld zahlt. Für unser gegenwärtiges Sozialsystem wäre dies das Ende. Immer weniger Arbeitende müssen immer mehr einzahlen – bis zur Absurdität. Was wird dann aus der Arbeitsgesellschaft?
Drehen wir die Frage um. Warum sollte unsere bisherige sogenannte Leistungsgesellschaft weiter fortbestehen? Und was ist eigentlich schlimm daran, wenn langweilige und entfremdete Arbeit wegfällt, solange die Produktivität dadurch steigt?
Seit Homo habilis und Homo erectus die ersten Faustkeile zurechtklopften, träumte der Mensch davon, so viel Arbeit wie möglich durch die Technik einzusparen. Bedauerlicherweise halfen dazu selbst die drei industriellen Revolutionen der Vergangenheit nicht weiter. Die Produktivität erhöhte sich, aber mit ihr wurden, wie gezeigt, zugleich immer mehr Arbeitskräfte benötigt. Vom Fortschritt zu weniger und angemessenerer Arbeit keine Spur! Noch im 19. Jahrhundert lebten 80 Prozent der Bevölkerung in England, Frankreich und Deutschland nicht besser als die Sklaven im antiken Rom. Sie waren politisch und privat nahezu rechtlos und starben mehr oder weniger schnell einen Tod durch Arbeit und Krankheit. Wie schön die Welt des Fabrikarbeiters nach der zweiten industriellen Revolution aussah, zeigt der Film Moderne Zeiten von Charlie Chaplin. Der Arbeiter – nur ein Rad in einer großen Maschine. Wer trauert heute schon um die Arbeitswelt von früher? Um die Bergwerke und Stahlhöllen des späten 19. Jahrhunderts oder die Knochenarbeit auf den Feldern? Und wer wird in hundert Jahren den ungezählten langweiligen Bürojobs hinterhertrauern, die jetzt verloren gehen? Oder dem lauten, stinkenden und gefährlichen Straßenverkehr?
Weniger zu arbeiten oder gar nicht mehr für Lohn arbeiten zu müssen, ist ein Versprechen und kein Fluch – jedenfalls dann, wenn man in einer Kultur lebt, die sich entsprechend weiterentwickelt. Denn dass der Wert des Menschen abhängig ist von seiner Arbeitsleistung gegen Geld, ist keine anthropologische Konstante. Es ist ein ziemlich englisches Konzept des 17. Jahrhunderts, verbunden mit Namen wie William Petty, John Locke, Dudley North oder Josiah Child. Über Jahrtausende der Menschheitsgeschichte kannten Gesellschaften andere Tugenden und soziale Distinktionen. Warum sollten wir auf einer viel höheren Stufe der Produktivität nicht auch zu neuen Tugendbegriffen finden?
Zum Problem wird Technologie also nicht schlichtweg dadurch, dass sie Lohnberufe ersetzt. Sondern vor allem dann, wenn sie unkontrolliert und zu unsittlichen Zwecken angewendet wird. Erschreckenderweise ist dies bei derzeit mächtigen Geschäftsmodellen leider oft der Fall. Die Informatiker, Programmierer und Netzwerkdesigner der Gegenwart arbeiten nicht an einer besseren Zukunft, sondern für den Gewinn weniger. Und sie verändern unser Leben und Zusammenleben ohne jede demokratische Legitimation. Das hunderttausendfach wiederholte Versprechen ist, unser Leben einfacher zu machen und nicht demokratischer. Und schon das Versprechen des einfacheren Lebens ist uneinlösbar. Noch hat jeder Versuch, die Komplexität des Lebens zu verringern, diese weiter erhöht.
Was wir der digitalen Technik und ihren Treibern tatsächlich verdanken, ist eine immer globalere Einheitszivilisation. Der digitale Code setzt sich spielend über Länder- und Kulturgrenzen hinweg und ebnet sie ein in einer technischen Universalsprache aus Einsen und Nullen, am Nil ebenso verständlich wie am Rhein und am Amazonas. Was winkt, ist die globale Einheitskultur mit alldem, was sich daran an Gewinnen bejubeln und an Verlusten betrauern lässt.
Kulturell betrachtet ist jeder Fortschritt zugleich ein Rückschritt. Die Biodiversität menschlicher Kultur wird immer kleiner. Der Prozess begann mit dem Siegeszug des Effizienzdenkens, verstärkt durch sein mächtigstes Mittel: das Geld – der einzigen Sache, deren Qualität sich allein nach der Quantität bemisst. Wo das Geld regiert, verschwinden die Grenzen, aus beschaulichen Wochenmärkten wurden unübersehbare globale Märkte für Rohstoffe, Fertigprodukte und Spekulationen. Man tauscht Kultur gegen Wohlstand. Unsere Lebensweisen gleichen sich einander an, erst in Europa und Nordamerika, dann in Asien und dem Rest der Welt. Auch die sozialen Unterschiede und Traditionen werden durch das Geld genichtet. Adlig oder bürgerlich, katholisch, protestantisch oder buddhistisch, Araber, Inder oder Deutscher, Frau oder Mann – das Geld macht keine Unterschiede, außer Arm und Reich. Wenn heute die Welt »flach« wird, wie der New York Times-Kolumnist Thomas Friedman 2005 in seinem Weltbestseller Die Welt ist flach kündete, dann ist sie nicht nur flach wie ein Bildschirm, sondern auch flach an Kultur.[9]
Die Logik zur Einheitlichkeit ist die Logik des Geldes. Seit seiner Erfindung bei den Lydern im 6.vorchristlichen Jahrhundert versucht es seine materiellen Grenzen zu sprengen. Entspricht der Wert des Geldes am Anfang noch seinem Materialwert, wird es nach und nach zum reinen Symbol. Spätestens mit der Einführung von Wechseln im 15.Jahrhundert und von Banknoten im frühen 18.Jahrhundert befreit sich das Geld völlig vom Realwert und wird virtuell. Kein Wunder, dass es sich in Kürze in den Industrieländern als Gegenstand auflöst und rein sphärisch wird: als bargeldloser Zahlungsverkehr ohne irdischen Gegenwert, bewegt von Computern ohne Seele in den Millisekunden des Hochfrequenzhandels.
Getrieben vom Effizienzdenken, das von Florenz aus über London und die Bucht von San Francisco die Welt für sich eingenommen hat, ebnen sich die globalen Unterschiede ein. An deren Ende steht das Bild des schlecht gekleideten Turnschuh-Entrepreneurs, der keinen Stil, keine Haltung, keine Tradition mehr hat und verkörpert. Sein Versprechen an die Menschheit ist, dass jeder, wenn er denn schon in keiner eigenen Kultur mehr lebt, zumindest in seiner eigenen Welt leben darf: selbst generiert durch die Suchbewegungen im Netz, den Spuren und Pfaden im virtuellen Sand. Was früher der Widerständigkeit des Lebens ausgesetzt war, verwandelt sich in ein narzisstisches Spiegelkabinett, sorgsam gewartet von gesichtslosen Profiteuren im Hintergrund.
Wenn diese Welt aus Welten bei vielen einen Schauder auslöst, dann deshalb, weil sie doppelt paradox ist. Weithin sichtbar baut sie die Hierarchien ab
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: