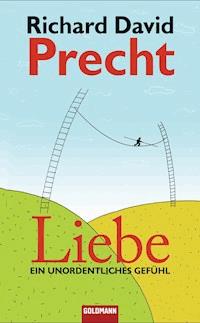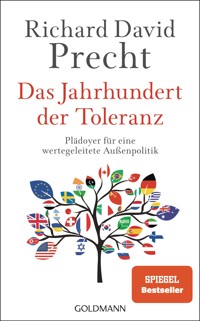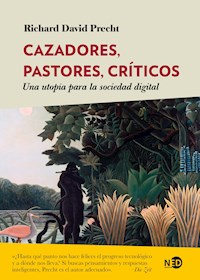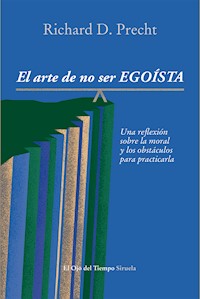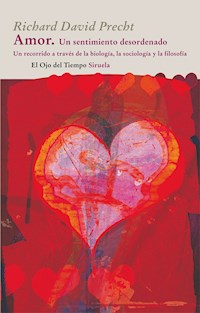18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Geschichte der Philosophie
- Sprache: Deutsch
Richard David Precht erklärt uns in fünf Bänden die großen Fragen, die sich die Menschen durch die Jahrhunderte gestellt haben.
Im ersten Teil seiner auf fünf Bände angelegten Geschichte der Philosophie beschreibt Richard David Precht die Entwicklung des abendländischen Denkens von der Antike bis zum Mittelalter. Kenntnisreich und detailliert verknüpft er die Linien der großen Menschheitsfragen und verfolgt die Entfaltung der wichtigsten Ideen – von den Ursprungsgefilden der abendländischen Philosophie an der schönen Küste Kleinasiens bis in die Klöster und Studierstuben, die Kirchen und Machtzentren des Spätmittelalters. Dabei bettet er die Philosophie in die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen der jeweiligen Zeit ein und macht sie auf diese Weise auch für eine größere Leserschaft lebendig. Ein Buch, das dazu hilft, sich einen tiefen Einblick in die Geschichte der Philosophie zu verschaffen und die Dinge zu ordnen. Tauchen Sie ein in die schier unerschöpfliche Fülle des Denkens!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 821
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Text zum Buch
Im ersten Teil seiner auf drei Bände angelegten Geschichte der Philosophie beschreibt Richard David Precht die Entwicklung des abendländischen Denkens von der Antike bis zum Mittelalter. Kenntnisreich und detailliert verknüpft er die Linien der großen Menschheitsfragen und verfolgt die Entfaltung der wichtigsten Ideen – von den Ursprungsgefilden der abendländischen Philosophie an der schönen Küste Kleinasiens bis in die Klöster und Studierstuben, die Kirchen und Machtzentren des Spätmittelalters. Dabei bettet er die Philosophie in die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen der jeweiligen Zeit ein und macht sie auf diese Weise auch für eine größere Leserschaft lebendig. Ein Buch, das dazu hilft, sich einen tiefen Einblick in die Geschichte der Philosophie zu verschaffen und die Dinge zu ordnen. Tauchen Sie ein in die schier unerschöpfliche Fülle des Denkens!
Über den Autor
Richard David Precht, geboren 1964, ist Philosoph, Publizist und Autor und einer der profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Er ist Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Von 2011 bis 2023 war er zudem Honorarprofessor für Philosophie an der Leuphana Universität Lüneburg. Seit seinem sensationellen Erfolg mit »Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?« waren alle seine Bücher zu philosophischen oder gesellschaftspolitischen Themen große Bestseller und wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Seit 2012 moderiert er die Philosophiesendung »Precht« im ZDF und diskutiert zusammen mit Markus Lanz im Nr.1-Podcast »LANZ & PRECHT« im wöchentlichen Rhythmus gesellschaftliche, politische und philosophische Entwicklungen.
Richard David Precht
ERKENNEDIEWELT
Eine Geschichte der Philosophie
Band 1
Antike und Mittelalter
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2015 by
Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: Uno Werbeagentur, München
Covermotiv: akg-images
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-15563-6V005
www.goldmann-verlag.de
Den vielen weltklugen und gebildeten iranischen Taxifahrern in Köln
The Universe is made of stories, not of atoms.
Muriel Rukeyser
Inhalt
Einleitung
Die Schule von Athen
PHILOSOPHIE DER ANTIKE
Es war einmal in Ionien…
Das Maß aller Dinge
Die menschliche Natur
Der Vagabund, sein Schüler und die öffentliche Ordnung in Athen
Schein und Sein
Geld oder Ehre? Platons Staat
Die Ordnung der Dinge
Eine artgerechte Moral
Aussteiger und Zweifler
Das richtige Leben im falschen
Legitimation und Verzauberung
Augustinus oder die Gnade Gottes
PHILOSOPHIE DES MITTELALTERS
Im Schatten der Kirche
Sinn und Zweck der Schöpfung
Die Entzauberung der Welt
Götterdämmerung
ANHANG
Ausgewählte Literatur
Antike
Mittelalter
Dank
Personenregister
Sachregister
Bildnachweis
Einleitung
Es freut mich sehr, dass Sie zu diesem Buch gegriffen haben. Und wahrscheinlich wissen Sie noch nicht einmal genau, auf welche lange und abenteuerliche Reise durch die Philosophie Sie sich hierbei eingelassen haben. Falls Sie vorhaben, den Weg, den Sie soeben beschritten haben, weiterzugehen, werden Sie durch viele abwechslungsreiche Landschaften des Geistes spazieren: von den Ursprungsgefilden der abendländischen Philosophie an der schönen Küste Kleinasiens bis in die Klöster und Studierstuben, die Kirchen und Universitäten des Spätmittelalters. Die beiden folgenden Bände werden Sie dann durch ganz Europa bis in jene Welt führen, in der Sie heute leben.
Ich werde mich dabei auf die abendländische Philosophie beschränken, wohl wissend, dass Kulturen wie Persien, China, Indien und andere eine eigene bedeutende Philosophiegeschichte haben. Doch um darüber zu schreiben, muss man diese Kulturen sehr genau kennen und ihre Sprachen beherrschen. Zudem würde ein solches Projekt leicht uferlos. Selbst wenn man sich auf das Abendland beschränkt, ist es eine gewaltige Herausforderung, dafür zu sorgen, dass der Leser in der Fülle des Materials den Überblick nicht verliert.
Ich werde Ihnen dabei keine festen und gesicherten Antworten auf Ihre vielen Fragen geben. Alle großen philosophischen Fragen sind offene Fragen; und jede Antwort treibt sofort wieder neue Fragen hervor. Dabei gilt für den, der sich mit den vielfältigen Ansätzen, Ideen, Begründungen und Spekulationen in der Geschichte der Philosophie beschäftigt, noch immer der Satz des großen französischen Skeptikers und Humanisten Michel de Montaigne: »Der Genuss ist es, der uns glücklich macht, nicht der Besitz.« Sich mit klugen Gedanken zu beschäftigen, sie nachzuzeichnen, sie zu verstehen und weiterzudenken ist eine kulinarische Beschäftigung des Geistes. Lesen ist Denken mit einem fremden Gehirn. Doch das Gelesene zu verarbeiten ist ein fortwährender Dialog mit uns selbst. Was lockt, ist die Aussicht, intelligenter über die Welt nachdenken zu können als zuvor.
Die vorliegende Geschichte der Philosophie ist kein Lexikon und keine Enzyklopädie. Und sie ist auch nicht die Geschichte großer Philosophen. An Lexika und Enzyklopädien zur Philosophie besteht kein Mangel, und viele Nachschlagewerke sind exzellent. Dazu kommen ungezählte Gesamtdarstellungen zur Geschichte der Philosophie, von denen viele auf ihre Weise sehr gut sind. Allerdings betrachten all diese Werke, wie überzeitlich sie sich auch geben mögen, die Geschichte der Philosophie unvermeidlich auch immer aus dem Blickwinkel ihrer Zeit. So etwa konnte Georg Wilhelm Friedrich Hegel zu Anfang des 19. Jahrhunderts noch glauben, dass die Philosophie eine aufsteigende Linie sei, die er in seinem eigenen Werk zum krönenden Abschluss gebracht hatte. Doch schon sein jüngerer Kontrahent Arthur Schopenhauer wandte sich mit Ingrimm gegen eine solche durchinterpretierte Geschichte der Philosophie. Eine komplett bewertete Geschichte zu lesen wäre so, als »wenn man sein Essen von einem anderen kauen lassen wollte«.
Spätere Philosophiehistoriker waren vorsichtiger als Hegel. Sie verzichteten auf das perfekte Durchkomponieren der Geschichte nach eigenem Gusto. Aber der Gedanke, dass die Geschichte der Philosophie die Geschichte eines permanenten Fortschritts zur Wahrheit sei, durchzog nach wie vor viele ihrer Historien. Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts ist uns dieser Optimismus nach und nach fremder geworden. Mit philosophischen Gedanken weiterzukommen bedeutet nicht unweigerlich, die Wahrheit zu enthüllen und freizulegen. Bereits der Begriff der Wahrheit ist uns heute vielfach suspekt. So sind wir in manchem klüger geworden, aber deshalb noch lange nicht weise. Oder mit Robert Musil gesagt: »Wir irren vorwärts!«
Eine besondere Schwierigkeit, Philosophiegeschichte zu schreiben, besteht bereits darin, dass wir uns heute oft genug darüber streiten, was Philosophie überhaupt ist. Für die einen ist sie eine exakte Wissenschaft (nämlich jene der Sprachlogik), für die anderen eher so etwas wie Gedankenkunst, nämlich die Artistik, schöne und intelligente Sätze zu denken. Die Spannbreite zwischen beiden Ansichten ist groß. Denn hinter diesen beiden einander widerstreitenden Sichtweisen verstecken sich höchst unterschiedliche Meinungen darüber, wie viel Wissenschaft beziehungsweise Freistil eigentlich in der Philosophie steckt oder stecken sollte. Ist die Überzeugungskraft philosophischer Argumente logisch wie jene in den Naturwissenschaften? Oder ist sie eher ästhetisch wie jene der Kunst?
Für beides lassen sich Argumente finden und auch Traditionen. Für ihre Gründungsväter Platon und Aristoteles ist die Philosophie die Frage nach dem richtigen Leben. Um dieses zu leben, muss ich viel wissen. Und gesichertes Wissen erlange ich nur durch eine gut begründete und darum »wahre« Meinung. Folglich ist Philosophie in antiker Tradition so etwas wie die Wissenschaft vom Wissen. Aristoteles führte die logische Schlussfolgerung in die Philosophie ein und schuf damit die Voraussetzungen für wissenschaftliches Denken. Im Gefolge der beiden großen Griechen verstanden fast alle Philosophen bis ins 19. Jahrhundert hinein ihr Metier als Wissenschaft oder gar als eine Über-Wissenschaft über allen anderen Wissenschaften; das Dach, unter dem alle anderen Spezialwissenschaften zu Hause sind und das ihnen helfen soll, sich selbst erst richtig zu verstehen.
Dazu gehört, dass nahezu alle Philosophen bis zu Hegels Zeit davon ausgingen, dass es die Philosophie gibt, wie es ja auch die Mathematik und die Physik gibt. Insofern konnte Hegel seine Philosophiegeschichte – eine der ersten überhaupt – so schreiben, als ob dieses Gedankenbauwerk objektiv in der Welt existiere. Der Kitt des Ganzen war ein Baustoff namens Vernunft, von dem große Philosophen wie Immanuel Kant und Hegel glaubten, dass auch sie überzeitlich und objektiv sei. Folglich bestand alle Arbeit des Philosophen darin, die Welt vernünftig zu durchdringen, um damit zeitlos Wahres zutage zu fördern.
Ein solcher Glaube an die Philosophie und die Vernunft ist uns heute fremd geworden. Spätestens zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben wir lernen müssen, dass es die Vernunft nicht gibt. Die »allgemeinen Quellen der Vernunft«, von denen Kant spricht, haben sich in viele einzelne Wasserstellen verflüchtigt. Wer etwas vernünftig durchdringt, tut dies in Worten und Sätzen. Er folgt nicht nur einer Logik, sondern auch einer Grammatik. Und er bedient sich einer Sprache, die nicht zeitlos ist, sondern kulturell bedingt und gefärbt. Der Anspruch, dass Philosophie Wissenschaft sein soll, lässt sich auch unter diesen geänderten Vorzeichen aufrechterhalten, wenn man möchte. Nur ist sie jetzt nicht mehr die Wissenschaft vom Wissen, sondern die Wissenschaft jener logischen oder unlogischen Sätze, in denen Menschen Behauptungen über die Welt aufstellen. Eine solche Wissenschaft erklärt allerdings nicht mehr, sondern sie beschreibt. Diesen Weg ist die sehr einflussreiche analytische Philosophie im Gefolge Gottlob Freges und Ludwig Wittgensteins gegangen.
Die Gegenposition ist die Idee der Philosophie als Gedankenkunst. Sie bricht sich in der Kritik an Hegel Bahn. Mit heiligem Zorn demolieren Arthur Schopenhauer und mehr noch Friedrich Nietzsche den Glauben an die Vernunft und alle darauf gegründete Philosophie. Statt mit Weltgebäuden haben wir es im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr mit Weltanschauungen zu tun. Der Philosoph erkennt nicht mehr die Welt, sondern er wirft ein besonderes subjektives Licht auf sie. Er gewichtet und wertet, polemisiert und spitzt zu und macht sich für eine besondere ethische oder ästhetische Haltung gegenüber der Welt und dem Leben stark. Nichts anderes geschieht gleichzeitig in der Kunst. Auch sie will nicht mehr das Sichtbare objektiv wiedergeben, sondern etwas subjektiv sichtbar machen.
Die Philosophien Schopenhauers und Nietzsches sind literarisch durchkomponiert und versuchen, den Leser ästhetisch in den Bann zu ziehen. Das Gleiche begegnet uns schon im 18. Jahrhundert in der französischen Philosophie, die essayistisch statt wissenschaftlich ist. Rousseau, Diderot oder Voltaire denken nicht in Systemen; sie schaffen Skulpturen des Denkens, Gedankenfiguren oder »Philosopheme« statt Philosophien. Und wie die Künste zu Stilrichtungen und -ismen werden, so auch die weltanschaulichen Philosophien. Man baut nicht mehr am großen Haus, sondern man prägt einen Denkstil aus, und die Weltanschauung wird zum Markenzeichen. Auch diese Tradition besteht bis heute fort, insbesondere in Frankreich, von wo sie einst ausging.
Ob man Philosophie als Wissenschaft versteht oder als Gedankenkunst – in beiden Fällen kann man sehr verschiedene Ansichten dazu haben, wie sinnvoll es ist, sich überhaupt mit ihrer Geschichte zu befassen. Aus der Sicht zahlreicher analytischer Philosophen ist die Beschäftigung mit der Geschichte der Philosophie ziemlich überflüssig. Analytische Philosophen verstehen ihr Metier, wie gesagt, als eine Wissenschaft, den exakten Wissenschaften vergleichbar. Und diese konzentrieren sich bekanntlich weitgehend auf die Probleme und den Erkenntnisstand der Gegenwart. Wozu sollte ein angehender Arzt viel über die Geschichte der Medizin lernen? Und wie viel beziehungsweise wie wenig muss ein Physiker von den Irrtümern und Spekulationen der Physik der Renaissance oder des Barocks wissen, außer vielleicht vom Gravitationsgesetz, das seine Gültigkeit seit Newton noch immer nicht verloren hat?
Aus einer solchen Sicht erscheint auch die Geschichte der Philosophie als eine Ansammlung von Theorien und Hypothesen, die nicht mehr so recht dem Stand des heutigen, weitgehend sprachanalytischen Philosophierens entspricht. Auch mich selbst hat während meines Universitätsstudiums die Geschichte der Philosophie nicht sonderlich interessiert. Ich wollte ja kein Historiker werden, sondern »wissen, was stimmt«. Statt nach bunten Geschichten aus dem philosophischen Archiv suchte ich nach überzeitlichen Wahrheiten: Ist die Geschichte ein dialektischer Prozess? Kann man Menschenrechte logisch begründen? Gibt es so etwas wie Wahrheit oder Gerechtigkeit, und ist ihre Durchsetzung in der Welt möglich?
Doch diese großen Fragen beschäftigten meine Professoren, wenn überhaupt, meist nur am Rande. In den Vorlesungsverzeichnissen deutscher Universitäten mit ihren zahlreichen Vorlesungen und Seminaren über Platon und Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche usw. zeigt sich ein ganz anderes Bild. Hier, so scheint es, regiert die Geschichte unmissverständlich über die Gegenwart. Viele Professoren, so darf man schließen, sind offensichtlich nicht der Ansicht, dass in der Geschichte der Philosophie mit jedem neuen Denker die Philosophie seiner Vorgänger zur Bedeutungslosigkeit erlischt. Viel mehr erscheint »Philosophie« als eine Art kultureller Vorrat von überzeitlichem Wert. Etwas, durch das sich der Philosophiestudent zunächst einmal hindurchackern sollte, um sich überhaupt zu philosophischen Erkenntnissen zu befähigen.
Mein Weg soll darin bestehen, beide Ansprüche zu berücksichtigen. Dieses Buch ist keine Philosophie und auch nicht einfach deren Geschichte. Es ist, in einer Formulierung Immanuel Kants, eine »philosophierende Geschichte der Philosophie«, dabei so allgemeinverständlich wie möglich und eingehüllt in das Gewand einer großen Erzählung. Auf der einen Seite sollen die behandelten Philosophen und ihre Ideen im Kontext ihrer Zeit vorgestellt und diskutiert werden. Ohne Hinweise auf Politik, Sozialgeschichte und Wirtschaftsgeschichte bleiben viele Ideen und Vorstellungen esoterisch. Das Leben von Philosophen spielt sich nicht zwischen Buchdeckeln ab. Und philosophische Gedanken entstehen nicht im luftleeren Raum oder in einer Sphäre, in denen Nachfolger mit Vorgängern diskutieren. So etwa bestand das klassische Griechenland nicht in erster Linie aus der Philosophie Platons und Aristoteles’, und das Sozial- und Wirtschaftsleben war etwas, das es irgendwie auch noch gab. Vielmehr wurden das Leben und das Denken der Menschen durch die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse geprägt, und die Philosophie war das, was es irgendwie auch noch gab.
Eine reine Darstellung der geschichtlichen Umstände und des zeithistorischen Kolorits hingegen wird den Leser allerdings nicht befriedigen. Fast alle Fragen der antiken Welt sind noch immer die unseren: Was ist ein gutes Leben? Was ist Wahrheit? Gibt es Gerechtigkeit, und wenn ja, wie ist sie möglich? Hat das Leben einen Sinn? Wo steht der Mensch in der Natur und im All? Gibt es Gott? Usw. Wie ein roter Faden ziehen sich diese Fragen durch die Reflexionen der Menschheitsgeschichte. Will man ihnen gerecht werden, so kommt man nicht umhin, die Sichtweisen früherer Philosophen aus heutiger Perspektive einzuordnen, zu bewerten und Stärken von Schwächen zu unterscheiden. Gerade an den Knotenpunkten der Entwicklung werden deshalb immer wieder Verbindungslinien von den Theorien vergangener Zeiten zum heutigen Denken gezogen.
Dabei läuft man leicht Gefahr, die Philosophen der Antike, des Mittelalters, der Renaissance, des Barocks und der Aufklärung als Vertreter einer bestimmten Philosophie-Richtung oder Denkschule zu sehen. Das aber waren sie, wie gesagt, ihrem Selbstverständnis nach fast nie. Sie rangen nicht, wie Philosophen später, mit ihrem Markenzeichen, ihrer historischen Identität, sondern sie rangen mit dem Ganzen der Welt. Platon war weder ein Platoniker noch ein Platonist. Und Descartes schmiedete nicht am Cartesianismus, sondern ackerte sich an einer geistigen Durchdringung der Welt ab, die er für alternativlos hielt. Für den Autor einer Philosophiegeschichte heißt dies, mit Etiketten und Einordnungen äußerst behutsam umzugehen. Der katalogisierende Blick des Systematikers verhüllt oft allzu leicht, was er doch eigentlich freilegen möchte.
Die wohl schwierigste Frage jeder historischen Darstellung ist immer die Auswahl und Gewichtung. Das gilt einmal angesichts des begrenzten Gesamtumfangs des ganzen Projekts auf drei Bände. Eine solche Philosophiegeschichte ist nicht vollständig und will es nicht sein! Stattdessen entscheide ich mich immer wieder für bestimmte Perspektiven. Geschichte zu schreiben bedeutet auszuwählen und in Beziehung zu setzen. Und selbstverständlich sind diese Gewichtungen höchst subjektiv, selbst wenn sie anderes beabsichtigen. Jede Verallgemeinerung tut der Individualität von Tatsachen unrecht, ebenso wie jener von Gedanken oder Ideen. Die vorliegende Geschichte der Philosophie ist also lediglich eine Geschichte der Philosophie. Und wie alle anderen kommt sie nicht umhin, zu vergröbern und zu vernachlässigen.
Das wichtigste Erkenntnis-Interesse dieser Philosophiegeschichte gilt auch nicht einer möglichst vollständigen Beleuchtung aller wichtigen Philosophen. Das Problem fängt schon damit an, dass niemand weiß, wer die wichtigsten Philosophen eigentlich sind. So gibt es Philosophen, die schon deswegen wichtig erscheinen, weil sie in der Philosophiegeschichtebis heute wichtig geblieben sind. Daneben gibt es Philosophen, die für die Philosophie einmal sehr wichtig waren, denen aber heute nur noch wenig Aufmerksamkeit zuteilwird. Des Weiteren gibt es Philosophen und Diskurse, denen in der klassischen Philosophiegeschichte nur wenig Aufmerksamkeit zuteilwurde, die aber aus heutiger Sicht enorm inspirierend und interessant erscheinen. Und nicht zuletzt sollte man an Philosophen denken, die in ihrer Zeit völlig unbedeutend waren, wie zum Beispiel Schopenhauer und erst recht Nietzsche. Letzterer gilt heute als wichtigster Philosoph seiner Zeit, aber sein großer Ruhm entstand erst posthum. Genau umgekehrt verhält es sich mit Philosophen, denen der Zeitgeist einst eine enorme Bedeutung verlieh, die heute aber an Strahlkraft verloren haben. Und wie soll man mit enorm einflussreichen philosophischen Denkern wie Karl Marx, Gottlob Frege oder Niklas Luhmann umgehen, die ihrem Selbstverständnis nach gar keine Philosophen waren?
In solcher Lage bietet es sich an, die Geschichte der Philosophie nicht schlicht chronologisch an ausgewählten Philosophen entlang zu erzählen. Immer wieder werden einzelne Probleme stärker gewichtet und beleuchtet. Und das gesamte Werk versteht sich als eine Art Fortsetzungsroman der immer gleichen großen Fragen in ihren jeweils neuen Zeitgewändern.
Gleichwohl bleibt eine solche »Geschichte« immer ein heikles Unterfangen. Zu schnell gleicht man Touristen, die an der Küste der Dominikanischen Republik hinter den Zäunen eines Luxusresorts Urlaub machen und behaupten, sie hätten das Land kennengelernt. So sollte man sich am Ende damit bescheiden, dass man nicht die Geschichte der Philosophie geschrieben hat – sondern nur einen weiteren Fußabdruck auf einem schmalen Trampelpfad der Überlieferung hinterlässt, die jenes Bild prägt, das wir uns bis heute von diesen Epochen machen.
Sollte Ihnen, lieber Leser, die Philosophie während der Lektüre dabei nicht einfach als Wissensgebiet oder gar als »Fach« erscheinen, so wäre die Aufgabe dieser Philosophiegeschichte erfüllt. Denn alle Philosophie ist am Ende nicht einfach das Erringen von Fachkenntnissen. Die meisten großen Denker bis 1900 waren keine Fachleute und auch keine Philosophie-Professoren. »Die Philosophie«, meinte Ludwig Wittgenstein, »ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit.« Diese Tätigkeit soll uns sensibler machen für die oft fragwürdigen Annahmen und Behauptungen in unserem Leben und Zusammenleben. Ihr Ziel ist nicht mehr wie früher die Wahrheit. Wer die Wahrheit liebt, bildet sich nicht ein, sie zu besitzen! Ihr Ziel ist es, den Rahmen zu vergrößern, in dem wir denken und leben. Philosophieren ist das Schärfen unserer Instrumente des Denkens in der Hoffnung, die begrenzte Zeit unseres Daseins ein wenig bewusster zu erleben. Und sei es auch nur, um zu verstehen, was wir nicht verstehen.
Richard David Precht
Köln, im Juli 2015
Die Schule von Athen
Vom irrealen Zauber der Philosophie
Ein wunderschöner Sommertag in Athen. Der Himmel ist mittelmeerblau mit wenigen Wolken. Das Licht fällt in eine prächtige Halle mit vier kassettierten Trommelgewölben. Und auf der kleinen Treppe dieses steinernen Lehrgebäudes stehen, hocken, kauern oder liegen achtundfünfzig griechische Männer, die dem schönsten aller Berufe nachgehen: Sie philosophieren!
Sie diskutieren mit kleinen oder großen Gesten, sinnen nach, schreiben oder rechnen, konstruieren und disputieren. Man sieht Bewunderung auf den Gesichtern, Staunen, Neugierde, Zweifel, Unglaube und tiefe Nachdenklichkeit. Und wenn es ein Bild gibt, das wie kein zweites in unser kulturelles Gedächtnis eingebrannt hat, was Philosophie ist und was Philosophen so treiben, so ist es dieses.
Es ist ein Bild ohne Namen, ein Wandfresko in den Stanzen, den Privatgemächern des Papstes Julius II. im Vatikan. Und doch glauben wir alle zu wissen, was es darstellt und wie es heißt: Die Schule von Athen. Ihr Urheber Raffael, der das Werk zwischen 1509 und 1511 schuf, hatte es ohne Titel gelassen. Erst sein italienischer Malerkollege Gaspare Celio gab dem Bild mehr als hundert Jahre später den berühmten Namen.
Raffael war siebenundzwanzig. Als Shooting Star war er aus dem künstlerisch viel bedeutenderen Florenz nach Rom gekommen, und das Ausmalen der Stanzen im zweiten Stock des neuen Wohngebäudes war seine erste Arbeit für den Papst. Ein Auftrag von höchster Stelle und mit höchstem Anspruch. Julius II. ist ein Mann, der mit Martin Luthers Ausspruch als »Blutsäufer« in die Geschichte eingehen wird; ein rücksichtsloser und kriegerischer Kirchenfürst, der die Macht des Papsttums Stück für Stück ausbaut. Warum in aller Welt möchte dieser Gewaltherrscher auf dem Stuhl Petri ein Philosophenbild in seinen Privatgemächern?
Das Unternehmen ist heikel. Raffael versteht nicht viel von Philosophie; er ist Maler, und die Malerei ist eine exquisite Handwerkskunst. Man lernt sie von anderen Meistern, aber man studiert sie noch nicht an Akademien. Der Raum, den er ausmalen soll, ist für Julius’ umfangreiche Privatbibliothek vorgesehen. Erst später wird er in Stanza della Segnatura umbenannt, und Julius’ Nachfolger werden hier Gericht halten. Die anderen Motive, die Raffael an die Wände malen soll, sind die Theologie, die Justiz, die Tugenden und die schönen Künste. Alles Wissen und alle Poesie der Welt sollen sich in diesem Raum ein Stelldichein geben, zusammengestellt für das Selbstwertgefühl des Papstes und den Anspruch der Kirche, alles miteinander zu vereinen.
Doch passt die Philosophie hierher? Keiner der hier versammelten griechischen Philosophen glaubt an einen jüdisch-christlichen Gott. Und doch steht die antike Philosophie, insbesondere jene Platons, für die Theologen des Papstes in keinem Widerspruch zum Christentum. Die Florentiner Marsilio Ficino und Giovanni Pico della Mirandola haben den Platonismus hoffähig gemacht, sogar in den Augen des Vatikans. So bringt man es mit viel starkem Willen und ohne Rücksicht auf philosophische Verluste fertig, Platon als Vorläufer des Christentums anzusehen, hübsch einsortiert neben Aristoteles und Plotin und in einer Ahnengalerie mit Moses und Jesus.
Nichts anderes soll Raffael auf seinem Fresko abbilden. In der Mitte des Bildes erscheinen Platon und Aristoteles wie zwei übermenschliche Gestalten in der Manier von Heiligen. In einem späteren niederländischen Stich wird man ihnen sogar Heiligenscheine verleihen und sie zu Petrus und Paulus ummünzen. Umgeben sind die beiden von anderen hervorragenden Männern der griechischen Philosophie und Wissenschaft. Pythagoras kniet vorne links und schreibt an einem Buch, Diogenes hängt auf den Stufen ab, Euklid (oder ist es Archimedes?) arbeitet vorne rechts mit dem Zirkel, und der stupsnasige Sokrates, ganz in Olivgrün, gestikuliert mit einem langhaarigen Krieger.
Die Kunsthistoriker vor allem des 19. Jahrhunderts haben sich viel Mühe gegeben, jeden Einzelnen der achtundfünfzig Männer zu identifizieren. Doch alle ihre Vermutungen bleiben Spekulationen. Tatsächlich können wir nur noch drei weitere Personen erkennen, und sie sind definitiv überhaupt keine griechischen Philosophen! Die dunkle Gestalt im Vordergrund, meist mit Heraklit identifiziert, trägt die Züge von Raffaels großem Konkurrenten Michelangelo. Und auch Raffael selbst ist am vorderen rechten Rand im Bild. Mit dunkler Kopfbedeckung und seinem blassen Engelsgesicht steht er neben seinem weiß gewandeten Gehilfen Sodoma.
Dass man Zeitgenossen in Bilder mit historischen Motiven schmuggelte, war in der Renaissance wie auch zuvor im Mittelalter gang und gäbe. Selbst Platon ist nicht einfach nach der Vorlage seiner berühmten antiken Büste gefertigt. Zeitgenossen erkannten in seinen Zügen leicht diejenigen Leonardo da Vincis. Es fiel ihnen nicht schwer, denn da Vinci stilisierte sich mit zunehmendem Alter selbst als griechischer Philosoph. Allerdings neigte er Platon nur optisch zu, sein philosophisches Idol fand er in Aristoteles.
Raffael malt ein gleichsam alltägliches Philosophengewusel, so wie es ein unbeteiligter Besucher wahrnehmen muss, der zufällig dabeisteht. Zu Anfang des 16. Jahrhunderts ist das radikal neu. Falls die Philosophie überhaupt auf Bildern verewigt wurde, dann meist in Form weiblicher allegorischer Figuren. Raffael dagegen scheint eine lebendig erzählte Passage aus Platons Dialog Protagoras vor Augen gehabt zu haben: »Als wir nun eingetreten waren, trafen wir den Protagoras in dem vorderen Säulengange herumwandelnd. Neben ihm aber gingen auf der einen Seite Kallias, der Sohn des Hipponikos, und sein Bruder von mütterlicher Seite, Paralos, der Sohn des Perikles, und Charmides, der Sohn des Glaukon, auf der anderen aber der andere Sohn des Perikles, Xanthippos, ferner Philippides, des Philomelos Sohn, und Antimoiros von Mende … Andere aber zogen hinterdrein und hörten dem, was gesprochen wurde, zu, und von diesen schien der größte Teil aus Fremden zu bestehen, welche Protagoras aus allen Städten, durch welche er auch kommen mag, hinter sich herzieht durch den Zauber seines Mundes, wie Orpheus, so dass sie alle willenlos diesem Zauber nachfolgen; es waren aber auch einige von den Einheimischen in diesem Reigen. An dem Anblicke dieses Letzteren nun hatte ich am meisten meine Freude, nämlich darüber, wie hübsch diese stummen Zuhörer sich davor in Acht nahmen, dem Protagoras vorne in den Weg zu treten, vielmehr, sooft er und die, die mit ihm gingen, sich umdrehten, sich sittig und wohlgeregelt auf beide Seiten verteilten, kehrtmachten und sich dann hinten in der schönsten Ordnung wieder anschlössen.«[1]
Die Beschreibung der vielen Zuhörer des Protagoras nimmt anschließend kaum ein Ende, und es entsteht ein gewaltiges Bühnenbild mit prachtvoller Halle, in deren Mittelpunkt der Philosoph steht. Die Szene hat einen durchaus ironischen Unterton, denn Platon hat Protagoras nicht gemocht. Der Aufruhr um den »großen Philosophen« wird einzig und allein entfacht, um die Eitelkeit eines berühmten Mannes vorzuführen, der von seinem Publikum maßlos überschätzt wird.
Dass Raffael hier allem Anschein nach Platons Dialog als Vorlage benutzt und zu anderen Zwecken umgestaltet, kann kaum seine eigene Idee gewesen sein. Der junge Maler konnte kein Griechisch und auch kaum Latein. Als Spiritus Rector hinter dem Fresko vermuten Kunsthistoriker deshalb seit einiger Zeit Aegidius von Viterbo, einen der einflussreichsten Theologen des Vatikans. Aegidius ist einer der besten Platon-Kenner seiner Zeit, und er zitiert den Protagoras an vielen Stellen seiner Werke. Nur mit seiner oder einer ähnlichen Hilfe konnte Raffael den Formen- und Personenschatz der Antike so umfangreich plündern und ein imaginäres Athen an die Wände des Vatikans projizieren.
Und genau dieses philosophische Niemandsland prägt heute wie kein zweites Bild die Vorstellung, die wir uns landläufig von der Philosophie machen. Zu oft erscheint sie, wie bei Raffael, als ein zeitloses Elysium, ein ideeller Ort, in dem die wahrheitssuchenden Gedanken über Jahrhunderte, gar Jahrtausende hinweg einander schwirrend begegnen, wie Libellen bei der Paarung. So scheint es nicht im Geringsten zu stören, dass auch zwischen den Philosophen und Wissenschaftlern der Schule von Athen Jahrhunderte liegen. Tatsächlich hätten wohl nicht einmal ein Dutzend gleichzeitig im gleichen Raum sein können. Und es stört auch nicht, dass der Betrachter einem großen Ereignis beizuwohnen scheint, obgleich in Wahrheit ja kaum etwas geschieht.
Vielleicht ist es gerade diese sakrale Irrealisierung, die dem Bild bis heute seine besondere Ausstrahlung verleiht; ein eigentümlich geschichtsloses Geschichtsbild mit Personen und Ideen, entkleidet von ihrem historischen Kontext. So schillern sie hin und her zwischen Allegorie und vorgetäuschter Realität. Und wenn nicht, wie nach dem Sacco di Roma 1527, wieder einmal plündernde Landsknechte das Fresko zerkratzen, so philosophieren sie noch heute …
Fernab aller gemalten Fantasien ist die antike Philosophie für uns allerdings oft schwieriger zu verstehen, als es beim ersten Anblick erscheint. Einerseits ist sie uns erstaunlich nah und gegenwärtig. Hier liegt die in Festreden gern zitierte »Wiege der Demokratie«. Ein Großteil der philosophischen Schlüsselbegriffe wie etwa psyché,idea,pragma,politeia und viele weitere finden sich wieder in Worten wie Psychologie, Idee, Pragmatismus und Politik. So scheint unsere heutige Kultur oft nichts anderes zu sein als eine kontinuierliche, vielleicht sogar logische Fortsetzung der griechischen Antike mit einem zwischenzeitlichen Update versehen durch das christliche Mittelalter.
Andererseits müssen wir uns fragen, inwieweit uns diese Sicht den Blick auf die antike Philosophie nicht verstellt. Von heutiger Warte aus betrachtet, ist sie der Ursprung unseres abendländischen Denkens, dessen wechselhafte Fortsetzung wir kennen. Für die Philosophen Ioniens, Süditaliens und Athens dagegen war ihr Philosophieren nicht der Ursprung einer zweieinhalbtausend Jahre langen Erfolgs- und Problemgeschichte. Niemand von ihnen empfand sich als Vorläufer oder Vorgänger. Und sie fällten auch nicht die Entscheidungen darüber, was aus ihrem Denken einmal als »ewige« philosophische Idee – wie plausibel oder irrlichternd auch immer – betrachtet werden würde und was nicht. Hätte Heraklit seine Philosophie tatsächlich in dem kleinen Satz »Alles fließt!« zusammengefasst, den manche später als die Quintessenz seines Denkens ausgemacht haben wollen? Zerfällt Empedokles gleichsam schizophren in zwei getrennte Bewusstseinszustände, einmal als »Physiker« und ein anderes Mal als »Seher« – weil wir nicht wissen, was zwischen beiden liegt? Ist die »Ideenlehre« tatsächlich der zentrale Baustein in Platons Denken, oder ist sie es nur für den »Platonismus«?
Man kann sich oft nicht genug darüber wundern, dass wir überhaupt so vielfältige Schriftzeugnisse aus der griechischen Antike haben; wenn auch nicht in Originalen, sondern in mittelalterlichen Handschriften. Der Weg, den diese Texte zurückgelegt haben, ist oft dunkel und verworren. Wie häufig wurden die Handschriften auf Papyrus oder Pergament abgeschrieben, auf Reisen mitgenommen und vor Andersdenkenden versteckt, so dass wir heute von ihnen wissen? Und wie viel der antiken Literatur fiel auf der anderen Seite Bränden, Verwüstungen sowie der bewussten Vernichtung durch christliche Zensoren anheim?
Was wir heute haben, sind Texte, die über mehr als zweitausend Jahre offensichtlich für bedeutsam gehalten worden sind und das Glück hatten zu überdauern. Oft ist es die unsichtbare Hand des Zufalls, die uns manches überliefert hat, anderes dagegen nicht. Aus der Überlieferung antiker Bibliotheken vor dem Jahr 500 nach Christus kennen wir die Namen von rund dreitausend antiken Autoren der griechischen und römischen Welt! Doch nur von vierhundert sind uns bis heute Schriften überliefert. Allein die Bibliothek von Alexandria soll im Jahr 47 vor Christus 500 000 bis 700 000 Schriftrollen in ihrem Besitz gehabt haben. Der allergrößte Teil davon ist für immer verloren.
Man kann schätzen, dass von der nichtchristlichen Literatur der Antike gerade jedes tausendste Buch überliefert ist, nämlich nur etwa dreitausend Titel. Von ungefähr hundertfünfzig Tragödiendichtern der antiken griechischen Welt, die in den Bibliotheksverzeichnissen erscheinen, haben wir heute nur noch ein paar Werke von dreien. Von den Philosophen der griechischen Welt, die vor Platon und Aristoteles Texte schrieben, kennen wir ausnahmslos nur Bruchstücke. Trotz seines bekannten Wirkens in Athen im 5. vorchristlichen Jahrhundert fehlen uns von Protagoras seine anscheinend zahlreichen Werke. So ist er am Ende mit einem einzigen – von Platon überlieferten – Satz in die Philosophiegeschichte eingegangen. Man stelle sich allen Ernstes einmal vor, unser Wissen über Spinoza, Rousseau, Kant, Hegel, Sartre oder Wittgenstein schnurrte auf einen einzigen Satz zusammen – zu welch bizarren Urteilen würden wir kommen?
Von Platon haben wir zwar offensichtlich fast alle Dialoge, aber bis heute streiten sich die Geister darüber, zu was sie eigentlich gedacht waren. Steckt der »wahre« Platon am Ende gar nicht in seinen Schul-Dialogen, sondern in einer »ungeschriebenen Lehre«? Von Aristoteles dagegen sind genau solche Texte überliefert, die gerade nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren – nämlich Mitschriften seiner Vorlesungen. Das hingegen, was Aristoteles publiziert hat, ist fast sämtlich verloren. Auch von den vielen hellenistischen Philosophen haben wir oft nur Bruchstücke und die Zusammenfassungen der Nachwelt. Bis auf wenige Ausnahmen, wie jene Plotins, lässt sich kaum ein Philosoph dieser Jahrhunderte überhaupt komplett darstellen. Nicht wesentlich anders sieht es im Mittelalter aus. Die reichhaltigen oder gar vollständigen Überlieferungen sind seltener als die dürftigen und unvollständigen.
Umso subjektiver ist, wen und was der Autor einer Philosophiegeschichte sich herausgreift und als interessant darstellt. Die Schwerpunkte in diesem ersten Band liegen meist auf spannenden politisch-ökonomischen und auf naturphilosophischen Fragen. Anderes, wie zum Beispiel Aspekte der Logik, wird wohl oder übel vernachlässigt, da es für viele Leser wenig eingängig ist. So habe ich bei Platon Erkenntnistheorie und Ethik ins Zentrum gestellt und manches andere Interessante nur gestreift. Aristoteles’ Metaphysik wird nur rudimentär behandelt, seine Poetik aus dramaturgischen Gründen im zweiten Band nachgereicht. Spätere Neuplatoniker wie Proklos und Simplikios sind weggelassen. Und auch Kirchenväter wie Origines und Clemens von Alexandria werden nicht ausführlich behandelt. Im Mittelalter trifft es Denker wie Hrabanus Maurus, Hugo von Sankt Viktor, Petrus Johannes Olivi und Thomas Bradwardine; auch Ramon Llull kommt sicher zu kurz. Zudem habe ich viele theologische Diskussionen, wie jene über die Trinitätslehre oder den Sentenzenkommentar des Lombardus, weggelassen. Das Gleiche gilt für die komplizierte Philosophie der verschiedenen Intellekte sowie für einige Folgeprobleme der aristotelischen Metaphysik.
Doch das Problem liegt nicht allein in der Auswahl. Kein Mensch überschaut die Zeit, über die er schreibt, wenn er über die Philosophie der Antike und des Mittelalters schreibt. Die lichtdurchflutete Klarheit, die die Schule von Athen uns vorgaukelt, haben wir im Umgang mit der antiken und mittelalterlichen Philosophie nicht. Und auch das Pathos, das den Blick färbt, wenn wir ihn von fern auf die Anfänge der Philosophie werfen, findet kein Widerlager in einer pathetischen Zeit. So lassen wir unsere Reise beginnen zu den wenig ideellen, sondern sehr menschlichen Ursprüngen der abendländischen Philosophie. Und zu Menschen, die die Nachwelt unglücklich als »Vorsokratiker« bündelt, so als sei ihr Denken ein großes »noch nicht« gewesen, obgleich es das für sie selbst natürlich niemals war …
[1] Platon, Protagoras. 314d–315b
PHILOSOPHIE DER ANTIKE
Es war einmal in Ionien…
Sonnenfinsternis im Abendland – Der erste Philosoph? – Alte Geschichten – Blick in den Kosmos – Heimwerker des Glaubens – Die Kraft der Mythen
Sonnenfinsternis im Abendland
Fängt die abendländische Philosophie an einem schönen Maiabend in der heutigen Türkei an? Genauer am 28. Mai des Jahres 585 vor Christus in der Stadt Milet, irgendwo unter Zypressen, Ölbäumen und Weinreben? Unter durstigen Bäumen in der ausgeglühten Luft des mediterranen Vorsommers? An diesem Abend erreicht eine totale Sonnenfinsternis über dem Atlantik Kleinasien. Sechs Minuten später ist der Spuk vorbei, aber seine Folgen sind gewaltig. Die Heere der verfeindeten Meder und Lyder sollen ehrfürchtig staunend vor dem Walten der Götter die Waffen in der Schlacht niedergelegt und einen fünfjährigen Krieg beendet haben. Und nur ein einziger Mann soll von alldem nicht beeindruckt gewesen sein: der Weise Thalesvon Milet. Er nämlich, so will es die Legende, hat die Sonnenfinsternis exakt vorausberechnet und angekündigt.
Der Chronist, der davon berichtet, lebt in einem anderen Jahrhundert. Er notiert das Ereignis etwa hundert Jahre später: Herodotvon Halikarnassos, der Vater der antiken Geschichtsschreibung. Auch nennt er keinen genauen Tag, auf den Thales die Sonnenfinsternis berechnet haben soll, sondern nur das Jahr.[2] Die zweite Quelle von Thales’ Prophezeiung ist noch fragwürdiger. Sie stammt aus dem 3. Jahrhundert nach Christus, also mehr als achthundert Jahre nach dem Ereignis. Es ist Diogenes Laertios, ein antiker Philosophiehistoriker, der alle Geschichten und Anekdoten sammelt, derer er habhaft werden kann. Er schreibt, »manche Autoren« gäben an, Thales »habe als erster Astronomie getrieben, Sonnenfinsternisse vorhergesagt und die Sonnenwenden festgelegt. Auch bestimmte er zuerst die Sonnenbahn von Wende zu Wende, nach anderen auch das Verhältnis von Sonnen- und Monddurchmesser zum jeweiligen Bahnumfang als 1:720. Als erster hat er den monatsletzten Tag mit ›der Dreißigste‹ bezeichnet und naturtheoretische Probleme erörtert.«[3]
Wer ist dieser Thales, dem spätere Chronisten eine solch ungeheuerliche astronomische Pionierleistung zutrauten? Fast alles, was wir über Thales’ Leben wissen, verdanken wir Diogenes Laertios, einer wegen ihrer Unzuverlässigkeit berüchtigten Quelle. Thales soll im Jahr 624 vor Christus geboren sein. Möglicherweise stammt er aus einer vornehmen milesischen Familie. Vielleicht ist er aber auch ein Phönizier, der nach Milet übergesiedelt ist. Die Stadt auf der Landzunge im Ägäischen Meer verfügt über vier Häfen und schon im 6. Jahrhundert vor Christus über eine höchst wechselhafte Geschichte. Minoer aus Kreta haben hier erfolgreich gesiedelt, Hethiter die Stadt eingenommen, Lyder die Hand nach ihr ausgestreckt– und die Stadt ist ein ums andere Mal zerstört worden. Zu den Lebzeiten des Thales jedoch steht Milet in größter Blüte. Handelsschiffe mit Öl, Wolle und Kleidung fahren von der zerklüfteten Küste Kleinasiens nach Etrurien im heutigen Italien, nach Syrien und nach Ägypten. Und mehr als siebzig Kolonien machen Milet zu einem bedeutenden Machtzentrum im östlichen Mittelmeer.
Die genaue Rolle, die Thales in dieser Handelsmetropole spielt, ist uns heute unbekannt. Die Wahrheit über Thales ist, dass wir keine Wahrheit über ihn haben. Keine einzige Schrift von seiner Hand ist überliefert, und von seinem Denken haben wir kaum mehr als eine kleine Zusammenfassung von Aristoteles. Als Ingenieur soll er einen Fluss umgeleitet haben. Vielleicht hat er tatsächlich die Überschwemmungen des Nils durch Gesetze der Natur erklärt und die Höhe der Pyramiden berechnet. Nach Herodots Auskunft hat er sich zudem in die Politik eingemischt. Er soll den Ioniern geraten haben, einen städteübergreifenden Regierungssitz in Teos, in der Mitte Ioniens, zu gründen, um den Gemeinden eine gemeinsame Machtzentrale zu geben.
Nach Diogenes Laertios steht Thales am Beginn der griechischen Philosophie, der Mathematik und der Astronomie; ein Autodidakt ohne einen bekannten Lehrer, dafür mit einem Forschungsaufenthalt in Ägypten. Von dort soll er die Geometrie mitgebracht haben und einige wichtige Lehren der Astronomie. In jedem Fall scheint er seine Zeitgenossen mit Wissen über die Natur beeindruckt zu haben. Was seine Vorhersage der Sonnenfinsternis betrifft, dürften seine Kenntnisse der ägyptischen Astronomie allerdings nicht ausgereicht haben. Und selbst wenn er von den Himmelsbeobachtungen der Babylonier erfahren haben sollte– im 6. Jahrhundert vor Christus konnte niemand die Zeit und erst recht nicht den Ort einer Sonnenfinsternis vorhersagen. Nicht einmal die genaue Länge des Sonnenjahres war bekannt.
Gleichwohl gibt es noch heute Historiker, die meinen, dass Thales bei seiner angeblichen Vorhersage irgendwie ins Schwarze traf, als er ins Blaue redete. Sie wollen sich nicht so recht damit abfinden, dass die Nachwelt dem Wirken des Thales ganz offensichtlich mit einem astronomischen Wunder zusätzlichen Glanz verleihen wollte. Bezeichnenderweise wurden ähnliche naturwissenschaftliche Mirakel auch seinen Nachfolgern angedichtet. So liest man von der Vorhersage eines Erdbebens und eines Meteoriteneinschlags– Berechnungen, die selbst im 21. Jahrhundert nicht mit Präzision möglich sind.
Warum wurde die Legende von der Prophezeiung des Thales für die Philosophiegeschichte seit der Antike so bedeutend? Nun, vielleicht einfach deshalb, weil sie so schön passt. Denn sie entwirft das Bild eines Mannes und einer Zeit, die sich aufmachten, Glaube und Aberglaube über Bord zu werfen und die wahren Gesetze der Natur zu erkennen. Wenn Thales eine Sonnenfinsternis vorhergesagt haben soll, dann bedeutet dies, dass Sonnenfinsternisse Naturereignisse sind. Und wie alle Naturereignisse können sie von einem weisen Naturforscher erkannt und berechnet werden. An die Stelle der Mantiker und Seher tritt ein unabhängiger Gelehrter, der keine Spökenkiekerei mehr veranstaltet, einer, der nüchtern, sachlich und vernünftig der Natur und ihren Gesetzen auf die Schliche kommt– der erste Rationalist. Tatsächlich ist dies das Bild, das die Philosophiehistoriker von Thales und der ionischen Philosophie gezeichnet haben. Demnach liegt die Botschaft an der Prophezeiung des Thales nicht darin, dass sie wahr ist. Sondern darin, dass sie eine Einstellung zur Natur und eine Haltung zur Welt ausdrückt, die wir gern mit der ionischen Naturphilosophie verbinden: den Anfang der Naturwissenschaften, ja vielleicht des wissenschaftlichen Denkens überhaupt und damit die Geburtsstunde des Abendlands.
Der erste Philosoph?
Bevor wir uns näher mit der Frage beschäftigen, ob das Abendland seinen Anfang mit einer Sonnenfinsternis nimmt, sollten wir einen kurzen Blick in die Lebenswelt werfen, in der ein Grieche wie Thales zu Hause war. Schon der Begriff »Grieche« (graecus) ist ein wenig irreführend, denn er stammt von den Römern und damit aus einer viel späteren Zeit. Es spricht wenig dafür, dass die Bewohner des heutigen Griechenlands im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus sich als eine kulturelle Einheit verstanden. Stattdessen gibt es viele kleine, voneinander ziemlich unabhängige Stadtstaaten, unter denen Milet der bedeutendste ist. Der größte Teil der Bevölkerung hingegen lebt nicht in Städten, sondern als Selbstversorger auf dem Land vom Weinbau und von der Kultur von Olivenbäumen und Feigen. Man rodet Buschwälder und legt Sümpfe trocken und schafft neue Anbauflächen in einem meist kargen und unfruchtbaren Land. Dazu züchtet man Schafe und Ziegen. Unter allen Haustieren sind sie die anspruchslosesten, und sie steigen bis in die rauen Gebirge hoch. Nur die Adeligen leisten sich Rinder und nutzen ihr Weideland für die Pferdezucht. Ihr Grundbesitz wird sich in den nächsten Jahrhunderten stetig vergrößern und das Land der Kleinbauern schrumpfen. Mächtige Könige mit entsprechenden Herrschaftsgebieten gibt es gleichwohl nicht. Die zerklüfteten Berge, das Meer und die vielen Inseln stehen einem Großreich im Weg. Stattdessen schaffen sie viele Kleinräume mit einzelnen versprengten Gesellschaften.
Doch die Zeit des Thales ist zugleich die Zeit großer Umbrüche in diesen Gesellschaften. Der aufblühende Handel im östlichen Mittelmeer nötigt Städte wie Milet zum Bau von Handelsschiffen. Aus einem Landvolk wird hier eine Seemacht. Zum Schutz der Flotte und der Kolonien baut man immer größere Kriegsschiffe, hochbordige Fahrzeuge mit drei Reihen von Ruderbänken. Es schlägt die Stunde eines neuen Berufsstandes, der physikoi, der Techniker und Ingenieure wie Thales. Ihre Aufgabe ist der Ausbau der Infrastruktur an Wegen, Befestigungsanlagen und Häfen. Die Bevölkerung wächst mit dem Wohlstand und will ernährt werden. Die Wasserversorgung muss gesichert sein. In vielen Regionen ist das Königtum gestürzt, und der Adel vergrößert Schritt für Schritt seine Macht. Auch in Milet herrschen vornehme Familien. Erbittert verteidigen sie ihren Reichtum gegen einzelne Tyrannen, das einfache Volk oder gegen die Lyder und Perser. Ihnen gegenüber steht eine wachsende Zahl von Menschen ohne Grundbesitz. Als Arbeitsnomaden ziehen sie zwischen den Kleinstaaten und Häfen umher. Es sind Fremde ohne Bürgerrecht. Auf ihnen, den Frauen und den Sklaven liegt die Last der schweren Arbeit.
Die sozialen, wirtschaftlichen und militärischen Probleme sind handfest und künden von einer turbulenten Zeit. Die Küste Kleinasiens im 6. Jahrhundert ist kein sorgenfreies Arkadien. (Und nicht einmal das ist sorgenfrei.) In dieser Kulisse spielen jene bekannten Anekdoten, die die beiden bedeutendsten Philosophen der Antike, Aristoteles und Platon, über Thales erzählen. Und beider Geschichten verraten etwas über den sozialen Status eines »Philosophen« zu jener Zeit.
Die Geschichte des Aristoteles ist äußerst schmeichelhaft. Sie dient als ein Beleg für die umfassende Intelligenz und praktische Nutzbarkeit des philosophischen Verstandes. Als man Thales »wegen seiner Armut einen Vorwurf machte, als ob die Philosophie zu nichts tauge, habe er, sagen sie, da er aufgrund seiner astronomischen Kenntnisse vorausgesehen hatte, dass die Olivenernte reichlich sein würde, noch im Winter mit dem wenigen Geld, das ihm zur Verfügung stand, als Handgeld, sämtliche Ölpressen in Milet und Chios für einen niedrigen Preis gemietet, wobei niemand ihn überbot. Als aber die Zeit (der Ernte) gekommen war und auf einmal und gleichzeitig viele Pressen verlangt wurden, da habe er seine Pressen so teuer verpachtet, wie er nur wollte, und auf diese Weise sehr viel Geld verdient: zum Beweise dafür, dass es für die Philosophen ein leichtes ist, reich zu werden, wenn sie dies wollen, dass es aber nicht das ist, was sie wollen.«[4]
Wahrscheinlich sagt diese Anekdote mehr über Aristoteles’ Sicht des Philosophen als eines bescheidenen Universalkönners aus als über den historischen Weisen Thales. Dennoch bleibt sie bis heute interessant, denn die Geringschätzung von philosophischer Gelehrsamkeit gegenüber unmittelbarem wirtschaftlichen Erfolg hat auch in unserer Welt nichts von ihrer Aktualität verloren. Offensichtlich mussten sich bereits die antiken Philosophen für ihre augenscheinlich nutzlose Tätigkeit rechtfertigen; ein Umstand, der schlecht in das oft kitschige Bild vom hochgeschätzten Geistesleben in der altgriechischen Welt passt.
Mich selbst erinnert die Geschichte vom ökonomischen Sachverstand des Thales an den Schriftsteller Hans Wollschläger, der sieben Jahre darauf verwandt hatte, James Joyces Meisterwerk Ulysses zu übersetzen. Da er sich für diese hoch anspruchsvolle Tätigkeit gesellschaftlich nicht genug gewürdigt fühlte, meinte er einmal lapidar: »Verlassen Sie sich drauf: Wer Schöne Künste auf die Welt bringen kann, der kann auch eine Puddingfabrik leiten.«[5] Er wollte damit sagen, dass jemand, der über so viel Kreativität und Intellekt verfüge wie er, auch in der schnöden Welt der Wirtschaft erfolgreich sein könne, wenn er nur wolle. Als ich Wollschläger, einen hochsensiblen und etwas schüchternen Mann, darauf ansprach, ob er tatsächlich glaubte, dass er als Unternehmer oder Geschäftsführer erfolgreich hätte sein können, meinte er nach einigem Zögern: »Ehrlich gesagt, wohl nicht…!«
Entsprechend schonungslos erscheint Platons Geschichte über das Treiben des weisen Thales: »Es wird erzählt… dass Thales, als er astronomische Beobachtungen anstellte und dabei nach oben blickte, in einen Brunnen gefallen sei und dass eine witzige, reizende thrakische Magd ihn verspottet habe: Er strenge sich an, die Dinge im Himmel zu erkennen, von dem aber, was ihm vor Augen und vor den Füßen liege, habe er keine Ahnung.«[6]
Platons Anekdote, so einfach sie klingt, hat der Philosophiegeschichte viel Kopfzerbrechen bereitet. Denn im Gegensatz zu Aristoteles’ Heldengeschichte von Thales als einem Experten für alles, kommt der Philosoph hier schlecht weg, nämlich als Tölpel und Trottel. Wie ist das Lachen der Thrakerin zu verstehen? Ganz offensichtlich doch als Spott über einen lebensfernen Theoretiker, dem es nicht einmal gelingt, das alltägliche Leben zu meistern. Natürlich haben spätere Philosophen noch den einen oder anderen Kniff gefunden, um die Sache zu entübeln. Etwa so, dass der Mensch durch den Blick in den Himmel erst seinen wahren Platz im Kosmos erkannte und damit auch jene Naturgesetze, die dazu verhalfen, so nützliche Dinge wie Brunnen zu bauen. Das Lachen der Thrakerin wäre demnach töricht. Aber man muss die Geschichte schon hübsch zurechtbiegen, um in ihr keine Warnung an den Philosophen zu erkennen, bei allen kosmischen Gedanken den Boden nicht unter den Füßen zu verlieren.
Wir dürfen annehmen, dass auch im antiken Griechenland nur sehr wenige Menschen damit beschäftigt waren, die Gesetze der Natur zu entschlüsseln oder spekulativen Theorien über den Kosmos nachzugehen. Das Leben ist kein Wolkenkuckucksheim (wie es der Komödiendichter Aristophanes spöttisch beschrieb). Die philosophische Betrachtung der Welt war von jeher eine Sache von mehr oder weniger prominenten Außenseitern.
Waren die Theorien des Thales für das Denken seiner Zeit überhaupt repräsentativ? Die berühmteste dieser Theorien ist Thales’ Ansicht vom Wasser als dem Ursprung allen Lebens. Aristoteles schreibt dazu: »Thales … bezeichnet als … Ursprung (arché) das Wasser (hydor). Auch das Land, lehrte er deshalb, ruhe auf dem Wasser. Den Anlass zu dieser Ansicht bot ihm wohl die Beobachtung, dass die Nahrung aller Wesen feucht ist, dass die Wärme selber daraus entsteht und davon lebt; woraus aber jegliches wird, das ist der Ursprung von allem. War dies der eine Anlass zu seiner Ansicht, so war ein andrer wohl der Umstand, dass die Samen aller Wesen von feuchter Beschaffenheit sind, das Wasser aber das Prinzip für die Natur des Feuchten ausmacht.«[7]
In der von Aristoteles geschickt nach eigenen Bedürfnissen zusammengestellten Ahnengalerie seiner Vorgänger ist Thales der erste Philosoph der Weltgeschichte. Er soll als Erster alle Erscheinungen in der Natur auf eine einzige Ursache zurückgeführt haben. Doch die Vorstellung vom Wasser als Urgrund allen Lebens und Seins ist sehr viel älter als Thales. Das weiß Aristoteles auch. Er kennt die Meinung der »Uralten«, die Mythen von Okeanos, dem Vater des Meeres, der Flüsse und aller Brunnen, und seiner Gemahlin Thetis als »Urhebern der Weltentstehung«. Die Dichter Homer und Alkman erzählen von ihnen. Und die Historiker verweisen heute auf noch ältere Quellen. Im babylonischen Schöpfungsmythos gibt es die Urwasser, die älter sind als die Welt, und zwar Apsu, das Süßwasser, und Tiamat, das Meer. Ähnliches findet sich in den Weltentstehungsgeschichten der Ägypter. Und auch die Hebräer, die sich in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft am Mythos ihrer Herren orientierten, ließen den Geist Gottes vor der Schöpfung »über den Wassern« schweben.
Besonders aufsehenerregend ist Thales’ Ansicht vom Wasser als dem Ursprung allen Lebens nicht. Doch Aristoteles gibt der Behauptung eine Wendung, die ihr eine ganz neue Qualität hinzufügt. Demnach habe Thales nicht nur gemeint, dass alles aus Wasser entstanden sei, sondern dass es auch nach wie vor aus Wasser bestehe. Und das wäre, falls es denn tatsächlich von Thales so gemeint ist, origineller.
Es ist aber nicht ganz klar, ob Aristoteles hier wirklich die Ansicht des Thales widergibt und nicht jene des Hippon von Rhegion. Er lebte etwa hundertfünfzig Jahre nach Thales und behauptete bereits vor Aristoteles, Thales habe das Wasser als Urprinzip und Ursubstanz (arché) bestimmt.
Ist Wasser der Elementarkörper, das unveränderliche Wesen, aus dem alles andere besteht, die Luft, die Erde, die Pflanzen und Tiere und der Mensch? Nach unserem heutigen Wissen sind Lebewesen lebendig – die Luft, die Erde und auch das Wasser selbst sind es nicht! Wie geht dies zusammen? Welche Eigenschaften traute Thales dem Wasser als dem Stoff aller Stoffe möglicherweise zu? Wenn das Wasser selbst nicht lebendig ist, was hat es dann in Bewegung versetzt? Wie lassen sich Entstehen und Werden verstehen? Warum war das Wasser nicht einfach Wasser geblieben, sondern hatte sich zum ganzen Kosmos geformt?
Auf diese Fragen gibt es keine guten Antworten. Auch Aristoteles schweigt darüber. Zwar berichtet er uns, dass »Thales glaubte, dass alles von Göttern voll sei«.[8] Aber was mit diesen Göttern gemeint sei– tatsächliche Göttergestalten oder nur so etwas wie eine allgemeine Beseeltheit von allem–, verrät Aristoteles nicht. Das Zweite scheint wahrscheinlicher zu sein. Aristoteles zufolge soll Thales Magnetsteine für »beseelt« gehalten haben, weil sie die Kraft besitzen, Eisen zu bewegen.[9] Und wenn der Magnet eine Seele (psyché) hat, warum nicht auch das Wasser, das die Natur formt? Vielleicht ist das Wasser selbst der Seelenstoff, der in allem waltet, das sich formt und bewegt? Glaubte Thales an mythische Götter? War er ein Pantheist, für den alles beseelt war? Oder war er der erste uns überlieferte Materialist der Geschichte, der nichts Übersinnliches anerkannte, sondern nur die Naturkräfte?
Alte Geschichten
Um dies zu beantworten, muss man sich fragen: Woran glaubten die Griechen zu Thales’ Zeiten und was? Welchen Überlieferungen und Traditionen vertraute man? Und warum?
In der Tat gab es Texte, die den Bewohnern Griechenlands vom 8. bis zum 6. Jahrhundert vor Christus halfen, sich in der Welt zurechtzufinden, auch wenn nur sehr wenige Menschen lesen konnten. Die Inhalte dürften gleichwohl vom Hörensagen weithin bekannt gewesen sein. Der wichtigste Text war Homers Ilias – die Geschichte vom Kampf um Troja. Homers in Versen geschriebenes Epos ist der größte Bucherfolg der Antike bis weit hinein in die Zeit der Römer. Obgleich heute niemand zu sagen weiß, wer Homer eigentlich war und ob alle ihm zugeschriebenen Texte tatsächlich von seiner Hand stammen – für die Griechen der klassischen Zeit sind die Epen von größter Bedeutung. Zwar erfahren sie in der Ilias und auch in der etwas weniger populären Odyssee wenig über ihre tatsächliche Geschichte – den lang und immer länger zurückliegenden Krieg um die kleinasiatische Stadt Troja –, aber die Dichtungen erklären den Menschen lange die Welt.
Ein ganzer Kosmos an Götter- und Heldengeschichten tut sich auf. Reiche, vornehme und mächtige Männer leben darin vor, was Sitte, Gebräuche und Moral sind. Die Epen erzählen von einer Zeit, in der Griechenland strahlender und wohlhabender war, als man es im 8. vorchristlichen Jahrhundert vorfindet. Könige und Helden bestimmen diese alte Welt, gebunden an Freundschaft, Treue und Ehre. Zugleich sind sie oft arrogant, maßlos und unbeherrscht; ein hoffärtiges Adelsgeschlecht mit einem ausgeprägten Hang zu Wettkämpfen, Kriegen, Ehe- und Schiffbrüchen. Ihm zugeordnet ist ein dicht gefüllter Olymp aus Göttern, die sich kaum anders verhalten als Homers irdische Helden. Nichts Menschliches ist ihnen fremd. In Zeus’ Himmel wie auf Agamemnons Erden geht es ziemlich gleich zu.
Noch eine zweite Quelle hilft den Griechen seit dem 8. Jahrhundert vor Christus dabei, eine komplexere Vorstellung von der Welt zu formen. Es sind die Dichtungen des Hesiod. In seinen Hauptwerken, dem Lehrgedicht Werke und Tage und der Theogonie, bekommen die Bewohner Griechenlands vielfältige Erklärungen über die Welt und über ihr Leben. Die Theogonie erzählte den Menschen alles, was sie wissen müssen, um zu verstehen, wo Himmel und Zeit, Erde und Wasser, Krieg und Frieden, Liebe und Tod und am Ende sie selbst herkommen. Hesiod blättert einen ganzen Katalog von Göttergestalten samt ihrer Herkunft und ihrer Funktion auf, von den Urgöttern Chaos,Gaia,Tartaros,Eros,Erebos und Nyx bis zur gegenwärtigen Göttergeneration. Was bereits lange Zeit vor Hesiod in vielen schillernden Geschichten erzählt worden ist, erhält nun ein unverwechselbares Design und ein festes System.
Die Werke und Tage dagegen erscheinen weniger melodramatisch. Die Sage des Prometheus als Freund und Erwecker der Menschheit wird aus der Theogonie aufgegriffen. Auch die dort erwähnte Pandora kommt noch einmal vor und öffnet hier ihre berühmte Büchse, aus der alle Laster und schlechten Eigenschaften des Menschen entweichen. Doch statt der unterhaltsamen Sex-and-Crime-Geschichten vom Werden der Welt erzählen die Werke und Tage einen ziemlich melancholischen Abgesang der Weltzeitalter. Vom strahlenden goldenen über das silberne, bronzene und heroische bis hin zum kargen eisernen Zeitalter der Gegenwart des 8. Jahrhunderts vor Christus. Auch die Einteilung der Welt in die Reiche der Gerechtigkeit und der Hybris kennen die Griechen von Hesiod. Noch wichtiger dürften die vielen Ratschläge an die Bauern sein. Es gibt praktische Anweisungen, wie sie ihr Vieh behandeln, ihre Saat aussäen und sich auf die kalten Wintertage vorbereiten sollen. Wenn die Historiker heute ein Bild davon haben, wie sich das mühselige Leben der vielen Kleinbauern der damaligen Zeit abspielte – dann vor allem durch Hesiod. Und während die Ilias und die Odyssee unverzichtbare Quellen dafür sind, die Ethik des müßigen und kriegführenden Adels zu verstehen, so lieferte Hesiod in den Werken und Tagen so etwas wie die Ethik des kleinen, schwer schuftenden Mannes.
Für die Bewohner Griechenlands vom 8. bis zum 6. vorchristlichen Jahrhundert sind Mythen ein selbstverständlicher Teil ihres Lebens. Es gibt nicht nur die systematisch ausgefeilten Mythologien Homers und Hesiods. Das ganze Leben ist durchsetzt mit religiösen Geschichten, Erzählungen und Erklärungen. Die Tage und das Tagwerk sind geordnet durch Rituale und Kulte, Orakel, Zeremonien und religiöse Feste. In den Mythen finden die Menschen ihren tagtäglichen Halt im Leben; das nötige Weltwissen, das ihnen hilft, ihren Platz im Kosmos zu verstehen. Und die Dichter, so scheint es, sind ihre wichtigsten Autoritäten. Sie erklären den Menschen den Sinn und die Bedeutung ihres Daseins und sagen ihnen, nach welchen Regeln sie zu leben haben.
Doch dann, in diesem Punkt sind sich alle Historiker einig, geschieht etwas Eigentümliches, hochgradig Seltsames. Irgendwo und irgendwann inmitten dieser durch Mythen gut befestigten Welt der Olivenhaine, Weinberge, Ziegenfelsen und aufblühenden Handelsstädte entsteht eine zweite Spur des Denkens – der sogenannte logos. Seinem Wortsinn nach bedeutet logos »Sprechen«, »mündliche Mitteilung«, »Wort« oder »Satz« sowie einiges ganz andere wie zum Beispiel »Sache«, »Definition«, »Rechnung« oder »Wertschätzung«. Und doch lässt sich bei aller Bedeutungsvielfalt leicht sagen, wovon die Rede ist, wenn man heute vom griechischen Logos spricht: vom Versuch einer »vernünftigen« Durchdringung der Welt.
Wann genau diese zweite Spur des Denkens begann und warum, wissen wir nicht genau. Das Beispiel des Thales zeigt, dass es mit den Anfängen dieses neuen »logischen« Verständnisses der Welt nicht ganz einfach ist. Wir haben kaum Texte aus dieser Zeit und müssen uns auf Urteile der Nachwelt verlassen. In jedem Fall entstehen im 6. Jahrhundert vor Christus Konzepte, welche die Phänomene der Natur nicht oder nur in zweiter Linie mythisch erklären, sondern vielmehr »naturalistisch« oder »rational«. Gemeint ist ein Denken, das zumindest Teile der Natur ohne den Verweis auf Götter, blumige Geschichten oder unüberprüfbare Traditionen erklärt.
Die überlieferten Geschichten und die Erklärungsversuche für die Entstehung dieser anderen Denkform als dem Mythos sind allerdings selbst oft mythisch. Man denke an die Sage von der Vorhersage des Thales. Oder an die seit Ende des 19. Jahrhunderts verbreitete Rede vom »griechischen Wunder«. Dabei haben wir bereits enorme Probleme, die wenigen erhaltenen Schriften der frühen naturalistisch inspirierten Denker zu übersetzen. Ihre Begriffe sind nicht die unsrigen, schon einfach deshalb nicht, weil ihre Vorstellungswelt nicht mit unserer heutigen identisch ist. Wir ahnen es mehr, als wir es wissen, dass sich im nordöstlichen Raum des Mittelmeers im 6. vorchristlichen Jahrhundert Spuren eines Denkens in Texten abdrücken, das wir »rational« oder »logisch« nennen. Ein Denken, das sich – zumindest in ersten Ansätzen – darum bemüht, die Natur ohne Vorurteile allein mit den Kräften des Verstandes zu durchdringen. An die Stelle der alten Götter treten abstrakte, gleichsam göttliche Prinzipien. Und dieses Denken wird Anregungen dafür liefern, was später einmal »Wissenschaft« heißen wird. Doch bis dahin ist es im 6. vorchristlichen Jahrhundert noch ein weiter Weg …
Blick in den Kosmos
Gibt es eine kosmische »Gerechtigkeit«, eine Art Balance of Power des Universums? Diese Ansicht findet sich jedenfalls im ältesten bis heute überlieferten philosophischen Satz aus Milet. Das Entstehen und das Vergehen aller Dinge in der Welt, so heißt es, erfolge »gemäß der Schuldigkeit. Denn sie leisten einander Sühne und Buße für ihre Ungerechtigkeit, gemäß der Verordnung der Zeit.«[10]
Der Verfasser dieser Zeilen ist Anaximander von Milet, ein Mann, von dem man erzählt, dass er Thales nahegestanden haben soll. Für manche ist er der erste »Philosoph«, denn sicherer als wir es von Thales wissen, erklärte er die Natur aus abstrakten Prinzipien. Geboren ist er vermutlich um 610/09 vor Christus, und wie Thales soll er um 546 vor Christus gestorben sein. Auch für Anaximander gilt, dass wir das meiste über ihn von Aristoteles wissen. Dabei erfüllt er eine dramaturgische Funktion: Er ist Teil einer kleinen Bilderbuchgeschichte von Männern, die die Natur auf der Grundlage von je unterschiedlich ausgewählten Stoffen oder Ursubstanzen erklärten, bis am Ende Aristoteles auftritt und die wahren Zusammenhänge darlegt.
Was bei Thales das Wasser gewesen sein soll, ist bei Anaximander jedoch keine konkrete Substanz, sondern ein völlig unstofflicher Stoff, das apeiron. Das Wort bedeutet so etwas wie das »Grenzenlos-Unendliche«. Unvorstellbar weit ausgedehnt, unsterblich und unzerstörbar, ist die Antimaterie des apeiron alles, was es gibt. Doch dieser ewige Urstoff befindet sich nicht in einem Stillstand. Vielmehr wogen in ihm einander widerstreitende Kräfte hin und her und versuchen jeweils ein Übergewicht zu bekommen: Feuer, Wasser, Wind und Luft – oder abstrakter: das Heiße, das Feuchte, das Kalte und das Trockene – ringen im Kosmos miteinander wie der Wechsel der Jahreszeiten auf der Erde. Doch das Gesetz der Natur führt immer wieder zu einem Ausgleich wie ein großer unsichtbarer Richter. Nach dem Feuer bleibt Asche zurück, Wasser trocknet aus, Kaltes erwärmt sich wieder usw. Denn wer sich zu weit ausdehnt, empfängt als »Strafe« seine Eindämmung durch ein anderes. Beständig ist nur der Wechsel, der dazu führt, dass der Kosmos stabil bleibt.
Es fällt auf, dass der zentrale Begriff für die Balance der Naturkräfte nicht aus der Technik oder der Beobachtung der Natur selbst stammt – sondern aus der Rechtsprechung! Dike, die jungfräuliche Tochter des Zeus und Personifikation der Gerechtigkeit, die die Bewohner Griechenlands aus Hesiods Werken und Tagen kannten, wacht hier als abstrakte kosmische Gerechtigkeit über die Harmonie der Welt. Sie ist das absolute Prinzip des Gleichgewichts, das Anaximander aus der gesellschaftlichen Sphäre in die kosmische Sphäre ausweitet.
Der Transfer der Gerechtigkeit von der Menschenwelt in den Kosmos ist äußerst spektakulär. Denn die Balance der Welt kommt ohne einen persönlichen Gott aus. Dies ist umso bemerkenswerter, als sich die »rationale«, nicht von Vorurteilen geprägte Vorstellung von »Gerechtigkeit« im 6. vorchristlichen Jahrhundert eigentlich noch in den Kinderschuhen befindet. Von der tatsächlichen Rechtsprechung gar nicht zu reden. Doch Anaximander scheint eine universale Gerechtigkeitslehre im Sinn zu haben, die das gesamte Sein umfasst. Alles physikalische Geschehen ist danach von einem inneren Sinn bestimmt und einer strengen Norm untergeordnet. Das physikalische Gesetz und das moralische Gesetz des Kosmos sind ein und dasselbe – ein Konzept, das uns in der Philosophiegeschichte später wiederbegegnen wird. Gottfried Wilhelm Leibniz nennt es zu Anfang des 18. Jahrhunderts Theodizee.
Hat Anaximander eine einzige Welt angenommen, oder sah er unsere Welt nur als eine von vielen innerhalb des apeiron? Wir wissen es nicht. Eine detaillierte Kosmogonie entwirft er jedenfalls nur für unsere Welt. Danach ballte sich bei deren Entstehung das Kalt-Feuchte zusammen, während das Heiß-Trockene nach außen gedrängt wurde und sich wie ein Feuerkranz um das Kalt-Feuchte legte – eine erste Ahnung des Trägheitsprinzips in der Physik. Die Flammen umschließen das Kalt-Feuchte wie die Rinde den Baum. Eingeschlossen durch das Feuer, beginnt das Kalt-Feuchte auszutrocknen und zu verdampfen. Nebel und Luftmassen breiten sich aus und zerteilen den Feuerkranz. Es bilden sich drei einander umschließende Feuerräder, ummantelt von finsterer Luft wie ein Fahrradschlauch auf einer Felge. Auf der Innenseite der Felgen bilden sich dabei kleine Öffnungen, aus denen das Feuer ausgeblasen wird. Das bisschen Feuer, das wir durch diese Löcher sehen, erscheint uns am nahe gelegenen Ring als Sterne, beim zweiten als der Mond und beim äußeren Ring als die Sonne. Verstopfen die Löcher des zweiten und dritten Ringes, erleben wir dies als eine Sonnen- oder Mondfinsternis.
Die Erde ist das, was vom ursprünglich Kalt-Feuchten übrig geblieben ist. Sie schwebt frei inmitten der drei Ringe in immer identischem Abstand. Ihre Form gleicht einem Säulenstumpf. Sie ist dreimal so breit wie hoch. Die Meere sind Überreste des Feuchten, die der Feuerkranz noch nicht ausgetrocknet hat. Dünsten die Sonnenstrahlen die Erde aus, kommt die Feuchtigkeit als Regen auf die Erde zurück. Auch die Winde entstammen der verdampfenden Feuchtigkeit und ebenso die Wenden von Sonne und Mond.
Die Biologen schätzen Anaximander, weil er in seine Kosmogonie einen Gedanken einwebt, den man als »evolutionär« bezeichnen kann. Denn die Frage, woher die Tiere und die Menschen kommen, erklärt er durch eine Abstammungstheorie. Alles Leben entspringt ursprünglich aus dem Meer, entstanden aus der Feuchtigkeit. Auch die frühen Menschen stammen aus dem Wasser. Zunächst waren sie fischähnliche Lebewesen mit stacheligen Hüllen, die erst im Erwachsenenalter aus der Hülle schlüpften und ans trockene Land gingen. Anaximander glaubt nicht, dass die Menschen sich Schritt für Schritt aus Fischen entwickelt haben, wie es heute die Evolutionstheorie tut. Sondern er glaubt, dass in früher Zeit sich jeder einzelne Mensch vom Fischstadium zum Stadium als Mensch entpuppt habe – ein Vorgang, der später offensichtlich nicht mehr nötig war, denn zu Anaximanders Zeit wurden Menschen allgemein sichtbar nicht mehr als Fische im Meer geboren. Immerhin hat er das Meer als Ursprung allen Lebens erkannt und angenommen, dass die Arten von Natur aus nicht unveränderlich sind.