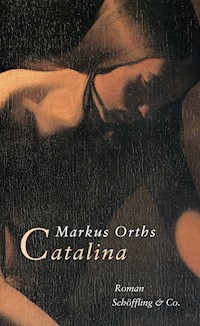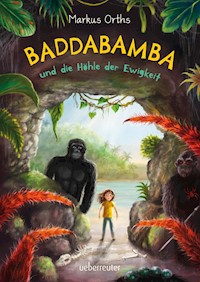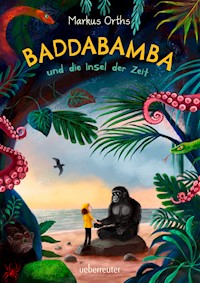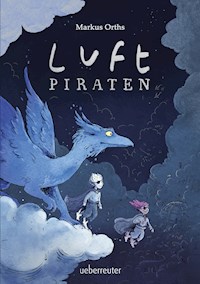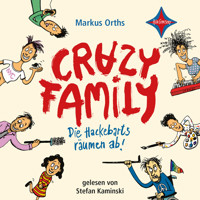8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Neues aus Niederkrüchten
- Sprache: Deutsch
Alles hat ein Ende – oder? Nächster Halt: "Niederkrüchten." Kaum ist Benno aus dem Bus gestiegen, spürt er wieder diese Heimatzähe. Hier bei seinen alten Eltern hat sich kaum etwas verändert. Auch die beste Freundin seiner Mutter, Klärchen, wohnt noch mit ihrer schlechtgelaunten Tante nebenan. Als Klärchen Benno wiedersieht, beklagt sie sich, wie selten ihre eigene Tochter sich zuhause blicken lässt. Und schon fasst sie einen Plan: Sie ruft ihre Tochter an und behauptet, Tante Erna sei gestorben. So ein Begräbnis ist ja eine große Sache. Wer kann da schon Nein sagen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
»Auf einmal spüre ich ein freudiges Glucksen, tief unten, im Magen: Tante Erna ist tot, lebt aber noch, und in ein paar Stunden werde ich nach langer Zeit endlich Sibille wiedersehen.«
»Nächster Halt: Niederkrüchten«
Kaum ist Benno aus dem Bus gestiegen, spürt er wieder diese merkwürdige Heimatzähe. Hier bei seinen alten Eltern hat sich kaum etwas verändert. Auch die beste Freundin seiner Mutter, Klärchen, wohnt noch mit ihrer schlechtgelaunten Tante nebenan. Als Klärchen Harald wiedersieht, beklagt sie sich, wie selten ihre eigene Tochter sich zuhause blicken lässt.
Und schon hat sie einen Plan gefasst: Sie ruft ihre Tochter Sibille an und behauptet, Tante Erna sei gestorben.
So ein Begräbnis ist ja eine große Sache.
Wer kann da schon Nein sagen …
Markus Orths
Ewig währt am längsten
Tante Ernas letzter Tanz
Roman
1
Dort steht sie. Ihr leuchtender Schopf ist unverkennbar. Seit etlichen Jahren gefärbt: ein matt-helles Henna. Ihre vom Wind zerzauste Dauerwelle wirkt wie ein oranger, fluffiger Blumenkohl. Dort steht sie. Dort steht Mutter. Sie trägt weder Handtasche noch Schirm, obwohl graue Wolken Regen ankündigen, nein, sie steht einfach da, in ihrem rundlichen, gemütlichen, achtzigjährigen Körper, blaue Stoffhose (»Keine Röcke! Das sieht mir zu sehr nach alter Frau aus!«), Birkenstock-Sandalen und vermutlich die karierte Lieblingsbluse unter der Jacke. Jetzt winkt sie, winkt dem Bus. Obwohl sie mich nicht sieht und gar nicht sicher sein kann, ob ich am Bahnhof den Bus überhaupt erwischt habe. Sie winkt, indem sie mit beiden Händen über ihrem Kopf fuchtelt, als sei sie in Seenot geraten. Oft habe ich ihr gesagt, dass sie mich nicht abholen muss: die paar Hundert Meter von der Haltestelle bis zum Haus. Doch sie lässt es sich nicht nehmen, sie freut sich zu sehr: Wenn sie meinen Bus auf sich zukommen sieht, dann gluckst es immer so schön, im Bauch, tief unten, sagt sie.
Ich hole Luft. Wenn ich aussteige, legt sich eine seltsame Heimatzähe auf Glieder und Stirn. Ich gehe Mutter entgegen. Jetzt sieht sie mich. Ihr Gesicht blitzt auf. Sie setzt sich in Bewegung. Ihr Trippeln, diese Schrittchen, das energische Schlenkern mit den Ellbogen. Ich breite die Hände aus wie Pastor Kasper am Altar. Wir nehmen uns in den Arm. Sie legt mir ihre Hand auf den Rücken, ich lege ihr meine Hand knapp unter den Nacken. Die Umarmung ist innig und flüchtig zugleich. Wir wissen wohl beide nicht genau, wie lange eine Umarmung zwischen Mutter und Sohn dauern sollte. Ich rieche eine Note Zitrone, als hätte sie für meinen Besuch nicht nur das Haus, sondern auch sich selbst von oben bis unten geschrubbt, mit ihrem Lieblingsmittel: Zitroquick. Sie tritt einen Schritt zurück und schaut mich an.
»Und? Wie is et?«, fragt sie.
In diesem Wie is et? liegt die ganze traurige Fröhlichkeit des Niederrheins. Das vernieselte Grau. Die hochgereckten Pappeln. Die schnurgeraden Flüsschen. Die im Morgendunst dampfenden Wiesen. Die vielen Seen, klitzeklein und hingekleckert.
»Und? Wie is et?«, fragt meine Mutter.
Und unsere immer gleiche Antwort ist nichts weiter als ein Laut, der dem Murmeln von gelangweilten Wiederkäuer-Kühen gleicht, die auf triefnassen Wiesen dumm glotzend vor sich hin mampfen, wir sagen: »Mhm.«
»Und? Wie is et?«, fragt sie.
»Mhm«, sage ich. »Und bei euch?«
»Mhm.«
»Alles beim Alten?«
»Mhm.«
»Wie schön.«
Sie hakt sich bei mir ein.
Wir gehen gemächlich.
Ich passe mich ihren Schritten an. Es ist, als wolle sie meine Heimkehr noch ein wenig hinauszögern. Wir biegen in unsere Straße ein. Ich lese das Schild: Pannenmühle. Mutter schmiegt sich leicht an mich, ihre Wange berührt meine Schulter. Noch hat sie mich nicht beim Namen genannt.
2
Als Erstes sehe ich das Klärchen: Mutters geliebte, Mutters allerbeste Freundin. Das Klärchen bewohnt die zweite Hälfte unseres Doppelhauses. Wenn meine Mutter rundlich ist, so ist das Klärchen fett. Dafür ist sie einen halben Kopf größer und hat breite Schultern. Sie trägt eine gestreifte Weste, Turnschuhe und, genau wie meine Mutter, stets Hosen. Die beiden verstehen sich blind, ihre Herzen schlagen auf selber Frequenz. Das Klärchen steht vor ihrer Haustür und wartet auf uns. Eine Umarmung scheitert an Klärchens Leibesfülle.
»Ach, dein Sohnemann!«, sagt das Klärchen. »Mal wieder im Lande?«
»Hallo, Klärchen!«, sage ich.
»Und?«, ruft sie. »Wie is et?«
»Mhm«, sage ich. »Alles beim Alten. Und bei dir?«
»Mhm.« Dann strafft sich ihr Körper und sie wendet sich an Mutter: »Na, Irma, da haste Glück, was? Das ganze Wochenende mit dem Herrn Sohn? Da freu ich mich für dich. Ich guck nachher mal vorbei!«
»Jetzt lass doch den Jungen erst mal ankommen«, sagt meine Mutter und pfriemelt den Schlüssel ins Schloss der Haustür. Ich nicke dem Klärchen zu, und Mutter schiebt mich sanft hinein.
Diese dumpfe Dunkelheit: Mutter ist ein wenig lichtempfindlich, sie sitzt gern in schummrigen Räumen. »Sonne geht mir auf die Nerven!«, ist einer ihrer Lieblingssätze, und sie mag das Flackern der Kerzen. Jetzt dimmt sie das Licht auf.
Nichts verändert sich hier. Der rostrote Fransenläufer im Flur. Die schlecht angedübelte Garderobe, an die ich meine Jacke hänge. Rechts das Gästeklo. Links die Küche. Wir gehen geradeaus ins Wohnzimmer. Die quietschgrüne Couch. Der Röhrenfernseher. (»Der tut es noch!«) Die kleine Essecke. Das Buffet. Nach vorn die Glasfront zur Terrasse, die äußeren Flügel mit dichtem Vorhang behängt. Nur durch die Mitte blinzelt der Tag: Die Sonne hat sich hinter Wolken verzogen. Herein dringt graues Einerlei.
In der linken Ecke des Wohnzimmers gibt es eine besondere Tür. Öffnet man sie, führt sie in einen kleinen Hohlraum. Auf der anderen Seite des Hohlraums gibt es eine zweite Tür. Geht man auch dort hindurch, steht man direkt im Wohnzimmer vom Klärchen. Meine Mutter und Klärchen haben die Türen vor mehr als zwanzig Jahren in die Wände hauen lassen, nachdem ihre beiden Einzelkinder (Sibille und ich) ausgezogen waren: ein glatter Durchbruch zwischen den Doppelhaushälften. So können das Klärchen und Mutter bei der jeweils anderen nach Belieben ein und aus gehen. Fast wie in einer Wohngemeinschaft. Die Türen stehen meist offen. Auch jetzt. Mutter geht hin und schließt sie. Ganz sanft.
»Wo ist Papa?«, frage ich.
»Och, gestern war der Magolei bei uns. Dann haben die zwei wieder geredet, stundenlang. Am Schluss hat der Magolei seinen Schirm vergessen vor lauter lauter. Jetzt bringt der Papa dem Magolei gerade den Schirm zurück. Der müsste aber längst wieder da sein. Bestimmt sind die wieder am Palavern, die zwei, über Särge und Grabsteine und Vampire. Letztens erst hat Papa sich für den Magolei einen Spruch zurechtklamüsert, einen Werbespruch. Bestattungen Magolei: Bei uns liegen Sie richtig. Ach: Weißt du, wer gestorben ist?«
»Nein.«
»Der Danners, Josef.«
»Kenn ich den?«
»Klar kennst du den. Der wohnt da vorne direkt auf der Erkelenzer Straße. Da musstest du früher immer vorbeifahren, wenn du den … Wie hieß der noch mal? … besucht hast?«
»Nein«, sage ich. »Kenn ich nicht.«
»Doch, doch, der Danners! Der Danners, Josef! Das ist doch der Vater von dem Sohn! Der hat euch jedes Jahr zwanzig Mark gegeben! Beim Sternsingen! Und jetzt ist der aus dem Fenster gefallen. Beim Fensterputzen. Das stand gestern in der Zeitung. Er wurde plötzlich und unerwartet aus unserer Mitte gerissen. Schlimm ist das. Da denkt man im Augenblick noch: Mensch, so sauber waren die Scheiben schon lange nicht mehr, und im nächsten Augenblick fällt man raus und steht nicht mehr auf.«
3
Ich gehe die Treppe hoch, in mein Kinderzimmer. Es ist eine Zeitreise. Alles unberührt. Ich bin wieder Kind, dasselbe Bett, dieselben Möbel, sogar meine sieben Stofftiere liegen in Reih und Glied, scheinen zu quietschen vor Freude, als sie mich sehen. Ich nehme meinen Lieblingsbären und lasse ihn kurz brummen. Mein Kissen. Mein Kuschelkissen. Auf dessen Bezug sich damals, ich war vielleicht dreizehn oder vierzehn, diese verräterischen Flecken sammelten: vom nächtlichen Bespringen. Einmal war ich dabei, als meine Mutter die Bezüge wechselte, und plötzlich bemerkte ich selbst diese Flecken und mir wurde siedend heiß klar, dass der Ursprung dieser Flecken aus Mutters Sicht eindeutig sein musste, über dieses Thema hatten wir noch nicht gesprochen, und weil mir auf einmal alles so schrecklich peinlich war, was ich hier Nacht für Nacht vollführte, ging ich in die Offensive, und es platzte mir – ohne, dass ich darüber nachgedacht hätte – die beinah empörte Frage aus den Lippen: »Was sind denn das für Flecken, Mama!?« Mutter lächelte damals, strich mir über den Kopf, erlöste mich aus meiner Pein und sagte: »Och, das sind nur Schweißflecken. Vom Schlafen. Die krieg ich wieder raus! Mit Zitroquick, mein Junge.«
Ich werfe meinen Rucksack in die Ecke, setze mich auf den alten Drehstuhl und rolle einen Meter zurück und wieder vor. Die Räder quietschen. Im Regal steht mein grüner Ordner mit den Filmmusikkomponisten. Ich schlage ihn auf: ein minutiöses Verzeichnis, welcher Komponist in welchem Jahr die Musik zu welchem Film komponiert hat. Bei Ennio Morricone finden sich die meisten Einträge, gefolgt von Max Steiner, Victor Young und Maurice Jarre. Ich lege mich ins Bett und schaue zur Decke: Reste von verglühten, selbstleuchtenden Kindheitssternen. Ich stehe schnell wieder auf. Im Beklemmungsbett werde ich noch lange genug liegen müssen. Ich habe nur einmal gewagt, meine Mutter zu fragen, ob ich nicht lieber in einem Hotel übernachten soll. Sie hat danach eine Viertelstunde lang geschimpft: Wie ich denn auf so eine Idee kommen könne! Das sei doch viel zu teuer! Ob es dem gnädigen Herrn bei ihr etwa nicht mehr gut genug sei? Oder ob ihm das Essen der eigenen Mutter nicht mehr schmecke?
Auf das Dachfenster säuseln jetzt Regentropfen. Ich gehe hinunter. Es riecht nach Hefeknödeln mit Vanillesoße. Bei jedem Besuch kocht Mutter Hefeknödel mit Vanillesoße, dazu gibt es eingelegte Pflaumen, bei jedem Besuch schmecken die Hefeknödel mit Vanillesoße ganz wunderbar, vor allem aber sind sie süß.
Obwohl ich bereits nach drei Hefeknödeln, einem halben Topf Vanillesoße und einem Schüsselchen Pflaumen pappsatt bin, esse ich noch den vierten und auch den fünften Hefeknödel, und meine Mutter setzt einen weiteren Topf mit Vanillesoße auf. Während des Essens ist sie ganz Mutter, fragt mich, wie es mir geht und was gerade ansteht, wie es in der Kneipe aussieht und ob ich das immer noch gern mache, an der Theke stehen, »in einem Wirtshaus«, aber sie fragt es nicht mit hochgezogener Augenbraue, sondern sie will es ehrlich wissen. Doch dann ist mir auf einmal schlecht von den fünf Knödeln, ich gehe ins Wohnzimmer und nehme mir einen Schnaps aus der Bar, einen selbst gebrannten Kirschschnaps, vom Nachbarn gegenüber: Willy Schmitz. Ich habe sofort den Kirschgeruch in der Nase und fühle meine verklebte rechte Handfläche: jene Spätsommernachmittage, an denen ich haufenweise Kirschen entsteinen durfte, draußen, mit einer am Tisch angeschraubten Entsteinungsmaschine aus Plastik, und die hellbraunen Steinchen, an die sich noch allerletzte, verzweifelte Fruchtfleischfetzen klammerten, ploppten in die weiße Schüssel, gerettet aber wurden die halb zerfledderten, ihres Innersten beraubten, entkernten, ausgehöhlten Kirschkörper, klebrig, süffig, zermanscht und im Saft ihrer eigenen Wunden seufzend.
Ich schaue nach draußen. Der niederrheinische Regen: hauchzarte, ziselierte Fäden. Als ich ausgestreckt und faul dort sitze und meine Mutter höre, die in der Küche werkelt – schon immer hat mich das Scheppern des Geschirrs und das Klappern des Bestecks auf geheimnisvolle Weise beruhigt –, schlummere ich beinah ein. Doch dann ist sie plötzlich da. Ich schrecke hoch. Sie sitzt mir gegenüber. Sie lächelt mich an. Und dann – endlich – fängt sie an zu reden.
4
Ich ziehe mein Smartphone aus der Tasche und schalte das Diktiergerät ein, ohne dass Mutter es merkt. Ich habe etliche Muttermonologe auf Band. Manchmal, allein, in Freiburg, wenn mich ein Gefühl der Entwurzelung überkommt, eine Halt- und Heimatlosigkeit, lausche ich ihrer Stimme. Das gibt mir ein wenig Geländer, das tut gut, und es hilft auch beim Einschlafen.
»Ruhe«, so Mutter. »Du immer mit deiner Ruhe! Das sagst du doch ständig! Ruhe! Ich soll mal an mich denken, sagst du. Ich soll mir mal was gönnen. Ich soll mich mal entspannen. Letztens erst hast du mir am Telefon noch gesagt, ich soll mal in die Sauna gehen, weißt du das nicht mehr? Und da hab ich gedacht, Irma, komm, hab ich gedacht, jetzt hör doch einmal nur auf deinen Sohn! Und da war ich also in der Sauna! Zum ersten Mal in meinem Leben. Das war unmöglich war das!«
Ich trage sie immer im Ohr, ihre Stimme: ein klarer Alt, der tiefer sackt, wenn sie Ernstes erzählt, manchmal – bei Lustigem – in die Höhe kiekst, in diesem niederrheinischen Singsang von endlos aneinandergereihten Wörtern, von nicht zu bändigenden Satzkaskaden, von Anekdoten, Gedanken, Schleifen, von ewigen Wiederholungen in atemberaubender Geschwindigkeit.
Jetzt aber bin ich müde. Die weite Reise. Die Knödel. Und in der Nacht habe ich schlecht geschlafen. Ich höre nicht richtig zu. Meine Gedanken schweifen ab. Ich schnappe nur noch ein paar Fetzen auf. Es wird ein lustiger Monolog, das steht fest. Ich freue mich darauf, mir das alles anzuhören, auf der Heimfahrt. Oder heute Nacht. Vorm Einschlafen.
»Und das glaubst du nicht, mein Junge«, sagt Mutter, plötzlich lauter, »jetzt kommt in dem Augenblick, da kommt auch noch der Pastor Kasper in die Sauna, kannst du dir das vorstellen? Der Pastor Kasper, der ist jetzt auch schon über achtzig und fast genauso dick wie mein Klärchen. Letzte Woche erst haben wir den auf der Straße getroffen, den Pastor Kasper, und der Papa gibt dem die Hand und sagt: Ach, da kommt der Pastor, der passt durch kein Tor.« Meine Mutter muss lachen: Es löst sich die obere Reihe der dritten Zähne und flutscht ihr auf die Lippen. Sie schiebt in einer einzigen fließenden Bewegung das Gebiss zurück in den Mund und redet weiter. »Furchtbar ist das mit dem Papa! Das wird immer schlimmer im Alter. Nur Unsinn hat der im Kopf, den ganzen Tag. Genau wie das Klärchen. Aber deshalb liebe ich die beiden auch so, da kann ich nichts dafür.«
Ihr Erzählen wächst sich aus zu einem alles vertilgenden Strom und was ihr in die Quere kommt, wird mitgerissen.
»Jetzt kommt der also in die Sauna rein, der Pastor Kasper, und der kommt da rein wie alle anderen, also wie Adam ohne jedes feige Blatt, aber zum Glück hängt dem sein Bauch runter bis auf die Oberschenkel, da kann man also nichts sehen, aber trotzdem. Ich sag: Herr Pastor, sag ich, was machen Sie denn hier in der Hölle? Und der Pastor sagt: Grüß Gott, Frau Storch, ich wusste gar nicht, dass Sie in die Sauna gehen. Ich sag: Ich auch nicht, aber gut, dass Sie da sind, Herr Pastor: Wenn ich gleich umkippe, dann können Sie mir direkt die Letzte Ölung geben. Da hinten gibt es Massagen, sag ich, die haben bestimmt Öl satt.«
Zwischendrin weiß meine Mutter oft nicht mehr, was sie am Anfang eigentlich hat sagen wollen. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen?, fragt sie dann erstaunt. Oder: Was wollte ich denn eigentlich erzählen? Oft verwechselt sie Wörter. Hieroglyphen werden zu Hierophyten. Diagonal heißt regional. Judas Ischariot nennt sie: Judas Ischias. Mal zwinkert sie
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: