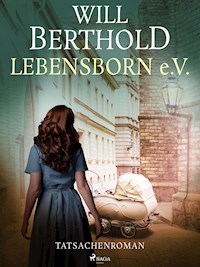Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die ergreifende, dramatische Geschichte einer Familie, die dem Krieg zum Opfer fällt. Während der Oberpostschaffner Arthur Kleebach in Berlin mit seiner Frau Silberhochzeit feiert, erhält das Ehepaar die Nachricht, dass ihr Sohn Gerd bei Arras gefallen ist. In der sinnlosen Hölle der Entscheidungsschlachten gibt es keine Gnade, und während die Männer dort sterben, warten ihre Mütter zu Hause auf die Rückkehr ihrer Söhne. Wenigstens von Fritz, Gerds Zwillingsbruder, kommt zwei Jahre später eine Nachricht aus einem britischen Kriegsgefangenenlager. Achim, der jüngste der Brüder, kämpft vor Stalingrad. Thomas hat es von Afrika nach Russland verschlagen, und dort sollen die beiden Brüder sich unverhofft wiedertreffen. Doch Thomas wird schwer verwundet und mit der letzten Maschine ausgeflogen, während Achim in der Hölle von Stalingrad zurückbleibt.Will Berthold (1924–2000) war einer der kommerziell erfolgreichsten deutschen Schriftsteller und Sachbuchautoren der Nachkriegszeit. Seine über 50 Romane und Sachbücher wurden in 14 Sprachen übersetzt und erreichten eine Gesamtauflage von über 20 Millionen. Berthold wuchs in Bamberg auf und wurde mit 18 Jahren Soldat. 1945 kam er vorübergehend in Kriegsgefangenschaft. Von 1945 bis 1951 war er Volontär und Redakteur der "Süddeutschen Zeitung", u. a. berichtete er über die Nürnberger Prozesse. Nachdem er einige Fortsetzungsromane in Zeitschriften veröffentlicht hatte, wurde er freier Schriftsteller und schrieb sogenannte "Tatsachenromane" und populärwissenschaftliche Sachbücher. Bevorzugt behandelte er in seinen Werken die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg sowie Themen aus den Bereichen Kriminalität und Spionage.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berfhold
Feldpostnummer unbekannt
Roman
SAGA Egmont
Feldpostnummer unbekannt
Genehmigte eBook Ausgabe für Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
Copyright © 2017 by Will Berthold Nachlass
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1978 by Goldmann Verlag, Germany
All rights reserved
ISBN: 9788711727249
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Sie hatten geflucht und gestürmt, gebetet und getötet, gesungen und gesoffen, gemault und gesiegt – und viele waren schon gefallen, bevor sie noch wußten, wie man ein Mädchen in den Arm nimmt. Sie waren gefahren, getippelt, gerobbt und gekrochen. Sie hatten Blasen an den Füßen, Schwielen an den Händen, Leere im Hirn und Paris in der Tasche.
Es war der 20. Mai 1940, Frühling – aber in der Luft schwang nicht der verwirrende Duft der Blüten, sie stank nach Pulvergas, nach Verwesung. Der deutsche Überraschungsangriff hatte Holland überrannt und Belgien kassiert; der gepanzerte Stoßkeil feldgrauer Kolonnen überflutete Nordfrankreich, trennte die Franzosen von den Engländern und drängte jetzt ungestüm zur Kanalküste weiter.
Eine Panzerjagd-Einheit der von General Rommel geführten 7. P.D. stoppte heute befehlsgemäß in dem kleinen Dorf bei Arras und bezog endlich Quartier, vielleicht nur für Stunden. Auf der Speisekarte des Blitzkrieges standen: Handstreiche aus der Luft, Panzerangriffe aus der Flanke, ausgeräucherte Bunker und heulende Stuka-Angriffe, aber es waren nur für die Taktik-Lehrer der Kriegsschulen Delikatessen, die Landser zeigten sich froh über einen warmen Schlangenfraß aus der Feldküche.
»Denn das«, pflegte der Gefreite Kleebach weise zu sagen, »ist immer noch besser, als ins Gras zu beißen…«
Er schob mit seinem Kumpel, Kameraden und Freund Böckelmann Doppelposten vor dem requirierten Schulhaus.
Allmählich ging der Tag in die Nacht über. Und mit der Dunkelheit kam die Stille in das idyllische Dorf, das vielleicht morgen schon ein Trümmerhaufen sein würde. Seine Bewohner durften ihre Häuser nicht verlassen; auch die deutschen Soldaten hatten in ihren Unterkünften zu bleiben, und so lebten die Menschen miteinander, doch getrennt voneinander im stählernen Käfig der »großen« Zeit.
Von drüben, aus der Nacht, in die sich der Feind gewickelt hatte, kam ein matter Windstoß und spielte mit den Blättern der üppigen Kastanie auf dem Schulhof, unter deren Krone die Fahrzeuge der Kompanie standen: vier Sturmgeschütze auf Selbstfahrlafetten, zwei LKWs, ein Schützenpanzerwagen und eine französische Beute-Pak. Jetzt, da die kalten Ungeheuer reglos und stumm nebeneinander standen wie satte Kühe auf der Weide, verloren sie ihren Schrecken, als könnten sie sich der friedlichen Stimmung anpassen.
Motoren haben es gut, dachte der Gefreite Gerd Kleebach, sie lassen sich einfach abstellen. Aber das Herz schlägt weiter, im Takt der Strapazen, und die Nerven vibrieren noch im Sud der Erregung; man ist müde und kann nicht schlafen, hungrig und will nicht essen. Wie ein Schwungrad, überlegte der 20jährige Abiturient weiter, das sich noch im Leerlauf weiterdrehen muß…
»Noch ’ne halbe Stunde bis zur Ablösung«, sagte der Gefreite Böckelmann zu ihm. »Hast du heute Post gekriegt?«
»Ja«, versetzte Kleebach, »von zu Hause… aber schon drei Wochen alt…«
»Schlamperei!« fluchte Böckelmann, »beschwer dich doch… dein Vater ist ja Postminister…«
»Nee… Postbote«, erwiderte Kleebach lachend. Er sah prüfend nach oben und nickte befriedigt. »Wird ein schöner Tag morgen«, sagte er voraus, »prima für die Schlipssoldaten von der Luftwaffe.«
»Ja«, Böckelmann deutete Richtung Feind, »die Tommy-Panzer wagen sich morgen nicht aus ihren Rattenlöchern… die Stukas halten sie uns von der Pelle.«
Dann standen sie nebeneinander und starrten in die Nacht. Nichts rührte sich. Jetzt wirkten die Häuser mit ihren hohen Dächern und niederen Fenstern unwirklich und verzaubert wie im Märchen.
»Wie weit ist es eigentlich noch bis nach Paris?« fragte Böckelmann.
»So an die drei Wochen«, antwortete sein Freund lächelnd.
»Dussel… ich meine, wie viele Kilometer?«
»Dreihundert oder vierhundert vielleicht …«
»Muß ’ne tolle Stadt sein…«
»Wirst’s erleben.«
»Hoffentlich, Mensch«, entgegnete Böckelmann, »und dann die Frauen, was?… So schwarzhaarige Dinger.«
Er zeichnete mit den Händen Konturen in das Nichts.
»Auf dich haben sie nicht gewartet«, erwiderte Kleebach.
»Auf dich auch nicht«, antwortete der Kumpel, »aber die gewöhnen sich schon an uns… meinst du nicht?«
»Kann sein.« Kleebach war zerstreut.
»Na…«, träumte Böckelmann weiter, »wenn wir erst in Paris sind… zuerst schlafe ich zwei Tage… dann eine Stunde Badewanne, dann einen Eimer Pudding, dann ein halbes Faß Rotwein… na, und dann, ein frisches Hemd am Leib, Schlag an der Hose, Urlaubsschein in der Tasche, und – Mademoiselle wu-lä-wu und so…«
»Von mir aus«, brummelte Kleebach.
»Die Französinnen sollen doch die Wucht sein.«
»Gerede.«
»Tu doch nicht so!« fuhr ihn Böckelmann gereizt an, »bist doch auch scharf auf ’ne Pariserin, oder?«
»Nee«, versetzte Kleebach großspurig.
»Du machst dir bloß nichts aus ihnen«, lachte der Freund halblaut, »weil sie sich nichts aus dir machen.«
Die beiden gingen auseinander, auf befohlene Distanz.
Kleebach, der Junge, war ein Jahr Soldat und seit zehn Tagen an der Front. Sie hatten ausgereicht, ihm zu zeigen, wie sich’s stirbt. Im übrigen war er guter Durchschnitt, wollte kein Held werden, aber auch nicht feige sein. Er war schmal und hager, hatte eine biegsame Figur und ein weiches Gesicht. Die letzten zehn Tage hatten seine Züge herber gemacht und die Kerben an den Mundecken verstärkt. Die Feuertaufe hatte sich für den jungen Berliner nicht als so hochtrabend erwiesen wie im Schwulst der PK-Berichte. Als alles vorbei war, wechselte Kleebach schlicht die Unterhose, das einzige Mal übrigens, und der Fall war für ihn erledigt.
So jung er war, hatte ihm die Zeit schon einiges beigebracht: wie man sich klein macht, wie man den Pernod unverdünnt trinkt, wie man die Erkennungsmarke eines Gefallenen auseinanderbricht, wie man den Kunsthonig unbemerkt wegwirft, wie man mit einem Minimum an Aufwand ein Maximum an Diensteifer aufweist, und wie man hübschen Französinnen nachsehend vergißt, daß man auf ihre Brüder schießt …
Die Luft war weich, der Abend mild. Am Himmel trat der Halbmond stärker hervor und versilberte die Dächer der Gehöfte. Kleebach sah am Großen Bären entlang. Dahinten könnte Berlin liegen, dachte er. Die Mutter, der Vater und die anderen fünf Kleebachs – vielleicht sehen sie auch gerade nach oben. Er spürte die Ruhe, die sich wie eine Daunendecke über die Landschaft breitete und Stellungen, Bunker, Ruinen, Befehle und Gräber zudeckte, Wer es schaffte, zog sich auf der Flucht vor dem Morgen diese Decke über den Kopf. Irgendwo hämmerte ein einsames Maschinengewehr, aber so weit entfernt, daß es die Panzerjagdeinheit nichts anging. Am Horizont zerplatzte eine Leuchtkugel, ihre Funken flogen auf drei hohe Pappeln in der brettebenen Landschaft, die ein paar Sekunden lang wie ein Friedhof wirkte, was traurig stimmte.
Kleebach sah zu den Blütenkerzen in der wuchtigen Baumkrone auf. Es würde in ein paar Monaten reichlich Kastanien geben, aber er wußte nicht, ob er im Herbst noch lebte. Er sah sich um und atmete schwer. Flieder, dachte er, weißer Flieder, die Lieblingsblumen seiner Mutter. Er ärgerte sich über den Duft, der sich an den Krieg verschwendete.
Im Haus gegenüber sah man plötzlich spärliches Licht. Der matte Schein, der aus dem Fenster fiel, war hell genug, um feindliche Granaten auf sich zu lenken.
»Was soll denn das ?« schimpfte Kleebach und wollte auf das Haus zugehen.
Heinz Böckelmann hielt ihn am Arm fest. »Sieh dir das an…«
Man konnte nur einen Schatten durch die Gardine sehen, einen Umriß, den Scherenschnitt einer rührend schmalen Figur, die noch mädchenhaft wirkte und schon fraulich war. Zwei Hände, die sich hoben, ein Kopf, der sich leicht nach unten beugte, daß die langen Haare vornüber fielen, zwei dünne Arme, die sich wieder nach oben reckten, als suchten sie einen Halt, als wollten sie sich ergeben.
Sie standen und starrten.
»Mensch«, sagte Böckelmann ergriffen.
Dann ging das Licht aus. Die beiden Posten konnten den Blick nicht vom Fenster wenden, sahen, wie sich der Vorhang teilte, bemerkten ein junges Mädchen, das leicht vorgebeugt, wie lauschend, in die Nacht starrte, und waren ihm so nahe, daß sie glaubten, das Gesicht mit den Händen streicheln zu können.
Die Französin bemerkte die beiden Soldaten und warf mit einem harten Ruck das Fenster zu.
»So etwas«, sagte Böckelmann.
Sein Freund schwieg.
Er roch nicht mehr den Flieder allein, er spürte den Frühling. Er spürte ihn in den Fingerspitzen, er legte sich auf den Brustkasten, er machte den Blick trunken, und er machte ihn bitter auf den Krieg, der ihm die Jugend stehlen wollte und sah das Recht zu leben, zu lieben, zu warten, zu träumen, zu küssen, Zärtlichkeiten zu empfangen und wiederzugeben.
»Das war die aus der Bäckerei… die Blonde…«, sagte Böckelmann, »weißt schon, die den Spieß heute nachmittag einen boche nannte…«
Kleebach hörte es nicht. Seine Augen hingen noch immer am Fenster. Aber die Nacht hatte das Guckloch zum Leben wieder zugeklebt. Nur zwei Katzen feierten es noch. Sie waren klüger als die Menschen, denn sie pfiffen auf den Krieg.
»Die ist höchstens zwanzig…«, sagte Böckelmann bewegt, »die bräucht’ mich nicht zweimal zu bitten…«
»Bei euch piept’s wohl?« fuhr eine scharfe Stimme dazwischen.
Die beiden Gefreiten nahmen automatisch Haltung an. Sie hatten den Schatten an seiner Stimme als Hauptfeldwebel Weber erkannt.
»Ihr Quasselfritzen!« fluchte er, »ihr Quatschweiber!… ihr Pennbrüder!«
Der Gefreite Kleebach versuchte Meldung zu machen: »Zwei Mann beim…«
»Beim Kaffeeklatsch…«, unterbrach ihn der Spieß unwillig.
»Auf Wache nichts Neues, Herr Hauptfeldwebel.«
»Natürlich«, brummte der Spieß, »bei Kleebach nie was Neues. Immer das Alte: immer die Klappe offen, der Herr Abiturient! Sie sind ein Schlumpschütze!« Er genoß die Macht seiner Litzen. »Was sind Sie, Kleebach?«
»Ein Schlumpschütze, Herr Hauptfeldwebel«, erwiderte der Gefreite.
»Schnell gefressen«, versetzte der Spieß spöttisch und ging weiter. »Sie melden sich nach der Wachablösung beim Kompaniechef, verstanden?«
»Jawohl!« schrie ihm Kleebach nach. Der Frühling war durch einen Anschiß ersetzt.
»Scheiße«, brummelte Böckelmann lakonisch.
Endlich kam die Ablösung. Gleichzeitig hatten sich die Katzen in der Dachrinne gefunden. Böckelmann bückte sich nach einem Stein und ließ ihn wieder fallen.
Im gleichen Moment fielen die Schüsse.
»A-larm… A-larm!« brüllte Kleebach.
Pfiffe gellten, Türen schlugen, alles rumpelte aus dem Haus, einer versperrte dem anderen den Weg, einer stürzte, drei, vier kullerten fluchend über ihn, rappelten sich wieder hoch, bis die ersten Befehle halbwegs Ordnung in das Durcheinander brachten…
Der nächtliche Spuk dauerte nicht lange. Vielleicht hatten die Vorposten tatsächlich einen englischen Spähtrupp gesichtet oder sie waren nur von einem streunenden Hund genarrt worden. Jedenfalls schossen sie in Richtung des Geräusches, und unverzüglich erwiderte die andere Seite, die sich jetzt angegriffen wähnte, das Feuer, Scheinwerfer rissen Löcher in die Nacht, Leuchtkugeln tasteten die Erde ab, und die MGs rotzten die glänzenden Perlen der Leuchtspurmunition in den Himmel. Man konnte den Tod fliegen sehen.
Ganz plötzlich war es wieder still. Eine Stunde nach dem Alarm konnten die Landser wieder in ihre Unterkunft gehen, sich das Koppel vom Leib reißen und hinhauen. Sie fluchten, daß nichts los gewesen war, vielleicht nur aus Erleichterung.
Dann schleppten drei Soldaten ein Bündel in einer Zeltplane an.
»Was ist denn nun schon wieder los?« fragte der Kompaniechef. Er hatte die Mütze schräg auf dem Kopf, eine Zigarette im Mundwinkel und die rechte Hand an der Hüfte. Er bot den Anblick des typischen Draufgängers, wie nach Maß gemacht für den maßlosen Krieg.
»Der Spieß… Herr Oberleutnant…«, meldete ein Obergefreiter.
Der Kompaniechef trat an das Bündel heran und beugte sich über den Verwundeten. Was los war, sah er mit einem Blick; nichts mehr zu wollen. Das sterbende Herz preßte das letzte Blut aus den Adern des Verwundeten. Das Gesicht des Hauptfeldwebels Weber verfiel innerhalb von Sekunden. Die Augen wurden groß, fragend, und dann starr. Seine Lippen zuckten noch, dann wirkten sie steif und blaß.
Der Oberleutnant richtete sich wieder auf. »Wie ist denn das passiert?« fragte er.
»Im Durcheinander… dämlicher Zufall…«, antwortete der Obergefreite.
»Schweinerei!« fluchte der Kompaniechef. »Deckt ihn zu«, sagte er dann, »und haltet die Klappe… die Kompanie erfährt’s noch früh genug…«
»Jawohl, Herr Oberleutnant«, schrien sie alle drei.
Der Kompaniechef ging in die Mannschaftsunterkunft.
»Achtung!« brüllte Böckelmann.
Der junge Offizier wehrte lässig ab. »Na, wie fühlt ihr euch, ihr jungen Krieger?« fragte er.
»Gut, Herr Oberleutnant«, riefen sie im Chor, wie es erwartet wurde.
»Haut euch gefälligst auf den Sack!« Der Offizier zündete sich eine Zigarette an. »Weiß nicht, wann ich euch wieder Schlaf bieten kann…«
Er wollte den Raum verlassen, als der Gefreite Kleebach auf ihn zutrat. »Ich habe Befehl, mich bei Ihnen zu melden, Herr Oberleutnant«, sagte er.
»Befehl?« erwiderte der Offizier zerstreut, »von wem?«
»Von Hauptfeldwebel Weber, Herr Oberleutnant.«
»Aber der ist doch…«, sagte der Offizier und brach ab, weil seine Zunge beinahe die eigene Order übertreten hätte. »Kommen Sie, Kleebach«, setzte er schnell hinzu und ging mit ihm auf den Gang des Schulhauses. »Schon wieder was ausgefressen?«
»Jawohl, Herr Oberleutnant… ich hab’ auf Wache gesprochen.«
»Ein Selbstgespräch, was?«
»Nein, Herr Oberleutnant.«
»Also, mit wem haben Sie gequasselt?«
Der Gefreite Kleebach zögerte. Sein Chef merkte, daß er einen Kameraden decken wollte, und lächelte verständig. »Schon gut«, entgegnete er, »langweilig, so ’ne Wache…« Er kratzte sich am Hinterkopf. »Hab’s nicht erfunden«, setzte er hinzu, »und bald ist der Zauber vorbei.« Er betrat mit Kleebach seine Unterkunft und nickte. »Haun Sie ab… und lassen Sie sich nicht mehr erwischen!«
Der junge Gefreite zögerte.
Der Offizier sah es, fummelte mit dem Lineal an seiner Erkennungsmarke herum, die wie ein Ritterkreuz um den Hals hing, nur tiefer, und sagte spöttisch: »Was ist… müssen Sie aufs Klo?«
»Nein, Herr Oberleutnant… bitte Herrn Oberleutnant melden zu dürfen, daß meine Eltern am 14. Juni silberne Hochzeit haben…«
»Kann ich was dafür ?« fragte der Offizier gelassen.
»Ich habe vier Brüder und eine Schwester«, fuhr Kleebach fort, »und alle kommen zusammen an diesem Tag… und da wollte ich…«
»Mitfeiern, was?«
»Jawohl, Herr Oberleutnant«, antwortete Kleebach erleichtert und fügte unmilitärisch hinzu: »Es ist nicht wegen mir, Herr Oberleutnant… aber meine Mutter, verstehen Sie, sie wartet doch, und sie ist so eine groß…«
»Mütter warten immer«, unterbrach der Offizier lakonisch, »und sind immer großartige Frauen… nee, mein Lieber…« Er trat an den Gefreiten heran und klopfte ihm auf die Schulter. »Urlaubssperre.«
»Jawohl, Herr Oberleutnant«, erwiderte Kleebach traurig.
»Kleebach«, sagte der Oberleutnant, »ich bin kein Unmensch, aber ich kann keine Ausnahme machen. Wenn der Krawall hier vorbei ist, sind Sie der erste, der fährt, ist das klar?«
»Jawohl, Herr Oberleutnant.« Der Gefreite grüßte mehr als zakkig.
Im ausgeräumten Schulzimmer brannte noch immer Licht. Ein paar Landser schnarchten laut. Drei Unentwegte klopften Skat, zwei Pedanten reinigten ihre Waffen, einige tranken Rotwein aus Kochgeschirren, andere aßen die Verpflegung von morgen auf, weil sicher sicher ist. In einer Ecke saß Böckelmann und spielte auf seiner Mundharmonika. Ein blutjunger Bursche neben ihm rieb das Band des frisch verliehenen EK II mit Staub ein, um es zu patinieren. Kleebach setzte sich an den wackeligen Holztisch und dachte über den Brief nach, den er seinen Eltern schreiben wollte.
»Gute Nacht, Mutter, gute Nacht …«, spielte Böckelmann leise,
»Schluß mit dem Quatsch!« grunzte einer im Halbschlaf.
»Laß ihn doch!« sagten die anderen gereizt.
»…hab’ dir Kummer und Sorgen gemacht!…«, summte Kleebach mit. Auf einmal war er ganz nahe bei ihr, nicht so verlegen wie sonst, wenn er zärtlich zu ihr sein wollte und durch jugenddumme Sprödigkeit gehemmt war, die nur mangelhaft verschleierte, wie sehr er an ihr und seinem Vater hing.
Und jetzt rückte der große Tag heran, der 14. Juni, und seit einiger Zeit redeten und schrieben die Kleebachs nichts anderes mehr, als wie sie ihren Eltern eine schöne Silberhochzeit bescheren könnten.
Meine liebe Mutter, schrieb Gerd Kleebach in sauberen, regelmäßigen Buchstaben, lieber Vater, eben habe ich mit dem Oberleutnant verhandelt und er versprach mir einen Sonderurlaub zu Eurem fünfundzwanzigsten Hochzeitstag, falls wir rechtzeitig in Paris sind, woran ich nicht zweifle. Ihr hört ja sicher aus den Sondermeldungen, wie rasch es vorwärtsgeht, und es ist auch gar nicht so schlimm, wie es aussieht…
Gerd schrieb den Brief zu Ende und gab ihn noch in der Nacht zur Post. Endlich legte er sich als letzter hin, und schließlich konnte er auch einschlafen, bis ihn Stunden später der schrille Pfiff wieder zum Appell rief, einer Hölle entgegen, die jene Soldaten der Kompanie nie vergessen würden, die sie überleben sollten…
Der Tag war frühzeitig aufgestanden. Er gab sich sonnig und warm, als wollte er den zwei Dutzend Männern in den blauen Uniformen, die bei dem Zustellpostamt im Berliner Westen ihre tägliche Bürde in Empfang nahmen, den Weg erleichtern. Sie hängten sich die Taschen um und traten rasch ihre Runde an. Sie wußten, ein ganzes Volk hatte sich zu dieser Zeit angewöhnt, am Fenster zu stehen und auf den Briefträger zu warten.
Der Postschaffner Arthur Kleebach kannte und liebte das Revier, durch das er seit vielen Jahren zweimal täglich treppauf und treppab ging. Er war 50, untersetzt und beliebt. Er freute sich mit den Kunden, denen er Geld bringen durfte, und sie mochten ihn auch, wenn er es zu kassieren hatte. Er wußte, daß er bei der alten Dame, die ganz allein stand, sehr behutsam klopfen mußte, da sie sich fürchtete, und er winkte der Mutter von nebenan mit dem Feldpostbrief ihres Sohnes schon von weitem zu. Er brachte Mahnungen in das Haus und Zeitungen, Prospekte und Grüße, Lebenszeichen und Todesnachrichten. Der Krieg hatte die Post zum ganz großen Umschlagplatz des Schicksals erhoben.
Aus den offenen Fenstern kam laute Marschmusik. Auch daran hatte sich Briefträger Kleebach längst gewöhnt. Die Zeit war groß und laut. Sie schmetterte mit Blech und haute mächtig auf die Pauke. Die Fanfaren der Sondermeldungen hatten es schwer, das Tempo der deutschen Truppen zu halten. Die Hakenkreuzfahnen blähten sich im Selbstbewußtsein; aus Besonnenen wurden Fanatiker, aus Skeptikern Optimisten, und die Gegner des Systems begannen lautlos zu verzweifeln. Im Inland stand man stramm, im Ausland zog man den Kopf ein. Ein Gefreiter zeigte seinen Generalen, wie man einen Blitzkrieg führt. Doch heute sollte er eine Panne erleiden. In Wenigen Stunden würde es zum Fiasko von Arras kommen.
Arthur Kleebach war fast fertig mit seiner Runde. Ein paar Stunden Ruhe, dann kam die Nachmittags-Zustellung. Das war sein Turnus seit vielen Jahren. Er konnte nicht sagen, wie viele Paar Schuhe er im Dienst durchgelaufen hatte. Vor kurzem sollte er durch einen jüngeren Beamten ersetzt werden, aber Kleebach hatte sich dagegen gewehrt, denn er wollte sich nicht von den Menschen trennen, die ihm vertraut geworden waren, nicht von dem kleinen Gespräch unter der Tür und nicht von dem flinken Wort im Weitergehen. Mochten viele seine Aufgabe für stumpfsinnig halten, für ihn war sie die interessanteste, die es gibt. Er war in jeder Wohnung zu Hause, wenn auch nur als flüchtiger Zaungast an der Tür. Im dritten Stock von Nummer 15 erhielt er gelegentlich ein Gläschen Wein, und die Witwe von Nummer 21 kochte eine Tasse Kaffee für ihn mit, ob er ihr freudige Nachricht überbrachte oder nicht.
Kleebach war ein Menschenkenner geworden auf seinem täglichen Gang. Er wunderte sich längst nicht mehr darüber, daß er von denen die größten Trinkgelder erhielt, die er am wenigsten bedachte, und von anderen, für die er ständig ganze Bündel Post anschleppte, gar nichts. Der tägliche Umgang mit seinen Kunden schuf Bekannte, fast Freunde.
Dienst und Familie, das waren die beiden Pole, zwischen denen sein Leben abspulte. Mehr wollte er nicht, und mit beiden war er zufrieden.
Noch zwei Häuser. Kleebach holte kräftiger aus. Drei Zeitungen noch und zwei Briefe. Er wohnte in seinem eigenen Zustellbezirk und war heute leer ausgegangen. Aber gestern hatte ihnen erst Gerd und vorgestern Fritz geschrieben, die Zwillinge, die beide den Feldzug im Westen mitmachten, der eine beim Heer und der andere bei der Luftwaffe. Außer ihnen gab es noch Thomas, den Ältesten, der seinen Steckschuß aus Polen im Berliner Heimatlazarett ausheilte und deshalb außer Gefahr war; Alfred, genannt Freddy, den Gigolo; Achim, den Pimpf, und Marion, das Nesthäkchen. Und vor allem gab es noch Maria Kleebach, seine Frau, die die »Orgelpfeifen« zur Welt gebracht hatte, die nach außen so eisern zusammenhielten, so gegensätzlich sie auch waren. Daß es ihnen allen einmal besser gehen sollte als den Eltern, war Arthur Kleebachs Wunsch, der sich zu erfüllen schien.
Thomas, der Philosoph, war schon Jung-Ingenieur, als ihn der Stellungsbefehl erreichte, und hatte freiwillig für die jüngeren Geschwister die Hälfte seines Einkommens abgetreten. Gerd und Fritz waren mit Hilfe eines Stipendiums spielend zum Abitur gekommen. Marion arbeitete als Sekretärin, Achim besuchte die siebte Klasse der Oberschule, und Freddy, der mit der mittleren Reife von der Penne abgegangen war, würde es später sicher auch zu etwas bringen.
Wieder stand Kleebach vor einer Tür und klingelte. Eine Frau im Morgenrock machte ihm auf.
»Guten Morgen, Frau Birner«, sagte er und reichte ihr den Feldpostbrief. »Sicher von Ihrem Mann…«, setzte er auf ihre stumme Frage hinzu.
»Danke«, antwortete die Frau zerstreut und griff hastig nach dem Umschlag.
Kleebach ging schnell weiter. So sahen sie alle aus, und alle griffen sie hastig nach dem Schreiben, und so groß war dann jedesmal bei seinem Auftauchen die Freude, daß sie im ersten Moment immer verstört wirkten.
Er hatte bei der Schreinerei im Gartenhaus die letzte Post abzugeben. Und gerade, als er zurückkam, hörte er den Schrei und bemerkte, wie die Nachbarn auf die Wohnung von Frau Birner zuliefen, sah im Weitergehen allen Schmerz, den ihr Gesicht festhielt und wußte, daß er ihr keine Freude gemacht, sondern die Todesnachricht ihres Mannes ins Haus gebracht hatte.
Er zog den Kopf zwischen die Schultern, ging mit müden Schritten weiter und wagte nicht daran zu denken, wie es sein würde, wenn er sich einmal selbst solche Post zuzustellen hätte…
Der Morgen hatte Sonne, die Luftaufklärung Voralarm gebracht. Die Panzerjagd-Einheit rückte in die Stellung bei Arras ab, die am Vortag bereits bestimmt worden war. Die Zivilisten gingen vorsorglich in den Keller. Die Erde war warm, die Sicht klar. Im Sonnenglast funkelten die Aluminiumschwingen der Flugzeuge. Es waren keine eigenen. Es waren Briten, die in geordneter Formation die Hauptkampflinie überflogen.
»Aus ist’s mit dem faulen Frieden«, bemerkte Böckelmann ahnungsbang.
»Was ist denn da heute los?« fragte sein Freund Kleebach kritisch. Bisher hatte die deutsche Luftwaffe den Himmel beherrscht. Alliierte Flugzeuge sah man höchstens vereinzelt, und dann stürzten sich gleich die Me’s auf sie, schossen sie ab, oder verjagten sie wenigstens.
»Unsere Jäger pennen heute noch«, fluchte der Gefreite Böckelmann. »Dein Bruder Fritz war immer schon ’ne Schlafmütze.«
»Der fliegt doch eine He 111«, versetzte Kleebach.
»Auseinander, ihr beiden!« fuhr sie der Kompaniechef an. »Kleebach, bleiben Sie gefälligst bei Ihrer Dreckskanone!«
»Jawohl, Herr Oberleutnant«, rief der Gefreite beflissen. Er war Richtkanonier der französischen Beutepak und beschoß den Feind mit seinen eigenen Geschossen.
Voralarm. Zehn Uhr morgens. Man hörte schon das dumpfe Dröhnen heranrollender Panzer. Vorsorglich forderte der Kompaniechef bei der Luftwaffe Stukas an. Die Stukas blieben aus.
»Was soll’s auch?« tröstete der Oberleutnant seine Leute, »das machen wir doch alles alleine…«
Die Sturmgeschütze der Kompanie hielten sich in einer seitlichen Mulde bereit. Noch war nichts zu sehen, aber die Landser starrten nach dem Horizont, bis ihre Augen tränten. Sie wußten längst, wie man einen Panzer abknallte. Sie hatten es während der Ausbildung hundertmal geübt, und während des Einsatzes mindestens dutzendmal erlebt. Ruhe gehörte dazu, und Mut, Nerv und Verve, alles andere war dann ein Kinderspiel: so nah wie möglich herankommen lassen, sorgfältig zielen, Überraschungsmoment ausnützen, Direktbeschuß, und dann wurden aus eckigen Vernichtungskästen platzende Stahlsärge.
Gegen elf Uhr war im linken Nachbarabschnitt der Teufel los. Noch immer keine Stukas. Noch immer kein Sperrfeuer durch die Artillerie. Noch immer nahmen es die Landser nicht ernster als es schien. Erst gegen Mittag wurden sie unruhig, als die Meldung durch die Front lief, daß den Tommies ein Panzerdurchbruch geglückt sei. Auch rechts schwoll jetzt der Kampflärm an.
»Ganz schöner Reichsparteitag«, brummelte der Oberleutnant, »gleich gibt’s Zunder… wie fühlen Sie sich, Kleebach?«
»Prima, Herr Oberleutnant.«
»Für jeden Panzer, den Sie liefern, kriegen Sie einen Urlaubstag extra«, versprach der Kompaniechef, »abgemacht?«
»Jawohl, Herr Oberleutnant«, versetzte der Richtkanonier und lächelte hinter seinem Offizier her.
Der Junge war ruhig. Er spürte nicht einmal Angst, nur ein leichtes Sodbrennen im unteren Teil der Speiseröhre, wo sie in den Magen mündet. Er warf die Zigarette weg und zündete sich die nächste an. Er hatte bisher drei, vielleicht sogar vier französische Panzer abgeschossen. Das war längst nichts Neues mehr für ihn, aber es blieb gräßlich. Nicht so sehr die Angst, von ihnen überrannt zu werden, als die Sekunde, in der die Granate aus dem Rohr fuhr und dreihundert Meter weg ein Blitz aufflammte und feindliche Soldaten, aber Menschen, vom brennenden Öl verschmort wurden und dann alle Angst und aller Schmerz dieser Erde in einem letzten Schrei lag. Manchmal fuhr Kleebach aus dünnem Schlaf hoch und hielt sich die Ohren zu, weil er glaubte, wieder das tierische Gebrüll zu hören und die Poilus zu sehen, die ausgestiegen waren, in blinder Panik aus dem Feuer liefen, und dann hoffte Kleebach jeweils im Wahn törichter Sekunden, daß sie durchkommen möchten, denn der Zwanzigjährige war weder der schlechteste Mensch noch der beste Soldat…
Auf einmal verstärkte sich das Dröhnen.
»Die kommen ja von links!« fluchte Kleebach, der sie von vorne erwartet hatte.
»Schon schlecht«, brummelte der Ladeschütze, während sie zusammen die Pak herumrissen.
Langsam krochen sie näher, schwarze Schatten zuerst, dann unförmige Käfer. Drei, fünf, elf, siebzehn – so viele, daß es Kleebach aufgab, sie zu zählen. Er richtete sein Geschütz auf den vordersten ein und wartete. Er wartete auf den Tod, den er zu bieten hatte.
»Entfernung neunhundert Meter«, kam die Meldung vom Messer. »Achthundertfünfzig«, verbesserte sich der Mann.
Das Gedröhn schwoll noch stärker an. Die Erde schien vor Angst zu beben. Der fetzende Motorenlärm sägte an den Nerven. Der Mund wurde trocken. In der Zielrichtung tänzelten Lichteffekte. Wer sich nicht hinter die Pak zu bücken brauchte, lag auf der Erde und sehnte sich danach, so tief wie möglich unter ihre Haut zu kriechen.
»Siebenhundert Meter«, kam der neue Meßwert durch.
Noch Zeit, zwang sich Kleebach zur Ruhe. Er sah nach links, wo sein Freund Böckelmann seitwärts vor ihm in einem Panzerdekkungsloch lag, das vermutlich nicht einstürzen würde. Er betrachtete die Mulde, in der die Sturmgeschütze darauf warteten, dem Feind in die Flanke zu knallen. Er blickte nach oben, von wo plötzlich ein anderes Gedröhne kam. Ziemlich nieder flogen die brummenden Schatten heran. Tausend Meter Höhe vielleicht, Flugzeuge, deutsche Stukas vom Typ Ju 87.
Na endlich, dachte Kleebach erleichtert. Er verfolgte aus den Augenwinkeln, wie die Ju’s eine Schleife zogen, um sich zu orientieren, wie sie die feindlichen Panzer erkannten und anflogen, langsam, bedächtig fast, wie sie dann mit einem plötzlichen Abkippen ihre gierigen Schnauzen nach unten stellten, wie die Motoren heulten, wie die Sirenen einsetzten, wie sich die Stukas direkt auf das Ziel stürzten, auf die Panzer, die im verzweifelten Zickzack entkommen wollten, wie sich der schwarze Punkt löste, der immer größer wurde und immer gräßlicher rauschte, wie der Boden zitterte, bis er mit einem einzigen Knall platzte, in dem alles unterging.
Vier Stukas hatten ihre Bomben abgeworfen und drehten bei, um im E-Hafen neue zu fassen. Hochbetrieb heute für Stukas, vier-, fünfmal und noch öfter mußten sie aufsteigen. Aber die Engländer schienen über Nacht mehr Panzer aus dem Boden gezaubert zu haben als die Luftwaffe Stukas hatte.
Die letzten beiden griffen an. Wo der zweitvorderste Panzer stand, war nur noch ein riesiger, gezackter Trichter. Ein zweiter Tommy stand in hellen Flammen. Ein dritter drehte bei und zog eine stinkende Rauchfahne hinter sich her.
Aber die anderen rollten weiter nach vorne, auf Kleebachs Pak zu, die sie noch nicht ausgemacht hatten. Stur. Langsam. Unerbittlich. Brummig. 400 Meter noch.
»Feuer frei!« befahl der Kompaniechef.
Drei Sekunden später hatte Richtkanonier Kleebach die erste Granate aus dem Rohr gerotzt.
»Treffer!« brüllte Böckelmann, der die Feuerwirkung zu beobachten hatte.
Genau am Turm, dachte Kleebach, biß seine Schneidezähne in die Unterlippe und nahm den nächsten aufs Korn. Dann zog die Sprengwolke ab – und die deutschen Kanoniere betrachteten mit rotgeränderten Augen das Unfaßliche: der getroffene Panzer rollte weiter. Genau am Turm erfaßt, kam er näher, als ob nichts geschehen sei, als ob ihn ein Kieselstein belästigt und keine Granate getroffen hätte.
Blindgänger, überlegte Kleebach und jagte Schuß auf Schuß hinaus.
Er spürte, wie seine Knie zitterten und seine Augen schmerzten. Die Zielansprache war genau, seine Hand sicher, jede Funktion saß.
Und es half nichts.
Kleebach verkrallte sich in den vordersten Panzer, schoß und schoß, traf und traf, mit rasendem Zorn, hatte nur noch ein Ziel im Leben vor Augen, nur einen Gedanken, nur einen Wunsch, nur einen Wahn: das verhaßte schwarze Drecksding zu vernichten.
Zweihundert Meter noch.
Die Tommies in ihren Panzern hatten es nicht einmal nötig, zu schießen. Jetzt erst merkten die genarrten Männer von der Pak, daß der Feind das Feuer nicht erwiderte, und dabei war er schon so dicht heran, daß man die britischen Infanteristen mit den schrägen Stahlhelmen erkannte, daß man die Sehschlitze deutlich sah und die Mündung der Bordkanone wie eine tote Augenhöhle gähnte.
Rechts ratterten die Sturmgeschütze los. Der Kompaniechef übersah wie immer die Bescherung. Erstmals setzten die Briten Panzer ein, deren Stahlplatten der deutschen Pak trotzten. Nicht nur an dieser Stelle, im ganzen Frontabschnitt, Hunderte von Panzern und zum Teil schon 30, 40 Kilometer hinter der deutschen HKL. Der junge Offizier wußte noch nicht, daß die Engländer und Franzosen, noch einmal alles in den Kampf werfend, an bereits vier Stellen durchgebrochen waren, daß die deutsche Führung das Debakel zu spät erkannte und nicht genügend Artillerie und Flugzeuge hatte, um es zu stoppen. Aber er sah, daß seine Männer an der Pak von den heranrollenden Panzern in Grund und Boden gestampft wurden, wenn er nicht sofort etwas noch so Sinnloses unternahm.
Er fuhr den Engländern in die Flanke, seinen anderen Sturmgeschützen im Führungswagen vorausfahrend, schoß mit seiner 8,8 den vordersten Panzer seitwärts in Klumpen, nahm einen zweiten aufs Korn, zog plötzlich das Feuer auf sich und stellte sich wie ein scheuendes Pferd auf die Hinterräder, Kavalkade des Todes, bevor er von seiner eigenen Munition in Fetzen gerissen wurde.
Vier, fünf Tommies änderten die Fahrtrichtung, auf die anderen, deutschen Selbstfahrer-Lafetten zu, aber das Gros rollte weiter, der Pak entgegen.
Kleebach schrie, weinte, fluchte, schoß und zitterte. 80 Meter noch… 70… Er starrte in den Schlund der Kanone, die gleich aufblitzen mußte. Er wollte leben, wollte treffen, wollte siegen, wollte entkommen, mußte zielen und wußte, daß es nichts mehr half.
50 Meter noch.
Keine Deckung mehr. Keine Flucht. Das vordere Ungetüm drehte sich auf einer Kette. Sein Fahrer schaltete herunter. Der Motor heulte knirschend auf. Und die Männer in der deutschen Pak-Stellung begriffen, daß der mörderische Stahlkasten es verschmähte, sie abzuknallen und sie einfach in den Boden wälzen wollte. Sie waren wie gelähmt und lagen jetzt schon fast im toten Winkel.
Die letzte Granate im Lauf.
Abschuß! Der letzte, verzweifelte Versuch.
Aufschlag, Die surrenden Splitter des eigenen Geschosses wirbelten ihnen im Abprall um die Ohren.
Aus. Vorbei. Kleebach stand halb gebückt, erledigt, geschlagen.
So sah ihn Böckelmann, der Freund. Und ausgerechnet er, der sonst wohl wußte, wann man die Schnauze tief in den Dreck zu bohren hatte, sprang hoch, aus der Deckung heraus, war mit zwei, drei Sätzen an den Panzer heran, knallte ihm eine geballte Ladung unter den Turm, wetzte weg, wurde beschossen, blieb liegen, rappelte sich hoch und überschlug sich zwei Meter von seinem Loch, während jetzt der Turm leicht schwankte, sich langsam hob und wie ein Zylinder im Windstoß wegflog.
Kleebach erfaßte nicht, daß er gerettet war, denn von rechts nahm ein zweiter Panzer Kurs auf ihn. Das Ungetüm war noch acht Meter entfernt. Er hörte, wie der Fahrer Vollgas gab, und er sah die Ketten, nichts als Ketten, die über seinen Körper rollen würden, und die widerliche Bordkanone, mit der ihm der Krieg eine lange Nase schnitt, und er wußte, daß er seine Mutter nie mehr wiedersehen würde und schrie so entfesselt, wie die Soldaten auf der anderen Seite, bevor sie zu Klumpen zusammenschmorten, und er sah sein eigenes Blut in den Dreck rinnen, und er spürte, wie sein Herz stillstand und seine Beine nicht mehr liefen, und er sah noch einmal in die Schlitze der Panzerplatten, erkannte die Kokarde noch, sah Raupen, bloß Raupen, nach deren Gliedketten sein Leben zählte und die sich drehten wie ein Fließband der Vernichtung – und dann sah er nichts mehr…
*
Am 14. Juni 1940, dem gleichen Tag, an dem sich die Eltern Kleebach vor fünfundzwanzig Jahren das Jawort gegeben hatten, ergab sich Paris den deutschen Truppen, und die Familie hängte, wie alle Nachbarn, die Fahnen zum Fenster heraus.
Alles schien sich verschworen zu haben, um den Familientag zu verschönern: Der Vater, der sich heute einen dienstfreien Tag genehmigte, war gerade noch rechtzeitig zum Oberpostschaffner befördert worden. Thomas, der Älteste, war in Genesungs-Urlaub, Freddy hatte eine Gans aufgetrieben, Achim ein paar Flaschen Wein besorgt und Marion, die Jüngste, dem Konditor eine große Torte abgerungen.
Fritz schrieb häufig; und dann war vorgestern auch noch der Brief von Gerd eingetroffen, den der Junge in einem Dorf in der Nähe von Arras aufgegeben hatte. Aber das wußte Vater Kleebach nicht, denn er ließ ihn ungeöffnet, um ihn seiner Frau als vielleicht schönstes Geschenk auf den Gabentisch zu legen.
Die Kleebachs wohnten in einem Rückgebäude Ecke Lietzenburger/Wielandstraße im Berliner Westen. Ihre Jubiläumsfeier fand in der guten Stube statt. Der Tisch war ausgezogen, auf der Anrichte lagen die Geschenke und in der Ecke standen die Bumen – mehr Blumen als Vasen – so dicht beieinander, daß sie Platznot hatten.
»Die Gans ist gleich durch«, sagte Freddy, der aus der Küche kam. Er war ein schlanker, lustiger Kerl mit gewellten, dunklen Haaren und hübschen, frechen Augen. »Na, wie hab’ ich das gemacht?« fragte er stolz.
»Wie immer, Gigolo«, foppte ihn Marion.
»Mensch«, fuhr Freddy fort, »drei Wochen bin ich mit der Feinkosthändlerstochter herumgezogen… hab’ Briefchen geschrieben und Händchen gehalten, im Mondschein ihr ins öhrchen geflüstert …«, er lachte zufrieden, »bis die Gans endlich die Gans herausrückte.«
»Freddy, bitte!« sagte der Vater streng. Seine Kinder waren ihm zwar schonfast alle über den Kopf gewachsen, aber er blieb die Autorität.
Mutter Kleebach schüttelte den Kopf. Sie betrachtete ihre Schar, als sähe sie sie heute zum erstenmal, und sie wunderte sich, wie immer, über diese Gegensätze. Neben ihr Thomas, der Älteste, viel zu ernst für seine 24 Jahre. Dann Freddy, der Luftikus, und Achim, der mit hochrotem Kopf vor dem Radio saß und alles andere vergaß.
»Mensch«, wandte er sich zu seiner Mutter um, »Paris im Eimer… das ist ja das höchste Geschenk, das sie euch zur Silberhochzeit machen konnten!«
Mutter Kleebach lächelte still. Sie wußte es besser, aber sie wollte ihrem Zweifjüngsten die Freude nicht nehmen.
Thomas legte den Arm um ihre Schultern.
»Wenigstens ist der Krieg im Westen bald aus«, sagte er leise, »und dann haben es auch Gerd und Fritz überstanden…«
Die Mutter lächelte. Achim drehte das Radio auf Fortissimo.
»Stell den Kasten leiser!« fuhr ihn Thomas an, der den Polenfeldzug mit einem Steckschuß liquidiert hatte und den Krieg nicht erst aus Sondermeldungen kennenzulernen brauchte.
Vater Kleebach genehmigte sich einen Schnaps. Er war ein wenig melancholisch heute, da er auf fünfundzwanzig Jahre erfülltes Leben zurücksah, auf ein Vierteljahrhundert Arbeit, Glück und Verzicht. Er trat an seine Frau heran. »Ja«, sagte er, »die Zeit vergeht … Hättest du damals gedacht, daß es einmal so viele Kleebachs geben wird?« Sie schüttelte den Kopf.
»Würdest du mich noch einmal nehmen?« fragte er versonnen.
»Jeden Tag«, entgegnete Maria Kleebach und sah ihn groß an.
Er lächelte, wie damals, als sie ihm »ja« gesagt hatte. Er hatte lange gezögert, um sie zu werben, er, der kleine Beamte, um sie, die Tochter eines Geschäftsmannes. Aber sie hatte ihn gemocht, viel mehr noch als das, und mit der ihr eigenen Energie alle Widerstände gebrochen.
»Ja«, sagte sie jetzt zu ihrem Mann, »ich danke dir, Arthur… für alles…«
Er putzte verlegen an seiner Brille. Seine Frau konnte aussprechen, was er empfand.
Die Familie Kleebach stellte ein freiwilliges Matriarchat dar. Die Mutter war Mittelpunkt. Ihre Kinder hatten es sich angewöhnt, zu ihr aufzusehen, genau wie der Mann. Sie hatte ein stilles, feines Gesicht, das noch immer schön war und dem die Silberhaare jetzt erst den würdigen Rahmen boten.
»Und Sommersprossen hat er…«, neckte Freddy seine Schwester, »und seine Nase sitzt schief, und mit so einem Kerl flanierst du herum…«
»Ihr Affen!« erwiderte die achtzehnjährige Marion und wurde rot.
»Nicht einmal das HJ-Leistungsabzeichen hat er geschafft«, warf der Pimpf Achim ein, »und am Reck ist er eine Niete…«
»Der bringt doch vor Verlegenheit den Mund nicht auf, wenn er bei dir ist…«, behauptete der Gigolo fachkundig.
»Hauptsache, deine Klappe steht immer offen«, verteidigte sich Marion.
»Verlaß dich darauf«, versetzte Freddy großartig. »Kannst ihn ja mal zu mir schicken… ich gebe ihm gerne Nachhilfestunden…«
»Schluß jetzt!« beendete der Vater die Debatte.
»Und eingehängt hat sie sich bei dem Kerl auch noch«, petzte Achim hinterher.
Auf der Anrichte stand die Torte, die es erst am Nachmittag geben würde, und ein stilisiertes Gelee-Herz umrahmte die Zahl 25. Sie würde nur in sechs Stücke geteilt werden, denn der siebte und achte Kleebach fehlten: Gerd und Fritz, die Zwillinge, die sich nicht nur äußerlich wie aufs Haar glichen, verhindert durch den Feldzug in Frankreich. Es war ein stillschweigendes Abkommen, nicht über sie zu sprechen, aber der Vater brach es jetzt, als er zurückkam und verlegen einen großen, weißen Fliederstrauß auspackte.
»Von Gerd«, sagte er.
»Wieso?« fragte die Mutter.
»Er hat es mir aufgetragen und hat allen anderen verboten, dir weißen Flieder zu schenken.« Arthur Kleebach lächelte nachdenklich. »Weil es deine Lieblingsblumen sind…« setzte er hinzu, »und dann noch etwas«, sagte er, als er merkte, wie schwer er seiner Frau die Abwesenheit der Zwillinge machte, »ein Brief von Gerd…«
»Oh«, erwiderte Maria Kleebach.
»Hier, deine Brille, Mutter«, sagte Achim.
Sie hielt den Umschlag wie unschlüssig fest. Er zitterte leicht in ihren Händen. Es waren Hände, die weich waren und rauh, die streicheln konnten und festhalten.
»Gerd…«, sagte sie leise. Als sie den Brief behutsam öffnen wollte, klingelte es. Vater Kleebach sah auf die Uhr.
»Schon zwölf?« sagte er, »das ist Rosenblatt…«
»Was will denn der bei uns?« fragte Frau Kleebach.
»Bitte treten Sie doch ein, Herr Rosenblatt«, begrüßte der Mann den Gast.
»Heil Hitler, Herr Ortsgruppenleiter!« rief Achim stramm.
»Ich will nicht stören«, sagte Pg. Rosenblatt, bevor er störte.
Er stammte aus dem Nachbarhaus und lief meistens in der Uniform herum, vielleicht, weil er unter seinem Namen litt und beweisen wollte, daß er trotzdem lupenreiner Arier sei. Er war vielleicht angenehmer als andere Hoheitsträger, aber nicht minder banal.
»Herzlichen Glückwunsch!« begrüßte er Mutter Kleebach und schüttelte ihr die Hand. »Außerdem habe ich eine angenehme Pflicht zu erfüllen.« Er stand in der Mitte des Raums und gab sich wie vor einem Rednerpult. »Frau Kleebach«, sagte er, »ich habe Ihnen die Grüße der Partei zu überbringen… und den Dank des Führers abzustatten…«
»Mir?« fragte die Mutter hilflos und ein wenig verwundert…
Bevor Maria Kleebach erfuhr, daß ihr heute das Mutterkreuz verliehen werden sollte, war beim Zustellpostamt Charlottenburg ein Einschreibepäckchen eingegangen, dessen Inhalt die Beamten nur zu gut kannten: Eine Brieftasche, eine Uhr, ein Ring vielleicht, ein paar Fotografien und eine Handvoll Briefe. Es waren die letzten Habseligkeiten eines gefallenen, deutschen Soldaten, und sie waren an die Adresse der Kleebachs Ecke Lietzenburger/Wielandstraße gerichtet.
Und der Vertreter des Mannes, der heute Silberhochzeit feierte, machte sich unter wehenden Fahnen hindurch, an marschierenden Kolonnen vorbei, auf den schweren Weg in die Wohnung seines Kollegen…
*
Gerade als Pg. Rosenblatt in der guten Stube der Kleebachs zu einer kurzen, bedeutungsvollen Rede ansetzen wollte, wurde der duftende Gänsebraten aufgetragen, denn die Nachbarin, die in der Küche mithalf, war der Meinung, daß sich ein Orden immer verleihen ließe, gebratenes Fleisch aber rechtzeitig auf den Tisch gehöre.
Weil der Ortsgruppenleiter zu den Menschen gehörte, die einen Anfang nur umständlich und das Ende nie finden können, rückte er, ohne sein Zutun, zum Gast auf und wurde vom Hausherrn in die Mitte der Tafel gebeten.
»Also dann, prost!« sagte Vater Kleebach und hob sein Glas.
»Ach, das duftet ja lecker«, erwiderte der Hoheitsträger, und hielt jetzt doch den Zeitpunkt für gekommen, stand auf und begann: »Ich darf mich ganz kurz fassen…«
Sie alle sahen ihn an, und unter ihren Blicken schien Pg. Rosenblatt zu wachsen, schien er so markant zu werden, wie er sein wollte.
»Meine liebe Frau Kleebach«, hob er die Stimme, »es tut mir leid, daß ich in Ihre Familienfeier eingedrungen bin… aber betrachten Sie mich bitte als den Stellvertreter unserer Volksgemeinschaft…«
Mutter Kleebach lächelte ihm zu, während sie ihm das knusprige Bruststück des Gänsebratens auflegte, wie es sich für einen Gast gehörte. Sie gönnte es ihm. Aber sie spürte doch einen leisen Stich dabei, denn schließlich saß er hier am Tisch als Stellvertreter von Gerd und Fritz, der Zwillinge, die der Feldzug im Westen vom Jubiläumstag ihrer Eltern fernhielt.
Aus der Blumenecke ragte der weiße Flieder, der eine eigene Vase und den besten Platz erhalten hatte. Wenn Mutter Kleebach hinsah, glaubte sie nur Flieder zu sehen, weil Gerd an sie gedacht und sich bei den anderen ausbedungen hatte, daß nur er ihr zur Silberhochzeit ihre Lieblingsblumen schenken durfte.
Und dann lag noch vor ihr ein Brief, den ihr Mann schon zwei Tage ungeöffnet in der Tasche getragen hatte, um ihn als Überraschung auf den Gabentisch zu legen. Sie wäre gerne in ihr Schlafzimmer gegangen, um ihn in Ruhe zu lesen, und mit Gerd ein paar Minuten allein zu sein. Aber jetzt schickte es sich nicht, und in gestohlener Hast wollte sie es nicht tun.
»Jedes Kind…«, fuhr Pg. Rosenblatt fort, »das eine deutsche Mutter ihrem Führer schenkt, ist eine Schlacht, die das ganze Volk gewinnt…«
Mutter Kleebach lächelte fein, und doch mit einer Spur Spott, denn eigentlich hatte sie die Kinder ihrem Mann geschenkt, und so tauschte sie jetzt mit Thomas, dem Ältesten, einen raschen Blick gegenseitigen Verstehens.
Thomas hatte die Arme auf den Tisch gestützt, und sein Gesicht wirkte fern, verschlossen. Er war breit und schroff, alles andere als ein bequemer Typ – äußerlich dem Vater am ähnlichsten, nur einen Kopf größer; einer, der nie ein Wort zuviel sagt und selten spontan reagiert.
Er ist zu alt für seine vierundzwanzig Jahre, dachte Maria Kleebach, aber er wird seinen Weg gehen, denn er weiß, was er will – wenn sie auch nicht immer verstand, was er wollte. Sie wußte, daß Thomas der einzige unter ihnen war, der »politisch« dachte. Die Zeit hatte nicht vermocht, über Gebühr in die Familie einzudringen. Der rechtschaffene Vater wollte die Kinder zu anständigen Menschen erziehen, und er dachte schlicht, daß sie dann von selbst zur braunen Bewegung stoßen müßten, falls diese eine saubere Sache sei. Im übrigen sollten sie es im Leben einmal besser haben als er, obwohl es ihm eigentlich nie schlecht gegangen war. Sie waren tüchtig und so geraten, wie es sich der Beamte nur wünschen konnte.
»Seien Sie stolz auf sich, Frau Kleebach«, fuhr der Ortsgruppenleiter fort, »und wenn ich mich so umsehe, dann haben Sie etwas Großes vollbracht… Sie haben uns fünf Soldaten…«, seine Augen blieben einen Moment an der achtzehnjährigen Marion hängen, die errötete, »…Und sicher auch eine zukünftige Mutter geschenkt, die immer zu Ihnen aufsehen wird…«
Thomas zog die Mundwinkel hoch. Marion hielt sich das Taschentuch vor den Mund. Achim, der Pimpf, saugte die Worte wie ein Schwamm in sich auf, und Freddy, der immer wußte, worauf es ankam, klapperte unmißverständlich mit seinem Eßbesteck. Vater Kleebach war beherrscht und geduldig wie immer.
»Ich komme zum Schluß«, sagte der Hoheitsträger. Er griff in die Tasche und holte wie ein Zauberer, der die weiße Taube flattern läßt, ein Etui aus Kunstleder hervor, entnahm ihm einen Orden am Band, ging mit gewichtigen Schritten auf Frau Kleebach zu und sagte: »Ich verleihe Ihnen hiermit im Auftrag des Führers das Ehrenzeichen der deutschen Mutter in Silber.«
Er legte ihr das Band behutsam um den Nacken und schüttelte ihr bewegt die Hand. Die Frau mit der zierlichen Gestalt, dem feinen Gesicht und den wachen Augen stand ein wenig befangen vor ihm.
»Na, wie fühlst du dich, Mutter?« rief Achim begeistert und gratulierte ihr als nächster, bis die resolute Nachbarin, die so stolz auf ihren gelungenen Gänsebraten war, eintrat und das richtige Wort fand. »Warum ißt denn hier keiner?« fragte sie schmollend. »Es wird doch alles kalt… und ich hab’ mir so viel Mühe gegeben.«
»Entschuldigen Sie, meine Liebe«, antwortete Pg. Rosenblatt und nickte ihr betont volkstümlich zu.
Endlich war es so weit. Da klingelte es wieder.
»Ich mach’ schon auf«, sagte Vater Kleebach und ging zur Tür.
Als er seinem Vertreter gegenüberstand, der heute den Dienst für ihn übernommen hatte, erschrak er; ein eisiger Hauch schien hinter dem Kollegen mit dem bekümmerten Gesicht herzuwehen.
»Ist etwas los?« fragte er hastig.
»Ja, Arthur, das heißt… nein eigentlich…«
Der Mann sah die Familientafel und es wurde ihm schlecht, vor seinen Augen drehte sich ein Propeller, dessen Flügel gleich niedersausen würden, auf jeden einzelnen von denen, die hier in fröhlicher Runde saßen. Er wich ihren Augen aus, zog den Kopf zwischen die Schultern, ein würgendes Gefühl nahm ihm die Worte.
Dann sah er durch die Luftschraube hindurch die braune Uniform von Rosenblatt, und nie war sie ihm schöner erschienen, und er griff nach dem Hoheitsträger wie nach einem Rettungsring im wirbelnden Sog.
»Kann ich Sie einen Moment sprechen?« fragte er halblaut.
Die beiden gingen auf den Gang. Alle sahen ihnen nach. Nur Arthur Kleebach, der Briefträger, hatte begriffen, um was es ging, hatte das kleine Einschreibepäckchen gesehen und kannte den Inhalt, und wußte, was es bedeutete: eine Armbanduhr, eine Brieftasche, ein paar Fotos, die letzten Habseligkeiten eines Soldaten, der gefallen war. Gerd oder Fritz? dachte er. Er sah zu seiner Frau hin, überlegte, wie er den ungeheuren Schlag, der auf ihn gefallen war, für sie mindern könnte, und sah gequält, wie ihre Hände über den Brief Gerds strichen, als ob sie ihn streicheln wollten, als ob sie ihn festhalten müßten.
Der Ortsgruppenleiter wirkte verstört, als er zurückkam. Nichts mehr an ihm war markant. Dem Mann mit dem paraten Sprachschatz waren die Worte ausgegangen.
»Es tut mir leid«, sagte er schließlich. Seine Stimme klang belegt, blechern, »daß ich…« Er verlor den Faden.
Ihre Augen brannten auf seiner Haut. Pg. Rosenblatt reichte Mutter Kleebach die Hand, aber es schien, als ob er sich an ihr festhalten müßte. »Ihr Sohn…«
»Gerd?« fragte sie wie gehaucht.
Er nickte schwer. Die Stille wirkte hohl, gespannt, unheimlich.
»Gefallen bei Arras…«, sagte er, um es schnell hinter sich zu bringen.