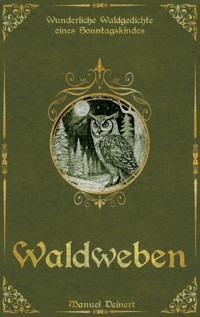4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampenwand Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der elfjährige Fenno verbringt nicht zum ersten Mal seine Sommerferien auf Opas Bauernhof. Erst ist alles wie immer: er lässt das Stockbrot in die Flammen fallen, kleckert mit dem Saft, wird von einer Mücke direkt auf die Nase gestochen und von seiner älteren Schwester gehänselt. Doch alles ändert sich, als ihm hinter Opas Hof eine Geisterhenne begegnet. Fenno ist sich sicher, dass es ein Geist ist, denn ihm fehlt der Kopf. Und so lange können selbst Hühner nicht ohne Kopf laufen. Ebenso sicher ist sich Fenno, dass man seinen Kopf nicht grundlos verliert. Irgendwas muss dem Huhn passiert sein. Aber was will die Henne? Rache? Gerechtigkeit? Und wieso sucht sie ausgerechnet den tollpatschigen Fenno auf? Nach anfänglichem Zögern sieht Fenno seine Stunde gekommen! Er wird den Mörder der Henne finden. So schwer und gefährlich wird das schon nicht werden. Und so stolpert er mit wenig kriminalistischem Gespür und großer Ahnungslosigkeit von einer Sackgasse in die nächste. Bis er schließlich eine ungeheuerliche Entdeckung macht!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ein Wunsch
Achtung! An die Seite!«, schrie ich und krallte mich am Lenkrad fest.
Die Kühe liefen laut muhend nach allen Seiten davon. Mit durchgedrücktem Gaspedal raste ich über die Weide und lachte wie ein Irrer. Das war die beste Verfolgungsjagd meines Lebens! Hinter mir sah ich den Bauern fluchend eine Mistgabel schwingen. Er versuchte vergeblich, mich aufzuhalten, ich ruinierte seine Weide und scheuchte die Kühe auf. Doch das war mir egal, ich war auf der Flucht! Mein Auto donnerte im Affenzahn durch das satte Gras und mein Herz schlug Purzelbäume. Ich wirbelte das Lenkrad linksherum und rechtsherum und drückte kräftig auf die Hupe.
Im Rückspiegel sah ich sie dann: die Ganoven. Mit einem Geländewagen brausten sie hinter mir her. Sie durften mich nicht kriegen. Ich hatte geheime Informationen gestohlen und das nahmen mir die Kerle verdammt übel.
Holzstücke streiften meinen Kopf, als mein Wagen den Weidezaun durchbrach und aufs Maisfeld flog. Wir krachten zu Boden, die Reifen drehten durch und dann rumpelten wir über die holperige Erde weiter. Der Mais maß bereits anderthalb Meter. Ein riesiges, kaum überschaubares Dickicht aus grünen, faserigen Blättern und rothaarigen Maiskolben. Hier würden sie mich nicht so schnell erwischen.
Doch diese Welt aus dichten Blättern und Maiskolben hatte einen Nachteil: Es war unmöglich zu sagen, in welche Richtung ich fahren musste. Ich konnte lediglich das Jaulen des Motors und das laute Brechen und Rauschen der Maisstängel hören, die ich über den Haufen fuhr. Und dann einen Schuss!
»Ihr kriegt mich ja doch nicht!«, rief ich in den warmen Sommerabend hinaus und hoffte, nicht plötzlich in einem Feldgraben zu landen.
Ein weiteres Mal riss ich das Lenkrad herum, fuhr eine irrsinnige Kurve, dass ich mich beinahe überschlagen hätte … und Rums!, hatte ich das Lenkrad in der Hand.
»Och nö!«, stöhnte ich und ließ mich in den Sitz plumpsen.
»Nee, Fenno«, hörte ich Opa lachen. »So wird das nichts mit deiner Flucht!«
Ich grummelte und legte das Lenkrad aufs Armaturenbrett. Opa hockte sich vor die Fahrertür und schaute mich durchs offene Fenster an. Sein Hut mit der angesteckten Hahnenfeder stieß dabei an den Rahmen. »Du kriegst aber auch alles kaputt, hm?«
Ich verschränkte die Arme und biss die Zähne aufeinander.
»Mach dir keine Sorgen«, versuchte Opa mich aufzuheitern. »Das Auto war schon vorher Schrott. Es fällt nicht auf, wenn das Lenkrad fehlt.«
Das munterte mich nicht auf. Natürlich war der rote Fiat Schrott. Seit Urzeiten stand er neben der Scheune, umringt von Brennnesseln und kleinen Sträuchern. Nur ein schmaler Trampelpfad führte zur Fahrertür. Den hatte ich in den vergangenen Tagen ins hohe Gras getreten. Wie in den Jahren zuvor, wenn wir unsere Ferien bei Opa verbrachten, war es meine liebste Beschäftigung: Verfolgungsjagden!
»Und jetzt komm«, sagte Opa. »Es gibt Stockbrot. Das Feuer brennt schon.«
Just stieg mir der rauchige Geruch von brennendem Holz in die Nase. Ich seufzte. Stockbrot. Das klingt aufregend und nach Abenteuer, nicht? Doch wem würde der Teig ins Feuer fallen? Mir, Fenno Schniggendiller.
Ja, ihr habt richtig gelesen: Fenno Schniggendiller. Ein Name, so merkwürdig wie ein Marienkäfer mit nur einem Punkt. Den schaut man sich an und denkt, irgendwas stimmt da nicht. Man weiß nicht recht, ob man das Tier bedauern, meiden oder ihm gratulieren soll.
Schniggendiller sei ein traditionsreicher Name aus Ostwestfalen, hatte Opa mir vor Jahren erklärt. Das war super – wenn man wie Opa in Ostwestfalen lebte. Aber ich wohnte in Gelsenkirchen, mitten im Ruhrgebiet, und da ist das kein Grund, auf diesen Namen stolz zu sein. Vor allem, wenn man ein Tollpatsch ist wie ich. Mir fiel nicht nur garantiert der Brotteig ins Feuer. Ich kleckste mit einer frischen Füllerpatrone auf das Heft meines Tischnachbarn, ließ den Käfig mit dem Klassenmeerschweinchen fallen, warf im Sportunterricht den Ball an die Decke anstatt ins Feld. All so was.
»Immerhin wirst du deswegen nicht verhauen«, zog mich meine Schwester auf.
Sie hatte gut lachen. Sie hatte es geschafft, sich unantastbar zu machen. Sie trug schwarze Klamotten mit Totenköpfen und konnte mit ihrem fiesen Blick jemandem das Atmen abgewöhnen. Einmal hatte sie einem Jungen ins Ohr gebissen, weil er sich trotz aller Warnsignale über sie lustig gemacht hatte. Niemand wagte es seither, Fritza Schniggendiller zu nahe zu kommen.
»Jetzt mach‘ schon«, rief Opa auf dem Weg zum Lagerfeuer.
Widerwillig stieg ich aus dem Auto, das nun kein Lenkrad mehr hatte, und schlenderte an der Scheune vorbei in den Hof, wo ein loderndes Feuer in einer Schale brannte. Opa hatte vier Baumstümpfe um das Feuer gestellt. Er zeigte auf den niedrigsten von ihnen. »Der ist für dich. Mama holt noch den Teig und dann kann’s gleich losgehen.«
Ich ließ mich auf den Stumpf fallen. Fritza saß mir gegenüber, ihre Baseballkappe tief ins Gesicht geschoben, und stocherte mit einem langen Stock in den Flammen herum. »Das Lenkrad ist ab?«, sagte sie und ich konnte hören, wie sie dabei verächtlich grinste. »Muss ja eine wilde Fahrt gewesen sein.«
Ich verzog die Mundwinkel. Fritza war zwei Jahre älter als ich und hielt meine Autofahrten für kindisch. »Bist du dafür nicht zu alt?«, hatte sie mich am ersten Abend nach unserer Ankunft gefragt. »Letztes Jahr konnte ich das noch verstehen. Aber jetzt? Fenno, du bist elf!« Als sagte das irgendetwas aus. Verfolgungsjagden sind immer toll. Vor allem, wenn man nichts anderes zu tun hat. Opas Bauernhof war nicht Disneyland.
Für Fritza war das kein Problem, sie zeichnete und malte oder las Bücher über sonderbare Tierwesen, die es sicherlich nicht auf Opas Hof gab. Und ich fuhr gern Verfolgungsjagden.
Mama kam mit einer Schüssel unter dem Arm aus dem Haus und setzte sich zu uns. »Hab’ ich was verpasst?«, fragte sie in die Stille hinein.
Fritza zuckte die Schultern. »Das frag besser unseren Rennfahrer.«
Mama reichte mir einen Klumpen Teig. Ich hob den Stock auf, der neben mir auf dem sandigen Boden lag, und knetete den Teig um die Spitze. »Was ist diesmal kaputtgegangen?«
Ich verdrehte die Augen. »Das Lenkrad ist ab.«
Mama lächelte. »Bis zu deinem Führerschein dauert es ja zum Glück noch ein paar Jährchen.«
Fritza schob ihre Baseballkappe hoch. »Ich werde seinem Fahrlehrer vorschlagen, eine Extraschraube durchs Lenkrad zu bohren.«
Ich hielt mein Stockbrot in die Flammen und funkelte Fritza über das Feuer hinweg an. »Ich weiß, wie man lenkt.«
Fritza nickte. »Und du weißt, dass man den Teig über die Flammen hält.«
Zähneknirschend hob ich meinen Stock aus dem Feuer und drehte ihn. Der Teig war an der Unterseite schwarz.
»Nur die dümmsten Hühner gackern über ungelegte Eier«, sagte Opa und wickelte Teig um seinen Stock. »Fenno wird das schon hinkriegen.« Er hielt seinen Stock über die Flammen. »Ich habe auch erst mit zwölf den Traktor gefahren.«
Na toll, dachte ich, was für ein Trost.
Opa zwinkerte mir zu. »Direkt in den Hühnerstall.«
Fritza grinste und ich horchte auf. »Du bist in den Hühnerstall gefahren?«
»Volle Lotte«, sagte Opa. »Mein Vater hat mir den Hintern versohlt, ich konnte drei Tage nicht sitzen. Und ich musste einen neuen Stall bauen.«
Ich schaute zur eingezäunten Wiese. Herr Kaiser hockte stolz nach Gockelart auf der Schubkarre und betrachtete Berta und die übrigen einundzwanzig braunen Hennen, die zwischen den Apfelbäumen und dem Stall herumliefen. »Den hast du gebaut?«
Opa nickte. »Den auch, ja, aber viele Jahre später.« Er zeigte neben die Scheune, wo der rote Fiat (ohne Lenkrad) vor sich hinrostete. »Damals stand der Hühnerstall da drüben. Er war kleiner als der jetzige, obwohl wir mehr Hühner hatten.«
»Ist Papa auch mit dem Traktor gefahren?«, fragte Fritza.
»Ja«, antwortete Opa. »Aber schön amtlich auf der Straße. Wie sich das gehört.«
»Ich soll euch von ihm grüßen«, sagte Mama und drehte ihren Stock mit dem Brotteig über den Flammen. »Er ist heil in Rumänien gelandet.«
Papa arbeitete für ein Ingenieursbüro. Lauter schlaue Leute, die irgendwelche Sachen erfanden und diese in der ganzen Welt verkauften. Deshalb musste er auf Geschäftsreise und konnte die Sommerferien nicht mit uns auf Opas Bauernhof verbringen.
»Der Arme«, sagte Fritza. »Er muss arbeiten, während wir gemütlich hier sitzen und den Abend genießen.«
Wie auf Kommando schauten wir uns um. Die Sonne lugte wie ein großes Auge durch die Wipfel der mächtigen Eichen, die hinter der roten Backsteinscheune wuchsen. Das grüne Tor stand weit offen und gab den Blick frei auf die vielen Holzkisten, in denen Opa allerlei alten Krimskrams aufbewahrte. Neben den Holzkisten staubte ein ausgedienter Pflug vor sich hin. Und an der Scheunenwand lehnten hölzerne Wagenräder sowie eine riesige rostige Zweihandsäge. Letztes Jahr war sie noch größer gewesen als ich. Doch am ersten Tag der Ferien hatte ich mit Stolz festgestellt, dass ich sie überholt hatte.
Opa liebte seinen alten Krempel. Die Kisten, Räder und der Pflug stammten zwar aus der Zeit seiner Großeltern, aber er sah trotz Papas Meckern darin keinen Grund, sich davon zu trennen. »Wenn ich mal deiner Mutter ins Grab folge«, sagte er zu Papa, »kannst du die Sachen gern einem Museum spenden. Bis dahin lass mir meine Erinnerungen.«
Der Scheune gegenüber befand sich das Haupthaus, ein altes, ebenfalls aus roten Backsteinen gebautes und mit Fachwerk verziertes Haus mit grünen Fensterläden. Auf den Dachziegeln wuchs Moos und die Giebel zierten zwei geschnitzte Pferdeköpfe. »Ein echtes westfälisches Bauernhaus«, hatte Opa mir einmal erklärt. »Die Pferdeköpfe schützen das Haus vor Gewitter und die Familie, die darin wohnt, vor Unglück.«
Ich glaubte ihm die Sache mit den Pferdeköpfen. Noch nie war ein Blitz in das 1822 gebaute Haus gefahren. Und soweit ich das wusste, hatte es noch nie ein Unglück in unserer Familie gegeben.
An das Haupthaus grenzte der Stall, der, abgesehen von einer Eule, einem Dutzend Mäusen und hunderten Spinnen, leer stand. Und zwischen Haupthaus, Hühnerwiese und dem roten Fiat wuchsen neun Apfelbäume auf einer großen, verwilderten Wiese. Vor einigen Jahren hatten da noch Opas Pferde gegrast. Doch nachdem Oma gestorben war und Opa seine Felder verpachtet und die Pferde verkauft hatte, überließ er die Wiese – wie die Scheune – sich selbst. In der Mitte der Wiese stand der alte Heuwagen mit seinen rostigen Rädern und morschen Holzplanken. Früher war ich oft darauf herumgeklettert. Bis ich eines Tages durch eine Planke durchgebrochen war und mir Hose und Haut aufgerissen hatte. Eine sechs Zentimeter lange Narbe zierte noch immer meine Wade.
»Es ist wirklich wunderschön hier«, seufzte Mama. »Als wäre die Zeit stehen geblieben.«
Opa rückte seinen Hut zurecht, so dass die Hahnenfeder zu tanzen begann. »Das ist sie auch.« Er zeigte zur Einfahrt, einem sandigen Weg, der durch eine schmale Allee aus sechzehn Eichen zur Landstraße führte. »Jedesmal, wenn ihr da durchfahrt, zerfallen eure Jahre zu Staub und ihr werdet wieder Kinder.«
»Na, bei Fenno hat der Zauber ja nicht viel zu tun«, meinte Fritza und drehte ihren Stock über den Flammen.
»Ich bin kein Kind!«, schmollte ich und um das zu beweisen, drehte ich ebenfalls meinen Stock. Und wie konnte es anders sein? Dabei fiel mein Teig ins Feuer.
»Seht ihr«, lachte Fritza, »ein richtiges Kind. Unbeholfen und dumm.«
»Fritza!«, mahnte Mama sie.
»Was denn?«, erwiderte Fritza. »Ich habe doch Recht. Guck doch! Er kann nicht mal einen Stock drehen.«
Ich warf den Stock ins Feuer und sprang auf. Mama und Opa tauschten genervte Blicke aus. Fritza grinste spöttisch und blickte mich erwartungsvoll an. Doch wie so oft wollte mir nichts Gemeines einfallen, also drehte ich mich um und rannte zur Scheune. An der Seitenwand führte ein Treckerweg fort vom Bauernhof, durch ein Wäldchen aus neunundvierzig Eichen und hin zu den Feldern. Dem folgte ich fluchend und schimpfend und stinksauer.
»Ich bin kein Kind«, meckerte ich, eine Eichel wegtretend. »Wieso kann sie mich nicht einfach in Ruhe lassen?«
Es war nicht so, dass ich Fritza hasste, ich fand sie bloß zum Kotzen. Ständig machte sie sich über mich lustig. Keine Gelegenheit ließ sie aus. Und leider gab es viel zu viele Gelegenheiten. Wie das Lenkrad. Wie das Stockbrot. Wie der Orangensaft heute Morgen, der mir durch die Nase gelaufen war, nachdem ich mich verschluckt hatte. »Du bist zu blöd zum Schlucken«, hatte Fritza gelacht.
Doch mehr als über ihren Spott ärgerte ich mich über mich selbst. Ich war wirklich zu blöd für alles. Immer ging etwas daneben. Ich hatte keine Ahnung, warum das so war. Doch es war so. Sie zeichnete echt krasse Bilder von Elfen und Orks und ich war zu blöd zum Schlucken. Zum Lenken. Zum Stockhalten.
Im Schatten der Eichen stampfte ich über den erdigen Weg, grollte und schmollte und wurde jäh von der untergehenden Sonne geblendet. Zum Schutz hob ich meine Hand und erkannte das Maisfeld, durch das ich noch vor einer halben Stunde in Gedanken gedüst war. Wie gut ich mich gefühlt hatte! Jetzt stand ich mit hängenden Schultern da, deprimiert und brummig.
Dem Weg folgend schlenderte ich am Maisfeld vorbei. Der Wind rauschte durch die anderthalb Meter hohen Halme und verteilte diesen herben Duft von Wiesen, Wildblumen und Getreide, wie es ihn nur bei Opa auf dem Land gab. Daheim roch ein Sommerabend bloß nach Grillfleisch, weil in jedem Garten gegrillt wurde.
Feine Staubkörner glitzerten im Sonnenschein. Irgendwo zwischen dem Mais rief ein Vogel und unzählige Mückenschwärme tanzten durch die Luft. Geduckt lief ich unter ihnen hindurch und stieß nach wenigen Augenblicken auf die Schienen.
Die eingleisige Spur wurde seit etlichen Jahren nicht mehr befahren. Früher ratterten hier Güterzüge quer durch die endlosen Felder. Seither rosteten die Schienen vor sich hin und die Holzbohlen darunter verrotteten.
Der Treckerweg kreuzte die Schienen, die auf einem leicht erhöhten Schotterbett durch die Felder verliefen. Ich ging die paar Schritte hinauf und stellte mich auf das Gleis. Weißgelbe Blumen wuchsen zwischen den Holzbohlen. Margeriten. Oder Kamille. Fritza wusste bestimmt den Unterschied. Fritza, die doofe Kuh!
Am Morgen hatte sie mich noch ausgelacht, weil ich eine Schwalbe nicht von einer Amsel unterscheiden könne. Ich wusste nicht, wie die quirligen Vögel hießen, die an Opas Scheune vorbeisausten. Also sagte ich den erstbesten Vogelnamen, der mir einfiel. Leider den falschen.
Ich schloss die Augen, atmete langsam ein und aus und wünschte mir, einmal etwas richtig zu machen. Irgendwas, das alle begeisterte, und mit dem niemand rechnete. Ich dachte dabei nicht an ein Stockbrot. Oder an ein Lenkrad. Nein, etwas Großartiges sollte mir gelingen. Etwas wirklich Wichtiges.
Da spürte ich den Schmerz. Direkt auf der Nasenspitze. Ich riss die Augen auf und konnte es nicht glauben: Eine Mücke saugte Blut aus meiner Nase. Ich schlug nach ihr, doch sie sirrte davon und ich traf meinen Zinken, der augenblicklich anfing zu jucken.
»Ich bin zu blöd, mir was zu wünschen«, seufzte ich und ließ mich auf die Schienen plumpsen. Mit gesenktem Kopf schwor ich mir, nie wieder aufzustehen. Mein Leben war sinnlos.
»Hm?«, stutzte ich. Das Licht hatte sich verändert. Langsam hob ich den Kopf – und sah direkt in die Sonne. Als roter Ball saß sie mir gegenüber, nur vier Zentimeter über den Schienen. Als wollte sie auf dem Gleis in die Nacht rollen.
Und dann bemerkte ich etwas im Augenwinkel. Lautlos bewegte es sich das Gleisbett hinauf. Eine Gans? Ein Fasan? Wieso machte das Tier keine Geräusche? Gebannt hielt ich die Luft an und traute meinen Augen nicht: Ins rote Sonnenlicht trat eine Henne. Eine weiße Henne ohne Kopf.
Zwei Möglichkeiten
Eine Henne ohne Kopf?«, wunderte ich mich und rieb mir die Augen.
Ich öffnete sie und … die Henne stand noch immer auf den Gleisen. Fünf Meter vor mir scharrte sie lautlos zwischen den Schottersteinen.
Ich befühlte meine Stirn. Hatte ich einen Sonnenstich? Oder war ein sonderbares Fieber in Westerheide ausgebrochen und befiel alle elfjährigen Jungen? Doch da war nichts. Mein Kopf fühlte sich völlig normal an.
»Ich träume«, stellte ich fest und kniff mir in den Arm. Zu meiner Verwunderung tat es saumäßig weh.
»Wenn es kein Hirngespinst ist, kann es nur echt sein«, schloss ich daraus.
Ich klatschte in die Hände. Opas Hühner liefen aufgeregt davon, wenn man sie erschreckte. Dieses Huhn rannte nicht weg. »Es hat ja auch keine Ohren«, dachte ich laut. Und da hielt das Huhn inne, als hörte es auf meine Stimme – was ohne Kopf kaum möglich ist.
»Put, put, put«, lockte ich es und ich schwöre, mit Kopf hätte es mich neugierig angeschaut. So drehte sich nur der weiße ausgefranste Hals in meine Richtung.
Jetzt war ich überfragt. Die Henne reagierte nicht auf mein Klatschen, jedoch auf meine Stimme. Das war seltsam. Demnach war es keine gewöhnliche Henne. Definitiv war es jedoch eine Henne, das konnte ich mit Sicherheit sagen. Sie hatte keine langen Schwanzfedern, wie es bei Hähnen üblich ist. Aber wie konnte sie ohne Kopf auf den Gleisen herumlaufen? Auch eine ungewöhnliche Henne braucht einen Kopf, um zu leben. Das war bei Hühnern nicht anders als bei Menschen.