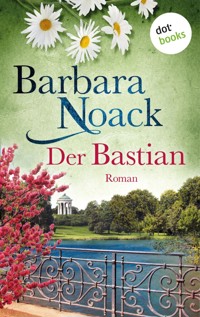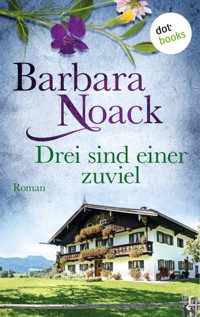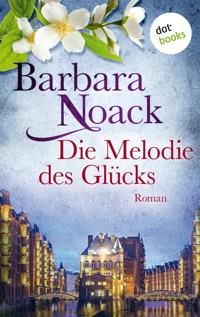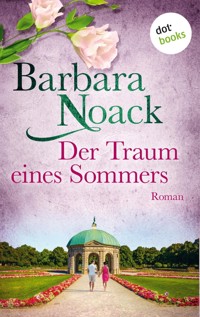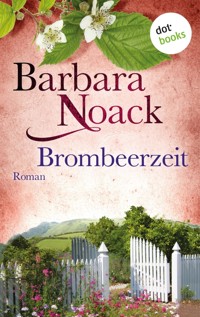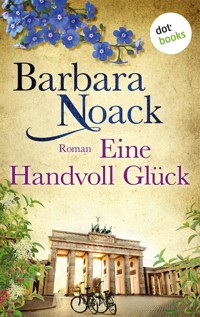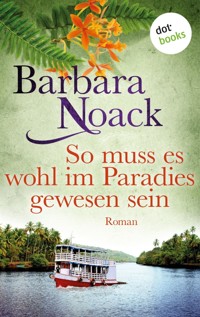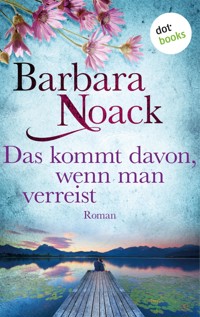Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rabauken zum Gernhaben: "Ferien sind schöner" von Bestsellerautorin Barbara Noack jetzt als eBook bei dotbooks. Ferien – die schönste Zeit des Jahres! Endlich genug Zeit für die Familie, gemeinsame Unternehmungen und Erholung vom Alltag. Von wegen! Für Philip und seine Freunde ist es die beste Gelegenheit, noch mehr Schabernack als sonst zu treiben und die Pläne ihrer Eltern gehörig durcheinander zu wirbeln … Auf gewohnt humorvolle und sympathische Art lässt Bestsellerautorin Barbara Noack den Leser an den vielen Erlebnissen mit ihrem Sohn teilhaben. Das Leben mit Kindern ist oft heiter und manchmal einfach nur zum Haare raufen – und immer auch ein großes Abenteuer. Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Ferien sind schöner" von Bestsellerautorin Barbara Noack. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ferien – die schönste Zeit des Jahres! Endlich genug Zeit für die Familie, gemeinsame Unternehmungen und Erholung vom Alltag. Von wegen! Für Philip und seine Freunde ist es die beste Gelegenheit, noch mehr Schabernack als sonst zu treiben und die Pläne ihrer Eltern gehörig durcheinander zu wirbeln …
Auf gewohnt humorvolle und sympathische Art lässt Bestsellerautorin Barbara Noack den Leser an den vielen Erlebnissen mit ihrem Sohn teilhaben. Das Leben mit Kindern ist oft heiter und manchmal einfach nur zum Haare raufen – und immer auch ein großes Abenteuer.
Über die Autorin:
Barbara Noack, geboren 1924, hat mit ihren fröhlichen und humorvollen Bestsellern deutsche Unterhaltungsgeschichte geschrieben. In einer Zeit, in der die Männer meist die Alleinverdiener waren, beschritt sie bereits ihren eigenen Weg als berufstätige und alleinerziehende Mutter. Diese Erfahrungen wie auch die Erlebnisse mit ihrem Sohn und dessen Freunden inspirierten sie zu vieler ihrer Geschichten. Ihr erster Roman »Die Zürcher Verlobung« wurde zweimal verfilmt und besitzt noch heute Kultstatus. Auch die TV-Serien »Der Bastian« und »Drei sind einer zu viel«, deren Drehbücher die Autorin verfasste, brachen in Deutschland alle Rekorde und verhalfen Horst Janson und Jutta Speidel zu großer Popularität.
Barbara Noack veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Romane »Die Zürcher Verlobung«, »Der Bastian«, »Danziger Liebesgeschichte«, »Drei sind einer zuviel«, »Brombeerzeit«, »Das Leuchten heller Sommernächte«, »Die Melodie des Glücks«, »So muss es wohl im Paradies gewesen sein«, »Jennys Geschichte«, »Der Duft von Sommer und Oliven«, »Der Zwillingsbruder«, »Das kommt davon, wenn man verreist«, »Auf einmal sind sie keine Kinder mehr«, »Was halten Sie vom Mondschein?«, »Valentine heißt man nicht«, »Der Traum eines Sommers« und »Eine Handvoll Glück« sowie »Ein Stück vom Leben«, die auch im Doppelband »Schwestern der Hoffnung« erhältlich sind. Auch bei dotbooks erschienen ihre Erzählbände »Flöhe hüten ist leichter« und »Eines Knaben Phantasie hat meistens schwarze Knie« sowie der Sammelband »Valentine heißt man nicht & Der Duft von Sommer und Oliven«.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2016
Copyright © der Originalausgabe 1977 by Albert Langen – Georg Müller Verlag GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Soloviova Liudmyla, Fernando Blanco Calzada
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-900-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Ferien sind schöner« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Noack
Ferien sind schöner
Heitere Geschichten
dotbooks.
Womit Kinder in Tutzing, Warschau,Oklahoma, Argentinien, Australien und überallsonst in der Welt ihre Eltern ärgern
Manche fangen damit schon ganz früh an, indem sie sich bereits zu einem Zeitpunkt einstellen, zu dem man. sie noch gar nicht geplant hatte.
Tagsüber schlafen sie sich aus, damit sie nachts schön munter sind.
Sie schmusen mit Vorliebe mit Leuten, die ihre Eltern nicht ausstehen können.
Sie mögen nicht die Hand geben.
Sobald sie laufen können, trödeln sie.
Sie malen viel lieber auf Tapeten als in die hübschen Malhefte, die ihnen Tanten schenken.
Einen richtigen, ausgewachsenen Bock haben sie selten zu Haus, aber gerne in der Öffentlichkeit, wo ihnen Publikum sicher ist.
Sie müssen immer alles anfassen.
Sie spielen freiwillig mit jedem Rowdy, aber nur sehr ungern mit den Kindern des Vorgesetzten ihres Vaters.
Je künstlicher etwas schmeckt, um so lieber trinken sie es.
Wenn sie sich die Hände waschen, ist das Handtuch hinterher schwarz und die Hände immer noch.
Alles muß man ihnen nachräumen.
Bei anderen Leuten futtern sie so viel, daß der Eindruck entsteht, sie müßten zu Hause Hunger leiden.
Sie haben niiie schuld. Es sind immer die andern gewesen.
Geschenke wollen sie haben, aber Dankbriefe schreiben wollen sie nicht.
Immer nehmen sie unser Handwerkszeug, dabei haben sie selber welches.
Wenn man mit ihnen Staat machen will, fallen sie garantiert in eine Pfütze.
Sie kippeln ständig mit dem Stuhl.
Sie wollen immer das haben, was sie nicht haben, und wenn sie es endlich haben, liegt es herum.
Sie hören nie zu, wenn man ihnen was sagt, aber sie hören alles, was sie nicht hören sollen.
Abends braucht man ein Pferdegespann, um sie ins Bett zu ziehen, und morgens muß man wieder Vorspannen, um sie herauszuziehen – letzteres allerdings erst seit dem Tage, da sie zur Schule gehen. Vorher waren sie immer um halb sieben putzmunter.
Es gibt so reizende Kinder in ihrer Klasse, aber mit denen sind sie leider nicht befreundet.
Gute Hosen kratzen angeblich, Jeans nie.
Sie kriegen den Mund nicht auf, wenn man sie etwas fragt. Aber kaum telefoniert man – dann sind sie plötzlich da und quasseln pausenlos dazwischen.
Bei Sonnenschein spielen sie gern im Zimmer.
Wenn man sie mit einem Auftrag fortschickt, kann man sicher sein, daß sie unterwegs einen Bekannten treffen oder ein Ereignis, das sie davon abhält, den Auftrag auszuführen.
Sie sind Meister im Erfinden von Ausreden.
Sie lungern im Haus herum und wissen absolut nichts mit sich anzufangen. Bittet man sie aber, mit dem Hund Gassi zu gehen, fallen ihnen spontan fünf unaufschiebbare Beschäftigungen ein, die sie daran hindern.
Eine echte technische Stütze und Freude
Endlich haben wir wieder einen Techniker in der Familie, den ersten seit jenem großen Baumeister mütterlicherseits, der im Weltkrieg I eine Brücke von einem polnischen Ufer zum anderen polnischen Ufer bauen mußte. Eine Brücke, welcher kein feindlicher Beschuß etwas anhaben konnte – sie stürzte schon vorher ein.
Mein Sohn (13) ist der neue Techniker in der Familie, eine echte Begabung, möchte ich sagen. Von mir hat er's nicht.
Beispiel: Wenn ich in einem fremden Auto das Fernlicht einschalten will, schalte ich das Abblendlicht erst mal aus, setze die Scheibenwischer in Gang, darauf die Winker und hupe. Nicht so mein Sohn. Er findet auf Anhieb den Hebel fürs Fernlicht. Er weiß eben – das ist er. Ich weiß es eben nicht.
Und so ist mir mein Sohn nun schon seit Jahren eine echte technische Stütze und Freude. Was hat er nicht alles erfunden, um mir das Dasein zu erleichtern. Ich denke bloß an die elektrische Spritzanlage für meine Topfpflanzen. Ein unvergeßliches Patent. Auch für diejenigen, die unter uns wohnten.
Oder sein automatischer Türöffner zwischen Arbeitszimmer und Flur.
Noch heute künden Löcher in der Wand und am Türholz von dieser Erfindung, die ungefähr so funktioniert hat: Die Klinke war mit einem Kontakt verbunden, der den Elektromotor an der Wand in Bewegung setzte. Im Zimmer waren oberer Türrand und Bücherregal mit einer Nylonschnur und Schießgummis verbunden.
In dem Augenblick, wo man vom Flur her die Klinke herunterdrückte, zog die Schnur an, die Tür ging auf, wenn sie ganz auf war, schaltete sich der Motor aus, die Tür fiel zurück und dem ahnungslos Eintretenden irgendwo hinein. Unserm Hund nur einmal, dann nie wieder – er flitzte wie ein geölter Blitz durch dieses Patent.
Meine scheue Frage nach dem Zweck des Türöffners – man wäre doch vor seinem Einbau so ganz einfach und gefahrlos hinein- und wieder hinausgelangt – stieß beim Erfinder desselben auf blankes Unverständnis.
Und so weiß ich spätestens seit diesem Patent, daß die Technik nicht nur dazu da ist, uns das Leben zu erleichtern, sondern auch, um alltägliche Vorgänge zusätzlich zu komplizieren, indem man ihnen Klingeln, Wecker, Lämpchen und Kurzschlüsse einbaut.
Andere Erfindung: die Alarmanlage anläßlich meiner Fischvergiftung.
Es ging mir miserabel, und Sohn zeigte ehrliche Besorgnis. Störte irgendwann meinen endlichen Schlaf mit unbeholfenen Zärtlichkeiten.
»Hör zu«, sagte er, als ich die Augen öffnete, »ich habe eine Alarmanlage für dich erfunden.«
Er gab mir ein Stück Strippe in die Hand.
»Die ist mit meinem Bett verbunden«, sagte er. »Wenn dir sehr mies ist, brauchst du nur dran ziehen. Die Schnur reicht bis in mein Zimmer. Wenn du ziehst, fällt an meinem Bett ein Eimer runter, der mit meinem Daumen verbunden ist. Davon wache ich auf und komme sofort.«
Ein guter Junge.
Mitten in der Nacht wollte unsere Afghanenhündin über den dunklen Flur zu ihrem Wassernapf, lief in die Schnur hinein und löste die Alarmanlage aus: Der Eimer fiel dröhnend neben Philips Bett auf den Fußboden.
Die Hündin sprang halb irr vor Entsetzen auf meinen schlimmen Bauch, im Haus wachte alles auf – nur mein Sohn schlief tief und fest weiter.
Noch eine Erfindung: die Haltevorrichtung mit Dreheffekt für den Weihnachtsbaum. Im Einsatz bewährte er sich vorzüglich als Kippeffekt.
Als ich vor den Baumtrümmern stand und schrie und uns allen die Haare raufen wollte, sagte mein Sohn so richtig nett geknickt: »Und ich dachte, du würdest dich freuen.«
Achterbahn
Karlchen möchte Achterbahn fahren. Achterbahn ist das größte. Warum fährt keiner mit ihm Achterbahn? – Weil du dafür noch zu klein bist, Karlchen. Und der Toni und der Andi und die Susi? Sind die vielleicht älter als er? Trotzdem fahren ihre Eltern mit ihnen Achterbahn. Bloß seine nicht. Warum nicht?
Karlchens Vater sagt, er kann es nicht. Beim besten Willen nicht. Er wird zu leicht schwindlig.
»Was ist das, schwindlig?«
»Was Schlimmes, da kann man nicht hinunterschauen. Gleich zieht es einen in die Tiefe.«
»Was zieht einen?«
»Die Tiefe eben.«
»Und warum kann man dann nicht Achterbahn fahren?«
»Weil man das Gefühl hat, man fliegt heraus.«
»Aber das ist doch gerade das Schöne. Das sagen Toni und Andi auch. Man denkt, man fliegt heraus, aber man fliegt nicht. Ein irres Gefühl, sagen sie.«
»Gehen wir doch lieber erst mal zu den Autoskootern«, lenkt Karlchens Vater ab.
Im Verlaufe eines Nachmittags auf dem Oktoberfest investiert er sechsmal autoskootern, ein halbes Brathendl, Zuckerwatte, saure Gurken, Geisterbahn, Flohzirkus, gebrannte Nüsse, Irrgarten, 2 Spezis, 3 Toilettenbesuche und ein großes Lebkuchenherz mit der Aufschrift »Unter Palmen am Meer« in Karlchen. Er erwürfelt ihm einen geigespielenden Bären. Aber selbst eine handfeste Prügelei unter Betrunkenen mit Polizei und Abführen kann Karlchen nicht von seiner Enttäuschung ablenken: Warum fahren seine Eltern nicht mit ihm Achterbahn?
Warum sind sie überhaupt so unsportlich? Andere Eltern fahren mit ihren Kindern Ski und Boot und verstehen was von schnellen Maschinen und vom Fußball. Karlchens Vater kann nicht schwimmen, fliegt nie, und nun ist er auch noch schwindlig. Karlchen weiß, daß er die liebsten Eltern von der Welt hat, liebere vielleicht als Toni und Susi – aber eben unsportlichere. Karlchen fühlt sich immer als Außenseiter, wenn die anderen Kinder erzählen, was sie Tolles mit ihren Eltern unternommen haben.
»Ist Mami eigentlich auch schwindlig?« fragt er. Seine Eltern sehen sich an und begreifen plötzlich, wieviel es für Karlchen bedeutet, mit einem von ihnen Achterbahn zu fahren.
»Also gut«, sagt seine Mutter und schluckt ihre Angst herunter, »ich fahr mit dir.«
»Ich fahre«, sagt sein Vater, »du bist doch noch viel schwindliger als ich.«
Sie streiten sich beinah, wer mit Karlchen nun fahren soll, während sie auf die Achterbahn zugehen – einer versucht durch sein Opfer den anderen vorm Schafott zu bewahren.
Aber wenn schon sterben um eines blödsinnigen Prestiges willen, warum dann nicht zu ebener Erde?
Nun stehen sie davor und sehen, wie die Wagen herunterschießen. Ihre Insassen kreischen. Manche machen auch einen verkrampften, stark in sich gekehrten Eindruck. »Na, Karlchen?« fragt der Vater.
Karlchen ist plötzlich gar nicht mehr so sicher, ob er wirklich Achterbahn fahren will, ob er sich vielleicht lieber doch nicht traut?
Aber als Sproß einer ebenso ängstlichen wie tapferen Familie atmet er einmal tief durch und sagt ja. Ein sehr blasses Ja.
Sie nehmen in einem Wägelchen Platz. Vorn Vater mit Sohn im Arm, hinter ihnen die Mutter mit dem geigenden Bären.
Die Musik spielt Hello Dolly, die Wagen rucken an, rollen hakend um die Kurve, leb wohl, du schöne Welt. Es geht steil in die Höhe. Die Wies'n mit ihrem bunten Menschengewühl und Gedudel und vor allem mit ihrem soliden Boden sinkt immer tiefer, bloß nicht runtergucken, sonst zieht es, Schwindligkeit ist ja was Furchtbares, begreift keiner, der sie nicht erlebt hat, krampft in den Fußsohlen, Karlchen in Vaters Arm macht huch und schließt die Augen, Vaters Hände kleben am Griff, ohne Halt zu finden, jetzt geht es abwärts.
In Schußfahrt abwärts, kopfüber abwärts, Magen hoch, heiliger Vater, hatten sie das nötig? Jetzt sind sie unten, aber nur kurz, dann geht's schon wieder hoch, hoch oben hakt es – es hakt! – ein Ruckeln, als ob der Wagen gleich … Hilfe, wir entgleisen!!
Sie entgleisen nicht, sondern schießen weiter wie gereizte Wespen durch die Luft, runter, rauf und – ist denn noch immer nicht Schluß, bitte schön? Ist das nicht ein bißchen viel Todesangst für zwo Mark pro Person?
Noch ein steiler Sturz. Sie rollen langsam aus. Klettern taperig und grüngesichtig auf die Erde zurück – süße, staubige, haltbare Erde. Hatten sie jemals im Leben ein Gefühl so tiefer Dankbarkeit?
»Na, Karlchen?«
Langsam kehrt Farbe in sein Gesicht zurück und Fröhlichkeit, eine unbändige, alberne Fröhlichkeit. Es war toll, versichert er.
Es war wirklich toll, daß sie sich das alle drei getraut haben.
Verbunden durch ihre Hände und ihr Heldentum verlassen sie das Oktoberfest.
Karlchen ist sehr stolz auf seine Eltern und auf sich selber auch.
Morgen wird er Toni und Andi und Susi und all den anderen Kindern erzählen: Wir sind auch Achterbahn gefahren. Na und –!?
Aber noch mal nicht, nie wieder.
Hochhauskinder
Die Mutter von Mäxchen und Reni hat eine Freundin, und die wiederum hat eine Kusine, deren Schwägerin eine Familie kennt, die doch wirklich mal in einem Mietshaus gewohnt hat, in dem ein kinderfreundlicher Mann als Hauswart tätig war.
Mäxchen und Reni kennen nur solche, die allen Kindern alles verbieten.
In der großen neuen Wohnanlage am Stadtrand dürfen sie bloß artig sein, ordentlich und vor allem leise, und genau das macht Mäxchen keinen Spaß.
Aber daran ist nicht nur der Hauswart schuld, sondern auch die hellhörige Bauweise.
In so einem Wohnblock leben die Mieter zwar jahrelang neben- und übereinander, ohne sich menschlich näherzukommen. Aber akustisch bilden sie eine Großfamilie, die alle Geräusche miteinander teilt.
Mäxchen hat daraus sofort Vorteile gezogen: Er braucht nur schön laut zu brüllen, gleich kriegt er seinen Willen, damit er das Brüllen wieder einstellt. An Erziehung ist dabei nicht zu denken.
Mäxchens und Renis Eltern wohnen im achten Stock wegen der schönen Aussicht. Sie hätten besser im Parterre gemietet oder im ersten Stock, zumindest in einer Höhe, die man über Treppen erreichen kann, ohne daß einem die Lunge aus dem Halse hängt.
Schon wegen Mäxchen wär's vernünftiger gewesen. Denn kaum ist er auf dem Spielplatz, fällt ihm ein, daß er seine Schaufel oben vergessen hat. Dann braucht er unbedingt seinen Roller. Dann hat er Durst. Inzwischen macht ihm ein anderes Kind seine Sandburg kaputt. Mäxchen muß sich bei Mutti beklagen.
So geht das den ganzen Vormittag und wäre ja auch nicht weiter schlimm, wenn sie nicht im achten Stock wohnten.
Natürlich gibt es einen Lift im Haus. Sogar zwei. Man kann sich sozusagen aussuchen, in welchem man steckenbleiben möchte.
Kleine Kinder dürfen aber nicht ohne Begleitung Erwachsener in einem Lift fahren.
Also muß die Mutter zuerst mit Mäxchen und Reni hinunter und zehn Minuten später mit der Schaufel und dann mit dem Roller. Sie liftet mal mit Saft und mal mit einer Buttersemmel abwärts, mit Leukoplast, zum Streitschlichten und schließlich mit den Kindern und dem Roller wieder hinauf zum Mittagessen und nach dem Essen wieder hinunter.
Zur Zeit der Hinterhöfe war's ja einfach. Da brüllten Kinder ihre Wünsche zum Küchenfenster hinauf, und Mutter schmiß runter. Sie hatte ihre Brut ständig mit einem Ohr im Auge.
Zum achten Stock kann man nicht hinaufbrüllen. Muß man auch nicht. Wozu hat man schließlich eine Sprechanlage. Die macht sogar Spaß. Fragen Sie Mäxchen. Hopst er eben am großen Klingelbrett hoch und drückt auf den obersten Knopf links, dann knattert es im Megaphon, und die Stimme seiner Mutter fragt erschöpft: »Was willst du denn nun schon wieder?«
Manchmal drückt Mäxchen auch daneben. Dann meldet sich eine fremde Stimme. Dann rennt er lieber weg.
Weil es sich aber nicht lohnt, wegen einer einzigen Stimme wegzulaufen, drückt er auf so viele Knöpfe, wie er mit einemmal erwischen kann.
Nun haben sie ihn dabei erwischt. Aus ist es mit der Bimmelei.
Die vielen Briefkastenschlitze beliefert er mit Kieseln, Bonbonpapieren und was er noch so entbehren kann. Im Frühjahr hat er mehrere Schlitze künstlich aufgehalten in der Hoffnung, es würden Vögel darin nisten, so wie im Briefkasten seiner Großeltern.
Aber die Vögel mögen keine Hochhäuser. Und Hochhäuser mögen keine Tiere.
Weil das Halten von Hunden und Katzen im Mietvertrag ausdrücklich verboten ist, hat Mäxchen die kleine Katze, die ihm in den Ferien zugelaufen war, nicht mit heimnehmen dürfen.
Aber die alte Hexe im ersten Stock links, die den ganzen Tag aus dem Küchenfenster hängt und bloß schaut, wo es was zum Petzen gibt – so eine ist laut Mietvertrag erlaubt!
Außer der Hexe und dem Geschimpfe des Hausmeisters fürchtet Mäxchen nichts so sehr wie den einsamen, langen Keller mit seinen holzvergitterten Gefängniszellen und die Tiefgarage. Sie könnten Mäxchen tothauen, ehe er da allein hineinginge. Sitzen doch lauter Mörder und Räuber zwischen den parkenden Wagen und lauern auf kleine, hilflose, alleingehende Knaben.
Nachts träumt er manchmal von ihnen und brüllt das Hochhaus zusammen.
Vom achten Stock aus kann man in der Ferne den Flughafen sehen.
Mäxchen sieht Maschinen aufsteigen und landen und möchte auch Flughafen sein. Er läßt viele kleine Papiersegler von seinem Balkon starten. Die meisten landen im Vorgarten. Einer ist mal auf dem Balkon im zweiten Stock hängengeblieben. Beim Nachschauen wäre Mäxchen beinahe selbst im Tiefflug nach, wenn ihn seine Mutter nicht im letzten Augenblick am Hosenboden erwischt hätte.
Aus war's mit der Fliegerei. Nichts wird einem erlaubt in diesem Haus.
Auf den großen Rasenflächen zwischen den Häuserblocks darf er auch nicht spielen, weil das nämlich Grünanlagen sind, und eine Anlage ist immer was Ernstes. Bleibt ihm bloß der Spielplatz mit seinem Klettergerüst, einem halben, umgestürzten Baumstamm, der Buddelkiste und dem Schild »Nur für Anliegerkinder«.
Nun kann man sich Anliegerkinder genausowenig aussuchen wie Verwandte. Mäxchen hatte es eines Tages satt, nur mit vorgeschriebenen Kindern zu spielen. Er brachte sich ein paar Cowboys und Indianer von der Straße mit, die besetzten mit Gegröle und Geknalle den Spielplatz, trampelten alles nieder, auch die Büsche drumherum, und am schlimmsten wütete Mäxchen selbst. Das war glatte Revolution.
Ein Glück, daß gerade zu der Zeit ein Platz für ihn im Kindergarten frei wurde.
Seine Schwester Reni ist ein stilles Kind.
Sie malt am liebsten den ganzen Tag. Auf ihren Buntstiftbildern kehrt immer dasselbe Thema wieder: ein Häuschen. Ein kleines Häuschen mit spitzem Giebel und einer Sonne. Rechts und links daneben blühen riesengroße, leuchtende Blumen. Davor ist eine Wiese, keine Grünanlage – eine richtige, zottelige Wiese mit staksigen Figürchen drin: Das sollen ein Hund sein, der sich freut, Reni auf der Schaukel und Mäxchen in einem klitzekleinen Planschbecken. Ach ja …
Werden Elefanten in einem Stück begraben?
Zog da vor ein paar Wochen meine Freundin um und stellte ihre Kinder (Vier und Sechs) bei mir unter. Wie beschäftigt und erfreut man untergestellte Kinder? Ich sagte, gehen wir in den Zoo.
Vier und Sechs sagten, da wären sie schon gewesen, kämen aber gerne noch mal mit.
Wenn man in unseren Tierpark hineingeht, sind gleich rechts die Elefanten und links die Meerschweinchen. Nun raten Sie mal, wo Vier und Sechs zuerst hinrannten? Zu den Meerschweinchen.
Denn Meerschweinchen haben sie selber zu Haus, Elefanten dagegen nicht (schon wieder ein Beweis für unsere Wohnraumnot).
Als gewissenhafter Kinderhüter hatte ich vor diesem Zoobesuch Brehms Tierleben studiert. Ich wußte somit alles über Elefanten, zumindest über die lebenden, nicht aber über die entseelten, und genau nach denen fragten sie mich:
»Was macht man mit einem toten Elefant? Begräbt man ihn in einem Stück oder –?«
Auch ihre zweite Frage, weshalb die Pfauen mit den Dickhäutern in einem Gehege Zusammenleben, konnte ich nicht beantworten. Ja, wer macht sich denn schon Gedanken über Elefanten im Zusammenhang mit Pfauen?
Ich sagte, gehen wir doch lieber zu den Löwen.
Die Löwen lagen herum wie die Wermutbrüder in den Isar-Auen, und nach einer halben Stunde lagen sie immer noch so da.
Sechs meinte, da wäre der aus der Fernsehserie doch ein ganz anderer Löwe gewesen. Der konnte schielen und denken wie ein Mensch.
Die Zebras kannten sie aus dem Fernsehen, die Kamele kannten sie aus dem Fernsehen, die Hängebauchschweine kannten sie nicht aus dem Fernsehen, wohl aber ihr Heimatland Vietnam. Sechs sagte: »Die sind vielleicht froh, daß sie hier sind und nicht da.«
Eine Frau lief aufgeregt an uns vorbei:
»Oben im Raubtierhaus ist Tigerfütterung! Man muß doch sehen, wie es ihnen schmeckt!«
Wir gingen auch zur Fütterung, aber unterwegs begegneten wir einem Schaufelbagger, der grub ein Loch in eine Wiese, und das war sagenhaft interessant.
Ich sagte, Bagger gibt's überall, nun kommt schon.
Sechs sagte, aber so einen schönen gelben wie diesen hier hätte er noch nie gesehen, und blieb stehen.
Inzwischen waren die Tiger satt.
Spätestens bei den Wasserbüffeln war mir klar, daß Sechs und Vier unter einem Zoobesuch noch etwas anderes verstanden als Tiere anschauen, nämlich Eis, Limo, Popcorn, Eis, Ponyreiten, Eis, Fischsemmel, Coca, Erdnüsse. Mir tat das Portemonnaie weh – und auch die Füße. Aber ins Affenhaus mußten wir noch unbedingt hinein.
Offenbar konnte uns der Gorilla nicht leiden. Er sah uns kommen und drehte sich gähnend um. (Wahrscheinlich kennt er Menschen aus dem Fernsehen.)
Die Schimpansen, Gibbons und Kapuzineräffchen dagegen waren richtig nett zu uns. Sie zeigten alles, was sie konnten, und sie konnten viel!
Sechs und Vier riefen hingerissen: »Guck mal, Tante, nein, wie süß!«
Das fand ich auch und meinte die Schimpansenmutter, die mit unendlicher Geduld und Zartheit das erste Stangenklettern ihres Babys überwachte.
Sechs und Vier hingegen meinten einen unscheinbaren, spillrigen Spatz, der zwischen den Besucherbeinen umhertippelte.
Daheim in ihrer Straße hätten sie ihn kaum beachtet.
Aber hier – zwischen all den exotischen Tieren – hatte er seine Bedeutung: Er war für die Kinder eine Handvoll heimischer Vertrautheit. Genau wie die Meerschweinchen und der Bagger.
Nach diesem Zoobesuch wundert es mich gar nicht mehr, daß deutsche Touristen in Süditalien so selig sind, wenn sie einem Würstchenstand begegnen.
Ich hau den Kasten noch mal kaputt!
Ich war natürlich dagegen, daß der Junge fernsieht. Ich wollte es ihm auf keinen Fall erlauben. Ich war auch mal gegen harte Bonbons, Pistolen, Anbrüllen und Hunde im Kinderbett – mit demselben Resultat.
Philip war ein mühsames Kind. So renitent. So unerschöpflich im Nervensägen. Ein Kind, das sich gegen alles wehrte – nur nicht gegen Fernsehen.
Wenn er vorm Fernseher saß, hatten wir wenigstens eine Stunde am Tag Ruhe vor ihm.
So kam es, daß er das Lied vom schmeichelnd tönenden Haarshampoo früher kannte als Müllerslust und bereits mit vier die überzeugende Waschkraft von Persil. Als er uns aber eines Abends mit der Feststellung »Dieser Käse hat ein erlesenes Bouquet« verblüffte, war Schluß. Wir strichen ihm das Werbefernsehen, aus dem er seine gewählte Ausdrucksweise bezog.
Wir hätten ebensogut dem Hund nach fünf auf dem Sofa verbrachten Jahren das Liegen auf dem Sofa verbieten können. Der Sohn klagte auf Gewohnheitsrecht. Wir durften ihm nicht nehmen, was wir ihm bisher aus Selbsterhaltungstrieb gestattet hatten.