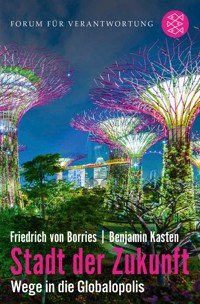14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Managerin Cornelia bittet den Kurator Florian, für die »Stiftung Nachhaltigkeit der Deutschen Industrie« ein Museum für ökologische Kunst zu entwickeln. Wie sähe ein Leben aus, das – im ökologischen Sinne – möglichst folgenlos bleibt?
Florians Projekt bringt ihn mit der Künstlerin Lisa zusammen, die Bäume pflanzt, um daraus Holzkohle für ihre Installationen und Zeichnungen herzustellen – und damit in ihren Kunstwerken CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Er trifft John, der als radikaler Öko-Aktivist gegen die Kohleindustrie und die Abholzung des Goldbacher Forstes kämpft, den Flüchtling Issa, der Florians Selbstgewissheiten hinterfragt, die frustrierte PR-Frau Suzanna, die für die EU Umweltpolitik macht, aber lieber Bienen züchten will, und den Bergmann Ronald, der Sorge um seinen Arbeitsplatz hat. Selbstüberschätzung trifft auf Lebensangst, Verzweiflung auf Hoffnung, Aktivismus auf Gewalt. Unerwartete Beziehungen entstehen, die im verschwenderischen »Fest der Folgenlosigkeit« ihren explosiven Höhepunkt finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Friedrich von Borries
Fest der Folgenlosigkeit
Roman
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Fest der Folgenlosigkeit
1 John sitzt am Lagerfeuer; Anka verdrängt ihre Erinnerungen; ich führe Adler und Drache ein
2 Florian und Lisa lernen sich im Zug kennen; sie zeigt ihm ihren »geheimen Wald«
3Bent ordnet sein Vermächtnis und setzt Cornelia und Bernd in ein unangenehmes Konkurrenzverhältnis
4 Suzanna Schnejder denkt über die Freiheit der Kunst nach und ärgert sich über Florian
5 Florian lernt das Center for Climate Justice kennen; die Jury wählt vier Stipendiaten aus
6 Cornelia kämpft im Aufsichtsrat um ihre »Vision 2030/2050«; es fällt die Entscheidung für eine »Stiftung Zukunft: für Kunst und Nachhaltigkeit«
7Florian besucht den Goldbacher Wald, ich erkunde den Hambi
8Die Stipendiaten lernen sich kennen und erkunden Meuws; die Idee für eine gemeinsame Aktion entsteht
9Die Stipendiaten organisieren eine Protestaktion; Cornelia muss improvisieren; und Florian erhält ein unanständiges Angebot
10 Auf Meuws wird über Kunst und Wahrheit diskutiert; Lisa hat einen Albtraum; Florian trifft eine Entscheidung
11Während Florian den Workshop auf der Insel Meuws abhält, lernen sich im Goldbacher Wald Anka und Cornelia kennen
12Lisa und Florian gehen ins Museum; Lisa weiß, dass sie schwanger ist, sagt Florian aber nichts
13Florian fährt zu Mikael Mikael und hat die Idee für ein »Museum für ökologische Kunst«
14Suzanna Schnejder teilt Florian mit, dass das Kunstprojekt der AFED abgebrochen wird
15Cornelia Stohmann veranstaltet ein Sponsorendinner, auf dem Florian seine Ausstellungsidee vorstellt; es kommt beinahe zum Eklat
16Cornelia trifft in Kopenhagen die Architektin Johanna Semmen; ich beginne zu gendern
17 Florian trifft Heike Waldmüller und stellt ihr seine Idee für eine Ausstellung über »Wald« vor; Issa ist von der Idee nicht überzeugt
18Lisa erzählt Florian immer noch nicht, dass sie schwanger ist; die Polizei räumt das Camp im Goldbacher Wald; John stirbt drei Tode
19Johns Tod ist wie ein klärendes Gewitter, er bringt Bewegung in festgefahrene Positionen
20Bent hält eine Beerdigungsrede; weder Cornelia noch Anka werden die Wahrheit erfahren
21 Issa zweifelt den Sinn der »Wald«-Ausstellung an und bringt die Folgenlosigkeit ins Spiel
22 Issa tritt bei
The Message
auf und lernt dort die Visagistin Doreen kennen; er gewinnt nicht, aber die Idee von Folgenlosigkeit verbreitet sich trotzdem
23 Florian und Lisa schauen
The Message
; Lisa sagt Florian, dass sie abtreiben wird; Florian hat einen merkwürdigen Traum
24Florian baut die Ausstellung auf; Ronald schüttet einen Berg Kohle vor das Museum; die Presse findet das interessant
25 Florian feiert ein Fest der Folgenlosigkeit; Bent verliest Bernds Testament
26 Issa erklärt die Schule der Folgenlosigkeit; die Jury trifft eine Entscheidung
27 Ich bin endlich am Ende des Romans angekommen; Florian schreibt einen Brief
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Fest der Folgenlosigkeit
Kann Folgenlosigkeit ein Ideal sein, wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit – unerreichbar, aber doch erstrebenswert? Oder muss das Denken über Folgenlosigkeit selber folgenlos bleiben?
Issa
Die Ästhetik des Unterlassens: Das Nicht-tun wird zur wichtigsten Handlung.
Bazon Brock
Lose, Lose, Lose – Leute, kauft euch Folgenlose! Hier könnt ihr gewinnen: keine Klimaerwärmung, keine Ungerechtigkeit, Zero-Emission und als Hauptgewinn: kein Weltuntergang. Macht mit bei der großen Folgenlos-Tombola und gewinnt: NICHTS!!!
Hannes von Coler
1
John sitzt am Lagerfeuer; Anka verdrängt ihre Erinnerungen; ich führe Adler und Drache ein
John hielt einen Ast ins Feuer und steckte sich eine Zigarette an. »Die werden versuchen, uns hier rauszukriegen. Und dann werden sie alles zerstören, damit wir nicht wiederkommen.«
Er blickte in die Runde. Die meisten kannte er, denn sie waren schon lange im Wald. Drei Neuankömmlinge, die er noch nicht kannte. Und die Frau, die die Presse machte. Er hatte schon öfter mit ihr gesprochen, aber ihren Namen vergessen.
John war nicht von Anfang an dabei gewesen, sondern erst vor einem Jahr zu den Waldbesetzern gestoßen. Vor drei Jahren hatte eine kleine Gruppe radikaler Umweltschützer den Wald in der Nähe von Goldbach, einem kleinen Dörfchen in der Lausitz, besetzt, was auch immer besetzen heißen mag, aber so nannten sie das, in Anlehnung an die Berliner Hausbesetzerszene, in der einige der Älteren aus der Gruppe früher aktiv gewesen waren. Sie waren im Wald, um, wie sie sagten, als lebende Schutzschilde die Bäume vor dem angrenzenden Tagebau zu schützen. Sie hatten Baumhäuser gebaut, dann Seilbrücken und Plattformen zwischen den Bäumen.
»Der Wald ist keine Goldgrube« war ihr Slogan, später kamen noch »Gold ist für alle da« und »Goldi bleibt« dazu. »Goldi bleibt« wurde schließlich zum Namen der Bewegung. Mit Unterstützung von Sympathisanten hatten sie eine Webseite aufgebaut. Auch in den sozialen Medien war »Goldi bleibt« aktiv: Die Waldbesetzer posteten Bilder ihrer Baumhäuser, berichteten von den Übergriffen der Polizei und baten um Sachspenden – Baumaterialien, Decken, Schlafsäcke, Essen. Mit der Zeit wuchs ein Unterstützerkreis, und mehr und mehr Umweltschützer kamen in den Wald. So war in den letzten drei Jahren eine Vielzahl von Baumhäusern entstanden, regelrechte kleine Siedlungen, die Fantasienamen wie Peacetown und Anarcho-Village trugen.
Insgesamt hundert Baumhäuser gab es, in denen rund 300 Menschen wohnten, im Sommer mehr als im Winter. Jetzt, zu Beginn des Frühlings, füllte der Wald sich wieder. Jede Siedlung hatte einen eigenen Charakter. Es gab eine mit Stacheldraht geschützte kleine Trutzburg, in der die Anarchos hausten, es gab die mehrstöckigen Konstruktionen der Hippiekommunen, mit großen, offenen Balkonen, Schrebergartenhütten auf Bäumen, in denen Familien mit kleinen Kindern wohnten, und es gab eine Gruppe von Baumhäusern, die nur Frauen offenstanden. Manche Besetzer hießen Besucher willkommen, zeigten ihnen den Wald, andere schotteten sich ab. Jede Gruppe organisierte sich selbst und gab sich eigene Regeln. Im Wald war ein kleines anarchisches Paradies entstanden, eine bunte Mischung sehr unterschiedlicher Menschen, die Autonome aus ganz Europa genauso anzog wie Öko-Aktivisten und Aussteiger aus der Region.
Diese Geschichte hat mit Nachhaltigkeit und Ökologie zu tun, mit Kapitalismus und mit Protest und natürlich auch mit Kunst; einer Kunst der Folgenlosigkeit, der Kunst, Dinge einfach sein zu lassen – und der Fähigkeit, zu wissen, wann Handeln dennoch nötig ist. Ich will von Menschen erzählen, die versuchen, ein möglichst folgenloses Leben zu führen, was auch immer das ist. Und von denen, die sich dagegen wehren.
Dafür brauche ich Protagonisten, die unterschiedliche Entwicklungen durchlaufen, in Konflikte mit sich selbst und miteinander geraten. Lisa und Florian, John und Bernd, Cornelia und Issa – und viele mehr.
Ich bin weder John noch Florian oder sonst jemand in diesem Roman. Ihre Erlebnisse sind nicht die meinen und meine nicht die ihren. Ob sie den Adler und den Drachen kennen, weiß ich nicht. Aber mich verbindet eine – schmerzhafte – Erfahrung mit den Figuren dieses Romans: das Scheitern. Lange habe ich geglaubt, einen Beitrag zur Verbesserung unserer Gesellschaft leisten zu können. Besonders erfolgreich bin ich dabei bislang nicht gewesen.
Zwei Regeln galten im ganzen Wald: Fremden nicht das Gesicht zeigen und niemandem, wirklich niemandem seinen echten Namen verraten. Wann immer möglich, Kapuze runterziehen, besser noch: Sturmhaube oder Strumpfmaske auf. Das, so die Überzeugung der Waldbewohner, schützte alle, denn wessen Namen man nicht kennt, dessen Namen kann man nicht verraten. Schließlich waren sie nicht ohne Grund hier im Wald. Sie führten einen Kampf, einen Kampf gegen einen übermächtigen Feind. Und sie hatten ein Ziel.
Der Feind war NEO, der große Energieversorger, und Ziel des Kampfes war, die drohende Rodung des Waldes am Goldbach zu verhindern. Etliche Gerichtsprozesse hatte es gegeben, diverse vom Aussterben bedrohte Tierarten wurden angeführt, um die Rodung zu verhindern, aber NEO hielt sich nicht immer an die Vorgaben, schaffte Tatsachen, indem bei Nacht und Nebel Waldstücke gerodet wurden. Und deshalb hatten die Waldbewohner die Baumhäuser gebaut, um vor Ort zu sein, aufzupassen, Widerstand zu leisten.
Natürlich war NEO nicht der einzige Feind. Die Verantwortung für illegale Rodungen schob der Stromerzeuger seinen Subunternehmen zu, und einer der wichtigsten Akteure dabei war RMW. Die Firma produzierte nicht nur die gigantischen Schaufelradbagger, mit denen die Kohle abgebaut wurde, sondern stellte auch die Sicherheitsleute – die Sekis, wie sie von den Waldbewohnern genannt wurden. Und dann war da natürlich noch die Polizei, die ab und an im Wald auftauchte. Diese übermächtige Phalanx an Feinden und das übergeordnete Ziel einten die Bewohner, je stärker der Druck von außen, desto größer das Zusammengehörigkeitsgefühl.
Immer wieder kam es zu Konflikten. Die Waldbesetzer sabotierten den Tagebau, blockierten die Bagger und bewarfen die Autos der Sekis mit Steinen. Die Sekis griffen Waldbewohner auf und übergaben sie der Polizei, mit der Begründung, sie hätten unerlaubt das Gelände von NEO betreten. Anzeigen wegen Haus- und Landfriedensbruch waren die Folge.
John zeigte mit seinem Arm auf die zwanzig Baumhäuser, die sich im Wald rings um das Lagerfeuer verteilten. »Das wird alles zerstört werden. Und alle anderen Siedlungen auch. Es sei denn, wir kämpfen. Wir müssen uns endlich richtig zur Wehr setzen. Ich kenne die. Die sind nicht kompromissbereit.«
»Woher kennst du die denn?«, fragte die Pressefrau.
Anka war eine der Wochenendaktivisten. Unter der Woche ging sie einem »bürgerlichen« Leben nach, von Freitagnachmittag bis Sonntagabend war sie im Wald, um hier die Welt zu retten. Viele der vor allem älteren Unterstützer schliefen nicht im Wald, schon allein, weil das Klettern in die Baumhäuser anstrengend und für den Gleichgewichtssinn herausfordernd war. Außerdem vermissten manche, die über Jahre einen gewissen Komfort gewohnt waren, dann doch recht schnell die Toilette, das fließende Wasser, den Stromanschluss. John mochte die Teilzeitbesetzer nicht, aber er wusste, dass die Bewegung Menschen wie sie brauchte, weil sie eine wichtige Brücke waren, eine Verbindung zur Welt da draußen.
»Mein Vater arbeitet da«, antwortete er, »ich bin damit groß geworden.«
Einige in der Runde schauten erstaunt auf.
»Dein Vater arbeitet bei NEO?«, fragte einer der Neuen, die John noch nicht kannten.
»Hey, keine Namen, keine Strukturen«, rief ein anderer dazwischen.
»Dann machst du hier jetzt so einen familiären Protest? Spätpubertäre Ablösung, oder was?«, fragte die Frau.
John betrachtete sie eingehender. »Wie heißt du nochmal?«, fragte er sie.
»Anka, das weißt du doch. Du bist John, wir hatten schon miteinander zu tun.«
»Ich merk mir keine Namen. Sorry. Wie bist du hier gelandet?«
Sie warf einen Stock ins Feuer. »Ich würde mal sagen: soziale Verantwortung. Kann ja so nicht weitergehen. Und ihr alleine«, sie schaute in die Runde, »ihr alleine schafft das nicht. Nur Abenteuercamp reicht nicht.«
John schüttelte den Kopf. Innerhalb der Bewegung gab es Streit über den richtigen Weg. Manche setzten auf Kooperation, versuchten, die Menschen in den umliegenden Dörfern für gemeinsame Aktionen gegen die Rodungen zu gewinnen, setzten auf ein Einlenken seitens NEO. Andere glaubten, dass das nur einen kurzfristigen Erfolg bringe, mediale Sichtbarkeit, die dann wieder verpuffte. Sie sahen den Wald als Keimzelle für einen viel grundlegenderen Widerstand. Auch John hatte die Hoffnung aufgegeben, mit NEO eine friedliche Einigung zu erzielen. Er glaubte, dass es zu einer Lösung nur durch einen gewaltsamen Konflikt kommen konnte – den die Waldbesetzer zwar verlieren würden, bei dem sie aber NEO oder wenigstens RMW mit in den Abgrund reißen würden. Auf jeden Fall würden sie ein Zeichen setzen, das andere ermutigte, den Weg des Widerstands weiterzugehen. Er war sich sicher, dass die nächste Eskalationsstufe kurz bevorstand; ihm war aufgefallen, dass in den letzten Wochen immer mehr Polizisten am Waldrand aufgetaucht waren, nicht um die Besetzer zu kontrollieren, sondern um das Gelände zu sondieren.
Die Art, wie John sprach, erinnerte Anka an jemanden, Bilder kamen hoch, die sie nicht einordnen konnte. Sie schob die aufkommenden Erinnerungsfetzen schnell beiseite und konzentrierte sich auf den Inhalt von Johns Worten. Seine Analyse stimmte. Die lokale Bevölkerung war gespalten. Ein Teil unterstützte die Besetzer, es gab Solidaritätsdemos und Leute, die Essen und Getränke brachten, Baumaterialien abluden oder manchmal auch ganz praktisch mitbauten. Es hatte Demos mit mehr als 20000 Teilnehmern gegeben, die friedlich durch den Wald liefen, um gegen dessen Zerstörung zu demonstrieren. Aber es gab auch andere Stimmen. NEO war der größte Arbeitgeber in der Region, RMW der zweitgrößte, und viele fürchteten um die Arbeitsplätze, die verloren gingen, falls der Tagebau eingestellt werden sollte.
John sog an seiner Zigarette und schnippte die Asche ins Feuer. »Wir müssen Barrikaden bauen. Damit die Bullen nicht mit ihren Räumfahrzeugen reinkommen. Große Barrikaden.«
Barrikaden, Symbole des Aufstands. Seit Jahren beschäftigte John sich mit diesem Thema. Paris 1830, Julirevolution, Aufstand der Machtlosen. Sie füllten Fässer mit Erde, türmten sie übereinander, um sich vor den Kugeln des Militärs zu schützen. Architekturen des Widerstands. Er hatte die Barrikaden, die er im Wald bauen wollte, genau im Kopf, sogar schon erste Zeichnungen angefertigt. Seit Tagen zog er durch den Wald, um mit den verschiedenen Gruppierungen der Waldbewohner zu reden. Sie waren nicht hierarchisch organisiert. Vieles passierte spontan. Aber Spontaneität, dachte John, kann man steuern, wenn man eine kritische Masse an Mitstreitern hat. Wenn ich aus jeder Siedlung nur zehn Leute begeistere, dann reicht das. Wenn wir gemeinsam anfangen, Barrikaden zu bauen, entfaltet sich eine Dynamik, die alle mitreißt. An jedem Zufahrtsweg in den Wald wollte John große Sicherungsarchitekturen bauen, aus alten umgefallenen Bäumen, die hier zuhauf rumlagen, aus Europaletten und natürlich auch aus Stacheldraht.
»Wenn wir uns nicht verteidigen, reißen die Bullen alle Baumhäuser in einer Nacht ab. Dann kommt am nächsten Tag die Presse, und alles ist weg. Wenn es uns gelingt, einen Angriff so rauszuzögern, dass es zwei, drei Tage dauert, dann haben wir eine Chance. Bilder von brennenden Barrikaden. Bilder von Menschen, die sich an Bäume ketten. Bilder von Bullen, die junge Waldbewohnerinnen schlagen. Wir brauchen hässliche Bilder von der Polizei, dann ist die öffentliche Stimmung auf unserer Seite, und die Polizei muss wieder abziehen. Asymmetrische Kriegsführung. Oder, Anka, so läuft das doch?«, brüllte John.
Am Lagerfeuer wurde es still. John sah Anka herausfordernd an. Erinnerungen an Gewalt und Ohnmacht, an Verzweiflung und Angst kamen in ihr hoch. Und plötzlich brach es aus ihr heraus. »Nein«, schrie sie, »so ist es nicht.«
2
Florian und Lisa lernen sich im Zug kennen; sie zeigt ihm ihren »geheimen Wald«
Florian war auf dem Weg nach Cottbus. Ein Termin bei der Europäischen Agentur für Umweltgestaltung, einer Einrichtung der EU, die der Diskussion um Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimawandel eine neue Richtung geben sollte. Oder, wie es auf der Webseite der Agentur stand: »Wir müssen Umwelt nicht nur schützen, sondern auch neu gestalten.« Schwerpunkt waren dabei die ästhetischen Fragen, die sich bei der Renaturierung von Industriebrachen und Tagebaulandschaften, beim Rückbau von Atomkraftwerken, bei der Errichtung von neuen Hochwasserschutzanlagen, Solarparks und Windkraftanlagen (an Land genauso wie offshore), aber auch bei der Einlagerung von CO2 stellten. Die wissenschaftliche Erforschung und technische Entwicklung derartiger Maßnahmen war die Aufgabe anderer Einrichtungen, bei der AFED, wie die Agentur ihrem englischen Namen Agency for Environmental Design entsprechend abgekürzt wurde, wurden die technischen und ökonomischen Aspekte zusammengeführt und mit der ästhetischen Dimension verknüpft: Wie sieht die vom Menschen gestaltete Umwelt der Zukunft aus? Man hätte dieses Thema für eine Nischenproblematik halten können, aber die EU-Kommission war zu der Ansicht gekommen, dass genau diese Frage erheblich zur Akzeptanz von Umweltschutz- oder, wie man inzwischen lieber sagte, Umweltgestaltungsmaßnahmen beitrage.
Florian hatte als externer Experte den Auftrag erhalten, für die AFED eine Ausstellung zu kuratieren. Ein Stipendium für Künstler war dafür von der Agentur bereits ausgeschrieben worden, vier Wochen Arbeitsaufenthalt beim Center for Climate Justice, einer auf der idyllischen kleinen Ostseeinsel Meuws angesiedelten Einrichtung der AFED. Eine präzise inhaltliche Ausrichtung hatte die Ausschreibung nicht, was Florian für falsch hielt, die Freiheit der Kunst, so seine Erfahrung, wird oft mit Unbestimmtheit verwechselt, was letztlich zu inhaltlicher Beliebigkeit führt und Kunst zu Dekoration reduziert, statt ihr kritisches Potential zu fördern. Für derartige Diskussionen war es nun zu spät, aus Sicht der Agentur – oder vielmehr aus Sicht von Suzanna Schnejder, die das Projekt seitens der Agentur betreute – gab es nur noch administrative Fragestellungen zu klären, zum Beispiel Ablauf und Sitzordnung der Jurysitzung. Und dafür stand ein Vorbereitungsgespräch an.
Florian hatte sich nicht mit Suzanna Schnejders Vorschlag für den Zeitplan beschäftigt. Der Zeitplan interessierte ihn nicht, ihn interessierten die Menschen, die sich für das Stipendium beworben hatten, oder, um genau zu sein: deren künstlerische Arbeiten. Er blätterte in den Aktenordnern, die er von der Agentur zugeschickt bekommen hatte, vollgestopft mit Motivationsschreiben, Arbeitsproben, Lebensläufen, Projektideen. 147 Bewerber für vier Stipendien. Stipendien waren für Künstler besonders am Anfang ihrer Karriere wichtig. Stipendien bedeuteten Geld und Reputation. Manchmal waren sie mit der Möglichkeit verbunden, etwas auszustellen, was in der Logik der Kunstwelt wieder zu mehr Reputation und in der Folge zu mehr Stipendien und mehr Ausstellungsmöglichkeiten führte. Folgenlos waren Stipendien nur für diejenigen, die keines bekamen.
Überall war es das Gleiche: Auf eine Person, die sich über ein Stipendium, einen kleinen Kunstpreis freute, kamen über vierzig Menschen, die nur ein unpersönliches Absageschreiben erhielten. Das ganze System war auf Erfolg und Konkurrenz ausgerichtet. »Wir danken für Ihre Mühen … unter der Vielzahl qualifizierter Bewerber … wir bitten, von Nachfragen abzusehen …« Scheißsystem, dachte Florian, es produziert mehr Enttäuschung, als dass es Sinn stiftet. Aber, auch das musste Florian im Laufe des Prozesses lernen, die Agentur hielt wettbewerbsbasierte Verfahren – so der Begriff – für transparent, folglich für demokratisch, und deshalb war es ihr wichtig, in alle Entscheidungsprozesse möglichst viel »Wettbewerb« einzubinden. Er überflog die Exposés. Weckte etwas seine Aufmerksamkeit, schaute er es sich genauer an, ansonsten blätterte er weiter.
Die Agentur war kein Ort der Kunst. Auch wenn der Name »Agentur« zum Ausdruck bringen wollte, eine moderne Organisation zu sein, war die AFED letztlich eine traditionelle Behörde. Die Freiräume, die Kunst braucht, gab es dort nicht.
All das wäre für Florian Grund genug gewesen, die Finger von dem Ausstellungsprojekt zu lassen. Aber er fand es wichtig, gerade in diesem Kontext ein Konzept zu entwickeln, das »weh tat«, und damit zu vermeiden, dass – wie es bei politisch motivierter Kunstförderung leider häufig ist – die Ausstellung am Ende nur die institutionellen Interessen der initiierenden Einrichtung widerspiegelte.
Natürlich hatte es für das Projekt eine offizielle Ausschreibung gegeben, mit einem transparenten Bewertungssystem – Konzept, Erfahrung und Kosten, für alles wurden Punkte vergeben, auf deren Basis dann die Vergabeentscheidung getroffen werden sollte. Dennoch hatte es hier und da ein informelles – und durchaus sympathisches – Gespräch mit Suzanna Schnejder gegeben, was bei ihm den Eindruck erweckt hatte, dass die AFED oder zumindest die Leiterin des Kunstprojekts mit ihm zusammenarbeiten wollte. Zudem hatte sie ihm in den Vertragsverhandlungen alle künstlerische Freiheit zugesichert.
Im Rückblick war ihm aber völlig unverständlich, warum sie ihn als Kurator ausgesucht hatte, da sie im weiteren Verlauf seine Arbeit nicht unterstützt, sondern letztlich verhindert hatte. Vielleicht lag es daran, dass Institutionen nicht so leicht aus ihrer Haut können und, was Abweichungen von ihren Routinen anbelangt, unglaublich träge sind. Das merkte Florian aber erst, nachdem er den Vertrag unterschrieben hatte. Die hierarchischen Gepflogenheiten der Institution drohten die versprochene künstlerische Freiheit aufzulösen: hier noch eine unbedingt erforderliche »Freigabe« durch eine übergeordnete Stelle in der EU-Kommission, dort eine »Steuerungsrunde« mit externen Experten, die natürlich nicht von Florian, sondern von der Agentur ausgewählt werden sollten. Florian befand sich in einem fortwährenden Aushandlungsprozess zwischen der künstlerischen Freiheit, die ihm wichtig war, und dem Kontroll- oder zumindest Teilhabebedürfnis der Agentur. Was es bedeutete, dass Suzanna Schnejder in der Agentur nicht nur für Kunst, sondern auch für PR zuständig und dass das Kunstprogramm der Abteilung »Marketing und Öffentlichkeitsarbeit« zugeordnet war, hatte Florian zuvor nicht durchschaut.
Dass er eine Vorbesprechung zwei Wochen vor der Jurysitzung unnötig fand, hatte Florian Suzanna Schnejder in einem Telefonat ausführlich erläutert – leider ergebnis- und folgenlos. Suzanna Schnejder bestand darauf, zu besprechen, was auf der Jurysitzung zu erwarten sei; eine Art Absicherungsgespräch, das Florian schließlich aus Höflichkeit und (aller behaupteten künstlerischen Freiheit zum Trotz) Abhängigkeit schlecht verweigern konnte.
So wollte er die anderthalbstündige Zugfahrt von Berlin nach Cottbus zumindest nutzen, um die Bewerbungen durchzusehen. Beim Blättern in den Portfolios verfestigte sich sein Eindruck, dass Künstler, deren Arbeit politisch motiviert war, zuweilen die formale Durcharbeitung vernachlässigten. Das galt natürlich nicht für alle Bewerber, aber für viele. Als würde es reichen, die Welt retten zu wollen, dachte er. Man sollte sich auf seinen guten Absichten nicht ausruhen. Idealismus führt eben nicht zwangsläufig zu guter Kunst.
Florian hatte das Projekt aber noch aus einem anderen Grund zugesagt, und das war sein Vater. Sein Vater war schon seit zwanzig Jahren tot, sie hatten sich nie besonders verstanden, nicht weil sie im Streit gewesen wären, sondern weil sie in verschiedenen Welten gelebt hatten. Florians Vater hatte im Umweltbundesministerium gearbeitet, er war Naturwissenschaftler gewesen, und mit den künstlerischen Fragestellungen, die Florian beschäftigt hatten, nichts anfangen können. Nun erschien es Florian, als ob das Projekt der AFED quasi post mortem eine Brücke schlagen könnte.
Diese Geschichte ist auch eine Geschichte über mich. Nicht direkt, sondern nur indirekt. Ich habe den Figuren ein paar Erfahrungen geliehen – ein Vorgang, den ich da, wo er passiert, als solchen offenlege. So hat auch mein Vater im Bundesumweltministerium gearbeitet. Und ich habe im Auftrag des Umweltbundesamtes ein Projekt über Kunst und Nachhaltigkeit durchgeführt, bei dem ich – allerdings mit wenig Erfolg – versucht habe, »Folgenlosigkeit« zu thematisieren. Immerhin ist dabei ein Film entstanden – Die Kunst der Folgenlosigkeit –, und auch die Idee für diesen Roman habe ich dort vorgestellt und mit den Beteiligten diskutiert.
Das Thema »Folgenlosigkeit« begleitet mich aber schon viel länger, eigentlich schon seit meiner Kindheit. Die Folgenlosigkeit meiner Kindheit war kein »Fest«. Sie war eine Qual. Ich habe meinen Vater vor Augen, wie er abends vor dem Radio sitzt, Nachrichten hört und sich Notizen macht, unleserliches Gekrakel auf kleinen Zetteln, die überall im Haus herumflogen. Warum? Wofür? Vielleicht hatten die Zettel für meinen Vater den Sinn, die eigene Existenz zu manifestieren. Für mich waren diese Zettel – und sind es rückblickend immer noch – der Inbegriff von unerfüllten Erwartungen: einer Form von Folgenlosigkeit, die ich nie erstrebenswert fand.
Diese Geschichte erzählt auch ihre Entstehungsbedingungen. Das ist mir wichtig, weil eine Geschichte nicht von alleine entsteht. Andere Menschen sind beteiligt – sowie der Drache und der Adler, zwei Begleiter, die ich mir nicht ausgesucht habe, mit denen ich mich aber abgeben muss.
Ob Florian seinen Vater geliebt hatte? Als Kind bestimmt. Für seine Empfindungen als Jugendlicher und Erwachsener war Liebe ein zu großes Wort. Gemocht? Bestimmt nicht. Gehasst? Auch nicht. Es gab kein Gefühl, das ihn mit seinem Vater verband. Es war einfach – nichts. Erinnerungen an einige wenige schöne Momente und einige wenige unangenehme; eine Geburtstagsfeier, Arbeit im Garten, Mathe für die Schule lernen, eine gemeinsame Reise. Aber alles fühlte sich seltsam leer an. Die positivste Erinnerung an seinen Vater war das Zucken der Augenbrauen, das das seltene Lächeln begleitete. Er versuchte, sich an das Lachen seines Vaters zu erinnern, aber es kam nichts. Hatte er nie gelacht? Bei seiner Mutter war er sich sicher, dass sie nie gelacht hatte, bei seinem Vater schlummerte irgendwo eine Erinnerung, die er nicht konkretisieren konnte. Wofür auch? Gefühle für seinen Vater würde er auch durch dieses Projekt nicht entwickeln können.
Eine Durchsage riss ihn aus den Gedanken, und er nahm wieder den Aktenordner mit den Bewerbungen in die Hand. Bei einer Bewerbung blieb er hängen, nahm die Mappe aus dem Ordner und begann zu blättern. Aggressive Kohlezeichnungen, dazu Fotos aus einem Wald und Fotos, auf denen nichts zu erkennen war außer einer krisseligen, unregelmäßig strukturierten schwarzen Fläche, deren Materialität Florian nicht identifizieren konnte. Das skizzierte Arbeitsvorhaben überflog er nur, irgendwas mit CO2-Speicherung; klar, ein Umweltthema musste es ja sein, wenn das Stipendium von der AFED ausgeschrieben war. Letztlich interessierte ihn das nicht besonders, er fand die Qualität der Zeichnungen wichtiger, die abgefragten und entsprechend eingereichten Absichtserklärungen entsprachen meist eh nicht dem, was am Ende herauskam, und sie sagten auch wenig über die Fähigkeiten des jeweiligen Bewerbers aus. Stattdessen las er den Lebenslauf durch. Lauter Arbeitsstipendien, einige residencies, Preise, der liebe Gott scheißt immer auf den gleichen Haufen, ging es ihm durch den Kopf, aber eben nicht ohne Grund. Er kramte die Liste mit den Einreichungen hervor und zeichnete ein Plus hinter den Namen, das erste in der langen Liste.
»Darf ich«, fragte die Frau, die ihm gegenübersaß, und nahm, ohne seine Antwort abzuwarten, den zuoberst liegenden Ausdruck in die Hand. »Und, wie finden Sie das?«
»Gut. Interessant. Nicht zu Ende entwickelt. Die Künstlerin ist auch noch jung. Ungefähr so alt wie Sie, vermute ich. Interessieren Sie sich für Kunst?«, fragte er.
»Ein bisschen, ja, jedenfalls genug, um selbst zu zeichnen.«
Eine Liebesgeschichte.
Warum?
Weil ich die Vermutung habe, dass eine Liebesgeschichte berührender ist als eine Erzählung über Kunst und Nachhaltigkeit. Es gibt noch einen anderen Grund, der viel wichtiger ist, weil er zum positiven Kern der Folgenlosigkeit führt: Könnten wir uns darauf einigen, dass es in der Liebe keinen Erfolg gibt?
Lisa liebte das Leben in der Stadt, aber sie liebte auch die Natur. Doch auch wenn sie mit John an vielen Aktionen von Ende Gelände in der Lausitz teilgenommen hatte, bezeichnete sie sich nicht als Umweltaktivistin. John hingegen war in ihren Augen ein richtiger Klimakämpfer. Ihre Leidenschaft war die Kunst. Sie hatte in Hamburg studiert, war dann nach Berlin gegangen, weil Berlin die deutsche Kunstmetropole war. London und New York hatten sie auch interessiert, irgendwie hatte sie nicht den Absprung geschafft, immer gab es einen Grund zum Bleiben; entweder eine Ausstellung, für die sie noch was vorbereiten wollte, oder eine Beziehung, die gerade angefangen hatte, oder eine, die gerade zu Ende zu gehen drohte. Natürlich waren das immer Ausflüchte gewesen, aber das wurde ihr erst nach und nach klar. Und selbst dann freute sie sich über jeden Vorwand, ihr Berliner Kunst-Habitat nicht verlassen zu müssen. Irgendwann hatte sie sich einfach damit abgefunden, nicht mehr die Welt zu erobern, oder, um es positiver auszudrücken: Sie hatte sich in ihrem Leben in der Berliner Bohème gemütlich eingerichtet.
Zu diesem Leben gehörte ein Ort, der ihr ganz eigener war, ein Stück Wald, das sie von ihrem Großvater geerbt hatte. Ungefähr dreißig Hektar, aber versteckt, abseits von allen Siedlungen und Infrastrukturen. Dem Untergang geweiht, davon ging sie aus, denn es lag in unmittelbarer Nähe der Tagebaugebiete, und irgendwann würde auch ihr kleines Stück Wald von den Braunkohlebaggern aufgefressen werden. Aber bis dahin war dieses Stück Wald ihr »Kraftort«, wie sie sagte. Hierhin zog sie sich zurück, wenn sie arbeiten wollte. Und der Ort war, in ganz materieller Hinsicht, Teil ihrer Arbeit.
Schon im Studium hatte sie fast nur gezeichnet, wobei sie Zeichnung sehr weit fasste; für sie war alles Zeichnung, was irgendwie aus Strichen und Linien bestand. Für sie war ein Baum eine Zeichnung, ein Wald und auch eine Wiese. Und wenn sie zu ihrem Wald fuhr, betrat sie eine Zeichnung, sie wurde ein Teil davon. Im Wald machte sie Fotos, die sie zerschnitt und dann wieder neu zusammenfügte, aus dem Wald schleppte sie Säcke mit Erde und Reisigbündel und Holzscheite in ihr Atelier, alles Material, aus dem sie ihre »Zeichnungen« machte.
Vor einem Jahr hatte sie ein neues Arbeitsmaterial entdeckt, nein, wiederentdeckt. Schon seit langem zeichnete sie mit Kohle, was natürlich nichts Besonderes war, fast jeder Künstler hat irgendwann einmal mit Kohle gezeichnet, in der ganzen Kunstgeschichte wimmelte es von Kohlezeichnungen, ganze Museen waren vollgestopft mit Kohlezeichnungen, aber Lisa, und das war etwas Besonderes, machte ihre Kohle selbst. Sie verwandelte ihren Wald Stück für Stück in Holzkohle. Kohle, mit der sie zeichnete, Kohle, die für sie selbst Zeichnung war. Und so, wie sie mit dem Wald zeichnete, wurde der Wald, den sie eh schon als Zeichnung verstand, zu ihrem Kunstwerk, einer von ihr »gezeichneten« Installation aus Erde und Holz und – vor allem – aus Kohle.
Sie sah Florian an, erkannte in seinem Gesicht Erstaunen und spürte eine gewisse Genugtuung darüber. Er war so in seine Unterlagen vertieft gewesen, dass er sie nicht bemerkt hatte. Sie hielt die Bewerbung in der Hand, ohne Anstalten zu machen, hineinzuschauen, warum auch, sie kannte sie ja schon.
Er streckte die Hand aus, als wollte er die Mappe zurückfordern, sagte aber nichts.
»Sie sind Florian Booreau?«, fragte sie.
Er schaute sie eine Zeit lang an. »Ist das ein Zufall?« Dann nahm er ihr die Mappe aus der Hand. »Sie sind«, er blätterte in den Unterlagen. »Sie sind Lisa Kostrovic, geboren in … Habe ich das richtig ausgesprochen, Kostrovic?«
»Ja, richtig ausgesprochen. Und Sie müssen mir jetzt nicht meinen Lebenslauf vorlesen, den kenn ich ja.«
Lisa schaute kurz aus dem Fenster.
Florian blätterte weiter in der Mappe herum. »Was ist das für ein Wald? Hier sind ein Foto von einem Wald und dann Kohlezeichnungen, da habe ich den Zusammenhang nicht verstanden. Können Sie mir dazu was sagen?«
»Wie viel Zeit habe ich denn?«
»Wann steigen Sie denn aus?«
Lisa schaute auf die Uhr. »In zwanzig Minuten.«
»Dann haben Sie zwanzig Minuten.«
»Das ist zu kurz«, sagte Lisa.
Florian zog die Augenbrauen hoch. »Gut, wenn Sie meinen«, und nahm eine weitere Mappe aus dem Aktenordner.
Sie stiegen an einem kleinen Bahnhof im brandenburgischen Nirgendwo aus. Die Fenster des Bahnhofsgebäudes waren vernagelt, auf den Bänken im Wartehäuschen saßen ein paar Typen und tranken Bier. Florian schrieb der AFED eine SMS, dass er ganz überraschend und kurzfristig unabkömmlich sei. Die Liste mit seinen Bewertungen, die, von einer Bewerbung abgesehen, fast nur aus Fragezeichen bestanden, schickte er ohne Kommentar per Mail. Er hatte kurz überlegt, das Plus hinter Lisas Namen noch zu löschen. Dass er mit ihr gerade den Zug verlassen hatte, war ja an und für sich nichts Verwerfliches, brachte aber eine gewisse Befangenheit mit sich. Sein Vater, dachte Florian, hätte das Plus bestimmt durchgestrichen. Sein Vater wäre allerdings erst gar nicht mit Lisa ausgestiegen, und deshalb wollte er, nur weil er wegen seines Vaters zur AFED hatte fahren wollen, es jetzt mit der Korrektheit nicht übertreiben.
»Komm, ich zeig dir was«, sagte Lisa und ging zu einem alten Auto auf dem Parkplatz neben dem Bahnhof.
Sie fuhren aus dem Ort raus, und während sie Felder und kleine Wälder passierten, erzählte sie von dem kleinen Waldstück, das sie von ihrem Großvater geerbt hatte. Der war Förster gewesen, hatte ihr beigebracht, wie man Bäume zieht und wie man sie fällt, hatte ihr die Geheimnisse des Waldes gezeigt, beigebracht, welche Pilze giftig und welche essbar sind, wo die Moose wachsen, mit denen man blutende Wunden stillen kann, hatte ihr verraten, an welchen Stellen man Walderdbeeren findet und wo man im Winter Futter für die Rehe auslegen muss.
»Und die Fotos in deiner Mappe sind aus diesem Wald?«, fragte Florian, als sie von der Landstraße in einen Waldweg einbog und das Auto am Wegesrand abstellte.
Sie nickte, beschied ihm zu schweigen und führte ihn in den Wald hinein, der, je weiter sie dem immer schmaler werdenden Pfad durch das dichte Unterholz und die dornigen Büsche folgten, immer verwilderter wurde. Schließlich kamen sie an eine große Lichtung. Der erdige Boden war dunkel verfärbt, und auf der gegenüberliegenden Seite stand eine kleine Holzhütte, daneben ein großer Polter mit rund zwanzig Baumstämmen. Einige Meter weiter befand sich ein schwarzer, vielleicht zehn Meter hoher Hügel. In der Mitte der Lichtung standen 49 junge Bäume, streng im Quadrat gepflanzt, mit jeweils anderthalb Metern Abstand.
»Dieser Ort ist mein Geheimnis«, durchbrach Lisa die Stille. Das stimmte zwar nicht ganz, John hatte sie davon erzählt, gelogen war die Behauptung aber auch nicht, denn sie hatte diesen Ort bisher noch niemandem gezeigt. »Mein Kraftort.«
Florian wollte etwas über Beuys sagen; die soziale Plastik, die kreative und gleichzeitig revolutionäre »Kraft«, das Übliche halt, blieb dann aber still. Er schaute sich um, atmete langsam und vorsichtig. Sein Blick tastete vorsichtig die Hütte, die Bäume und den merkwürdigen schwarzen Hügel ab. Dann drehte er sich zu Lisa und schaute sie an. Sein Blick war weder fragend noch erstaunt, er war glücklich, an diesem Ort zu sein.
»Es ist ganz einfach«, begann Lisa. »Erst fälle ich Bäume, dann mache ich aus dem Holz Kohle, und dann pflanze ich dafür wieder neue Bäume. Ein Kreislauf von Wachstum und Zerstörung, von Dynamik und Stillstand.«
Von ihrem Großvater hatte sie auch das Handwerk der Köhler gelernt, ein dreckiger Vorgang. Lisa verbrannte ihre Kohle nicht, sondern benutzte sie als eine Art CO2-Senke, als Speicher. »Manche machen atmosfair, ich mach Kunst.«
»Die schwarzen Fotos sind von der Kohle«, sagte Florian mehr zu sich selbst.
Lisa nickte.
Dann gingen sie zu dem schwarzen Hügel in der Mitte, dem »Kohleberg«, wie Lisa ihn nannte. Lisa erzählte von Carl von Carlowitz, einem sächsischen Oberbergbauhauptmann im frühen 18. Jahrhundert. Carlowitz sei im Erzgebirge für den Wald zuständig gewesen, weil man das Holz damals für die Verhüttung der Silbererze brauchte. Er hatte angeordnet, dass Bäume nicht nur gefällt, sondern auch nachgepflanzt werden mussten, weshalb er heute als »Vater« der Nachhaltigkeit gelte. »Der Wald und die Bäume«, sagte Lisa wütend, »interessierten ihn gar nicht, ihm ging es nur darum, genug Holz zu haben, um Silber aus dem Erz zu schmelzen, ihm ging es nicht um die Natur, nicht um den Wald, sondern ums Geldverdienen, so wie den meisten, die heute von Nachhaltigkeit reden. Ohne Holz keine Holzkohle und ohne Holzkohle kein Silber. Ohne Kohle keine Kohle. Und so ist es auch heute noch, oder?«
Sie waren nun bei dem Hügel angelangt, den Lisa aus der von ihr gekokten Kohle aufgeschüttet hatte. Florian stellte sich die wütende Lisa als rußverschmierte Köhlerin vor, die aus Holz, Gras und Erde einen Meiler baut und später die fertige Kohle in einer Schubkarre durch den Wald fährt – eine unheimliche Figur wie aus einem Grimm’schen Märchen. Er hob ein Stück Kohle auf, zerrieb es langsam zwischen seinen Handflächen und verteilte den Kohlestaub auf seinen Armen, bis sie schwarz waren.
Lisa schaute ihm zu, dann nahm sie ebenfalls ein Stück Kohle in die Hand und ging einen Schritt auf Florian zu. Langsam führte sie die Kohle an sein Gesicht und strich ihm damit über die Wangen, zeichnete ein ephemeres Muster dünner Linien auf seine Haut.
»Das ist ein schöner Ort«, sagte Florian leise, nahm Lisa das Stück Kohle aus der Hand und begann nun seinerseits ganz vorsichtig, ihr Gesicht damit zu bemalen.
3
Bent ordnet sein Vermächtnis und setzt Cornelia und Bernd in ein unangenehmes Konkurrenzverhältnis
Die Tafel war festlich gedeckt, am Kopf saß wie immer Bent Stohmann, dann, mit etwas Abstand, an der einen Längsseite Cornelia und an der anderen, ihr direkt gegenüber, Bernd. Außerdem war Hermann Berneburg mit am Tisch, der langjährige Freund und Berater von Stohmann, was darauf hinwies, dass dieser etwas Wichtiges zu besprechen oder, was wahrscheinlicher war, zu verkünden hatte. Das Essen zog sich, erst die Vorspeise, eine Gänsestopfleber, Bents Lieblingsgericht, dann ein leichtes Käsesoufflé, gefolgt von einem kräftigen Wildschweinbraten. Während der Vorspeise hielten die drei noch Small Talk, beim Käsesoufflé kam Stohmann schließlich auf den eigentlichen Grund der Zusammenkunft zu sprechen.
»Ihr wisst, dieses Jahr werde ich siebzig Jahre alt, und nach unserer Satzung muss ich dann leider, ja, leider, wie ich betonen möchte, aus dem Vorstand von Mining International ausscheiden. Und aus dem von RMW natürlich auch.«
RMW hatte er vor gut dreißig Jahren von seinem Schwiegervater übernommen und anschließend Mining International aufgebaut. RMW und Mining International waren unter dem Dach der Stohmann Holding vereint, die intern nur »Die Firma« genannt wurde, und es war Stohmann, der die Firma zu ihrer jetzigen Größe geführt hatte.
Sein Schwiegervater hatte für das traditionelle Bergbaugeschäft gestanden, Stahl und Kohle, damals, und diese lokale Industrie mit guten Maschinen auszustatten, das war lange das Geschäftsmodell von RMW gewesen, den Ruhr Maschinenwerken. RMW hatte alles hergestellt, was die Montanindustrie benötigte, Hochöfen, die gigantischen Schaufelradbagger und natürlich die Pumpen, mit denen das Wasser aus den Gruben geholt wird.
Bent hatte, zugegebenermaßen hochriskant, den Maschinenbau für das klassische Montangeschäft zwar nicht verlassen, aber das Geschäftsfeld erweitert. Statt nur neue Maschinen zu bauen, hatte er ein ganzes Servicepaket entwickelt, Leasing, Finanzierung, Security. Außerdem hatte er, lange bevor die technologischen Entwicklungen absehbar waren, auf Zukunft gesetzt. Mit den Gewinnen von RMW hatte Stohmann auf der ganzen Welt Schürfrechte für seltene Erden erworben, den Rohstoff, der heute den digitalen Kapitalismus am Laufen hielt, die Minen betrieb er unter dem Namen Mining International. Er wollte, wie er immer sagte, »eine Stufe weiter nach oben in der Wertschöpfungskette«.
RMW hatte mehr Mitarbeiter und machte mehr Umsatz als Mining International, aber die Minen in Australien, Asien und Afrika brachten mehr Gewinn als RMW. Es war, wie Stohmann gerne sagte, ein kleiner, aber auch nicht unbedeutender Akteur am internationalen Rohstoffmarkt, »eine Perle«, während RMW ein hartes Geschäft betrieb, mit geringen Margen und vielen Konflikten.
»Es ist also an der Zeit, über die Zukunft nachzudenken. Die Weichen zu stellen.« Er machte eine Pause, um Bernd und Cornelia ins Gesicht zu schauen. »Die richtigen Weichen.« Er machte wieder eine Pause, aß noch ein bisschen von dem Käsesoufflé, nahm einen Schluck vom Chablis, um dann zu ergänzen: »Die Weichen richtig stellen.«
Ich habe noch nicht meine beiden Gefährten vorgestellt. Den Adler und den Drachen. Sie sind keine Freunde, nein, aber sie sind Teil von mir. Sie sind nicht immer bei mir, nur manchmal. Der Adler treibt mich voran, und der Drache wirft mich zurück. Der Drache (der Herr meiner Traurigkeit und Bote des Todes) ist der Widersacher des Adlers (meines immer wieder sich aufbäumenden Optimismus). Manchmal kämpfen sie miteinander, und manchmal kämpfen sie mit mir. Sie erscheinen nicht immer als Adler und Drache, sie können auch ganz andere Formen annehmen. Wenn sie sich als Adler und Drache zu erkennen geben, ist ihr Wesen am deutlichsten. Am besten geht es mir, wenn sie beide weit weg sind. Dann vergesse ich sie, und dann bin ich glücklich.
Cornelia war die Situation unangenehm. Sie hatte nie »Vater« oder gar »Papa« zu Stohmann gesagt, auch wenn sie sich an ihre echten Eltern nicht mehr erinnern konnte. Ihre Erinnerung setzte erst mit fünf oder sechs Jahren ein, Kindergarten, vor allem Schule, da war sie schon bei Stohmann. Später, als sie vierzehn oder fünfzehn Jahre alt war, hatte sie versucht, etwas über ihre »wirkliche Familie«, wie sie es damals nannte, herauszufinden, und war bei ihm auf Granit gestoßen. Immer wieder hatte er betont, dass sie »eine Stohmann« sei. Er hatte behauptet, dass er nichts über ihre Mutter und ihren Vater wisse. Alles, was er ihr gesagt hatte, war, dass ihre Mutter krank gewesen sei; irgendwann hatte er präzisiert, ihre Mutter sei drogensüchtig gewesen. Über ihren Vater hatte er nie was gesagt, nur einmal, abfällig, dass es den wahrscheinlich nie gegeben habe.