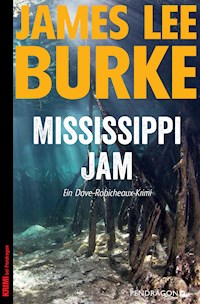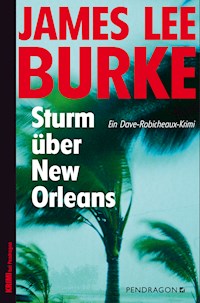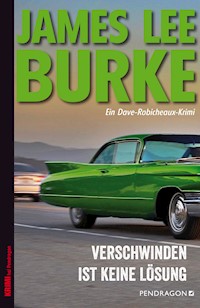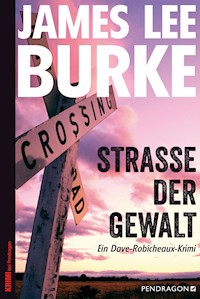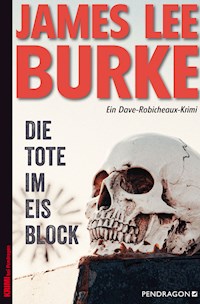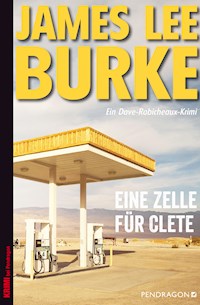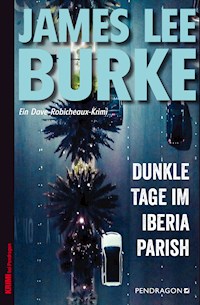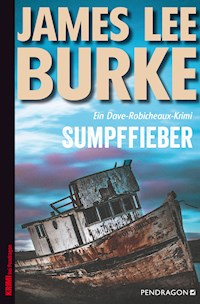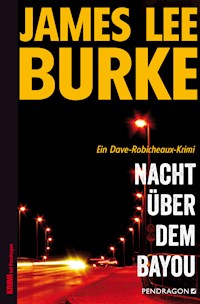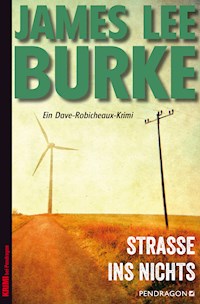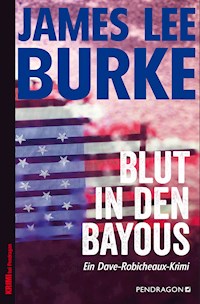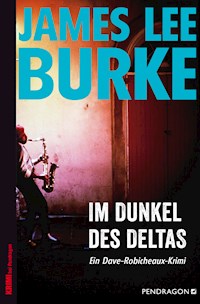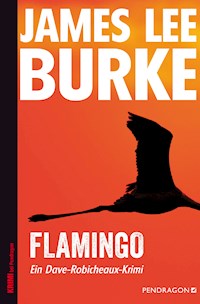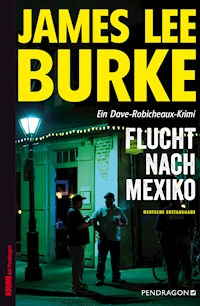
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Dave Robicheaux-Krimi
- Sprache: Deutsch
Manche Erinnerungen - wie die an einen geheimnisvollen Sommer seiner Jugend - verdrängt Dave Robicheaux lieber. Doch das Geständnis eines sterbenden Mannes zwingt ihn dazu, ein lange zurückliegendes Rätsel um das Verschwinden einer Frau endlich aufzuklären. Damals wollte sein Halbbruder Jimmie mit Ida Durbin nach Mexiko durchbrennen, aber am Tag der Flucht verschwand sie plötzlich. Die Suche nach der Wahrheit stürzt Robicheaux in die Intrigen der wohlhabendsten Familie von New Orleans. Gleichzeitig hat er ein ganz anderes Problem, denn in seinem Bezirk werden Frauen entführt und brutal ermordet. Er ermittelt in beiden Fällen, bis ihm klar wird, dass alle Verbrechen auf unheilvolle Weise zusammenhängen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
James Lee Burke • Flucht nach Mexiko
Für Linda und Roger Grainger
JAMES LEE BURKE
Flucht nach Mexiko
Ein Dave-Robicheaux-Krimi Band 14
Aus dem Amerikanischen von Jürgen Bürger
1
Es war das Ende einer Epoche, von der ich vermute, dass Historiker sie womöglich als das letzte Jahrzehnt der Amerikanischen Unschuld ansehen. Es war eine Zeit, an die wir uns weniger wegen bestimmter historischer Ereignisse als vielmehr in Bildern und Tönen erinnern — rosafarbene Cadillacs, Autokinos, stilisierte Straßenkriminelle, Rock ’n’ Roll, in der Musikbox Hank und Lefty, der dirty bop, Baseballspiele am helllichten Tag, ausgeschlachtete ’32er Fords mit Mercury-Maschinen, die mit einem Höllenlärm an Drive-in-Lokalen vorbei Rennen veranstalteten, das Ganze vor einer Kulisse aus Palmen, einer sich kräuselnden Brandung und einem violetten Himmel, den Gott ganz offensichtlich als filmisches Tribut an unsere Jugend erschaffen hatte.
Die Jahreszeiten schienen ewig zu dauern und nicht den Gesetzen des Wandels zu unterliegen. Und wenn doch, dann war es unwahrscheinlich, dass der Frühling unseres Abschlussjahres jemals vom beißenden Geruch des Winters beschmutzt werden würde. Wenn uns Bilder von Sterblichkeit in den Sinn kamen, mussten wir uns nur gegenseitig ins Gesicht sehen, um uns zu versichern, dass keiner von uns jemals sterben würde, dass Gerüchte weit entfernter Kriege rein gar nichts mit unserem Leben zu tun hatten.
Jimmie Robicheaux war mein Halbbruder. Er war ein Hitzkopf, ein Idealist und bei Kneipenschlägereien ein furioser Faustkämpfer, häufig jedoch auch verletzlich und übel missbraucht von jenen, die seine tief sitzende Gutmütigkeit auszunutzen verstanden. 1958 schufteten er und ich in Zehn-Tages-Schichten mit anschließenden fünf freien Tagen für eine sogenannte Doodlebug-Firma, das heißt für eine Seismografen-Crew, die Gummikabel und seismische Detektoren in den Buchten und Sümpfen entlang der Küsten von Louisiana und Texas verlegte. Wenn wir freihatten und an Land waren, hingen wir auf Galveston Island ab, angelten nachts auf den Landungsbrücken, gingen morgens schwimmen und aßen gebratene Shrimps in einem Café im Vergnügungsviertel im Hafen, wo direkt vor den offenen Fenstern Möwen flatterten und kreischten.
Der vierte Juli jenes Jahres war ein eigenartiger Tag. Der Luftdruck sackte ab, der Himmel nahm eine chemisch grüne Farbe an, und wo die hereinrollenden Brecher auf den Strand klatschten, spülten sie jede Menge Sand und tote Köderfische an Land. Die Dünung zwischen den Wellen war glatt, nur von Regentropfen leicht gekräuselt, aber unter der harmlos erscheinenden Oberfläche herrschte ein enormer Sog, fast wie Stahlkabel um die Oberschenkel, und der Sand verschwand blitzschnell unter unseren Füßen, wenn die Wellen zurück hinaus aufs Meer gezogen wurden.
Die meisten Schwimmer verließen das Wasser. Vielleicht lag es an unserer Jugend oder der Tatsache, dass Jimmie und ich zu viel Bier getrunken hatten, jedenfalls schwammen wir weit hinaus bis auf die dritte Sandbank, das letzte Hindernis zwischen der Insel und dem Rand des Festlandsockels mit seinem jähen Gefälle. Die Sandbank bot jedoch einen recht soliden Untergrund und lag mit ihrem Kamm nur gut einen halben Meter unter der Oberfläche, was es einem Schwimmer erlaubte, vor dem Gezeitenstrom sicher, den herrlichen Blick sowohl auf den Horizont im Süden als auch auf die überall entlang der Küste angehenden Lichter zu genießen.
Die Sonne brach durch die Gewitterwolken im Westen, direkt über dem Rand der Welt, und erinnerte an flüssiges Feuer, das sich im Inneren der Wolken sammelte. Zum ersten Mal an diesem Tag sahen wir unsere eigenen Schatten auf der Wasseroberfläche. Dann erkannten wir, dass wir nicht allein waren.
Etwa 30 Meter weiter auf dem offenen Meer zog eine Haifischflosse, stahlgrau und dreieckig, durch die Dünung und verschwand wieder unter einer Welle. Jimmie und ich standen mit heftig pochenden Herzen auf der Sandbank und warteten, dass die Flosse wieder auftauchte. Hinter uns hörten wir das Knistern und Knacken der Blitze in den Wolken.
„Wahrscheinlich ein Sandtiger“, meinte Jimmie.
Aber wir wussten beide, dass die meisten Sandtigerhaie eher klein sind und eine gelbliche Färbung haben und sich nicht bei Sonnenuntergang auf dem äußeren Schelf her umtreiben. Wir starrten lange Zeit aufs Wasser, dann bemerkten wir, wie, dicht unter der Wasseroberfläche, ein Schwarm Köderfische panisch auseinanderstob. Die Köderfische schienen wie Silbermünzen in die Tiefe zu sinken, dann wurde die Dünung wieder glatt und dunkelgrün und kräuselte sich nur noch leicht, wenn der Wind etwas auffrischte. Ich hörte, dass Jimmie so schwer atmete, als hätte er sich einen Berg hinaufgequält.
„Sollen wir zurückschwimmen?“, fragte ich.
„Die verwechseln Menschen mit Seeschildkröten. Sie schauen nach oben, bemerken eine Silhouette, sehen, wie wir mit Armen und Beinen herumplanschen und denken, hey, das sind Schildkröten“, sagte er.
Es war nicht kalt, aber der Wind verursachte ihm eine deutliche Gänsehaut.
„Lass uns abwarten, bis er weg ist“, sagte ich.
Ich sah Jimmie tief Luft holen und wie sein Mund einen Kegel formte, als ob ein Stück Trockeneis auf seiner Zunge verdampfte. Dann wurde sein Gesicht aschfahl, und er sah mir direkt in die Augen.
„Was?“, fragte ich.
Jimmie zeigte stumm nach Süden, auf etwa zwei Uhr von unserem Standort aus gesehen. Eine Flosse, größer als die erste, zog diagonal durch eine Welle und zerschnitt sie. Dann sahen wir, wie der Rücken des Hais die Wasseroberfläche durchbrach, das Wasser von seiner Haut, in der Farbe von geschmolzenem Zinn, abperlte.
Wir hatten keine Alternative. Die Sonne ging unter wie ein zerflossener Planet, der im eigenen Rauch versank. In einer halben Stunde würde die Flut einsetzen, uns von der Sandbank heben und uns keine andere Möglichkeit lassen, als zum Strand zurückzuschwimmen, wobei unsere Körper sich als Silhouette deutlich gegen den Abendhimmel abzeichnen würden.
Musikfetzen und der Lärm explodierender Feuerwerkskörper wehten von der Hafenmole zu uns herüber, und wir sahen die Lichteffekte von Raketen und Leuchtkugeln über den alten Offiziersquartieren der U.S. Army entlang des Strandes. Eine Welle strich über meine Brust, und im Wasser bemerkte ich die rosa-bläuliche Gasblase und die rankenartigen Nesselfäden einer Portugiesischen Galeere. Sie trieb weiter, dann schien noch eine und eine weitere aus einer Welle zu fallen und wie halb aufgeblasene Ballons in einem Strudel zu kreisen.
Vor uns lag ein weiter Weg bis zum Strand.
„Da sind Haie im Wasser! Habt ihr Jungs die Flaggen der Rettungsschimmer nicht gesehen?“, rief eine Stimme.
Ich wusste nicht, woher die junge Frau gekommen war. Sie saß rittlings auf einem Reifenschlauch, an den zwei weitere gebunden waren, und sie hielt ein kurzes Holzpaddel in den Händen. Sie trug einen schwarzen Badeanzug und hatte rötlich-blonde Haare. Auf ihren Schultern glühte ein Sonnenbrand. Hinter ihr, in der Ferne, konnte ich die Spitze einer steinernen Mole sehen, die weit in die Brecher hinausragte.
Sie paddelte mit ihrem improvisierten Floß, bis es direkt über der Sandbank trieb und wir hinüberwaten konnten.
„Wo kommst du denn her?“, fragte Jimmie.
„Wen interessiert’s? Spring besser rauf. Die Quallen können dir das Licht ausblasen“, sagte sie.
Sie war groß und schlank und kaum älter als wir, und ihr Akzent war stark texanisch. Eine Welle brach an meinem Rücken, brachte mich aus dem Gleichgewicht. „Seid ihr Jungs taub, oder was? Man hat nicht so richtig das Gefühl, ihr freut euch, dass jemand euch aus dem Schlamassel holt, in den ihr euch manövriert habt“, sagte sie.
„Wir kommen!“, erwiderte Jimmie und kletterte auf einen der Reifenschläuche.
Zweimal wurden wir von Wellen überspült, und wir brauchten fast eine halbe Stunde, um das Becken zwischen der dritten und zweiten Sandbank zu durchqueren. Ich meinte, ich hätte eine Rückenflosse durch die Wasseroberfläche brechen und dann im Licht der Abendröte dahinziehen gesehen, und einmal stieß ein fester Körper gegen mein Bein, als würde man von einem etwas einfältigen Schlägertypen in einem vollen Bus angerempelt.
Als wir jedoch die zweite Sandbank hinter uns hatten, befanden wir uns in einer völlig anderen Welt, die berechenbarer war, wo wir mit den Zehenspitzen den Grund berühren, den Rauch der Grillfeuer riechen und Kinder beim Fangen spielen im Dunkeln hören konnten. Unser Leben war nicht mehr dem unendlichen Ozean ausgeliefert, in dem es Raubtiere gab und wo man leicht Opfer der Naturgewalten werden konnte, wenn man zu achtlos war. Als wir uns aus der Brandung erhoben, fühlte sich der Wind auf unserer Haut so süß an wie der Kuss einer Frau.
Unsere Retterin sagte, ihr Name sei Ida Durbin und sie hätte uns von der Mole aus mit dem Fernglas gesehen und wäre zu uns hinausgepaddelt, weil nur ein Stück weiter die Küste hinauf bereits ein Kind von einem Hai angegriffen worden sei.
„Machst du das für jeden?“, fragte Jimmie.
„Es gibt immer Leute, auf die man aufpassen muss, zumindest solche, die noch nicht begriffen haben, dass im tiefen Wasser Haie leben“, meinte sie.
Jimmie und ich besaßen ein kanariengelbes 1946er Ford Cabrio mit Weißwandreifen und verchromten Zwillingsauspuffrohren. Wir fuhren Ida zur Mole zurück, wo sie ihre Strandtasche holte und in einem Umkleidehäuschen den Badeanzug gegen Kleid und Sandalen tauschte. Dann gingen wir zusammen in eine Strandbar, wo es Wassermelone und gebratene Shrimps gab. Zwischen den Palmen waren Lichterketten mit winzigen weißen Lämpchen gespannt, und dort saßen wir, aßen Shrimps und sahen dem Feuerwerk über dem Wasser zu.
„Seid ihr beide Zwillinge?“, wollte sie wissen.
„Ich bin 18 Monate älter“, antwortete ich.
Sie sah uns an. „Ihr seht euch verflixt ähnlich für Brüder, die keine Zwillinge sind. Vielleicht hat eurer Mama einfach gefallen, wie ihr ausseht, und daraufhin hat sie beschlossen, für euch beide nur ein Gesicht zu benutzen“, sagte sie. Sie grinste über ihren eigenen Witz, wendete dann aber den Blick ab und studierte intensiv ihre Handrücken, als Jimmie versuchte, den Augenkontakt zu halten.
„Wo wohnst du, Ida?“, fragte er.
„Da drüben“, sagte sie und deutete unbestimmt mit dem Kopf Richtung Hauptstraße.
„Arbeitest du hier in Galveston?“, hakte er nach.
„Eine Weile, ja. Ich muss jetzt los“, erwiderte sie.
„Wir fahren dich“, sagte er.
„Nee, ich nehm ein Taxi. Mach ich immer so. Kostet nur 50 Cent“, antwortete sie.
Jimmie wollte protestieren.
Aber sie stand auf und wischte Krümel der gebratenen Shrimps von ihrem Kleid. „Und ihr Jungs passt demnächst besser auf euch auf “, sagte sie.
„Jungs?“, wiederholte Jimmie, nachdem sie fort war.
Galveston Island war damals ein merkwürdiger Ort. Es war eine Arbeiterstadt, an den Stränden herrschte Rassentrennung, die Jax Brauerei war der größte Betrieb und die salzige Meeresluft hatte ihre Spuren auf den alten viktorianischen Häusern hinterlassen, deren Anstriche abblätterten. Es war ein Urlaubsort für Arme und Außenseiter sowie eine kulturelle Enklave, wo die strengen baptistischen Sitten von Texas wenig galten. In jeder Kneipe am Strand standen Spielautomaten. Für diejenigen, die richtig zocken wollten, für gewöhnlich reiche Öl-Leute aus Houston, gab es Nachtclubs mit Blackjack, Craps und Roulette im Angebot. Eine sizilianische Familie hatte alles fest im Griff. Eine ganze Reihe ihrer Günstlinge ging 1947 mit Benjamin „Bugsy“ Siegel nach Las Vegas. Einer von denen baute das Sands auf.
Dennoch herrschte auf der Insel eine allgemeine Atmosphäre von Arglosigkeit und Vertrauen. Die Achterbahn im Vergnügungspark war vom Texas Department of Public Safety offiziell stillgelegt worden, die entsprechende amtliche Mitteilung war an einen Pfosten direkt neben dem Kartenverkauf genagelt worden. Trotzdem drängten sich an jedem Sommerabend Urlauber in die offenen Wagen, die über verzogene Schienen donnerten und durch hölzerne Kurven rasten, deren Sparren und rostige Bolzen gefährlich vibrierten.
Fromme Familien füllten die Bingosäle und aßen gekochte Krebse, in deren Schalen sich manchmal schwarzes Öl befand. Bei Tagesanbruch waren riesige Lastkähne voller Müll auf Südkurs unterwegs Richtung Horizont, kreischende Möwen über ihnen, um Tonnen unbehandelten Abfalls zu verklappen, der sich irgendwie, so die Vorstellung, in inaktive Moleküle völlig harmloser Substanzen verwandeln würde.
Aber landeinwärts von den Fahrgeschäften, den Angel-Molen, billigen Kneipen und Fischrestaurants gab es noch ein anderes Galveston. Und einen anderen Wirtschaftszweig, der keinen Anspruch auf Unschuld erhob.
Während der folgenden zwei Tage sahen wir Ida Durbin weder auf der Hauptstraße noch bei den Lokalen draußen am Pier oder auf einer der Landungsbrücken, und wir hatten auch keine Ahnung, wo sie wohnte. Dann, an einem Samstagmorgen, als wir einen Block vom Strand entfernt in einem Friseurladen saßen, sahen wir sie am Schaufenster vorbeigehen. Sie trug einen weichen Strohhut und ein bedrucktes Kleid mit lavendelfarbenen mexikanischen Rüschen am Saum. Über ihrer Schulter hing ein Kordelzugbeutel.
Wie ein geölter Blitz schoss Jimmie aus der Tür.
Sie erzählte ihm, sie müsse eine Geldanweisung für ihre im Nordosten von Texas lebende Großmutter machen, außerdem ihre im Postamt lagernden Briefsendungen abholen, sie müsse weiterhin etwas gegen den Sonnenbrand auf ihrem Rücken kaufen, und sie habe den ganzen Tag und auch abends Verpflichtungen.
„Morgen ist Sonntag. Da ist alles geschlossen. Was machst du da?“, fragte er mit einem breiten Grinsen.
Sie starrte fragend ins Nichts, hielt den Mund geschlossen und die Lippen gespitzt. „Ich schätze mal, ich könnte ein paar Sandwiches machen und wir treffen uns auf dem Vergnügungspier“, sagte sie.
„Wir holen dich ab“, sagte er.
„Nein, werdet ihr nicht“, erwiderte sie.
Am nächsten Tag erfuhren wir, dass Picknick mit Ida Durbin Sandwiches mit Wiener Würstchen, Karottensticks, einen Krug Eistee und drei Riegel Milky Way bedeutete.
„Manche Leute mögen keine Wiener“, sagte sie und sie sprach das Wort irgendwie komisch aus. „Aber mit ein paar Blättern Salat und Mayo find ich sie richtig gut.“
„Ja, die sind echt lecker. Stimmt doch, Dave, oder nicht?“, fragte Jimmie.
„Auf jeden Fall“, sagte ich und versuchte, ein Stück dieses angeblichen Würstchens runterzuspülen, das sich im Mund wie ein Batzen Gummi anfühlte.
Wir waren auf dem Vergnügungspier, saßen auf einer hölzernen Bank im Schatten einer riesigen Außenleinwand. Im Hintergrund hörte ich Flipperautomaten und leises Knallen von einer Schießbude. Ida trug einen rosafarbenen Rock und eine weiße Bluse mit Spitze am Kragen; ihre Arme und ihr Dekolleté waren übersät mit erdbeerfarbenen Sommersprossen.
„Dave und ich fahren morgen wieder mit dem Schiff raus“, sagte Jimmie.
Sie kaute auf einem Karottenstick, starrte mit leerem Blick auf den Strand und die auf den Sand gleitende Brandung.
„In zehn Tagen sind wir wieder an Land“, meinte Jimmie.
„Gut. Vielleicht sehen wir uns dann wieder“, erwiderte sie.
Falls in ihrer Stimme so was wie Überzeugung gelegen haben sollte, habe zumindest ich es nicht gehört. Unter uns krachte eine Mordswelle gegen die Stützpfeiler und ließ die Planken unter unseren Füßen vibrieren.
2
Nach der nächsten Tour kehrten wir in das Motel zurück, in dem uns der Manager, unser an einen Rollstuhl gefesselter Cousin, als Gegenleistung für ein paar Besorgungen kostenlos wohnen ließ. Die nächsten fünf Tage hatte Jimmie nichts anderes im Kopf, als Ida wiederzusehen. Wir kurvten in unserem Cabrio die Hauptstraße rauf und runter, angelten nachts auf den Landungsbrücken, gingen zu einer Tanzveranstaltung in einem mexikanischen Viertel und spielten Shuffleboard in verschiedenen Kneipen am Strand, aber niemand, mit dem wir sprachen, hatte je etwas von Ida Durbin gehört.
„Meine Schuld. Ich hätte ihr die Nummer des Motels geben sollen“, sagte mein Bruder.
„Sie ist älter als wir, Jimmie.“
„Na und?“
„So sind die Mädels eben, wenn sie älter sind. Sie wollen uns nicht kränken, aber die führen ein ganz anderes Leben, wollen lieber mit älteren Männern verkehren, du verstehst, was ich meine? Für die ist das doch eine Herabsetzung, wenn sie mit jüngeren Typen gesehen werden“, sagte ich.
Falsche Ansage.
„Ich glaube das alles nicht. Sie hätte uns doch sonst keine Sandwiches gemacht. Nennst du sie eine Heuchlerin oder was?“, fragte er.
Wir kehrten aufs Schiff zurück und erledigten einen Job südlich von Beaumont, verlegten Gummikabel und Geophone in einem Sumpfgebiet, schritten über Wasser-Mokassinschlangen und schlugen nach Moskitos, die dicht wie schwarze Gaze in den Schatten hingen. Als wir diesen Job hinter uns hatten, kehrten wir mit Sonnenbrand und Insektenstichen sowie verdorbenen Lebensmitteln zurück, welche die Köche aufgetischt hatten, nachdem die Kühlanlage ausgefallen war. Aber sobald wir unser Motel erreichten, sprang Jimmie unter die Dusche, zog sich frische Klamotten an und machte sich wieder auf die Suche nach Ida.
„Hab sie gefunden“, sagte er nach zwei Tagen. „Sie war in einer Musikalienhandlung. Sie klimperte auf einer Mandoline herum, pling, pling, pling, dann fing sie an zu singen, nur ich und der Ladenbesitzer waren da. Sie hört sich an wie Kitty Wells. Sie hat versprochen, sie würde warten. Komm schon, Dave.“
„Warum bist du zurück ins Motel gekommen?“
„Um meine Brieftasche zu holen. Ich lade uns alle zum Essen ein.“
Jimmie hatte gesagt, sie warte in einer Musikalienhandlung. Tatsächlich aber war es eine Pfandleihe, ein schmutziges, orangefarbenes Gebäude, eingekeilt zwischen einem Billardsalon und einer Kneipe am Rand des Schwarzenviertels. Sie saß auf einer Bank unter einer Segeltuchmarkise und drehte am Stimmwirbel einer Gibson-Mandoline auf ihrem Schoß. Der Lack unterhalb des Schalllochs war durch jahrelange Plektrumstriche über das Holz weitgehend abgeschabt.
Auf der Straße war es heiß und laut, Dreck und Abgase von Schrottkisten verpesteten die Luft. „Oh, hallo Leute“, sagte sie und sah unter ihrem Strohhut zu uns auf. „Ich dachte, du kommst nicht mehr zurück. Ich wollte gerade schon gehen.“
„Hast du die Mandoline gekauft?“, fragte Jimmie.
„Ist schon meine. Ich zahle immer die Zinsen dafür, damit Mr. Pearl sie nicht verkaufen muss. Er erlaubt mir, wann immer ich Lust habe, reinzukommen und ein bisschen auf ihr zu spielen.“
Sie brachte die Mandoline dem Leihhausbesitzer zurück und kam dann wieder heraus. „Tja, ich mache mich jetzt besser wieder auf den Weg“, sagte sie.
„Ich möchte euch zum Essen einladen“, sagte Jimmie.
„Das ist nett von dir, Jimmie, aber ich muss mich für die Arbeit fertig machen“, erwiderte sie.
„Wo arbeitest du denn?“
Sie lächelte, ihre Augen im Sonnenlicht grün und leer, abgelenkt von einem Auto, das auf der Straße Fehlzündungen hatte.
„Diesmal fahren wir dich aber“, sagte ich.
„Mein Bus hält direkt da drüben an der Ecke. Seht ihr, da kommt er auch schon, genau zur rechten Zeit“, sagte sie und setzte sich Richtung Kreuzung in Bewegung. Unter ihrem Arm klemmte ein Anzeigenblatt. Sie warf einen Blick zurück über die Schulter. „Ich hab ja jetzt eure Nummer. Ich werde anrufen. Versprochen.“
Jimmie starrte ihr nach. „Du hättest sie singen hören müssen“, sagte er.
Als der Bus sich vom Bordstein entfernte, saß Ida ganz vorn, in dem den Weißen vorbehaltenen Teil, völlig versunken in ihre Reklamezeitschrift.
Gerade als wir in unser Cabrio stiegen, trat der Leihhausbesitzer heraus auf den Bürgersteig. Er war ein hochgewachsener, weißhaariger Mann mit Bierbauch und großen Händen. In der Brusttasche seines Hemds steckten Zigarren. „Hey, ihr zwei“, sagte er.
„Sir!“, antwortete ich.
„Das Mädchen hat auch so schon mehr als genug Probleme. Macht’s ihr nicht noch schwerer“, sagte der Ladenbesitzer.
Jimmies Hände lagen auf dem Lenkrad, er beugte den Kopf vor. „Worüber zum Teufel reden Sie da?“, fragte er.
„Komm mir noch mal so frech und ich werd’s dir zeigen“, raunzte der Inhaber.
„Scheiß doch drauf. Was haben Sie damit gemeint, dass sie Probleme hat?“, fragte Jimmie.
Aber der Leihhausbesitzer drehte sich um und verschwand wieder in seinem Laden.
Am folgenden Abend kam Jimmie betrunken ins Motel und stürzte in der Duschkabine aus Blech. Er stieß mich zurück, als ich ihm aufhelfen wollte. Sein muskulöser Körper war nass, und ein Blutfaden zog sich von seinem Haaransatz nach unten.
„Was ist passiert?“, fragte ich.
„Nichts“, blaffte er.
„Hat das irgendwas mit Ida Durbin zu tun?“
„So nennen die sie nicht“, sagte er.
„Was?“
„Red nicht mehr über Ida“, brummte er.
Am nächsten Morgen war er fort, bevor ich aufwachte, aber unser Auto stand noch auf seinem Stellplatz. Ich überquerte den Seawall Boulevard zum Strand und sah ihn im Sand sitzen, barfuß und mit nacktem Oberkörper, um ihn herum die eingefallenen Gasblasen von Quallen.
„Da, wo sie arbeitet, wird sie Connie genannt. Nachnamen kennt man da gar nicht“, sagte er.
Am vorausgegangenen Nachmittag hatte Ida ihn im Motel angerufen und ihm gesagt, er sei ein netter Kerl, sie wüsste, dass er auf dem College gut klarkommen werde und dass sie sich vielleicht in ein paar Jahren wiedersehen würden, wenn er ein reicher und erfolgreicher Mann wäre. Aber bis dahin hieß es nun erst einmal Abschied nehmen, und er dürfe sie in seiner Vorstellung nicht mit dem Mädchen verwechseln, das die Richtige für ihn sei.
Nachdem sie aufgelegt hatte, fuhr Jimmie schnurstracks zu der Pfandleihe und sagte dem Inhaber, er wolle Idas Mandoline kaufen.
„Die ist nicht zu verkaufen“, sagte der Mann.
„Ich werde sie Ida zum Geschenk machen. Also, wie viel macht es?“, fragte Jimmie.
„Was versprichst du dir denn davon, Junge?“, fragte der Mann.
„Wovon soll ich mir was versprechen?“
Der Inhaber schnipste mit den Fingern gegen die Vitrine. „Sie ist mit 35 Dollar beliehen, dazu kommen noch zwei Dollar Abschlussgebühr.“
Jimmie zählte den Betrag aus seiner Brieftasche ab. Der Inhaber verpackte die Mandoline in eine zweischichtige Papiertüte und legte sie auf die Vitrine.
„Können Sie mir sagen, wo sie arbeitet oder wohnt?“, fragte Jimmie.
Der alte Mann starrte ihn an, als sei ein Geisteskranker in sein Geschäft gekommen.
„Ich habe dich für eine taube Nuss gehalten, Junge, aber ich schätze, du meinst es ernst. Sie wohnt und arbeitet an ein- und demselben Ort. In der Post Office Street. Kapierst du es jetzt?“
Die Farbe auf den zweistöckigen Häusern blätterte ab, in den knochentrockenen kargen Gärten wuchs nicht mal Unkraut, die Bettlaken an den Wäscheleinen flatterten im heißen Wind.
Jimmie parkte das Cabrio und sah unsicher zu den Häusern hinüber, den Hals der Mandoline in einer Hand. Ein Streifenwagen der städtischen Polizei rollte vorbei, zwei uniformierte Beamte auf den Vordersitzen. Sie unterhielten sich, und keiner registrierte ihn auf der Straße. „Ich suche Ida Durbin“, sagte Jimmie zu einem schwarzen Mädchen, das in einem Garten neben einem Haus Wäsche aufhängte.
Die Kleine war zierlich, trug eine staubig-gelbe Bluse, durchgeschwitzt unter den Achseln. Ihre Unterarme waren rosa und weiß gefleckt, fast so, als wäre ihre natürliche Pigmentierung aus der Haut gebleicht worden. Sie schüttelte den Kopf.
„Sie hat Sommersprossen und rotblondes Haar. Sie heißt Ida“, sagte Jimmie.
„Das hier ist ein schwarzes Haus. Weiße Männer kommen tagsüber nicht her“, sagte sie. Der Wind schlug ihr ein Laken ins Gesicht, grau vom Waschen, doch sie schien das gar nicht zu bemerken.
Jimmie trat einen Schritt näher zu ihr. „Hör zu, wenn dieses Mädchen in einem Laden für Weiße arbeitet, warum sollte ich dann …“, setzte er an.
Plötzlich spürte Jimmie jemanden im Fenster hinter sich. Das schwarze Mädchen nahm seinen Korb Wäsche und entfernte sich schnell. „Du siehst nicht aus wie der Gasableser“, sagte der Mann im Fenster.
Er war weiß, hatte kleine Ohren, eingefallene Wangen und Haare so schwarz und glänzend wie Lackleder, geölt und im Nacken zu einer leichten Locke gekämmt.
„Ich suche Ida Durbin“, sagte Jimmie.
Der Mann lehnte sich auf die Fensterbank und dachte nach. Er trug ein cremefarbenes Cowboyhemd mit abgesteppten Taschen und an den Schultern aufgestickten Rosenbordüren. „Vier Türen weiter. Frag nach Connie. Ach, weißt du was, ich bring dich einfach hin“, sagte er.
„Geht schon in Ordnung“, antwortete Jimmie.
„Bin hier, um zu helfen“, sagte der Mann.
Auf dem Weg die Straße hinunter streckte der Mann seine Hand aus. Sie war klein, hart und die Knöchel traten deutlich hervor. „Ich heiße Lou Kale. Ist Connie dein Schwarm?“, fragte er.
„Das Mädchen, das ich suche, heißt Ida.“
„In dieser Straße hier benutzt niemand seinen richtigen Namen. Das heißt, außer mir“, sagte Lou Kale und zwinkerte. „Ich wollte sie Ida Red nennen, nach dem Mädchen aus diesem Song von Bob Wills. Allerdings fand sie das nicht respektvoll, also hat sie sich selbst einen Namen ausgedacht. Wie heißt du eigentlich?“
Jimmie zögerte, berührte mit der Zunge die Unterlippe. „Siehst du, was ich meine?“, sagte Lou Kale. „Sobald die Leute einen Fuß in die Post Office Street setzen, machen ihre Namen auch schon einen Abgang.“
Lou Kale begleitete Jimmie durch die Vordertür eines zweigeschossigen viktorianischen Hauses mit Holzsäulen auf der Galerie und einer Veranda im ersten Stock. Die Jalousien waren geschlossen, um den Staub draußen zu halten, und die Luft im Inneren war durch die aufgeheizten Wände stickig. Die Sofas und Stühle mit gerader Rückenlehne waren leer; der einzige Farbklecks im Raum war das Plastikgehäuse einer Wurlitzer-Jukebox, die an der hinteren Wand angeschlossen war. Lou Kale sagte einer korpulenten Weißen in der Küche, dass Connie Besuch habe.
Die Frau mühte sich eine Treppe hinauf, die unter ihrem Gewicht ächzte, und brüllte dann einen Flur hinunter.
„Sieh mich an, Junge“, sagte Lou Kale. Er schien seinen Gedankenfaden verloren zu haben. Er berührte seine Nase mit einem Knöchel, schnaubte scharf und schien seine Worte neu zu sortieren. Er war kleiner als Jimmie, hatte eine kompakte Statur, einen flachen Bauch, die Venen auf seinen Armen standen deutlich hervor, die dunkle Jeans saß hoch auf den Hüften. Er sah jetzt verschmitzt aus. „Du bist nicht hier, um ’ne Nummer zu schieben, stimmt’s?“
„Wen interessiert, warum ich hier bin. Ist ’n freies Land, nicht?“, erwiderte Jimmie. Er fragte sich beiläufig, warum er ein so schlechtes Englisch sprach.
Lou Kale saugte geräuschvoll an seinen Zähnen, die Lider flatterten, während er eine an der Wand summende Fliege beobachtete. Dann wedelte er mit den Fingern in der Luft, als füge er sich einer Situation, die er nicht unter Kontrolle hatte. „Du gibst Connie dein Geschenk, dann machst du einen Abgang. Der Laden hier ist tabu für dich, und das Gleiche gilt für Connie. Soll heißen, such dir ’n eigenes Mädel und komm gar nicht erst auf irgendwelche dummen Gedanken. Verstehen wir uns?“
„Nein.“
„Dacht ich mir schon“, meinte Lou Kale. „Connie, komm hier runter.“
Als Ida Durbin die Treppe herunterkam, trug sie eine knappe Jeans-Shorts und eine Bluse, die aussah, als wäre sie aus feinem Gazestoff, durch den man die Konturen des schwarzen BHs erkennen konnte, den sie darunter trug. Sie hatte geschlafen, und auf ihrem von der aufgestauten Hitze geröteten Gesicht waren die Falten des Kissens zu erkennen, auf dem sie gelegen hatte. Sogar im Halbdunkel konnte Jimmie den verletzten Ausdruck in ihren Augen erkennen, als ihr klar wurde, wer ihr Besucher war.
„Wechselt ein paar schnelle Höflichkeiten, Leute, und dann ist dein Freund auch schon wieder unterwegs“, sagte Lou Kale zu ihr.
Jimmie machte einen Schritt auf sie zu und streifte dabei mit dem Arm Lou Kales Schulter. „Ich habe die Mandoline ausgelöst“, sagte er.
„Jimmie, du solltest nicht hier sein“, erwiderte sie.
„Ich dachte nur, ich bring dir einfach kurz die Mandoline vorbei, mehr nicht“, sagte er mit stockender Stimme. Er reichte sie ihr steif und unbeholfen. Lou Kale schnippte mit einem Fingernagel gegen das Glas seiner Armbanduhr.
„Danke. Du gehst jetzt besser“, sagte sie.
Da konnte Jimmie sich nicht länger zurückhalten. „Wer ist dieser Kerl?“, fragte er und deutete auf Lou Kale. „Was machst du hier?“
„Connie, heute Morgen haben zwei Tanker aus Panama angelegt. Geh jetzt und bring dein Nickerchen zu Ende“, sagte Lou Kale. „Alles bestens hier. Glaub mir, ich mag den Typ. Ist ein netter Junge, genau das ist er.“
Sie ging die Treppe hoch, warf Jimmie noch einen Blick zu. Lou Kale schob sich in Jimmies Blickfeld. „Du hast deine gute Tat vollbracht. Das ist doch Belohnung genug, richtig?“, fragte er. „Richtig?“
„Ja“, erwiderte Jimmie, aber er rührte sich nicht vom Fleck.
„Wir stehen hier nicht auf leeres Gequatsche“, sagte Lou Kale und legte eine Hand auf Jimmies Schulter. Sein Atem schlug gegen Jimmies Haut.
Dann schob Lou Kale ihn Richtung Tür, fast so, als hätte Jimmie keinen eigenen Willen, und ehe Jimmie sich versah, war er wieder draußen und die Tür fiel laut hinter ihm ins Schloss.
Die sengende Sonne stand blendend weiß am Himmel, und die Luftfeuchtigkeit fühlte sich auf seiner Haut an wie klamme Wolle. Einen Augenblick lang hörte er keinen Ton, als wäre er unter einer Glasglocke gefangen. Oben schaltete irgendwer ein Radio ein, und aus dem Fenster hörte er die näselnde Stimme von Kitty Wells It Wasn’t God Who Made Honky Tonk Angels singen.
Nachdem Jimmie mir von seinem Abstecher in die Post Office Street erzählt hatte, ging ich mit ihm frühstücken und dachte, unser kleines Missgeschick mit Ida Durbin sei vorüber. Aber ich sollte mich irren. Sie rief ihn am selben Nachmittag an und bat um ein Treffen auf dem Vergnügungspier.
„Lass die Finger von ihr“, sagte ich ihm.
„Sie ist durch Haie gepaddelt, um uns von der Sandbank zu retten“, sagte er.
„Sie ist eine Nutte. Daran kannst du nichts ändern. Benimm dich, als hättest du ein Hirn“, sagte ich.
Und wieder einmal hatte ich ohne vorher nachzudenken gesprochen. Unser Vater, in der Ölbranche bekannt als Big Aldous Robicheaux, war ein herzensguter, ungebildeter Cajun und verrufener Kneipenschläger gewesen, zu dessen Seitensprüngen auch eine Prostituierte in Abbeville gehört hatte. Diese Frau starb in einer Bundeseinrichtung in Carville, Louisiana, an Lepra. Sie war Jimmies Mutter gewesen.
Ich begleitete Jimmie zum Pier und hörte mir Ida Durbins Geschichte über ihre Herkunft an. Weder Jimmie noch ich besaßen die Erfahrung, diese Geschichte richtig einzuordnen oder ihren Wahrheitsgehalt beurteilen zu können. Sie erzählte uns, sie sei bei ihrer Großmutter in einer kleinen Industriestadt unmittelbar südlich der Grenze zu Arkansas aufgewachsen und habe ihr Haus mit fast 3 000 Dollar beliehen, um für die Krebsbehandlung der Großmutter in Houston aufkommen zu können. Als Ida das Darlehen nicht zurückzahlen konnte, hatte sie die Wahl zwischen Zwangsräumung oder in einem Stundenhotel anschaffen.
„So was passiert einfach nicht, Ida. Zumindest heute nicht mehr“, sagte Jimmie. Er sah sie schräg von der Seite an. „Oder?“
Sie drehte eine Wange ins Licht. Sie hatte viel Make-up aufgetragen, aber wir sahen dennoch die Schwellung im Kieferbereich. Es erinnerte an eine Reihe getrockneter Trauben. „Ich habe mit Lou Kale darüber gesprochen, aufzuhören. Er sagte, wenn ich das mache, was sie Spezialdienste nennen, damit sind Mädchen gemeint, die absolut alles machen, dann könnte ich in einem Monat draußen sein“, sagte sie.
„Ist er für die Prellungen in deinem Gesicht verantwortlich?“, fragte Jimmie.
„Nein, das war ein Cop. Er war betrunken. Keine große Sache“, antwortete sie.
Wir waren inzwischen ganz am Ende des Piers, und wir konnten zusehen, wie Möwen Sandgarnelen aus den Wellen fischten. Die Sonne brannte heiß auf die Planken, der Wind wehte, und auf dem Geländer war getrocknetes Blut, wo irgendwer Köder kleingehackt hatte.
„Ein Cop?“, wiederholte Jimmie.
„Die kriegen von Zeit zu Zeit so was wie Freikarten“, sagte sie.
Ich wollte mir das nicht länger anhören. Ich kehrte allein ins Motel zurück. Später hörte ich Jimmie draußen mit Ida, dann fuhren die beiden mit unserem Cabrio weg.
Am nächsten Tag ging Jimmie nicht mit mir zurück zur Arbeit, sondern hing stattdessen mit Ida in Galveston ab. Er kaufte ihr Kleidung und zahlte jeweils vier Dollar für vier Aufnahmen ihrer Songs in einem Tonstudio auf dem Vergnügungspier. Das alles spielte sich zu einer Zeit ab, als wir einen Dollar und zehn Cent die Stunde verdienten für eine Arbeit, die abgesehen vom Bau provisorischer Straßen in den Sümpfen als niedrigste und schmutzigste in der Erdölbranche galt. Außerdem hob er auf der Bank seine Ersparnisse in Höhe von 112 Dollar ab, Geld, das er fürs College zurückgelegt hatte, und gab es Ida. Als ich nach der Tour zurückkam, hätte ich ihn am liebsten k.o. geschlagen.
„Was hat sie damit gemacht?“, fragte ich. Er machte auf dem Boden Liegestütze in Unterwäsche, hatte die Füße auf der Fensterbank abgestützt. Seine schwarzen Haare glänzten, seine breiten Schultern waren glatt wie polierter Marmor.
„Hat’s diesem Typen gegeben, diesem Lou Kale, um ihre Schulden zu begleichen“, erwiderte er. Er nahm die Füße von der Fensterbank und setzte sich auf. Ich hörte, wie draußen die Brandung auf den Strand schlug. „Starr mich nicht so an!“
„Keiner ist so blöd“, sagte ich.
„Wir haben eine ihrer Aufnahmen zu Sun Records nach Memphis geschickt. Da haben auch Johnny Cash und Elvis Presley angefangen. Und auch Jerry Lee Lewis“, sagte er.
„Ja, hab schon gehört, dass es in der Grand Ole Opry jede Menge Auftrittsmöglichkeiten für singende Prostituierte gibt.“
„Warum erweist du nicht wenigstens ab und zu mal anderen Leuten ein bisschen Respekt?“, blaffte er.
War ich für meinen Bruder verantwortlich? Ich beschloss, dass ich es nicht war. Außerdem beschloss ich, dass ich nicht als Geisel der selbst verschuldeten Opferrolle anderer Leute gehalten werden wollte. Ich überließ Jimmie das Cabrio und kehrte nach Louisiana zurück, bis ich wieder mit den anderen auf dem Schiff rausmusste. Ich hoffte, dass Jimmie spätestens nach der nächsten Tour sein Techtelmechtel mit Ida Durbin hinter sich hätte.
Es war ein heißer, windiger Tag, als Jimmie mich am Dock abholte. Ein Sturm braute sich zusammen, und im Süden war der Himmel metallisch blaugrau, die Binnengewässer gelb vom aufgewühlten Sand und die Wellen trugen Schaumkronen so weit das Auge reichte. Jimmie hatte das Verdeck des Cabrios geöffnet, und er grinste mich breit hinter den Sonnenblenden an, als er mich mit meinem Seesack über der Schulter auf sich zukommen sah. Ein Eimer mit eisgekühlten Pearls und Jaxes stand auf dem Rücksitz, Kondenswasser auf den Langhalsflaschen im Sonnenlicht.
„Du siehst glücklich aus“, sagte ich.
„Ida steigt aus dem Milieu aus. Heute Abend hole ich sie aus diesem Haus. Wir gehen nach Mexiko“, sagte er. Er griff nach hinten und zog ein Bier aus dem Eis. Er knackte den Kronenkorken mit einem Flaschenöffner, den er an einer Kordel um den Hals trug, und reichte mir die Flasche. „Hast du nichts zu sagen?“
„Das ist ein bisschen mehr, als ich im Moment mental verarbeiten kann“, meinte ich. „Wie holt man jemanden aus dem Milieu?“
„Ich bin zu den Cops. Wir leben in einem freien Land. Leute können andere Leute nicht zwingen, im Puff zu arbeiten“, sagte er.
Ich begann erst zu sprechen, nachdem er den Motor angelassen hatte und den Parkbereich verließ, während die Sonne die Ledersitze aufheizte und die Palmen im Wind raschelten. „Die Cops, die ab und an Gratisnummern schieben, sind jetzt auf der Seite der Guten?“, fragte ich.
„Es gab tatsächlich kleinere Unstimmigkeiten“, sagte er. „Erinnerst du dich noch an die 112 Mäuse, die Ida und ich diesem Typen gegeben haben, diesem Lou Kale? Er sagt, die Kerle, für die er arbeitet, sehen das als Zins an, womit Ida ihnen die eigentliche Kreditsumme immer noch schuldet. Ich weiß noch nicht genau, wie ich damit umgehen soll.“
Er nahm ein Bier aus dem Halter am Armaturenbrett und trank, während er mit einer Hand lenkte, auf seiner Sonnenbrille die Spiegelbilder von Bäumen, Himmel und Asphalt, die auf ihn zu rasten, wie ein außer Kontrolle geratener Filmstreifen, und er gleichzeitig das Gaspedal durchtrat.
An diesem Abend fuhren Jimmie und Ida mit dem Wagen fort, angeblich, um Lou Kale wegen der 112 Dollar zur Rede zu stellen, die Kale ihnen offensichtlich gestohlen hatte. Ich ging raus aufs Vergnügungspier und aß einen Burrito zum Abendessen. Die Gewitterwolken im Süden knisterten vor Elektrizität und am Horizont konnte ich die Lichter von Frachtern sehen und fragte mich, ob es Jimmie tatsächlich ernst damit war, mit Ida Durbin nach Mexiko zu gehen. In drei Wochen würde das Herbstsemester am Southwestern Louisiana Institute in Lafayette beginnen, wo wir beide eingeschrieben waren. Drei Wochen trennten uns noch von Normalität und Football-Spielen an frischen Samstagnachmittagen, dem Wummern der Blaskapellen, der harmlosen Tanzveranstaltung für Studienanfänger in der Turnhalle, dem Geruch verbrennenden Laubs und Barbecues im Stadtpark auf der anderen Straßenseite des Campus. Im Geiste sah ich meinen Halbbruder samt seinen Illusionen im Treibsand versinken, während Ida Durbin rittlings auf seinen Schultern saß.
Meine eigene Mutter war vor langer Zeit in eine Welt der billigen Bars und noch billigeren Männer verschwunden. Big Aldous, unser Vater, war bei einem Blowout ums Leben gekommen, als ich 18 war. Jimmie hatte keine oder nur sehr wenig elterliche Autorität in seinem Leben kennengelernt, und ich war ganz offensichtlich nur ein minderwertiger Ersatz gewesen. Ich warf meinen Burrito in einen Mülleimer, ging in eine Kneipe am Strand und trank bis zwei Uhr morgens, während Hagelkörner groß wie Mottenkugeln auf die Brandung einprügelten.
Ich wachte vor Tagesanbruch auf, zitterte am ganzen Leib, die verzerrten Stimmen und Gesichter der Leute aus der Kneipe realer als der Raum um mich herum. Ich konnte mich nicht erinnern, wie ich es zurück ins Motel geschafft hatte. Wasser sickerte durch die Zimmerdecke herein und eine Mülltonne flog draußen am leeren Carport vorbei. Ich saß auf der Bettkante, meine Hände zitterten, mein Hals war so trocken, dass ich nicht mal schlucken konnte. Die Vorhänge waren nicht zugezogen, ein enges Geflecht an Blitzen spannte sich auf dem gesamten Himmelsgewölbe über dem Golf. In dem flüchtigen weißen Glanz, der die Wolken und Wellen erhellte, meinte ich einen grün-schwarzen See zu sehen, in den die nackten Leiber der Verdammten bis zur Brust eingetaucht standen und mit aufgerissenen Mündern all jenen zuschrien, die es hören würden.
Zum damaligen Zeitpunkt wusste ich es noch nicht, aber ich hatte gerade meine erste Passage auf der SS Delirium Tremens gebucht.
Ich vergrub den Kopf unter einem Kissen und versank sofort in einem schweißnassen Traum. Das Donnern ließ die Wände wackeln und der Regen peitschte in Strömen gegen die Scheiben. Ich meinte zu hören, wie die Tür aufging und ein jäher Schwall feuchter Luft in den Raum eindrang. Vielleicht war Jimmie zurückgekehrt, sicher und wohlbehalten, und all meine Ängste und Sorgen, die ich mir um ihn gemacht hatte, waren völlig unbegründet gewesen, sagte ich mir im Schlaf. Als ich aber aufblickte, war der Raum still, sein Bett gemacht, der Carport leer. Ich spürte, wie ich in einen Strudel aus Übelkeit und Angst hineingezogen wurde, begleitet von einer Erweiterung der Blutgefäße im Gehirn, was sich anfühlte wie ein Strang Klavierdraht, der mithilfe eines Stocks langsam immer enger um meinen Kopf gezurrt wurde.
Als ich das zweite Mal aufwachte, hörte ich nichts außer dem Regen, der aufs Dach schlug. Das Donnern hatte aufgehört, der Strom im Motel war ausgefallen und das Zimmer lag in absoluter Schwärze. Dann zuckte ein gewaltiger Blitz über den Golf, und ich sah einen Mann auf einem Stuhl sitzen, keinen halben Meter von mir entfernt. Er trug Koteletten und ein gestreiftes Cowboyhemd mit perlmuttfarbenen Druckknöpfen. Seine Wangen waren eingefallen, trugen tiefe Schatten, der Mund klein, voller winziger Zähne. Eine vernickelte Automatik mit weißen Griffschalen ruhte auf seinem Oberschenkel.
Er beugte sich vor, musterte mich aufmerksam und ließ seinen Atem über mein Gesicht streichen. „Wie heißt du?“, fragte er.
„Dave“, antwortete ich. „Dave Robicheaux.“
„Wenn du nicht Jimmie bist, bist du sein Zwilling. Welcher von beiden?“, fragte er.
„Sagen Sie mir, wer Sie sind“, erwiderte ich.
Er hielt die Mündung der Pistole an meine Stirnmitte. „Ich stelle hier die Fragen, Champ. Leg dich wieder hin“, sagte er.
Ich bemerkte eine Schwellung oberhalb seines linken Auges, eine Platzwunde an der Lippe, einen Blutpfropf in einem Nasenloch. Er zog den Schlitten der Pistole zurück und lud eine Patrone in die Kammer. „Leg die Hände aufs Laken!“, befahl er.
Mit einer Hand tastete er meine Knöchel und die Oberseiten der Finger ab, behielt dabei die Augen fest auf mein Gesicht gerichtet. Dann stand er auf, ließ das Magazin aus dem Knauf der Automatik springen und entlud die Patrone in der Kammer. Er griff herüber, hob die Patrone vom Boden auf und ließ sie in seiner Uhrentasche verschwinden. „Du hast ganz schön viel Glück, mein Junge. Wenn du unerwartet eine Auszeit kriegst, ’ne echte Pause, so wie jetzt, dann verplempere sie nicht. Lass dir das von einem erfahrenen Mann sagen“, meinte er.
Dann war er weg. Als ich einen Blick aus dem Fenster warf, war von ihm nichts mehr zu sehen, kein Auto, nicht mal Fußabdrücke im Matsch vor dem Eingang des Zimmers. Ich lag auf dem Bett, eine gallige Suppe stieg aus meinem Magen auf, meine Haut kribbelte, als wäre sie verletzt, und die Bettdecke verströmte den abgestandenen Geruch von Sex.
Es war kaum zu glauben, aber ich schloss die Augen und schlief wieder ein, fast als hätte ich einen alkoholbedingten Blackout. Als ich wieder aufwachte, war es später Vormittag, die Sonne schien, ich konnte von draußen Kinder spielen hören. Jimmie packte einen geöffneten, auf seinem Bett liegenden Koffer. „Dachte schon, du schläfst den ganzen Tag durch“, sagte er.
„Irgendein Kerl hat nach dir gesucht. Ich glaube, es war dieser Zuhälter aus der Post Office Street“, sagte ich.
„Lou Kale? Glaub ich nicht“, erwiderte Jimmie.
„Er hatte eine Kanone“, sagte ich. „Was meinst du mit: ‚Glaub ich nicht‘? “
„Er hat die 112 Mäuse nicht zurückzahlen wollen, die er gestohlen hat. Er hat mir mit einem Messer gedroht. Also hab ich ihn mir zur Brust genommen. Das Geld hab ich ihm auch abgeknöpft“, sagte er. Er ließ seine gefaltete Unterwäsche in den Koffer fallen und drückte sie flach, die Augen immer konzentriert auf seine Aufgabe gerichtet. Ich konnte nicht fassen, was er da gerade gesagt hatte.
„Wo ist Ida?“, fragte ich.
„Wartet am Busbahnhof auf mich. Zieh dich an, du musst mich dorthin fahren. Heute Abend werden wir im guten alten Monterrey mexikanisch essen. Kaum zu glauben, stimmt’s?“, fragte er. Er berührte seine geschwollenen Hände, grinste mich dann an und zuckte mit den Achseln. „Hör auf, dir Sorgen zu machen. Typen wie Kale machen nur heiße Luft.“
Aber Ida war weder am Busbahnhof noch, als die Cops das prüften, in dem Bordell an der Post Office Street. Genau genommen war sie so komplett verschwunden, als wäre sie von der Erdoberfläche abgesaugt worden. Wir kannten weder den Namen ihrer Heimatstadt noch konnten wir mit Sicherheit sagen, dass sie tatsächlich Ida Durbin hieß. Für die Cops waren unsere Besuche auf dem Polizeirevier quasi Belästigungen, und sie sagten, Lou Kale sei nicht vorbestraft, er bestritt, eine Auseinandersetzung mit Jimmie gehabt zu haben und auch, jemals eine Frau namens Ida Durbin gekannt zu haben. Die Prostituierten in dem Haus, in dem Ida gearbeitet hatte, sagten aus, eine Putzfrau namens Connie wäre eine Weile dort gewesen, sei aber zwischenzeitlich nach Arkansas oder Nordtexas zurückgekehrt.
Die Jahre vergingen, und ich versuchte, nicht an Ida Durbin oder ihr Schicksal zu denken. Auf meiner langen Odyssee durch miese Kaschemmen und Ausnüchterungszellen und Nachtclubs jeder Art – im tiefen Süden, den Philippinen und in Vietnam – hörte ich manchmal eine Stimme aus der Musikbox, die mich an Kitty Wells erinnerte. Ich wollte glauben, es wäre Idas Stimme, dass die Vier-Dollar-Platten, die sie und Jimmie an Sun Records geschickt hatten, doch irgendwie ein ganz besonderes Wunder in ihrem Leben vollbracht und ihr in Nashville die Tür geöffnet hatten, und dass sie jetzt irgendwo da draußen war, unter einem anderen Namen, in Raststätten sang, wo als Beweis für Berühmtheit eine Gitarre mit Sunburst-Lackierung und ein mit Pailletten besetztes Western-Kostüm voll ausreichten.
Aber ich wusste es besser, und wenn meine durch den Alk hervorgerufenen Tagträumereien verblassten, sah ich Ida zwischen zwei Männern eingekeilt auf dem Rücksitz eines Autos, das nachts eine unbefestigte Straße hinunterraste, einem Ziel entgegen, das sich kein Mensch je wünschen würde.
3
Beinahe hätte ich Ida Durbin vergessen. Aber eine Unterlassungssünde, falls es das tatsächlich war, kann wie ein rostiger Axtkopf sein, der sich im Kernholz eines Baumes vergraben hat – früher oder später, irgendwann finden ihn die Zähne eines wirbelnden Sägeblatts.
Troy Bordelon war ein übles Arschloch, als ich ihn auf dem Southwestern Louisiana Institute in Lafayette kennenlernte. Das SLI, wie es auch genannt wurde, war das erste College im Süden ohne Rassentrennung. Soweit ich wusste, gab es keinerlei Zwischenfälle, als sich die ersten schwarzen Studenten einschrieben, im Großen und Ganzen verhielten sich Weiße wie Schwarze mit gegenseitigem Respekt. Abgesehen von Troy Bordelon. Sein Name war französisch, aber er kam aus einem kleinen Industriekaff nördlich von Alexandria, einer Gegend, wo die Taten der rassistischen White League und der Knights of the White Camelia in die Geschichte der Reconstruction, des Wiederaufbaus nach dem Sezessionskrieg, mit einem heißen Eisen eingebrannt waren.
Troy hielt die Tradition am Leben.
Ein schwarzer Junge aus Abbeville namens Simon Labiche war der einzige Schwarze in meiner Einheit des Reserve Officer Training Corps. Troy tat alles in seiner Macht Stehende, um Simon das Leben schwer zu machen. Beim Exerzieren trat er Simon immer wieder in die Hacken, brachte ihn aus dem Tritt, raunte ihm ständig rassistische und sexuelle Beleidigungen ins Ohr. Als Simon es ins Drillteam schaffte und im Rahmen der Halbzeit-Feierlichkeiten des Homecoming-Spiels auftreten sollte, spendierte Troy ihm als quasi Friedensangebot einen kalten Drink am Kiosk. Er versetzte das Getränk mit einem hochwirksamen Abführmittel, das bei Rindern massiven Durchfall auslösen kann.
Simon, gekleidet in weiße Leggings, machte sich vor den Augen von 20 000 Zuschauern in die Hose, ließ sein M-1 in den Matsch fallen und flüchtete zutiefst beschämt vom Spielfeld.
Aber Troy beschränkte seine Übergriffe nicht auf Minderheiten. Er tyrannisierte jeden, der eine Schwäche zeigte, und meistens waren das Leute, die Troy an ihn selbst erinnerten. Auch gewann er mit zunehmendem Alter nicht die Weisheit, die es ihm erlaubt hätte, den Ursprung seiner sadistischen Neigungen zu erkennen. Er kehrte in seine Heimatstadt zurück, wo er mit dem Sheriff und dem Gemeinderatsvorsitzenden verwandt war, und nahm eine Arbeit bei einem Finanzunternehmen auf, das sich im Besitz derselben Familie befand, der auch die Baumwollfabrik und die Holzhandlung der Stadt gehörten.
Seine Macht über arme Weiße und Schwarze war gewaltig. Er war großmäulig, herrisch und unermüdlich in seinem Hohn für die Verletzlichen und die Schwachen. Für Troy war ein Gnadenakt eine Identifikation mit seinem Opfer.
Merkwürdigerweise wollte er sich immer auf einen Kaffee oder ein gemeinsames Essen mit mir treffen, wenn er in New Iberia vorbeikam. Ich vermutete, wahrscheinlich war ich für Troy Teil seines selbst gestrickten Erinnerungsschatzes an die Zeit auf dem College in Lafayette, eine Zeit, an die er offenbar voller nostalgischer Wehmut zurückdachte. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich Polizeibeamter war und er die Gesellschaft eines Menschen genoss, der Macht und Autorität repräsentierte.
„Wir hatten echt eine verdammt gute Zeit damals, stimmt’s?“, fragte er und schlug mir kräftig auf den Arm. „Die Tanzabende und alles. Wie wir uns im Wohnheim immer Streiche gespielt haben. Hey, erinnerst du dich noch, wie …“
Ich versuchte dann zu lächeln und gab mir alle Mühe, nicht auf die Uhr zu sehen.
Dann erhielt ich eines schönen Tages, es muss so Anfang Juni gewesen sein, nachdem ich im Iberia Parish Sheriff ’s Department das Handtuch geworfen hatte, einen Anruf von Troys Exfrau, einer Lehrerin namens Zerelda. Jahre zuvor, mit 36, hatte sie bereits wie 60 ausgesehen. Ich konnte mir nicht mal vorstellen, wie sie wohl heute aussah. „Er will dich sehen. Kannst du heute Nachmittag herkommen?“, fragte sie.
„Hat er kein Telefon?“,fragte ich.
„Er ist im Baptist Hospital. Von mir aus kannst du sämtliche Schläuche seines Lebenserhaltungssystems abziehen. Aber die arme Sau hat eine Scheißangst vorm Sterben. Was kann ein frommes Mädchen da schon tun?“, erwiderte sie.
Offenbar hatte Troys Ende mit der neuen Kellnerin im Blue Fish Café begonnen – einer übergewichtigen, grobknochigen Landpomeranze, die sich für den ersten Tag im neuen Job die Lippen knallrot anmalte und die Haare wusch und föhnte. Sie wollte gefallen und hielt ihre neue Anstellung für eine Gelegenheit, Kassiererin oder Hostess zu werden, ein großer Karrieresprung nach ihrem alten Job im Wal-Mart. Als Troy zum Frühstücken hereinkam, steckte er sich im Nichtraucherbereich eine Zigarette an, ließ seinen Kaffee zurückgehen, weil er nicht heiß genug war, und sagte der Kellnerin, auf seinem Besteck befänden sich Flecken von der Spülmaschine. Als sein Essen serviert wurde, beklagte er, sein Steak sei noch rosa in der Mitte, die Spiegeleier zu flüssig, und man habe ihm Vollkorntoast statt des gewünschten Roggentoasts gegeben.
Als die Serviererin sein Wasser verschüttete, fragte er, ob sie ambulante Patientin des Reha-Zentrums für Epileptiker sei. Am Ende seines Frühstücks war sie mit den Nerven völlig am Ende. Als sie sich zum Abräumen über seinen Tisch beugte, erzählte er laut einen derben Witz über eine vollbusige Frau und einen Vertreter für landwirtschaftliche Geräte, der Melkmaschinen verkaufte. Der Kopf des Mädchens leuchtete wie eine rote Glühbirne.
Dann passierte eines dieser Dinge, mit denen kein Mensch je rechnet, schon gar nicht in einer Kleinstadt. Der Inhaber des Restaurants war ein kräftiger, rundlicher Libanese, der regelmäßig die Assembly of God Church besuchte und aufgrund seiner wortkargen Art nur selten Aufmerksamkeit erregte. Ohne ein Wort zu sagen, nahm er einen Becher mit kochend heißem Kaffee und leerte diesen über Troy Bordelons Kopf.
Nachdem Troy aufgehört hatte zu schreien, ging er mit Fäusten auf den Inhaber los, und der Kampf verlagerte sich vom Gastraum in die Küche. Dort hätte es aufhören sollen. Zwei Männer, die ihre besten Jahre längst hinter sich hatten, hätten sich, betreten und verlegen über ihr Verhalten, trennen sollen. Als sie jedoch zu kämpfen aufgehört hatten und ein Friedensstifter beide aufforderte, sich zu entschuldigen, sammelte Troy Blut und Speichel in seinem Mund und spuckte dem Inhaber ins Gesicht. Der Inhaber antwortete darauf, indem er ein höllisch scharfes Fleischermesser viermal in Troys Brust rammte.
Etwa bei Einbruch der Dunkelheit erreichte ich das Krankenhaus in der kleinen Stadt, wo Troy den größten Teil seines Lebens verbracht hatte. Es war ein wunderschöner Abend mit einem hellen Sommerhimmel, auf dem der Mond über Baumwollfeldern und einer langen Reihe zartgrün belaubter Bäume am westlichen Horizont aufging. Die Luft roch nach Kunstdünger, fernem Regen, Nachtblühern und den vor Leben wimmelnden Teichen einer Fischzuchtanlage. Ich wollte nicht in das Krankenhaus gehen. Besuche an Sterbebetten oder von Beerdigungen waren noch nie meine Stärke gewesen, und jetzt, mit fortgeschrittenem Alter, konnte ich zunehmend weniger die selbstsüchtigen Forderungen ertragen, die den Lebenden von den Sterbenden zugemutet wurden.
Troy lag auf seinem Bett in der Intensivstation wie ein schwangerer Wal, der aus großer Höhe fallengelassen worden war. Er trug sein blondes Haar immer noch im Bürstenschnitt der 1950er, nur dass es jetzt steif vor Brandsalbe war. Was seine Exfrau als Lebenserhaltungssystem bezeichnet hatte, war ein Gewirr durchsichtiger Schläuche, Sauerstoffflaschen, Infusionsbeutel, einem Katheter und Monitore, die mich auf den ersten Blick denken ließen, dass Troy dank moderner Technik vielleicht doch noch eine Chance auf eine weitere Runde bekam.
Dann holte er Luft, und ein saugendes Geräusch löste sich aus seiner Brust, wie ich es nie wieder hören wollte.
Er hatte sich in seine Sauerstoffmaske übergeben, eine Krankenschwester wischte ihm Gesicht und Hals ab. Er legte seine fleischige Hand um meine, drückte mit einer Kraft und Stärke zu, die ich in seinem Zustand nicht erwartet hätte.
„Sir, Sie müssen sich vorbeugen, um Ihren Freund zu verstehen“, sagte die Schwester.
Ich hielt mein Ohr dicht vor Troys Mund. Sein Atem traf auf meine Haut wie ein Schwall Faulgase aus einem Kanaldeckel. „’innerst dich noch an diesen Neger … diesen schwarzen Jungen, der, dem wir den Streich mit dem Abführmittel gespielt haben?“, flüsterte er.
„Ja“, sagte ich, obwohl das Wort „wir“ nichts mit den tatsächlichen Ereignissen zu tun gehabt hatte.
„Hab ein total schlechtes Gewissen deswegen. Aber so war’s damals eben, was? Meinst du, er weiß, dass es mir leidtut?“
„Klar weiß er das“, erwiderte ich.
Ich hörte ihn schlucken, der Speichel in seiner Luftröhre machte ein schmatzendes Geräusch.
„Vor vielen Jahren kanntest du mal ein Mädchen, das eine Nutte war“, sagte er. „Die haben sie sich geschnappt. Mein Onkel war Cop in Galveston. Er war einer der Kerle, die sie sich geschnappt haben. Ich hab gesehen, wohin die sie gebracht haben. Ich hab den Raum gesehen, in dem sie war.“
Ich sah ihn an. Er hatte weit auseinanderstehende, runde Augen, sein jugendlicher Haarschnitt und sein schweineähnliches Gesicht wirkten wie eine bizarre Karikatur des Jahrzehnts, dem zu entwachsen er sich nie erlaubt hatte. „Wie hieß das Mädchen?“, fragte ich.
Er leckte sich über den Mund, seine Hand knüllte mein Hemd zusammen. „Ich weiß es nicht. Sie hat ein paar Leuten viel Geld abgenommen. Du und dein Bruder, ihr habt sie aus einem Puff geholt. Also haben die sie sich geschnappt.“
Ich spürte das Hämmern meines Herzens. „Dein Onkel und wer?“, fragte ich.
Er schüttelte den Kopf. „Cops und ein Zuhälter. Sie hatte eine Mandoline. Die haben sie kleingeschlagen.“
„Haben die sie umgebracht?“
„Keine Ahnung. Ich hab Blut auf einem Stuhl gesehen. Ich war ja noch ein Kind. Genau wie du und Jimmie. Was sollte ein Kind denn da schon machen? Ich bin abgehauen. Mein Onkel ist heute tot, vermutlich erinnert sich sowieso außer mir kein Mensch mehr an dieses Mädchen.“
Ich glaube, ich hatte noch nie eine so traurige Gestalt gesehen wie ihn. Seine Augen waren wässrig, eingefallen. Sein Körper war umhüllt von Fett, das ihm die Luft aus den Lungen zu pressen schien. Er ließ mein Hemd los und wartete darauf, dass ich etwas sagte, als ob meine Worte den Dämon vertreiben könnten, der vermutlich sein Leben lang an seiner Seele genagt hatte.
„Ja, wir waren damals alle noch Kinder, Troy“, sagte ich und zwinkerte ihm zu.
Er versuchte zu lächeln, die Haut kräuselte sich um seinen Mund. Ohne seine Zustimmung legte die Krankenschwester ihm wieder die Sauerstoffmaske an. Durchs Fenster sah ich einen Übertragungswagen auf dem Parkplatz, mit dem Logo eines aggressiven Fernsehsenders aus Shreveport auf der Flanke. Falls die Nachrichtencrew allerdings hier war, um über Troy Bordelons Ableben zu berichten, war das für Troy nicht von Bedeutung. Er sah aus dem Fenster auf das letzte rotglühende Stückchen Sonne über dem Horizont. Ein Schwarm Krähen erhob sich von den Ästen einer Sumpfzypresse in einem See, stieg in den Himmel auf wie die Asche eines verloschenen Feuers. Der Ausdruck in seinen Augen erinnerte mich an einen Ertrinkenden, dessen Stimme einen potenziellen Retter nicht erreichen kann.
Wieder draußen ging ich zu meinem Pick-up, den Kopf voll albtraumhafter Bilder davon, wie wohl Ida Durbins letzte Augenblicke gewesen sein mochten. Wie hatte Troy sich ausgedrückt? Er hatte „Blut auf einem Stuhl gesehen“.
„Momentchen, Robo“, rief eine Stimme hinter mir.
Robo?
Sie waren zu zweit, kantige Statur, gut aussehend, militärische Haltung, die Uniformen gestärkt und gebügelt, Sonnenbrillen, obwohl es praktisch stockfinster war, die goldenen Dienstmarken und Namensschildchen blitzblank, die Schuhe auf Hochglanz poliert. Ich hatte sie verschiedentlich bei dienstlichen Treffen in Baton Rouge und New Orleans gesehen. Ich erinnerte mich nicht an ihre Namen, aber dafür an ihr Auftreten. Es war eine Art, die jeder langjährige Gesetzeshüter oder Offizier beim Militär sofort erkennt. Solche Männer ließ man niemals in Situationen kommen, in denen sie unbeaufsichtigt Macht über andere Menschen ausüben konnten.
Ich nickte kurz zur Begrüßung, sagte aber nichts.
„Beruflich hier?“, fragte der eine. Auf seinem Namensschildchen stand Shockly, J. W. Er neigte den Kopf leicht zur Seite bei seiner Frage.
„Ich nicht. Ich mache eine Auszeit“, erwiderte ich.
„Ich hab gesehen, wie du in Troy Bordelons Zimmer gegangen bist. Wart ihr Kumpels?“
„Wir haben zusammen studiert.“
Der zweite Deputy grinste breit hinter seiner Sonnenbrille, als befänden wir drei uns in einem privaten Club und sein völlig unpassender Gesichtsausdruck wäre absolut in Ordnung. Auf seinem Namensschildchen war Pitts, B. J. eingraviert. „Die arme Sau war ein richtig scharfer Hund, stimmt’s? Schätze mal, die Hälfte aller Schwarzen im Parish dürfte jetzt besoffen sein“, sagte er.
„Keine Ahnung“, sagte ich.
„Der alte Troy wollte nicht zufällig all seine Sünden gestehen?“, fragte der zweite Deputy, der namens Pitts.
Shockly zog an seiner Nase, um die Verärgerung über die so unbedachte wie vielsagende Äußerung seines Freundes zu verbergen.
„War nett, euch Jungs zu sehen“, sagte ich.
Keiner der beiden sagte Auf Wiedersehen, als ich weiterging. Als ich schon im Auto saß und einen Blick in den Rückspiegel warf, standen sie immer noch grübelnd auf dem Parkplatz und fragten sich vermutlich, ob sie zu viel oder zu wenig gesagt hatten.
Ich beschloss, dass ich noch einmal mit Troy reden musste, wenn die beiden Sheriff ’s Deputies nicht in der Nähe waren. Ich nahm mir ein Zimmer in einem Motel in der nächsten Stadt und kehrte bei Sonnenaufgang zum Krankenhaus zurück, doch Troy war während der Nacht gestorben.
Ich war Witwer und lebte allein in New Iberia, einer Stadt mit 25 000 Einwohnern am Bayou Teche im Südwesten des Bundesstaats. Jahrelang war ich Detective beim Iberia Sheriff ’s Department und gleichzeitig Besitzer eines Geschäfts für Anglerbedarf mit angeschlossenem Bootsverleih außerhalb der Stadt gewesen. Nachdem jedoch Alafair, meine Adoptivtochter, ausgezogen war und aufs College ging, und das Haus, das mein Vater 1935 gebaut hatte, bis auf die Grundmauern abgebrannt war, verkaufte ich den Laden samt Anleger an einen älteren Schwarzen namens Batist und zog in ein kleines Haus an der East Main direkt am Ufer des Teche in einem Viertel, in dem es Eichen und Pekannussbäume, Azaleen, Mandeleibisch und Philodendren schafften, die verfallene Eleganz einer längst vergangenen Ära sowohl zu verbergen als auch hervorzuheben.
Nach meinem Besuch an Troys Krankenbett bekam ich Ida Durbin nicht mehr aus dem Kopf. Ich versuchte mir einzureden, dass die Vergangenheit vergangen war, dass Ida sich mit brutalen und gewissenlosen Leuten eingelassen hatte, und dass weder ich noch Jimmie für ihr Schicksal verantwortlich waren.
Aber über die Jahre hatte ich viel zu oft miterlebt, wie die Akten von Vermisstenfällen ohne Aufklärung einfach geschlossen wurden. Fast immer ging es um Menschen, die keine Stimme hatten und deren Familien weder Macht noch Einfluss besaßen. Gelegentlich versuchte ein übereifriger Cop, eine Ermittlung aktiv zu halten, ackerte in seiner Freizeit die Unterlagen erneut durch und folgte Spuren, doch letzten Endes schloss auch er früher oder später seinen persönlichen Frieden und versuchte, nicht länger über Stimmen zu grübeln – wie ich es jetzt tat –, die ab und an in unseren Träumen um Hilfe schrien.
Ich hatte keine nachweisbaren Anhaltspunkte, dass tatsächlich ein Verbrechen begangen worden war, nichts außer der Aussage eines von Schuldgefühlen getriebenen Mannes, der sagte, er habe vor Jahrzehnten Blut auf einem Stuhl gesehen. Selbst wenn ich eine Ermittlung beginnen wollte, wo sollte ich denn anfangen? In einer texanischen Küstenstadt, wo die meisten Beteiligten höchstwahrscheinlich längst tot waren?
Ich hatte noch ein anderes Problem. Für einen genesenden Alkoholiker, für einen trockenen Säufer, sind Selbstbetrachtung und Einsamkeit die perfekte Kombination, und für mich war das genau so, als würde ich mir ein Bolzenschussgerät mitten auf die Stirn halten und abdrücken.
Ich mähte das Gras auf meinem Grundstück und harkte danach geschwärztes Laub auf der Schattenseite des Hauses zusammen, um es in einem rostigen Ölfass bei den Eichen unten am Bayou zu verbrennen. Ein Rennboot mit Wasserski im Schlepptau kam vorbei, zog eine schäumende gelbe Furche durch die Mitte des Bayou. Auf der gegenüberliegenden Seite im City Park blühten die Kamelien, Kids spielten Baseball und Familien bereiteten auf den Picknickplätzen das Mittagessen zu. Aber ich konnte die gedrückte Stimmung nicht abschütteln, die wie Spinnweben an mir haftete, seit ich Troy Bordelons Aussage auf dem Sterbebett gehört hatte.
Ich kehrte ins Haus zurück und las die Zeitung. Der Leitartikel war alles andere als unbeschwert. 50 Kilometer außerhalb von New Iberia war die Leiche einer jungen Schwarzen, gefesselt an Handgelenken und Knöcheln, in einem Zuckerrohrfeld gefunden worden, nicht weit entfernt von dem Kloster in Grand Coteau. Ihren Wagen fand man knapp drei Kilometer entfernt neben einem ländlichen Friedhof, wo sie die Grabstelle ihres Bruders besucht hatte. Die Fahrertür ihres Autos war nur angelehnt, der Motor noch im Leerlauf.
Während der letzten sechs Monate hatte man zwei Frauen in Baton Rouge erst entführt und schließlich ihre Leichen in den Sumpfgebieten entsorgt. Der Mord an der Schwarzen in Grand Coteau besaß Ähnlichkeiten mit den Morden in Baton Rouge, nur dass der Mörder, sofern tatsächlich derselbe Täter alle drei Frauen ermordet hatte, zum ersten Mal in der Gegend zugeschlagen hatte, die bei uns Acadiana heißt.
Ein Nachtrag des Zeitungsberichts erwähnte, dass in den letzten zehn Jahren über 30 Frauen in der Gegend von Baton Rouge von unbekannten Tätern ermordet worden waren.
Clete Purcel, mein alter Freund beim NOPD, hatte in New Iberia ein zweites Büro seiner Detektei eröffnet und pendelte nun zwischen hier und seinem Büro an der St. Ann Street in New Orleans. Er behauptete, sich so lediglich einen größeren geschäftlichen Spielraum verschaffen zu wollen, in Wahrheit jedoch war für Clete angesichts seiner durchaus prekären Rechtsposition und seinem Hang, stets das reinste Chaos zu hinterlassen, ein hohes Maß an Mobilität unerlässlich.
Wie viele Cops haben längere Vorstrafenregister als die meisten der Verbrecher, die sie in den Knast schicken? Zu Cletes Possen gehörten über die Jahre: Auf der Herrentoilette eines Greyhound-Busbahnhofs einem Mafia-Killer den Mund mit einem kompletten Spenderinhalt flüssiger Handwaschseife zu füllen, einen betrunkenen Kongressabgeordneten mit Handschellen an einen Hydranten gefesselt auf der St. Charles Avenue zurückzulassen, das Cabrio eines Gangsters mit Beton auszugießen, ein Gangmitglied an den Fußknöcheln von einer Feuerleiter fünf Etagen über der Straße baumeln zu lassen, mit einer Planierraupe kreuz und quer über das palastartige Grundstück von Max Carlucci – eines Paten der Cosa Nostra – am Lake Pontchartrain zu donnern, einem Kinderschänder eine Billardkugel in den Rachen zu stopfen, eine Neunmillimeterkugel in die Schädeldecke eines FBI-Spitzels zu jagen … und außerdem war er höchstwahrscheinlich dafür verantwortlich, dass ein Mafioso aus Galveston namens Sally Dio und mehrere seiner Schläger bei einem Flugzeugabsturz aufgrund von Sand im Treibstofftank ums Leben gekommen waren.