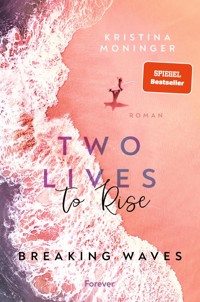9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Breaking Waves
- Sprache: Deutsch
LIMITIERT: Erste Auflage mit Farbschnitt! Fünf Freundinnen. Vier Liebesgeschichten. Eine große Schuld. Lee ist am Ende. Der Traum ist aus, alles ist verloren. Sie lebt auf Hawaii, frisch getrennt von ihrer Freundin Dakota, und kämpft mit den Folgen eines schweren Unfalls, der sie einen Arm und ihre Profisurfkarriere gekostet hat. Am Tiefpunkt ihres Lebens erreicht sie eine beunruhigende Nachricht aus Harbour Bridge. Sie kehrt zurück auf die Insel und quartiert sich im vermeintlich leeren Ferienhaus ihrer ersten Liebe Parker ein. Dass nicht nur Parker, sondern auch Dakota auf der Insel ist, kann sie nicht ahnen … Band 1: Breaking Waves - One Second to Love Band 2: Breaking Waves - Two Lives to Rise Band 3: Breaking Waves - Three Tides to Stay Band 4: Breaking Waves - Four Secrets to Share
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Four Secrets to Share
Kristina Moninger wurde 1985 in Würzburg geboren und hat ihre Kindheit in einem kleinen Dorf auf dem Land verbracht, in dem sie auch heute noch mit ihrem Mann und ihren Zwillingen lebt. Sie hat bereits mehrere gefühlvolle Romane veröffentlicht und ist #1-Spiegel-Bestsellerautorin. Findet man sie nicht am Schreibtisch, dann sehr wahrscheinlich mit der Nase in einem Buch oder mit Familie und Hund in der Natur.
Schwer gezeichnet von einem Unfall versucht Lee, auf Hawaii über die Runden zu kommen. Sie hat das Surfen aufgegeben und sich ans Unglücklichsein gewöhnt, bis sie einen Anruf aus Harbour Bridge bekommt und begreift, dass ihre Vergangenheit sie längst eingeholt hat. Lee hat schon lange mit der Insel ihrer Kindheit abgeschlossen, doch ihre einstigen Freundinnen haben mit ihren Nachforschungen über die verschwundene Josie in ein Wespennest gestochen. Lee will ihre Freundinnen um jeden Preis beschützen und nimmt dafür sogar ein Wiedersehen mit Parker in Kauf, denn sie ist die Einzige, die weiß, was damals mit Josie geschehen ist.
Kristina Moninger
Four Secrets to Share
Breaking Waves
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei Forever Forever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH Berlin
1. Auflage Juli 2024© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung: Favoritbuero GbR - Bettina ArltTitelabbildung: © Wonderful Nature / ShutterstockAutorenfoto: © Wundertoll FotografieE-Book-Konvertierung powered by PepyrusAlle Rechte vorbehalten
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
ISBN978-3-95818-795-5
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Harbour Bridge
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
A Girl Named Josie
41
42
In A Dark Night
Dank
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Harbour Bridge
Harbour Bridge
Prolog
Wir tragen unsere Surfbretter über unseren Köpfen zur Wasserkante. Jede von uns einen Lei – eine hawaiianische Blumenkette – um den Hals. Auch wenn ein Paddle-Out nicht zu unserer Kultur gehört, nicht eine unserer Traditionen ist, so fühlt es sich dennoch richtig an, so zu gedenken. Es ist echter, tiefer, bedeutsamer, als einen Sarg in einem Erdloch zu versenken.
Von jenem Tag im Krankenhaus an war klar, dass es das ist, was wir machen wollen. Unsere Art, uns zu verabschieden, musste mit einem Surfbrett zu tun haben. Mit Wellen und diesem kollektiven Gefühl der Verbundenheit. Zueinander und zur Natur. Wir haben keine Leiche, die wir zu Grabe tragen können. Aber es ist genug, ein Gefühl in unserer Mitte zu balancieren und auf unseren Boards in den Ozean zu paddeln. Nebeneinander schlagen unsere Arme ins Wasser, mit kräftigen Zügen und kosmischer Energie.
In diesem Moment sind wir vereint, begreife ich. Wir sind Familie. Das Zeichen des Respekts ist auch eines von wiedergefundener Schwesternschaft. Jahre und Ereignisse, Geheimnisse und Intrigen haben uns getrennt. Aber hier in unserem tiefen Empfinden rücken wir einander wieder näher.
Es gibt keine Worte für das Gefühl, keine Sprache, die ausdrücken kann, wie ich jetzt und hier zwischen diesen Frauen empfinde. Stumm verständigen wir uns auf den Ort im Wasser, an dem wir innehalten, unsere Boards drehen und einen kleinen Kreis bilden. Wir setzen uns auf, die Beine links und rechts vom Brett, und strecken die Arme aus. Fassen einander mit Händen und Herzen. Die Emotionen in mir schießen wie Wellen durch mein ganzes Sein. Die Wut und auch die Liebe, die Verzweiflung im Vergangenen sowie die Euphorie eines Neuanfangs, die Trauer und die Freude, die Traurigkeit und die Hoffnung. Sie alle finden hier zusammen, schließen wie unsere Körper einen Kreis.
Eine nach der anderen hebt den Lei an, streift ihn langsam und vorsichtig über den Kopf, bereit, ihn in der Mitte unseres Kreises abzulegen. Wir feiern den Abschied, und wir feiern das Leben.
Dann heben wir unsere Stimmen zu jenem Chant, den wir zuvor gemeinsam ausgesucht haben.
Ho ike mai ke aloha. Lass deine Liebe über die ganze Welt fließen und fliege wie ein Vogel.
1
»Na dann, aloha«, murmele ich vor mich hin. Ich sitze auf einem der froschgrünen Stühle, die mein Mitbewohner Qualle vor seiner spartanisch eingerichteten Hütte aufgebaut hat, und beobachte die Truppe, die aus dem Reisebus steigt, der soeben angekommen ist. Die Touris mustern die karge, unaufgeregte Umgebung, die so völlig anders sein muss, wie man sich Hawaii vorstellt. Hier am Kamehameha Highway wehen zwar Palmen im Wind, aber besonders spektakulär ist die Aussicht nicht. Viel mehr als ein paar wettergegerbte, schäbige Hütten, weiße Pavillons mit Surfequipment und zwei Foodtrucks gibt es nicht zu sehen. Auf der anderen Straßenseite befinden sich ein Parkplatz, eine kleine felsige Bucht und Absperrzäune. Der Treffpunkt für die Tour ist mein erster Streich. Aber warum sollte ich auch irgendwohin fahren, wenn die Meute genauso gut zu mir kommen kann? Qualle, der eigentlich Benni heißt, findet mich prätentiös, dabei glaube ich, er weiß nicht mal, was das genau bedeutet.
»Deine Opfer für heute?«, fragt Qualle und drückt mir einen Becher Kaffee in die Hand. »Die Armen.«
»Ach was, selbst gewähltes Leid. Wollen wir wieder wetten?«
»Nationalitäten?«, will er wissen, legt seinen Kopf mit dem schrecklichen Topfschnitt zur Seite und streicht sich über den ebenfalls schrecklichen Schnurrbart. Wie fast jeder hier auf Hawaii hat er vielfältige Wurzeln. Qualle ist ein Baum, dessen Zweige sich in alle Himmelsrichtungen erstrecken. Sein Genpool ist so bunt wie die Auswahl in seinem kleinen Shop.
»Europäer, hauptsächlich Deutsche.«
»Gut, dann sage ich, sie fragen dich bereits nach fünf Minuten.«
»Mutig heute, hä?« Ich grinse ihn an.
»Europäer, Deutsche im Besonderen, sind sehr direkt«, erklärt er.
»Wie viele Deutsche kennst du bitte?«
Qualle zuckt mit den Achseln. »Bestimmt so zwei oder drei. Also, was sagst du? Wann fragen sie dich, wie es passiert ist?«
»Nach der Einführung, kurz bevor wir Pupukea erreicht haben. Ich gebe ihnen fünfzehn Minuten.«
»Einsatz?«, erkundigt sich Qualle und setzt sich neben mich auf einen blauen Liegestuhl, der ebenso billige Plastikware ist wie die Pseudo-Blumenketten der zwei Blondinen, die sich auf der anderen Straßenseite pikiert umsehen.
»Spam Musubi aus dem Waikane Store«, sage ich, ohne nachzudenken.
»Scheiße, Lee, nicht dein Ernst«, schimpft Qualle und spuckt seinen Kaugummi vor mir ins verdorrte Gras. »37 Meilen für ein Stück gegrilltes Fleisch auf Sushi-Reis?«
Ich zucke mit den Achseln. »Gegrilltes, karamellisiertes Fleisch. Und du hast die Nori-Blätter vergessen. Ich lebe für Spam Musubi, nur deswegen bin ich noch auf Hawaii.«
»Wo solltest du denn sonst sein?«, fragt er verständnislos. Die Antwort bleibe ich ihm und mir schuldig. Er hat ja recht, wo sollte ich schon hin. Ob hier oder sonst wo, es ist ja auch völlig egal. Der Ort ändert nichts an der Situation. Ich halte Qualle meine Hand hin, damit wir die Wette besiegeln können. Dann überquere ich die Straße und begrüße die Bustruppe: »Ich bin Lee und euer Tourguide für heute. Ich bin hier geboren, und wenn ihr erwartet, dass ich euch langweilige Facts wie Einwohnerzahlen und Quadratmeter oder so einen Bullshit vorlabere, dann solltet ihr die Tour noch schnell umbuchen. Ich karre euch auch garantiert nicht dahin, wo alle landen, okay? Also wenn ihr in euren angesagten Recycelrucksäcken aus Bananenblättern eine To-do-Liste für O‘ahu habt, dann könnt ihr sie entweder fachgerecht hinter mir entsorgen«, ich deute auf einen Mülleimer am Straßenrand, »oder aber ihr macht zu Hause ein nettes Feuerchen damit. Wer die Hotspots sehen will, kann sich eine YouTube-Doku anschauen. Und nein, bevor jemand fragt, an den Waikiki Beach fahren wir nicht.«
Betretenes Schweigen, kurzes Kichern. Nichts, was ich nicht schon kenne.
Irgendwann im Laufe der Tour, während ich den Touris eine Märchenversion über den Verlust meines linken Arms erzähle, schaue ich aus dem Busfenster hinaus in die Landschaft. Auf die Wellen, die sich unten am Laniakea Beach brechen, der für seine Riesenschildkröten bekannt ist. Blicke auf das satte Grün der sich erhebenden Berge im Hintergrund und auf Häuser, die auf so klangvolle Namen wie Mokuleia und Waialua hören. Und ich wünschte, ich würde etwas spüren oder zumindest die Schönheit der Natur wertschätzen. Aber da ist nichts außer dieser Leere in mir.
»Du bist die mieseste Reiseführerin, die ich kenne«, schimpft Milo, der Busfahrer, dessen pinkes Hemd farblich perfekt auf das Logo von Pearl Travel abgestimmt ist, als ich am Ende der Tour den Bus verlasse.
»Ich nehme das als ein Kompliment«, erwidere ich und versuche zu grinsen. »Übrigens, wusstest du, was Touristen an jedem Ort der Welt gemeinsam haben?«
Milo seufzt. »Sag es mir.«
»Sie sind überall gleich dumm.«
Aber Milo lacht nicht, er mustert mich stattdessen streng. »Lee Baker, meinst du nicht, dass du es etwas übertreibst mit deinem Hass auf die Welt?«
Ich schaue ihn überrascht an. »Ich hasse die Welt nicht, ich liebe sie.«
»Dann liegt es wohl daran, dass du dich selbst nicht liebst.«
Und damit hat er mich zum ersten Mal sprachlos gemacht. Tatsache ist, er hat recht. Ich liebe mich selbst nicht. Nicht mehr.
Qualle sitzt auf der Couch und stopft irgendetwas in sich rein, als ich nach Hause komme. Auf seinem Schoß ruht die Tonschüssel, die Dakota mal angeschleppt hat, als sie in ihrer Töpferphase war. Verfluchte Scheiße, warum gibt es hier immer noch Sachen von Dakota? Als wollte sie uns selbst nach ihrer Abreise noch ständig daran erinnern, dass sie einmal hier zu Hause gewesen ist. Morgen werde ich die Schale nehmen und sie zu dem anderen Nippes in Qualles Shop stellen. So wie ich es mit Dakotas Flossen, ihrem Board und all den anderen Sachen gemacht habe, die sie hiergelassen hat, als gäbe es einen point of return für uns beide. Ich beobachte Qualle. Der Spinner hat sich nicht mal die Mühe gemacht, seinen Wetsuit auszuziehen. Um ihn herum hat sich bereits ein kleiner See gebildet.
»Hey, bandita«, ruft er mir zu. Er findet das witzig, ich nicht, aber Qualle ist der einzige Mensch, der mich so nennen darf.
»Sonst noch jemand da?« Die Frage ist eigentlich überflüssig, weil immer irgendjemand hier ist. Das Haus steht nicht nur bis zum Dach voll mit Surfsachen, Möbeln und allerlei sperrigem Kram, es wohnen auch viel zu viele Menschen hier.
Die beiden hinteren Zimmer des einstöckigen Beachhauses hab ich an drei Typen aus Australien vermietet. Im Wohnzimmer schlafen in unregelmäßigen Abständen zwei Mädels aus Europa, Karina und Mareike. Karina spricht mit einem Akzent, der so sehr nach Averys in ihren ersten Jahren in den Staaten klingt, dass es kaum auszuhalten ist.
Wenn die beiden hier sind, muss sich Qualle auf seiner Isomatte zusammenrollen. Meistens schläft auch noch jemand in der Badewanne. Aber hey, das hier ist Hawaii, wer verbringt hier schon viel Zeit drinnen? Hier sind die Leute am Meer, im Wasser, alles dreht sich ums Surfen und Tauchen. So wie das für mich auch mal war. Als Dakota noch da war, hatten wir auch immer Mitbewohner, nur nie so viele. Doch jetzt verliere ich manchmal selbst den Überblick, wer jetzt wieder wen angeschleppt hat, damit er ein paar Tage hier rumhängen kann.
In der Hochsaison, die gerade beginnt, leben in dem Haus bis zu zwanzig Surfer. Die in den Vans auf dem Parkplatz nicht eingerechnet. Ich hab das echt mal geliebt, jetzt finde ich es zum Kotzen. Am liebsten würde ich sie noch heute alle rausschmeißen. Alle bis auf Qualle. Aber North Shore O‘ahu ist ein teures Pflaster. Jeder Cent an Miete zählt. Und eines muss man den Leuten lassen, sie tun immer noch so, als würde ich dazugehören. Außer Qualle spricht die Tatsache, dass ich seit zwei Jahren, drei Monaten und vierzehn Tagen nicht mehr surfen war, niemand an.
»Du hast schon wieder Post«, reißt Qualle mich aus meinen Gedanken. Er klopft neben sich aufs Sofa, wo ein Stapel Briefumschläge liegt. »Willst du die Briefe eigentlich mal öffnen?«
»Nein«, sage ich. Ich hab wirklich keine Lust, schon wieder Dakotas Entschuldigungsversuche zu lesen oder irgendwelche Liebesschwüre, die mir echt am Arsch vorbeigehen.
»Warum abonnierst du Zeitungen aus South Carolina, wenn du sie dann nicht liest?«
»Hast du etwa meine Post aufgemacht?«
»Ich?«, fragt er unschuldig.
»Sonst wüsstest du doch nicht, dass da Zeitungen drin sind!«
»War nichts Interessantes.«
»Qualle!«
»Was?«
»Schon mal was von Postgeheimnis gehört?«
»Schon mal was davon gehört, dass es so was in einer Kommune nicht gibt?«
»Das hier ist keine Kommune, sondern eine Zweckgemeinschaft.«
Qualle fasst sich theatralisch ans Herz. »Autsch.«
Ich lasse mich neben ihn auf die Couch fallen. Mitten in den Pool aus Meerwasser. Neben die Briefe, die erstaunlicherweise noch trocken sind.
»Ah, und es hat jemand für dich angerufen!«
»Wer?«
»Ich bin nicht rangegangen«, sagt er entrüstet. »Ist schließlich dein Handy. Auch wenn du es ständig hier rumliegen lässt, wie deine Post. Aber den Area Code hab ich mir gemerkt. 843. Wer ruft dich aus South Carolina an?«
Qualle ist einer meiner besten Freunde, wahrscheinlich mein einziger richtiger, seit Parker … und Dakota weg sind. Aber Qualle kennt nicht die ganze Geschichte. Er weiß nicht, dass ich nicht aus San Francisco bin, wie ich gern behaupte, sondern von einer kleinen Insel an der Ostküste komme.
»Sagt mir nichts«, antworte ich schnell. »Bestimmt verwählt.«
Oder? Nach all den Jahren wird sich kaum eines der Mädchen bei mir melden. Ich hab mich ja auch nie gemeldet. Es immer vorgehabt, aber nicht gewusst, was ich sagen soll. Und dann, als ich sie gebraucht hätte, hat es sich undankbar angefühlt anzurufen. Wie wenn man zum ersten Mal in die Kirche rennt, wenn man in Not ist, sonst Gott aber am ausgestreckten Arm verhungern lässt.
Ich brauche keine Gefühlsalmosen. Nicht von Avery, nicht von Odina, nicht von Isa. Vielleicht hat Parker angerufen, flüstert eine leise Stimme in mir. Ganz sicher war es nicht Parker.
»Sag mal, was futterst du da eigentlich? Ist noch was da?«, frage ich Qualle, um mich abzulenken.
»Maiseintopf. Brauchst auch kein Messer dafür«, sagt er und grinst. Als ob ich in den letzten zwei Jahren, drei Monaten und vierzehn Tagen mit Messer und Gabel gegessen hätte.
»Arschloch«, erwidere ich, grinse aber auch.
»Und wer hat die heutige Wette gewonnen?«
»Ich«, sage ich. »War aber knapp.«
»Hat jemand geheult?«
»Nein, aber Milo ist sauer. Ich hab eine von den Chicas bei der Kajaktour umgeworfen.«
»Du hast was?«
»Sie hat sich geweigert, eine Eskimorolle zu machen, also hab ich nachgeholfen.«
Qualle lacht. »Ich verstehe echt nicht, warum sie dir nicht längst gekündigt haben.«
Ich zucke mit den Achseln. »Es ist eine gute Story, alle wollen die Frau, der ein Hai den Arm abgebissen hat.«
»Du bist das Arschloch«, sagt Qualle und lacht so schallend, dass seine Dreadlocks mitwippen.
»Ich weiß«, erwidere ich und nehme ihm die Schale ab. »Bis du mir das Spam Musubi besorgt hast, esse ich den Shit hier.«
2
Ich scheuche ein paar Wildhühner weg, setze mich auf die Treppe, die direkt zur Pipeline führt, und schaue auf die Wellen. Es gibt ein verdammt schönes, verdammt berühmtes Foto von mir auf dieser Treppe. Aus einer anderen Zeit. Einem anderen Leben.
Ein Haus am North Shore, unglaublich, höre ich Parker sagen. Oder habe ich es selbst gesagt, und Parker hat nur die Augen verdreht? Keine Ahnung, warum sich Parker immer noch in meine Gedanken schleicht. Wenn auch nicht mehr ganz so häufig wie in meinen ersten Jahren auf Hawaii … Wenn ich früher aus einer Tube herausgesurft bin, ohne vom Brett zu fliegen, als ich meine erste Sechsmeterwelle gestanden habe, oder im Winter, wenn die gigantischen Swells aus den Tiefen des Pazifiks der Pipeline und ihren drei Riffen zu größter Pracht verhelfen, habe ich stets an Parker gedacht. Ich habe versucht, ihn mir hier vorzustellen. Es ist mir nie gelungen, weil ich seine chirurgisch genauen Carves, seine Eleganz und diesen unbedingten Willen nicht auf einen der unzähligen anderen Surfer projizieren konnte.
Jetzt im Oktober, so kurz vor der Hauptsaison, füllen sich die Strände noch schneller als üblich. Im Winter, wenn die Wellen am North Shore ihren Zenit erreichen, erlebt die Surfwelt regelmäßig ihr blaugrünes Wunder – Pipeline at its best. Einige Surfer sind jetzt bereits im Line-up. In meinem Magen zieht etwas, und instinktiv schiebe ich die Schildkappe tiefer in mein Gesicht. Wie passend, dass die Cap ein Emblem der World Tour von vor zwei Jahren trägt. Jene Tour, die ich so knapp verpasst habe. Ein Symbol für all das, was ich nach dem Unfall verloren habe. Meinen Arm, Dakota, meine Jobs, meine Sponsoren, meine Leidenschaft, eine gute Portion Lebensmut und eben die erste Teilnahme an der Tour. Gewonnen habe ich eine shitty Anstellung als Tourguide, eine Menge Mitleid, Phantomschmerzen, eine Tonne Sarkasmus gemischt mit Zynismus und den Platz auf der Zuschauertribüne. Ich kann es nicht lassen, obwohl es verdammt wehtut, den Surfern zuzusehen, die sich hier Tag für Tag an der Banzai Pipeline in die big waves stürzen. Ich konzentriere mich wieder aufs Meer, das sich zu einem Gebirge aus Blau auftürmt.
Meinen verbleibenden Arm um meine Mitte geschwungen, sehe ich mich um. Aber niemand schaut in meine Richtung. Das Interessanteste an mir – den Armstumpf – verberge ich in dem leeren Ärmel meiner Jacke. Sodass kaum auffällt, dass mir eine Gliedmaße fehlt. Ein Arm macht etwa sechs Prozent des Körpergewichts aus, das hab ich mal gegoogelt. In meinem Fall sind das knapp sechs Pfund. Ganz schön wenig. In etwa so viel wie ein Longboard. Oder die zwei Shortboards, die da vorn am Strand liegen. Und viel zu leicht für mein verkorkstes Leben. Ach, fick dich, Dakota.
Um die Gedanken an meine Ex-Freundin loszuwerden, denke ich lieber wieder an Parker. Parker war immer der Wettkampfkommentator in meinem Kopf.
»Smooth lines.« – »Dieser Turn, absolut episch.« – »Was für ein Biest von einer Welle.« – »Big section, sie fliegt raus, eine Carve und kickt dann raus aus der Sicherheit der Barrel.«
Sobald ich von den Surfern wegsehe, kommen Parkers vorwurfsvolle Klänge durch. Du könntest wieder surfen. Es gibt Boards mit Haltegriff, es ist nicht ausgeschlossen. Sieh dir Bethany Hamilton an, Lee.
Ach, halt die Klappe, Parker.
Auf der stürmischen See paddelt gerade Griffin Chipman raus. Der Kerl ist noch verrückter als ich und scheut kein Risiko, auch wenn er noch verdammt jung ist. Allerdings auch verdammt gut. Chip traue ich mindestens genauso viel zu wie der Frau neben ihm im Line-up. Carissa Moore könnte die erste Olympiasiegerin im Surfen werden. Ich schlucke. Bei den letzten Meisterschaften, mehr als zwei Jahre in der Vergangenheit, als ich nur noch Zuschauerin war, hat sie einen Satz gesagt, den ich nie vergessen werde. »Lee Baker, du wärst in der Lage gewesen, mir den Rang abzulaufen. Es ist eine Schande. Wenn ich jemanden gefürchtet habe, dann dich.« Jetzt fürchtet sich niemand mehr vor mir. Ich fürchte mich höchstens vor mir selbst.
Dennoch kann ich es nicht lassen zuzusehen. Der Anblick ist majestätisch. Ein Surfer nach dem anderen schnappt sich seine Welle und stürzt sich in die grün schimmernden Tunnel, die ich so lange nicht mehr von innen gesehen habe. Ich verharre, bis die Wellen abgeflacht sich und nur noch kooks und Möchtegerns im Line-up sitzen.
»Wie sieht’s aus, bandita, willst du deinen Arsch mal hochbewegen? Die Party geht gleich los. Oder muss ich dir helfen, weil dir neuerdings auch ein Bein fehlt?«, brüllt Qualle mich aus meinen Gedanken.
»Schon gut, du Arschloch, ich komme.«
Oben auf der Terrasse hat sich Kenny, der im Surfschuppen kampiert, seine Klampfe gepackt. Um ihn versammelt sich ein gutes Dutzend Leute. Die alte Lichterkette, die Dakota vor vielen Jahren um die Bäume geschlungen hat, beleuchtet die Szenerie. Bierflaschen werden herumgereicht, und überall sitzen Leute barfuß auf den Holzbohlen. Ein paar Boards lehnen am Geländer, und Neos sind zum Trocknen über die wenigen abgeranzten Terrassenmöbel gelegt. Auch ohne all das Equipment sieht man auf den ersten Blick, dass das hier alles Surferdudes sind. Miguel, einer der Brasilianer, trägt wie immer das seltsame Kopftuch und die breite Brille, ohne die er sich nicht mehr zeigt, seit er für diesen Bildband posiert hat. Er tut gern so, als würde er das ganze Jahr in einem Van leben, statt sich bei mir durchzuschnorren. Mareike lümmelt auf Karinas Schoß, und alles wirkt viel zu sehr nach heiler Familie. Die Szene gräbt ein kleines Loch in meinem Magen. Als hätte ich unstillbaren Hunger. Nach Spaghetti am Spieß. Mein Gott, wie lange ist das her. In letzter Zeit passiert es viel zu häufig, dass die Vergangenheit mich in den Schwitzkasten nimmt.
»Hey, Baker, hast du einen Musikwunsch?«, fragt Kenny, nachdem ich mich im Schneidersitz neben Miguel niedergelassen habe.
Einem Impuls folgend sage ich: »Kennst du das neue von Force of Habit?«
»›One Second‹?«
Ich nicke.
Er grinst breit. »Klar!«
Kenny hat natürlich keine Ahnung, dass ich und Avery jahrelang zusammen gesurft sind. Dass sie einst meine Freundin war. Kein Wort würde er mir glauben, es für eine meiner Storys halten.
»Hol die Ukulele und spiel mit!«, fordert er mich auf.
»Muss das sein?«, erwidere ich so gleichgültig wie möglich, während mein Herzschlag sich seltsam beschleunigt. Ich will den Wunsch gerade zurücknehmen und irgendeinen 90er-Jahre-Punk-Song nennen, aber da hat Kenny bereits die ersten Takte angeschlagen. Und einen Augenblick erlaube ich mir, an Avery zu denken. An Isa. An Odina. Und sogar an Josie.
Qualle nutzt den Moment, holt meine Ukulele und legt sie mir in den Schoß. Das Instrument habe ich, anders als mein Surfboard, nach dem Unfall nicht in die Ecke gestellt. Natürlich kann ich mit meinem Armstumpf nicht greifen, aber ich habe bestimmte Zupftechniken, mit denen ich zumindest ein paar Songs begleiten kann. Ich bemerke, wie alle versuchen, mich nicht anzustarren.
»Noch nie einen Einhändigen Ukulele spielen gesehen, oder was?«, frage ich, doch da hat Kenny schon losgelegt. Er hat eine schöne Stimme, aber sie besitzt nicht Averys raue Sexyness und auch nicht Jakes emotionale Bandbreite. Gänsehaut bekomme ich trotzdem, auch dort, wo ich gar keine Haut mehr habe. Es ist die schlimmste Art von Phantomschmerz, weil es sich so anfühlt, als hätte mein Körper zu wenig Raum für meine Gefühle. Einen Arm zu wenig Gänsehaut.
»Guter Song, wirklich guter Song.«
Mareike rutscht auf Karinas Oberschenkel und verzieht das Gesicht. »Aber was soll das bitte bedeuten: ›We pretended oh so humble, what no one ever was‹?«
»Hast du noch nie so getan, als wärst du jemand völlig anderes?«, zische ich Mareike zu. Ich weiß nicht, ob ich nur nicht ertrage, dass sie diesen so perfekten Song beleidigt, oder aber ob ich nur nicht verstehe, wie jemand dieses Gefühl nicht kennen kann.
»Ne, hab ich nicht«, sagt Mareike.
»Du bist eben ziemlich einfach gestrickt«, kontere ich.
Mareike zuckt zusammen, Karina fängt an, ihren Rücken zu streicheln, und ich muss jetzt auch noch an Dakota denken. Verdammt.
»Qualle, ziehen wir einen durch?«, frage ich und bin schon aufgestanden, ehe er antworten kann.
Wir setzen uns runter an den Strand, und das Marihuana betäubt meinen Schmerz auf angenehme Weise. Es macht meine Gedanken ein paar Gramm leichter.
»Sag mal«, meint Qualle irgendwann. »Was ich schon immer von dir wisse wollte …«
Und dann stellt er mir eine Frage, die mir noch nie jemand gestellt hat. Ich bin Tausende Male gefragt worden, wie ich meinen Arm verloren habe. Vielleicht genauso oft, ob ich danach noch einmal gesurft bin. Ich wurde gefragt, woher ich komme, woher meine dunkle Haut und das vergleichsweise helle Haar stammen, ich wurde gefragt, wie es mich nach Hawaii verschlagen hat, warum ich noch immer hier bin, weshalb ich keine Prothese trage oder ob ich mich noch ohne Hilfe anziehen kann.
Qualle fragt: »Wie bist du eigentlich zum Surfen gekommen?«
Und ich antworte.
3
Siebzehn Jahre zuvor
Die Surfer am Strand von Harbour Bridge waren meine Religion. Ich war elf oder zwölf Jahre alt, ein paar Wochen nachdem meine Mutter mit mir aus einem Vorort von Baltimore auf die Insel in South Carolina gezogen war, als ich die Surfer das erste Mal bewusst wahrnahm. Aus purer Langeweile und aus Heimweh nach meinen Freunden hatte es mich aus der Enge des Trailers an den Strand verschlagen. Da waren zwei Surfer im Weißwasser.
Ihr Anblick fesselte mich so, dass ich mehrere Stunden lang am Pier saß und ihnen zuschaute. Dieses Gefühl, etwas Entscheidendes entdeckt zu haben, diese Gier nach etwas noch nicht Greifbarem war so neu und prickelnd, dass mein Herz zu klein schien, um das Gefühl zu speichern. Mein Kopf zu unerfahren, um es zu benennen. Erst später wurde mir klar, dass ich in diesem Moment zum ersten Mal in meinem Leben Bekanntschaft mit der Sehnsucht gemacht hatte.
Daraufhin zog es mich jeden Tag nach der Schule an den Pier. Nicht immer hatte ich Glück, und erst nach ein paar Wochen verstand ich genug vom Wetter, um einschätzen zu können, ob die Surfer am Pier auf Wellen warteten oder ob die Brandung sie an andere Orte meiner neuen Heimat gerufen hatte. Und irgendwann war es nicht mehr genug, nur zuzusehen. Ich wollte Teil dessen werden.
Zuerst machte ich es wie die anderen Kinder auf der Insel. Ich kaufte mir von dem wenigen Taschengeld, das meine Mutter für mich abzweigen konnte, ein billiges Boogieboard und ließ mich von den schaumigen Wellen ans Land ziehen. Ich lernte, aus einer Unterströmung seitlich herauszuschwimmen, und bekam ein Gefühl fürs Wasser. In der Videothek lieh ich mir Surferfilme von Taylor Steele und versank stundenlang darin. Ich wurde zu einer Besessenen.
Die Frau in unserem Nachbartrailer hatte eine erwachsene Tochter namens Jenny, und weil ich Lords of Dogtown gesehen hatte, schwatzte ich ihr Jennys altes Skateboard ab. Wie die legendären Jungs aus den Siebzigern wollte ich das Surfen auf die Straße übertragen. Hauptsächlich jedoch übertrug ich meine naive Unfähigkeit vom Meer aufs Land und musste feststellen, dass Beton und Wasser sich bei falschem Verhalten gleich hart anfühlten. Am Pier fand ich ein altes, löchriges Shortboard und beschloss kurzerhand, dass es niemand vermissen würde. Ich nannte das Brett »Al« und startete meine Karriere. Die ersten Versuche gingen schief, natürlich taten sie das. Nur weil ich gesehen hatte, wie andere surften, konnte ich es noch lange nicht selbst. Aber ich wollte nicht aufgeben und imitierte einfach alles, was ich beobachtete.
Ich schnappte die Sprache der Surfer auf, murmelte Begriffe wie »A-Frame«, »Windshell«, »Shorebreak« vor mich hin. Mit ihren magisch klingenden Worten eröffnete ich mir eine neue Welt.
Jede Bewegung der Männer und Frauen auf dem Board spielte ich in meinem Kopf hundertfach ab, bevor ich sie selbst ausprobierte. Schulterblicke, Beinhaltung und die Art ihrer Armschläge. Nichts, was ich nicht in mich aufsog und verinnerlichte.
Ich fing an, mir Zinkpaste ins Gesicht zu schmieren, wie die hartgesottenen Surfer, die stundenlang in der Sonne brüteten und sich einen schmerzhaften sunburn ersparen wollten.
Ich lebte für die Momente, in denen die Surfer sich über die Wellen erhoben. Die frühen Morgenstunden, wenn sie sich wie eine ganz eigene Spezies am Strand versammelten oder im Line-up auf Wellen warteten, waren mir heilig.
Ich machte unzählige Anfängerfehler, ohne dass ein Lehrer mich korrigierte. Ich sprang vom Brett, statt onshore zu paddeln. Ich wusste nie, wie weit vorne auf dem Brett ich stehen sollte. Bis mir einer der Locals einen Aufkleber aufs Brett pappte, damit ich mich besser orientieren konnte. Ich zog mir Blutergüsse an den Fußfesseln zu, weil sich die Leash jedes Mal, wenn ich das Board verlor, um mein Bein wickelte und daran zerrte. Mein Körper sah aus wie der eines misshandelten Kindes. Auch die Finne hinterließ blaue Flecken an Armen, Waden und Brust. Immerhin behielt ich meine Zähne. Dank Bash, einem der Locals, der mir zeigte, wie ein Face Cage – jene Bewegung, mit der man die Arme vors Gesicht hielt und sich schützte – funktionierte.
Ich gehörte zwar immer noch nicht dazu, aber zumindest wurde ich akzeptiert, gegrüßt und nicht mehr nur belächelt. Manchmal lieh mir einer der Surfer sein Board, schubste mich in die etwas größeren Wellen oder gab mir einen Tipp. Der Gang zum Pier oder zum Wash-Out wurde eine tägliche Routine, wichtig wie Zähneputzen, notwendiger als Nahrungsaufnahme und bedeutender als alles andere in meinem Leben.
Meine Mutter kommentierte meine neue Leidenschaft kaum. Es war nicht ihre Art, sich zu viele Gedanken zu machen. Sie hatte auch einfach nicht die Zeit dazu. Sie war froh, dass ich einem harmlosen Hobby nachging. In Baltimore hatten wir in einer Gegend gewohnt, die zunehmend von kriminellen Banden kontrolliert wurde. Wenngleich das kleine Häuschen, das meine Mutter von meinen verstorbenen Großeltern geerbt hatte, nett und gutbürgerlich gewesen war, so hatte sich unser Wohnblock verändert. Meine Mutter war mit mir nach Harbour Bridge gezogen, weil sie nicht wollte, dass ich zwischen Drogendealern und Bandenkriegen aufwachsen musste.
Aber auch wenn ich nicht darauf hoffen konnte, von ihr Geld für einen Wetsuit oder ein richtiges, funktionsfähiges Board zu erhalten, unterstützte sie mich nach ihren Möglichkeiten. Sie machte mir keine Vorschriften, wann ich zu Hause zu sein hatte, solange ich anständige Noten mitbrachte. Weil sie ohnehin kaum zu Hause war, führte ich für einen Teenager ein extrem freies Leben.
So erwartete ich auch, niemanden vorzufinden, als ich eines kühlen Oktobermorgens durchgefroren an unserem Trailer ankam und mir den ganzen weiten Weg hoch in den billigen Norden der Insel überlegt hatte, wie ich an einen Neoprenanzug kommen konnte. Doch die Tür stand offen, und ein einziger Blick ins Innere zeigte mir, dass etwas nicht stimmte.
Das Radio lief, was ungewöhnlich war, denn meine Mutter war sehr gewissenhaft, was den Strom betraf. Sie musste doch längst bei einem ihrer Jobs sein. Ich überlegte. Dienstag. Ja, das war der Tag, an dem sie in der Wäscherei arbeitete und mittags Pizza für die Bianchis ausfuhr. An Dienstagen kam sie immer sehr spät nach Hause.
Ich stand unschlüssig vor der Tür, wusste nicht, was ich tun sollte. Im Radio plärrten Brandy & Monica »The Boy is mine«. Ein Einbrecher würde wohl kaum das Radio anschalten.
»Lee?«, hörte ich sie erschöpft keuchen.
»Mom?«
Ich sprang in den Trailer und sah ihren Rücken. Meine Mutter hing gekrümmt über der Kloschüssel. Ich kniete mich hinter sie und legte die Hand zwischen ihre Schulterblätter. »Mom, was ist los?«
Ihr weißer Arbeitskittel war klatschnass. »Mom, was ist passiert?«
Ich versuchte mich zu erinnern, ob ich meine Mutter je krank gesehen hatte. Aber es wollte mir nicht einfallen. Nie hatte ich sie irgendwie schwach erlebt. Keine Erkältung, kein Jammern, nie ein Tag, an dem sie von der Arbeit ferngeblieben wäre.
»Hilf mir hoch, bitte«, stöhnte sie.
Ich sah auf meine Hände, dann auf meine Mutter, auf ihr helles Haar, das an ihrem Nacken klebte, bemerkte auf einmal, wie dünn und ausgefranst es wirkte. Dann endlich griff ich unter ihre Arme. Spürte ihre harten Knochen und hob sie hoch. Ich hatte es mir schwer vorgestellt, aber es war leicht. Viel zu leicht. Mich rückwärts durch den winzigen Gang unseres Wohnwagens bewegend, zog ich sie hinter mir her, bis ich sie an unserem winzigen Tisch absetzte. Kalte Perlen bildeten sich auf meiner Stirn.
»Was ist passiert, Mom? Bist du überfallen worden?« Eine andere Erklärung hatte ich nicht. Im Radio klang rauschend, als hätte meine Anwesenheit im Trailer den Empfang gestört, »My heart will go on«. Wie absurd das alles war.
Mom stützte ihr Gesicht in die Hände. »Ich muss zur Arbeit.«
Ich sah sie an. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen. Zum ersten Mal fand ich meine Mutter alt.
»Aber so kannst du doch nicht arbeiten gehen!«
Mom machte Anstalten, sich zu erheben, aber sie kam nicht hoch. Vorsichtig ging ich vor ihr in die Knie und knöpfte ihr langsam den nass geschwitzten Kittel auf. Wir lebten seit geraumer Zeit auf engstem Raum zusammen, und dennoch hatte ich meine Mutter sehr lange nicht mehr nackt gesehen. Ich erschrak beim Anblick ihrer eingesunkenen Brust und der spitzen Knochen. Mit zusammengepressten Lippen zog ich aus dem Schrank über der Essnische ein frisches T-Shirt heraus. Daneben lag sorgsam gefaltet und gestärkt ein zweiter Arbeitskittel. Ich warf ihn über mein nasses Bikinioberteil.
»Ich übernehme deine Schicht heute«, erklärte ich. Sie wollte protestieren, aber dazu war sie zu schwach. Ich griff nach ihrer Hand, um sie kurz zu drücken.
»Aber du hast Schule«, murmelte sie.
»Mach dir keine Gedanken, Mom. Wir wären heute ohnehin nur ins Museum gegangen.«
Es war eine Lüge. So wie ich die nächsten Tage log, als es ihr nur langsam wieder besser ging und ich jeden Morgen, statt den Weg zur Schule einzuschlagen, meinen Rucksack unter dem Trailer versteckte und mir den weißen Kittel überzog. Um acht Stunden illegal in der Wäscherei zu schuften und das Geld, das es am Ende der Schicht bar auf die Hand gab, ins Portemonnaie meiner Mutter zu schmuggeln.
Es war nur das erste Mal von vielen, die folgen sollten. Meine Kindheit endete an diesem Vormittag, aber ich hatte das Wasser, ich hatte das Surfen, ich hatte meine Wellen. Ich kanalisierte alles in meine Leidenschaft, in den Sport und das Gefühl, einer namenlosen Sehnsucht nachzupaddeln.
Parker lernte ich kennen, weil ich nicht in den Wetsuit pinkeln wollte, den Bash mir geliehen hatte. Am östlichen Ende von Harbour Bridge gab es kaum Dünen, keine Gelegenheit, meine volle Blase zu entleeren, ohne vom gesamten Line-up dabei beobachtet zu werden, wie ich mich komplett entblößte. Also blieb nur das verlassene Beachfronthaus. Die Treppe, die vom Strand nach oben auf die Veranda führte, war marode, und ich rechnete schon fast damit, dass die Tür verschlossen war. Stattdessen stand sie weit offen.
Drinnen waren ein paar Möbel mit staubigen Bettlaken abgedeckt. Auf dem Boden lagen Mäuseköttel, und alles war voller Sand. Inmitten dieses Drecks saß ein Junge.
»Heilige Scheiße!«, rief ich und presste die Hand an die Brust. Das Wasser tropfte mir aus den Haaren und aus dem Anzug. Der Junge hatte die Arme um seine Knie geschlungen und sah mich an, als könnte er durch mich hindurchschauen.
»Was machst du hier?«
»Ich heule«, sagte der Junge mit dem dunkelblonden ohrlangen Haar. Obwohl er da mitten im Dreck saß, waren seine Klamotten sauber und wirkten teuer. In seinem Haar blitzten helle Strähnen, als hätte ihn die Sonne direkt auf den Kopf geküsst.
»Und was machst du hier?«, fragte er.
»Wollte pinkeln gehen«, sagte ich und musterte seine geschwollenen Augen.
»Aha«, brummte er.
»Wir vergießen also beide Wasser«, stellte ich fest. Und sah zufrieden, dass ein winziges Lächeln über sein Gesicht kroch. Es verschwand gleich wieder.
»Ich hab dich hier noch nie gesehen«, sagte er leise.
»Ich war auch noch nie hier zum Pinkeln.«
»Ich meine, auf der Insel.«
»Und?«
Er zuckte mit den Achseln und schaute dann wieder auf den Boden.
»Willst du mir sagen, warum du heulst?«
»Wieso sollte ich?«
Jetzt war es an mir, mit den Achseln zu zucken. »Na ja, vielleicht wird es dann ja besser.«
»Wenn du mir sagst, was du heute getrunken hast, musst du dann nicht mehr aufs Klo?«
»Punkt für dich«, erwiderte ich. »Weißt du, wo das Bad ist?«
Er deutete mit dem Arm in Richtung Flur. »Da vorne.«
Er war noch da, als ich wiederkam. Ich setzte mich neben ihn und hielt ihm meine Hand hin. »Lee. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen.«
Der Spruch gelang mir gut, wie ich fand. Ich war eine höflichere Version von mir selbst. Denk dran, Lee, wie du sprichst. Sonst sehen die Leute nicht nur den Trailerpark, sie hören ihn auch.
Er nahm sie nicht. »Parker«, sagte er schlicht.
»Hi, Parker.«
»Hast du das Klo nicht gefunden?«
»Doch.«
»Warum bist du dann noch hier?«
»Weil ich wissen will, warum du so traurig bist.«
Er sagte nichts.
»Ich weiß schon, du bist eigentlich so ein Megaüberflieger in der Schule und hast heute eine schlechte Note kassiert, deine Eltern sind furchtbar streng, weil sie wollen, dass du mal Anwalt wirst, und jetzt überlegst du, ob du für immer hierbleiben sollst oder es wagen kannst, nach Hause zu gehen und ihnen deine Note zu beichten.«
»Medizin«, gab er zurück.
»Hä?«
»Sie wollen, dass ich Medizin studiere. Und nein, ich hatte noch nie eine schlechte Note.«
»Okay, nice, dann ist es etwas anderes. Du hattest einen Hund namens Heinz, der im stolzen Hundealter von dreiundzwanzig Jahren gestorben ist.«
»Kein Mensch nennt seinen Hund Heinz. Was ist das überhaupt für ein Name?«
»Also kein Hund?«, hakte ich nach.
»Eine Schwester. Namens Mae-Ann. Sie ist nur siebzehn geworden.«
»Fuck, dein Ernst?«, rief ich. »Sorry«, sagte ich etwas leiser.
Er zuckte, als wäre es ihm völlig egal, was ich da eben losgelassen hatte. »Sie mochte es hier. Ich war manchmal mit ihr da, und wir haben uns überlegt, wie die Zimmer aussehen könnten, wenn sie renoviert wären. Aber wir sind nicht fertig geworden. Sie hat sich dann lieber aus dem Fenster gestürzt, als mit mir Farben für das Wohnzimmer auszusuchen.«
Es war eine Weile still, bis auf das leise Tropfen meiner nassen Haare.
»Das ist ein schönes Geräusch«, sagte Parker.
»Vielleicht solltest du es trotzdem einrichten, das Haus. In Gedanken«, schlug ich vor.
»Das geht nicht, ohne sie habe ich keine Ideen.«
»Ich bin gut mit Ideen.«
Parker erwiderte nichts. Aber er sah mich zum ersten Mal richtig an.
»Ich wohne in einem hässlichen Trailer, ich würde gern mal ein richtiges Haus einrichten. Und wir könnten eines der Zimmer besonders schön machen, für deine Schwester.«
»Davon kommt sie auch nicht zurück.«
»Woher willst du das wissen?«
Er sah mich an, als wäre ich der dümmste Mensch auf Erden.
»Sie kann sich ja als Hausgeist hier einnisten.«
»Ich glaube nicht an Geister.«
»Aber es könnte doch sein, oder? Und wenn sie dann hierherkommt, dann soll ihr Zimmer schön sein.«
Parker sagte nichts, aber ich sah, dass sich etwas in seinem Hals bewegte, als wäre da eine ganze Welle voller Tränen, die er schlucken musste.
Ich leckte mir über die Lippen und plapperte drauf los. Weil ich noch nie so einen traurigen Menschen gesehen hatte und weil ich wollte, dass er wieder ein klein wenig lächelte. Wie vorhin. »Wenn ich ein Mädchen wäre, das Mae-Ann heißt, würde ich in einem Zimmer mit einer richtig bunten Tapete wohnen wollen. Dschungelfarben, viel Grün und ein bisschen Rosa. Ein wenig Türkis. Blätter oder Palmen oder so was. Ich hätte gern einen Nachttisch, mit einem abschließbaren Fach. Auf jeden Fall so einen Korb, in den man Klamotten schmeißen kann, und eine Lampe zum Lesen, mit allen Stephanie-Plum-Krimis auf einer Kommode. Die Möbel wären alle weiß, und es gäbe so ein Tablett, damit man im Bett frühstücken kann. Und einen Spiegel wie in einer Theatergarderobe, mit riesigen Lichtern. Der Boden wäre hell, und es gäbe einen flauschigen Teppich. Alles würde zusammenpassen. Nur die Kommode nicht, auf der die Krimis stehen, die wäre knallpink und hätte bunt verzierte Möbelknöpfe.«
Parker war still. Vermutlich hatte ich es mal wieder ein bisschen übertrieben.
»Ich glaube, ich gehe jetzt lieber«, sagte ich.
»Kannst du bleiben?«, murmelte er. »Das klingt schön. Ich würde das Haus gerne mit dir einrichten.«
Ich blieb. Und so trafen wir uns den ganzen Sommer über immer wieder in dem Haus, manchmal auch am Strand. Ein paarmal ging Parker sogar mit mir surfen. Zumindest bezeichneten wir unsere ungelenken Versuche auf dem Board als surfen. So wurde Parker Johnson mein Freund. In so vielen Dingen war er das absolute Gegenteil von mir. Ruhig, wo ich zu laut, nachdenklich, wo ich zu leichtsinnig war. Und so unglaublich klug, wohingegen ich von so vielen Dingen keinen Schimmer hatte. Wir richteten in Gedanken zusammen das alte Haus ein, malten Skizzen, tanzten zu längst vergessenen Songs durch die leeren Räume, flippten Steine über das flache Wasser der Marsch und fischten mit einer selbst gebastelten Angel nach Barschen, die wir auf einem rostigen Grill am Strand anbrieten. Bis die Ferien zu Ende waren und Parker zurück ins Internat musste.
Ich nahm ihn nie mit ins Forest Hill Retreat, den Trailerpark, in dem ich mit Mom lebte, und er sprach nie wieder ein Wort über Mae-Ann.
4
Von meiner Mutter und Parker erzähle ich Qualle nichts. Diesen Teil der Geschichte ertränke ich in Bier. Mit fortschreitendem Abend leert sich die Terrasse allmählich. Ich höre ein verdächtiges Quietschen aus Richtung des Trampolins und will etwas Anzügliches hinüberrufen, aber meine Zunge ist zu schwer. Kenny singt leise »Fuck Fahrenheit«. Es klingt seltsam. So geflüstert und gehaucht, so ruhig am Feuer. Es ist ein Song, der nach Berlin gehört (was für ein Konzert das war, ich wünschte, ich hätte in der Menge stehen können, anstatt es live auf MTV zu schauen), und es sollte verboten sein, ihn so zu spielen, wie Kenny ihn jetzt spielt. Mit dieser unerträglichen Melancholie. Auch der Alkohol in meinem Kreislauf kann nicht verhindern, dass ich knietief in der Vergangenheit versinke. Ich stehe auf, torkele zum Haus und will mich in mein Bett legen. Aber da hat sich schon eine Frau breitgemacht. Ihr Kopf steckt unter meinem leicht angegilbten Kissen (Dakota war diejenige, die bei uns die Betten bezogen hat). Also schaue ich nach, ob die Couch frei ist. Ist sie. Und sogar trocken. Es liegen allerlei Papiere darauf, aber das könnte mir in meinem Zustand nicht gleichgültiger sein. Ich lasse mich einfach fallen.
Und wache Stunden später vom Gegacker der Wildhühner auf. Ich blinzele. Das Sonnenlicht ist ekelhaft hell. »Licht aus«, blöke ich. Der Geschmack in meinem Mund ist kaum zu ertragen, ich werde aufstehen müssen, um Zähne zu putzen oder wenigstens mit Listerine zu gurgeln. Im Bad stütze ich mich auf das Waschbecken und schaue in den Spiegel. Ich erkenne mich nur halb darin, weil der Spiegel am oberen Rand gesplittert und schon ziemlich blind ist. Wie eine Brille, die man zu lange nicht geputzt hat. Mein Anblick erschreckt mich dennoch. »Fuck, Lee, du siehst aus, als hätte dich jemand aufgefressen und danach wieder ausgekotzt«, sage ich laut zu mir selbst.
»Nimm mal den Zettel aus dem Haar, dann ist es schon nur noch halb so schlimm«, kommentiert eine amüsierte Stimme hinter mir. Ich fahre herum und sehe, dass Qualle auf der Toilette hockt und mir mit der leeren Klorolle zuwinkt.
»Ahhh«, schreie ich und verschwinde unter seinem Gelächter aus dem Bad, ohne mir die Zähne geputzt zu haben. Auf dem Weg zurück ins Wohnzimmer zupfe ich mir den Zettel aus dem Haar. Um die Geräusche aus dem Bad zu übertönen, schalte ich den Fernseher ein. Ich zappe durch die etwa dreißig Standardsender, ohne irgendetwas zu finden, das mich interessiert. Dakota hatte ein Hulu-Abo, war bei HBO und Netflix angemeldet, und ich glaube, wir hatten zeitweise sogar Disney Channel.
Ich lande bei einer Sendung über Fixer-Upper, mit einem Typen, der mal als Breezeblock bekannt war und jetzt irgendeinen Sozialbullshit macht. Interessiert mich nicht die Bohne, also drücke ich weiter, bis ich bei einer Nachrichtensendung hängen bleibe.
Ich hämmere so lange auf dem Plus der Fernbedienung herum, bis die Stimme der Moderatorin endlich laut genug ist.
»Heilige Scheiße!«, entfährt es mir, als die Moderatorin sagt: »Alexandra Blythe dagegen ist seit Langem überzeugt davon, dass ihre Tochter tot ist. Ist das mütterliche Intuition, Mrs Blythe? Immerhin haben sie zehn Jahre lang intensiv nach Josephine gesucht?«
Neben mir lässt Qualle sich auf die Couch fallen. »Bist du taub, oder was?«
Er schnappt sich die Fernbedienung und regelt die Lautstärke herunter, ich antworte nicht, sondern starre auf den Fernseher, wo tatsächlich Josies Mutter ein Mikrofon unter die ballonartig aufgespritzten Lippen gehalten bekommt und etwas antwortet, was in Qualles nächstem Satz untergeht.
»Ha, ist doch klar, dass die Alte kein Interesse mehr daran hat, ihre Tochter lebend zu finden!« Qualle will umschalten.
»Warte!«
Ich packe seine Hand und halte sie fest. Gerade wird eine Schätzung über Josies Vermögen eingeblendet. Die Zahlen verschwimmen vor meinen Augen, nichts ergibt Sinn.
»Dass Josie ausgerechnet jetzt, kurz vor Erscheinen der HBO-Dokumentation über ihr mysteriöses Verschwinden vor zehn Jahren, tot aufgefunden wurde, hat eine ganz eigene Ironie, nicht wahr?«, kommentiert Qualle.
Ich nicke wie betäubt.
Aus Alexandra Blythes Augen quellen Krokodilstränen. Aber mir ist, als würde ich sie weinen. Echte Tränen, nicht so ein Fake Shit. Ich wische mir über die Wange. Sie ist nass.
»Hey«, sagt Qualle. »Was ist denn los?«
Ich schaue auf meine Hand, auf die Fernbedienung, mit der ich gerade wieder lauter gestellt habe, blicke auf den Bildschirm, wo die Kamera über kristallklarem Wasser und bewachsenen Felshügeln schwebt und dann zu einer verwackelten Aufnahme von den Überresten eines Rollers auf einer Straße voller Schlaglöcher schwenkt. Neben dem Roller steht ein Lkw, quer über die Straße. Das Bild verändert sich erneut und zeigt eine weiße Plane. Ich blinzele. Keine Plane. Ein Leichentuch.
Die Moderatorin kommt wieder ins Bild, ihr Gesicht ist eine Fratze aus aufgemalten Emotionen. Darunter blitzt Sensationsgier.
»Das ist der Coup des Jahres!«, staunt Qualle. Ich möchte ihn schlagen, möchte die Moderatorin verprügeln, ich möchte, dass das aufhört. In mir krampft sich ein Schmerz zusammen, der so schwer zu ertragen ist, dass ich irgendein Ventil brauche. Ich presse meine Finger um das Plastik der Fernbedienung, lasse los, aus Angst, dann die Bilder und mit ihnen Josie verschwinden zu lassen. Als wäre sie das nicht längst.
»Offenbar hat Josephines Leben ein jähes und brutales Ende auf der philippinischen Insel Palawan gefunden.«
Das alles ergibt keinen Sinn. Josie tot. Palawan. Diese surreal wirkenden Gesichter im Fernsehen. Die Tränen auf meiner Wange. Mein Körper ist zu klein für die Gefühle, die ihn überschwemmen, wie ein unterdimensioniertes Gefäß. Wohin damit?
»Aber auf Palawan kann man doch nicht einmal besonders gut surfen!«, sage ich laut. »Warum war sie nicht auf Siargao?«
Ich bemerke Qualles Seitenblick.
Die Moderatorin beendet ihre künstliche Pause. »Der Unfall ereignete sich bereits vor zwei Wochen, die Neuigkeiten drangen jedoch erst heute über die Nachrichtenagentur AP zu Fox News. Die lokalen Behörden vermelden, dass es sich zweifelsfrei um die seit zehn Jahren vermisste Josephine Blythe handelt. Nicht nur trug sie ihren Ausweis bei sich, Alexandra Blythe hat ihre Tochter vor Ort identifiziert und sie in einer spirituellen Zeremonie beisetzen lassen.«
Beigesetzt? Wie kann sie schon beerdigt sein? Alles krampft in mir, und die Nachricht ist noch nicht einmal ansatzweise dahingesickert, wo ich sie auch gar nicht haben will.
»Mach mal deinen Mund zu, was ist denn los?«
Ich kann Qualle nicht antworten.
»Du heulst doch nicht, oder?«
»Nein«, erwidere ich und wische mir noch einmal über die Wange.
Die Moderatorin gurrt: »Wir melden uns in Kürze wieder mit einem Statement von Meryl Streep, die sich zutiefst betroffen über den Tod ihres Patenkindes zeigt. Bleiben Sie dran.«
Josie.
Tot.
Auf Palawan.
Es klingt wie ein Witz. Wie der Titel eines Low-Budget-Thrillers. Die Headline eines Tabloid Paper. Wie der Ticker der April-Fools’-Ausgabe von News America.
Aber doch nicht wie die Realität, oder?
Das ist doch nicht das Ende? Das kann einfach nicht das Ende sein. So gehen Geschichten nicht aus! Josie ist untergetaucht, vor zehn Jahren. Mit meiner Hilfe, mit der Hilfe von Menschen, die sie geliebt haben. Wirklich geliebt haben. Und auch wenn ich sie seit dem Abend des Festivals nie mehr gesehen habe, hatte ich das Gefühl, an ihrem Leben teilzuhaben. Eine Zeit lang zumindest. Palawan also. Ganz abwegig ist das nicht. Die Postbox, über die wir uns geschrieben haben, ist seit Langem abgemeldet. Ich habe keine Ahnung, wo meine Briefe letzten Endes gelandet sind. Insgeheim wusste ich ja, dass Josie nicht bei Anjali bleiben konnte, dass das auch nur eine Zwischenstation war.
Ich greife mir mit der Hand an den Hals, als könnte ich die Flut an Gefühlen abdrehen, die mich zu ertränken drohen.
Palawan. Philippinen. Ein Roller. Ein Lkw. Und Josie.
Das erfahre ich jetzt also über Fox News. Fuck, Lee, wer hätte es dir auch sagen sollen? Hier ist Josie, calling from heaven, ich bin dann mal tot.
Ob Avery jetzt in einem Tourbus sitzt und die News im Radio hört? Ob Odina in der Mittagspause zwischen zwei Herz-OPs in der Kantine die anderen Ärzte sagen hört: Sie haben die Blythe tot in Palawan gefunden.
Wen?
Na, diesen ehemaligen Kinderstar, der vor Ewigkeiten verschwunden ist.
Nie gehört.
Und Isa? Ich kann mir Isas Gesicht am allerwenigsten dabei vorstellen, wie sie von Josies Tod erfährt.
Der Schmerz macht ein klein bisschen Platz, wird beiseitegedrängt von … einem Gefühl, das ich sofort identifiziere, auch wenn ich es nicht mag. Das ist … Sehnsucht. Weird, sehr weird. Sehnsucht wonach eigentlich? Nach Josie? Nach Odina? Nach Isa? Nach Avery?
»Lee, was ist denn los? Jetzt sag schon!«
Qualles Gesicht ist so nah, dass ich seinen Atem auf der Wange spüre. Ich drücke mit der Fernbedienung gegen seine Brust.
»Qualle, du hast gesagt, eine Nummer aus SC hat mich angerufen, war das eine Frau namens Avery? Oder Isa? Oder Odina?«
»Bin nicht rangegangen«, höre ich ihn ausweichend murmeln.
»Warum ruft mich eine Nummer aus South Carolina an, Qualle? Auf meinem neuen Handy?«, unterbreche ich ihn.
Qualle stockt, und damit ist alles klar.
»Die Briefe …«, fängt er an und windet sich dabei wie eine Schlange. »Vor drei Wochen kam einer, aber du machst die ja nie auf.«
»Oh ja, das kickt total rein, dass du meine Post liest und an Wildfremde meine Handynummer rausgibst.« Langsam werde ich wütend. Was sich zugegeben besser anfühlt als der Schmerz von eben oder die ansonsten vorherrschende ewige Gleichgültigkeit gekoppelt mit meinem Drang zu Sarkasmus, der ja – zu so viel Reflektion bin ich fähig – auch nur eine Kompensation ist für meine Unzulänglichkeiten. Ich schüttele mich. Genug. Ich schreie lieber Qualle an.
Aber der steht plötzlich neben mir, und in seinem Gesicht ziehen sich die Augenbrauen wie Gewitterwolken zusammen. »Wenn ich deine Post nicht öffnen würde, Lee, dann hättest du kein Haus mehr, weil du nie Rechnungen zahlst, wie auch, wenn die Kuverts geschlossen bleiben. Dann hättest du den Gerichtsvollzieher vor der Tür stehen. Das Telefon wäre abgemeldet, das Wasser, der Strom …« Er zählt an seinen Fingern meine Versäumnisse ab.
Auf dem Bildschirm ist die Moderatorin wieder da, und hinter ihr auf einem eingeblendeten Screen ist tatsächlich Meryl Streep zu sehen. Ohne Ton. Als müsste die blöde Flimmerkiste Raum schaffen für das real stattfindende Drama.
Qualle wedelt mit der Hand vor meinem Gesicht herum.
»Reiß dich mal aus deinem Selbstmitleid raus. Du hast alles! Du bist noch da, du hast Freunde, du lebst an der verfickten Pipeline. Du bist am Leben! Du musst nur wieder anfangen, es zu genießen, und nach deinem Glück greifen!«
»Mit links oder mit rechts? Weißt du, das macht einen bedeutenden Unterschied.«
Aber Qualle lacht nicht über meinen lahmen Witz.
»Und offenbar hast du nicht nur hier Freunde, sondern auch dort in South Carolina, auf Haven Bridge …«
»Harbour Bridge«, korrigiere ich scharf. Seltsam, den Namen laut auszusprechen.
Er seufzt. »Auf jeden Fall warten da Menschen, die dich brauchen.«
Ehe ich ihm zuvorkommen kann, hat er nach einem der Briefe gegriffen und hält ihn so hoch, dass ich nicht an ihn rankomme. Failure of my life, dass ich nur knapp über fünf Fuß groß bin.
Qualle räuspert sich und liest vor: »›Liebe Lee, es war wirklich nicht leicht, dich zu finden.‹«
»Lass das, Qualle«, protestiere ich halbherzig.
Unbeeindruckt fährt er fort: »›Du bist also noch auf Hawaii. Und du surfst noch. Wir sehen dich über die größten Wellen reiten und es ist gut und befreiend zu wissen, dass du deinen Traum erfüllt hast. Wir drei, Avery, Isa und Odina, haben durch eine Verkettung von Umständen in den letzten Wochen wieder zueinandergefunden. Wir haben viel geredet, viel über die Vergangenheit, unsere Zeit hier auf Harbour Bridge, aber auch über die Gegenwart. Viel über dich und uns. Lee, wir können die Vergangenheit nicht mehr auf sich beruhen lassen. Und dazu brauchen wir dich. Bitte melde dich, so schnell es geht. Es ist wahnsinnig wichtig. Vielleicht können wir telefonieren. Dann könnten wir es dir besser erklären. Wenn dich dieser Brief erreicht‹«, Qualle bricht ab. »Na ja …«, sagt er etwas kleinlaut. »Ich hab dich immer wieder auf den Brief angesprochen, aber du wolltest ihn ja nicht lesen. Dann war da dieser Moment.« Er beißt sich auf die Lippe. Und ich weiß genau, worauf er anspielt, auf meinen Zusammenbruch vor knapp einer Woche. Ich sehe zur Seite. Will nicht, dass er mich daran erinnert, wie kurz davor ich war, auch den Rest der Tabletten in meiner Nachttischschublade mit Bier und Wein hinunterzuspülen.
»Und dann hab ich dieser Odina eine Nachricht geschickt. An die Nummer, die auf dem Brief steht. Und hab ihr deine gegeben.«
Er schaut jetzt nicht mehr aus wie ein reumütiges Kind, das seinen Spinat nicht essen will.
»Aber du«, seine Stimme wird höher, »gehst ja nicht an dein Handy!«
Ich lasse mich rückwärts auf die Couch fallen. Auf einmal wird mir das alles zu viel. Der Schock über Josies Tod ist überwältigend. Auch wenn ich sie so lange nicht gesehen habe, war sie eine gewisse Konstante in meinem Leben. Zumindest so lange, bis sie dachte, ich hätte ihr Vertrauen missbraucht. Ich bin nicht gut darin, mich um andere Menschen zu kümmern. Es gab auch nie viel Familie in meinem Leben. Nicht wie bei Odina. Keine Geschwister oder Halbgeschwister, wie Avery und Isabella welche haben. Ich weiß nicht, wie Familie geht. Wie man das macht, dass man jahrelang Kontakt hält. Ich hatte immer nur Mom. Und Parker. Bis ich sie beide nicht mehr hatte.
Ich hab das Loch in meinem Herzen, in dem auch meine einstigen Freundinnen stecken, einfach zugeschüttet.
»Ich fühle mich … erdrückt«, stöhne ich.
»Das ist doch ein Anfang«, meint er.
»Sich erdrückt zu fühlen?« Ich linse zu ihm hoch.
»Dass du zugibst, etwas zu fühlen«, korrigiert er. Sein Blick wird dabei ganz weich.
»Und was mache ich jetzt?«
»Ich möchte nicht spoilern, aber ich glaube, du wirst da hinfliegen. Nach Haven Bridge!«
»Sag mal, Qualle, weil ich nie Rechnungen bezahle, müsste ich doch genug Geld für einen Flug nach Charleston haben, oder?«
5
Als der Flieger über O‘ahu abdreht, schaue ich absichtlich nicht aus dem Fenster. Ich erinnere mich noch daran, als ich hierherkam und beim Landeanflug zum ersten Mal diese unwirkliche Landschaft gesehen habe. Den Krater des Diamond Head in Honolulu. Es war mir damals, als würde ich auf dem Mond landen, nicht auf einer Insel mitten im Pazifik.
Warum verlasse ich den Mond, um zurück zur Erde zu fliegen? Ich wünschte, ich könnte wenigstens meine widerstrebenden Gefühle im Orbit lassen.
Ich mustere stattdessen meinen Sitznachbarn. »Du kannst die Armlehne nehmen, ich hab keine Verwendung dafür«, sage ich und deute auf meinen Armstumpf.
Der Mann, Ende dreißig, schätze ich, der eine flatterige Hose mit bunten Mustern trägt, schaut betreten zur Seite. Ich habe ihm so sehr den Wind aus den Segeln genommen, dass er sich jetzt vermutlich nicht mehr traut, mir seine Bordkarte unter die Nase zu halten, um nachzuweisen, dass ich auf seinem Fensterplatz sitze.
Eine halbe Stunde lang herrscht Ruhe, dann wird der Typ neben mir nervös. Wenn er mir schon den Fensterplatz überlässt, glaubt er wohl, Anspruch auf Konversation zu haben.
»Wo fliegen Sie hin?«, fragt er förmlicher, als seine Hippiekleidung es vermuten lässt.
»Nach San Francisco, wie der ganze Flieger«, erwidere ich.
»Äh, ja … und von dort aus? Was machen Sie auf dem Festland?«
»Ich fliege direkt weiter.«
Er nickt wissend und ist kurz davor, seine Story zu erzählen. Die mich nicht weniger interessieren könnte.
»Nach Mexiko«, erkläre ich, bevor er anfangen kann. »Weißt du, ich bin Organspenderin. Beruflich. Einen Arm hab ich schon vertickt, mal sehen, was mir das Cártel de Sinaloa für eine Niere und mein rechtes Bein zahlen kann.«
Er starrt mich mit offenem Mund an, und ich lächele. Ich versuche, nicht daran zu denken, warum ich das letzte Mal O‘ahu verlassen habe. Und wen ich auf der Rückreise kennengelernt habe. Da saß nämlich kein Wannabe-Hippie, der sich am Waikiki Beach vorkam wie die Reinkarnation von Jim Morrison. Sondern Dakota. Allerdings am Fenster. Weil die schlaue, wortgewandte, sexy Dakota sich niemals von jemandem den Fensterplatz wegnehmen lassen würde.
Schnell, ganz schnell schaue ich raus und stelle mir vor, die Wolken da draußen wären Wellen. Und verwerfe auch diesen Gedanken sofort wieder, weil er traurig macht. Du könntest trotzdem weiter surfen. Einen Scheiß kann ich.
Als ich kurz vorm Einschlafen bin, stupst der Typ neben mir mich über die Armlehne hinweg an und sagt: »Das war jetzt aber nicht dein Ernst, mit Mexiko, oder? Weil, ich meine, wenn du Geld brauchst, da gibt es doch andere Möglichkeiten … ich …«
Ich lasse die Schultern sinken, das ist nämlich eines der Dinge, die ich noch beidseitig kann. »Nein, ich fliege nach Charleston, dort treffe ich drei Freundinnen, die ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe, und ich werde ihnen erzählen müssen, dass ich dafür gesorgt habe, dass die Fünfte von uns verschwinden konnte.«
»Wegen dem Arm, den du an die Organmafia verkauft hast?«, erkundigt er sich mitfühlend, und fast muss ich lachen.
»Wegen des Arms«, korrigiere ich seine Grammatik. Sprich anständig, Lee, sonst nehmen dich die Leute nicht für voll. Sonst sehen sie nicht nur, dass du aus dem Trailerpark kommst, sie hören es auch noch.
Alter, jetzt hab ich sogar schon meine tote Mutter im Ohr. Tote Mutter, tote Josie.
»Vielleicht muss ich einfach mal wieder nach Hause«, murmele ich. Genau genommen versuche ich, schon seit Qualle mir den Flug gebucht hat, mir vorzustellen, wie es auf Harbour Bridge sein wird. Den ganzen Weg vom North Shore bis zum Airport habe ich mir verschiedene Szenarien durch den Kopf gehen lassen. Und als meine Tasche auf dem Gepäckband einen Aufkleber mit dem Kürzel SFO erhalten hat, war ich kurz davor umzudrehen, weil es sich so falsch und richtig zugleich angefühlt hat. Wie ein Flug ins Weltall eben. Rein theoretisch weiß ich, wie es da aussieht. Aber es wird trotzdem alles anders sein, als ich glaube.
Jeder Gedanke an Harbour Bridge dreht automatisch eine Schleife in meinem Kopf, bis er immer wieder bei Josie ankommt. Ich ertrage es nicht, es ist zu viel. Also versuche ich, die Erinnerungen an Josie zu überlagern. Und Parkers Leben kann ich mir so gut vorstellen wie eine Folge Friends. Nur ohne Lachkonserven. Parker hat sich mit Sicherheit eine Harvard-Absolventin geangelt, die ein Auslandssemester in Europa absolviert hat und superschlau zurückgekommen ist. Die Ahnung vom Klimawandel und eine Meinung zu Elektromobilität und Waffenlobbyismus hat, die Shakespeare liest statt Evanovich. Er wird ihr dann vielleicht von der wilden Lee erzählen, von dem Mädchen aus dem Trailerpark. Und sie wird ihm den Arm tätscheln, ohne einen Hauch von Eifersucht. Wird sagen: Das klingt so romantisch … Und sich denken: Gut, dass sie absolut keine Konkurrenz für mich ist.
Parker und Mackenzie (sie muss einfach Mackenzie heißen, vielleicht auch Kaitlin) werden geheiratet haben, in einer hippen Zeremonie. Am Strand vermutlich, elegant, in einem schlichten weißen Kleid, deeper Rückenausschnitt, deepe Rede von Parkers Spießerdad. Ich hätte eine Einladung bekommen, hätte er meine Adresse herausgefunden. Ganz bestimmt. Und ich hätte entweder abgelehnt (sehr wahrscheinlich) oder ich wäre als die bemitleidenswerte Lee zurückgekommen. Ich hätte definitiv das Falsche getragen, wie soll man mit einem Arm auch das Richtige tragen. Und Mackenzie hätte mich angelächelt, ihre Hand auf meine gelegt und gesagt: Wir werden bestimmt gute Freundinnen werden. Parker hat mir so viel von dir erzählt.