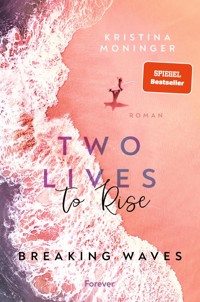9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Breaking Waves
- Sprache: Deutsch
Fünf Freundinnen. Vier Liebesgeschichten. Eine große Schuld. Odina Bianchi hütet viele Geheimnisse. Denn sie hat mit Noah, Averys unverschämt anziehendem Bruder, eine heimliche Affäre begonnen. Noah will mehr, doch Odina kann sich nach der gescheiterten Beziehung mit dem Vater ihres Sohnes auf keinen Mann mehr einlassen. Und Avery würde Odina nie verzeihen, wenn sie Noahs Herz bricht. Außerdem weiß Odina viel mehr über das Verschwinden ihrer Freundin Josie, als sie zugibt. Je mehr Zeit sie mit Isabella und Avery verbringt, desto schwerer fällt es ihr, die Wahrheit zu verschweigen … Band 1: Breaking Waves - One Second to Love Band 2: Breaking Waves - Two Lives to Rise Band 3: Breaking Waves - Three Tides to Stay Band 4: Breaking Waves - Four Secrets to Share
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Three Tides to Stay
KRISTINA MONINGER wurde 1985 in Würzburg geboren und hat ihre Kindheit in einem kleinen Dorf auf dem Land verbracht, in dem sie auch heute noch mit ihrem Mann und ihren Zwillingen lebt. Sie hat bereits mehrere gefühlvolle Romane veröffentlicht. Findet man sie nicht am Schreibtisch, dann sehr wahrscheinlich mit der Nase in einem Buch oder mit Familie und Hund in der Natur.
Fünf Freundinnen. Vier Liebesgeschichten. Eine große Schuld.
Odina Bianchi hütet viele Geheimnisse. Sie hat mit Noah, dem unverschämt anziehenden Bruder ihrer besten Freundin Avery, eine heimliche Affäre begonnen. Noah will mehr, doch Odina kann sich nach der gescheiterten Beziehung mit dem Vater ihres Sohnes auf keinen Mann mehr einlassen. Und Avery würde Odina nie verzeihen, wenn sie Noahs Herz bricht. Außerdem weiß Odina viel mehr über das Verschwinden ihrer alten Freundin Josie, als sie zugibt. Je mehr Zeit sie mit Noah und Avery verbringt, desto schwerer fällt es ihr, die Wahrheit zu verschweigen …
Band 1: Breaking Waves - One Second to LoveBand 2: Breaking Waves - Two Lives to RiseBand 3: Breaking Waves - Three Tides to StayBand 4: Breaking Waves - Four Secrets to Share
Kristina Moninger
Three Tides to Stay
Breaking Waves
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei Forever Forever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH Berlin
1. Auflage März 2024© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung: Favoritbuero GbR - Bettina ArltTitelabbildung: © Wonderful Nature / ShutterstockAutorinnenfoto: © Wundertoll FotografieE-Book powered by pepyrus
ISBN 978-3-95818794-8
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Epilog
DANK
Leseprobe
Lee
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Für Maex, meinen Jungen
Motto
We are so lightly here It is in love that we are made,in love we disappear
Leonard Cohen
Prolog
Zehn Jahre zuvor
Der Leuchtturm ragte schemenhaft vor mir auf, ein unheimlicher Riese, der nur noch zum Schein über die Bucht wachte. Längst war er nicht mehr funktionsfähig, sein Licht erloschen. Ich drehte mich von dem bedrohlichen Anblick weg, das Meer im Rücken, und sah den sandigen Pfad hinauf, den ich selbst genommen hatte. Der Mond allein reichte nicht aus, um den Weg zu beleuchten. Die Scheinwerfer eines Wagens würde ich von Weitem erkennen können. Wie wollte Josie überhaupt hierherkommen? Würde sie sich von einem ihrer Bodyguards fahren lassen?
Fünf Minuten vor zehn.
Wir würden eine Lösung finden. Ganz sicher. Wir waren Freundinnen. Sie konnte mir vertrauen. Aber wo blieb sie? Die Stille um mich herum war beinahe gespenstisch.
Zwei Moskitostiche am Oberarm. Aber keine Josie.
Ich knipste die Taschenlampe an, konnte jedoch nichts sehen. Bei jedem leisen Geräusch, jedem einzelnen Rascheln, das die Stille unterbrach, zuckte ich nervös zusammen.
»Josie, bist du das?«
Keine Antwort.
Fünf Minuten nach zehn.
War Josie eigentlich eher der pünktliche oder der unpünktliche Typ? Es wollte mir nicht einfallen.
Zehn Minuten nach zehn.
Schweiß auf meiner Stirn. Es war still, nichts als das dumpfe Schlagen der Wellen gegen den Strand.
Fünfzehn Minuten nach zehn.
Ein dritter Stich auf dem anderen Arm und ein verdammt schlechtes Gefühl. War sie aufgehalten worden? Ich checkte noch einmal mein Handy, als hätte ich das nicht ohnehin minütlich getan. Kein Anruf, keine Nachricht von Josie. Nur eine SMS von meinem Bruder.
Andrea: Bist du zu Hause???
Eilig tippte ich: Ja, liege im Bett. Lass mich schlafen
Zwanzig Minuten nach zehn.
Fast schon wünschte ich, sie würde mir ihre Hand von hinten auf die Schulter legen und mich erschrecken. Laut lachen, während ich fluchen würde.
Ich wählte Josies Nummer. Mailbox. Die Stiche juckten. Ich wollte nicht mehr hier sein. Meine Arme waren kalt, auf meiner schweißnassen Stirn klebten feine Härchen. Ich dachte an Josies grüne Strähnchen, an Averys Kreolen. Und verfluchte mich.
Warum hatte ich den anderen nichts gesagt? Wir hätten gemeinsam herfahren oder nach Josie suchen sollen. Sie würde noch kommen. Ganz sicher.
Das Handy piepste, und ich zuckte zusammen.
Andrea: Josie ist verschwunden! Wusstest du das? Sie suchen nach ihr.
Ich drückte die Nachricht weg. Antwortete nicht. Was sollte ich auch sagen? Ja, das war der Plan, ich warte am Leuchtturm auf sie?
Elf Uhr und immer noch keine Josie.
1
Vor dem Polizeirevier in Charleston hängen die Fahnen reglos. Erstarrt wie Papierfähnchen auf einer Geburtstagstorte. Holden Kaine, der Polizist mit dem dunklen krausen Haar, lehnt erschöpft an seinem glänzenden Dienstmotorrad und erwidert freundlich unseren Gruß. Er lebt ebenfalls auf Harbour Bridge, und wir kennen uns noch aus Schulzeiten. Kaum vorstellbar, sich bei dieser Gluthitze auch noch einen Helm aufsetzen zu müssen. Allein die Uniform erscheint mir bei diesen tropischen Temperaturen wie eine Zwangsjacke.
Wir warten schon seit einer halben Stunde vor dem Revier auf Isabella. Weder Isas Mutter noch Avery oder ich können in Ruhe auf der Bank im Schatten ausharren. Immer wieder gehen wir vor dem Revier auf und ab, begleitet von den wachsamen Augen Holden Kaines.
Und dann endlich sehen wir Isa. Mit energiegeladenen Schritten verlässt sie die City Hall und geht auf uns zu. Ihr Blick sucht meinen, und sie fängt zaghaft an zu lächeln. Ich erwidere das Lächeln, das sich wie eine Umarmung anfühlt. Es gibt allen Grund dazu. Denn Isa hat sich überwunden und ihren Peiniger angezeigt. Endlich hat sie sich den Geistern der Vergangenheit gestellt, und ich bin mir sicher, dass ihre Wunden jetzt schneller heilen werden.
»Isa, ich bin so unglaublich stolz auf dich«, sage ich, als sie bei uns ankommt. Auch wenn sie diesen schrecklichen Tag, an dem der Regisseur Wellington Josie und sie missbraucht hat, nie vergessen wird, so kann sie nun vielleicht irgendwie damit abschließen. Eine Erinnerung daraus machen, die sie nicht mehr bei jedem Schritt begleitet.
»Und jetzt finden wir Josie«, erklärt Isa uns ungewohnt laut. Ihre Mutter sucht unseren Blick. Avery will etwas sagen, aber schließt den Mund wieder.
»Sie lebt noch, da bin ich mir jetzt sicher!«, verkündet Isa und hakt sich bei Avery ein. »Du hattest recht, Odina, wir müssen sie suchen. Wir dürfen sie nicht aufgeben.«
Isas Worte wirken bei mir wie eine Notbremse. Alles in mir kommt ruckartig zum Stehen. Meine ehrliche Freude über ihren Mut. Denn da ist mehr. Da ist ein riesiger Batzen halb garer Gefühle. Mein Verstand jubelt mit Isa. Mein Herz sagt mir, ich solle mich schämen.
»Schau nicht so, Odi! Alles ist gut.« Isabella drückt meine Hand. Wahrscheinlich weil sie mein schlechtes Gewissen für Sorge hält.
»Es wurde noch eine Anzeige gegen Wellington erstattet!« Ihre Stimme springt Trampolin. »Noch eine, verstehst du?«
Ich nicke langsam. Auch wenn ich das Blitzen in Isas Augen nicht ganz nachvollziehen kann. Ist das nicht eine schlechte Nachricht? Noch jemand, der unter Wellington gelitten hat? Warum freut sie das so?
»Hörst du mir zu?«
»Ja«, sage ich abwesend und schaue die Straße entlang. Die Luft ist statisch aufgeladen und flirrt wie in einem alten Westernfilm. Die Hitze ist kaum zu ertragen. Ich will zurück nach Harbour Bridge. Zurück ans Meer, wo die stete Brise die Sommertemperaturen von South Carolina viel erträglicher macht. »Natürlich höre ich dir zu, Liebes.«
»Am Jahrestag ihres Verschwindens hat Josie ihn angezeigt. Wenn das kein Zeichen ist.«
Ich horche auf.
»Wirklich?«, nimmt Avery mir die Frage vorweg.
»Ja!«
Ich bleibe stehen, bemerke zu spät, dass Isas Hand dabei aus meiner rutscht. »Und es war sicher Josie? Warum hat sie uns denn dann nicht kontaktiert?«
Es zuckt kurz in Isas Gesicht.
Ich schiebe schnell nach: »Dann müssen wir nur noch ihre Kontaktdaten herausfinden.«
»Hab ich schon! Also, ich weiß, wo die Anzeige erstattet wurde. Einen Namen habe ich nicht gesehen. Aber wer sollte es sonst gewesen sein, wenn nicht Josie? Ich meine, ausgerechnet an diesem Tag, zehn Jahre nach ihrem Verschwinden. Wir müssen dahin fahren. Gleich morgen.«
»Und wenn nicht? Wenn das alles nur ein Zufall ist?«, fragt Avery.
»Zufall? Die Zeitungsannoncen im Harbour Chronicle, mit Details aus unserer Vergangenheit, die nur wir kennen können? Und die andere Anzeige, die auf den Tag genau zehn Jahre nach Josies Verschwinden erstattet wurde?«
»Nein«, sage ich langsam. »Ich glaube auch nicht, dass das alles nur Zufall ist. Aber wie machen wir weiter?«
Über Isas Gesicht huscht ein so lebendiger Ausdruck, dass sie einen Moment lang völlig verändert wirkt.
Sie will nach ihr suchen. Das ist doch auch genau das, was ich ihr schon so lange klarmachen möchte.
»Ich bin doch nicht umsonst in ein Haus eingebrochen und hab nach Beweisen gesucht. Die haben uns jetzt nicht direkt weitergebracht. Jesper hat ein Alibi. Aber immerhin wissen wir, dass er ein Stalker ist, der seinen kranken Mist in Ordnern sammelt«, sagt Avery, ruhig, aber bestimmt. Isas Mutter blickt einigermaßen schockiert.
Ich stimme Avery eilig zu. »Du hast recht. Wir haben tagelang befürchtet, Josie läge im Moss Lake begraben. Keine von uns wird das je vergessen. Wir müssen die Wahrheit herausfinden.« Ich will das hier. Ich will diese Suche. Ich brauche diese Suche. Ich muss Josie finden. Einen anderen Weg sehe ich nicht. Denn die Zeit läuft mir davon.
»Ich fahre dorthin, je schneller, desto besser!«, erklärt Isa aufgeregt. »Was meint ihr, Ave, Odina, würdet ihr mitkommen?«
»Wohin?«
»Nach Thousand Oaks. Dort wurde die Anzeige erstattet.«
»Thousand Oaks in …?«, fragt Avery.
Isa zuckt mit den Schultern und sagt vorsichtig: »Kalifornien.«
Ich ziehe scharf die Luft ein, während Avery keine Miene verzieht.
»Ich würde wirklich gerne helfen, meine ich. Mitkommen, aber …« Ich sehe Isa an, die offensichtlich nicht begreift. Wie auch. »Isa, ich kann nicht einfach so nach Kalifornien fliegen!«
Ich sage nicht, dass ich dafür das Geld nicht habe. Unmöglich, einen Flug nach Kalifornien zu bezahlen, ohne … Ich schiebe den Gedanken beiseite und füge schnell hinzu: »Mit Jamie, ich meine, wie soll ich das machen?«
»Könnte Jamie nicht …«, Isa bricht ab, sucht wieder nach meiner schlaff herabhängenden Hand. Drückt sie. Ich bin erleichtert, dass sie nicht vorschlägt, ich solle doch Wilson auf Jamie aufpassen lassen. Wir sind noch lange nicht so weit, all unsere Geschichten zu teilen, aber trotz der vielen Jahre haben wir ein gewisses blindes Verständnis füreinander nicht verloren. Darüber bin ich sehr froh. Denn es gibt so viel zu erklären, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll.
Weil Avery der Ansicht ist, dass wir Isas Sieg über die Dämonen ihrer Vergangenheit nur auf eine Weise feiern können – gemeinsam surfen –, sitzen wir am nächsten Morgen nach einer Stunde in den Wellen am Strand und teilen uns eine riesige Portion Pancakes. Rhonda White höchstselbst hat sie eingepackt und kleine Schälchen mit Puderzucker, Marmelade und Sirup beigelegt.
Wir schauen ein paar Jugendlichen zu, die noch im Wasser sind und emsig trainieren, während wir hungrig über unser Frühstück herfallen.
»Bald finden wieder die Mid-Atlantic Regionals statt«, sagt Isa und deutet auf eines der Mädchen im Wasser. »Gar nicht schlecht, was sie da macht.«
»Wisst ihr noch, wie sauer Lee damals war, weil Celeste den Heat gewonnen hat?«, erinnert sich Avery.
»Ich werde nie vergessen, wie sauer du auf Josie warst wegen Jake«, bemerkt Isa.
Avery räuspert sich. »So peinlich im Nachhinein. Wie vieles ich jetzt ganz anders bewerten würde.«
Dann sehen beide mich an.
»Was?«
»Auf dich war nie jemand sauer, du warst, nein, du bist die Verlässlichste unter uns.«
Isa nickt bekräftigend. Avery rutscht näher und legt mir ihre Hand auf den nassen Oberschenkel. »Ich bin so froh, dass wir uns wiederhaben. Ich meine, Odi, du hast dir auch früher schon immer mehr Sorgen um andere gemacht als um dich selbst. Du warst immer die Anständige, die Ehrliche, die Zuverlässige.«
»Wir mussten erst erwachsen werden, Odina wusste schon als Teenager, was richtig und falsch ist.«
Beide lächeln mich warm an. Mir wird kalt.
Ich will etwas Gegenteiliges sagen, aber da kommt kein Ton aus meiner ausgedörrten Kehle. Verdammt, fühlt sich so ein unverdientes Lob schlecht an. Ehrlich. Zuverlässig. Anständig.
Wenn sie wüssten …
Ich will aufstehen, mich abwenden, aber selbst dazu bin ich zu feige. Also lächele ich müde und stopfe mir noch einen Pfannkuchen in den Mund. Was ich hier esse, spare ich mir zu Hause.
»Sei doch nicht so bescheiden, Odi. Du kannst das ruhig mal annehmen. Ohne dich wäre unser Kleeblatt schon viel früher zerbrochen. Du warst immer der Kitt, der unsere Freundschaft zusammengehalten hat.«
Avery stupst mich an, grinst. Weil sie keine Ahnung hat, dass ich vielleicht mal der Kitt war, aber dass es ohne mich auch nicht zum Riss gekommen wäre. Ich bin erleichtert, als Avery kurz darauf das Thema wechselt und über ihre Fortschritte im Songwriting erzählt, die neuen Songs, die sie und Jake schreiben, und wie gut es tut, all die Emotionen der letzten Jahre, die vielen Missverständnisse zwischen ihnen, in Worte zu fassen.
»Wenn Jake und ich mal unterschiedlicher Meinung sind, schreiben wir jetzt einfach wütende Duette«, erklärt sie glücklich.
»Wenn wir streiten, reißen Preston und ich im wahrsten Sinne des Wortes Wände ein«, erklärt Isa lachend, und dann folgt ein kurzer Seitenblick auf mich.
Was soll ich sagen? Wenn mein Ex und ich streiten, muss ich aufpassen, dass ich mir keine einfange?
Natürlich spreche ich den Gedanken nicht laut aus, denn wenn ich schon keine grundehrliche, zuverlässige, anständige Freundin mehr bin, dann doch eine, die ihren Liebsten alles Glück der Welt gönnt.
Was sollte ich aktuell auch mit einem Mann? Wo soll der reinpassen zwischen Finanzsorgen, drohender Obdachlosigkeit, zwei Jobs, Jamie und diesem ganzen verdammten Chaos um Josie.
»Lass mal einen von den neuen Songs hören, Ave«, fordere ich sie auf, um abzulenken.
»Warum kommst du nicht mit Jamie heute Abend mal vorbei? Ein Abend unter Freunden, wir quatschen, essen, machen ein bisschen Musik – Sammy und Rodriguez sind noch da, wir spielen euch die neuen Sachen vor, und dann verbannen wir die Männer, chillen auf der Terrasse und erzählen uns Storys von früher?« Avery strahlt übers ganze Gesicht, und Isa klatscht kurz in die Hände.
»Ja, unbedingt!«
Später bin ich so müde von der Schicht im Krankenhaus, dass selbst das Öffnen der Haustür schon fast zu viel ist. Mama sieht auf und wischt sich die Hände an der Schürze ab, auf der kleine Tomaten abgebildet sind. Dann geht sie auf mich zu, legt ihre beiden Hände an meine Wangen und drückt mir einen Kuss auf die Stirn. »Tutto bene, topolina?« Alles in Ordnung, mein Mäuschen?
»Si, Mama«, sage ich. »Tutto bene.«
Sie mustert mich, während sie ihre Hände noch immer an meine Wangen hält. Dann lässt sie mich los, und um ihre Augen herum explodieren die kleinen Fältchen, als sie lächelt.
»Keinen Satz glaube ich dir«, sagt sie in diesem melodischen Tonfall, der ihr Englisch wie an den Kanten geschliffen klingen lässt. Ein wenig beneide ich sie um ihren Akzent. Ich habe fast keinen, wenn ich Englisch spreche, nur einen deutlich hörbaren, wenn ich in meine Muttersprache verfalle. Irgendwie finde ich das traurig, als hätte ich die Heimat gegen die Wahlheimat getauscht und die Gelegenheit verpasst, mir wenigstens eine der beiden Sprachen ganz zu eigen zu machen.
»Kein Wort«, korrigiere ich sie. »Ich glaube dir kein Wort, sagt man.«
Mama winkt ab und geht mit schwingenden Hüften an mir vorbei, um sich auf den Küchenstuhl zu setzen, den mein Bruder Andrea und ich immer noch den Beichtstuhl nennen. Hier saßen wir, mit aufgeschlagenen Knien, wegen schlechter Noten, nach ertappten Schwindeleien, geschwänzten Kirchgängen und manchmal auch, wenn wir um Taschengeld gebettelt haben. Auf diesem Stuhl wurde geweint, getröstet, gebockt, geschimpft, verziehen und eben auch gebeichtet.
»Bald ist es so weit«, sagt sie. »Unsere Abreise steht bevor.«
Ich nicke langsam. Ich kenne das Datum natürlich, ich habe die Flugtickets gesehen, die sie seit drei Wochen in der Schublade mit den Heftpflastern versteckt. Der Tag, an dem meine Eltern das Land verlassen werden, liegt lächerliche sechs Wochen entfernt. So nah ist die Zukunft, in der dieses Haus jemand anderem gehören wird. Meine Eltern erfüllen sich den Traum von der Rückkehr nach Italien. Und ich bleibe hier.
»Du kannst mitkommen, immer noch, Odina!«, sagt sie und sieht mich an. Sie hat ihre fleischigen Hände über dem Bauch gefaltet. Die stets rot lackierten Fingernägel Ton in Ton mit den Tomaten auf ihrer Schürze.
»Ich weiß, Mama. Aber es geht nicht. Ich bleibe Jamies wegen hier.«
»Jamie liebt Italia«, behauptet Mama.
Ich seufze innerlich. »Jamie war ein einziges Mal in Italien, Mama. Da war er zwei Jahre alt. Er kann sich nicht mehr daran erinnern. Er ist Amerikaner. Ich kann ihm nicht seine Heimat nehmen.«
So wie ihr mir, füge ich im Stillen hinzu.
»Madonna mia, du machst problema, wo keine sind, topolina.«
»Sein Vater lebt hier, Mama.«
Noch ehe ich weitersprechen kann, schnaubt sie: »Pezzo di merda!«
»Ja, Wilson ist ein Mistkerl, aber er ist Jamies Vater. Hier sind seine Freunde, seine Schule. Er kann nur ein paar Brocken Italienisch. Was soll er denn in Europa? Es ist ihm fremd. Man kann Heimat nicht vererben, Mama.«
»Dein Englisch war auch nicht so gut, als wir gekommen sind.« Sie hebt die Hände und macht eine verzweifelte kreisende Bewegung.
Eben, will ich sagen. Genau deswegen. Ich will nicht, dass mein Sohn das Gleiche erleben muss wie ich. »Basta, Mama! Ich komme schon zurecht.« Ich vermeide, jetzt auch noch die Tatsache anzusprechen, dass auch mein Bruder nach Italien zurückkehren wird. Aber Mama erledigt das für mich. »Wenn wenigstens Andrea noch hier wäre, Kind.«
»Ich sehe ihn doch sowieso nie, seit er nach Savannah gezogen ist. Um Andrea hast du dir auch nie solche Sorgen gemacht.«
Aber Andrea ist auch nicht alleinerziehend, hat einen guten Collegeabschluss und arbeitet bei einem Laborgerätehersteller als Marketing Coordinator. Außerdem hat er Francesca, die nicht nur wahnsinnig hübsch, sondern auch noch verdammt schlau ist. Francesca, die Japanologie studiert hat, Ishiguro liest und versteht und ihre Abschlussarbeit über Gewalt in der Literatur von Haruki Murakami geschrieben hat. Gut, damit lässt sich vermutlich ebenso wenig Geld verdienen wie mit meiner Leidenschaft für große Wellen.
»Andrea ist nicht allein, und Andrea verdient viel Geld«, stellt meine Mutter zusammenfassend fest.
»Du musst dir keine Sorgen machen, Mama, ich bin hier auch nicht allein, und ich verdiene genug für Jamie und mich.«
Lüge. Lüge. Halbwahrheit.
»Andrea kommt in zwei Wochen und hilft beim Umzug«, sagt sie, »dann sprich mit ihm, vielleicht kann er dich überzeugen. Du hast sonst auch immer auf ihn gehört.«
»Mama, ich bin erwachsen, ich brauche Andrea nicht als meinen Berater.«
Sie kräuselt ihre Nase. »Hast du denn jetzt die Wohnung sicher?«
»Klar«, behaupte ich. »Ich hab den Mietvertrag schon unterschrieben.« Genau genommen wurde ich schon vor Besichtigung aussortiert. Single mom ticks all the boxes.
Meine Mutter mustert mich von oben bis unten. Aber auch wie Isabella und Avery ist sie es nicht gewohnt, dass ich lüge. Es sind keine selbstsüchtigen Unwahrheiten. In beiden Fällen lüge ich, um andere zu schützen. Trotzdem ist es ein mieses Gefühl. Ich will nicht, dass meine Eltern ihren Traum vom Alterswohnsitz in der Heimat meinetwegen verschieben oder gar begraben müssen. Sie haben ihr Leben lang schwer geschuftet und sich nie eingestehen können, dass es ein Fehler war, ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten auszuwandern. Überall auf der Welt gibt es unbegrenzte Möglichkeiten, aber das heißt nicht, dass man auch in der Lage ist, diese wahrzunehmen. Am Ende kommt einem dann doch das Leben dazwischen. Dafür bin ich das beste Beispiel.
Mama sieht mich an wie damals, als ich zugeben musste, Isabella Whites Bild auf Toilettendeckel geklebt zu haben. Ich wende mich ab, ertrage es nicht, wie leid es ihr tut, mich hier zurückzulassen, wie sehr sie sich wünscht, ich würde mitkommen. Und schlimmer noch: dass sich ein Teil von mir wünscht, mitgehen zu können. Nicht wegen der sizilianischen Paschas, mit denen sie mich nur zu gern verkuppeln würde, aber der Tatsache wegen, dass man Heimat zwar nicht vererben, sie aber auch nicht aus einem Menschen herausschneiden kann, indem man ihn verpflanzt. Ich höre Josies Worte noch in meinen Ohren: Nicht mal Avery ist frei. Die streckt ihre Beine über den Atlantik und weiß nicht, wie lange sie den Spagat halten kann. Manchmal glaube ich, dass es mir auch so geht. Ich liebe Harbour Bridge, aber ich vermisse Italien mit einer Inbrunst, die nicht zu den wenigen Jahren, die ich in diesem Land gelebt habe, und den noch selteneren Besuchen dort passen will.
»Ich gehe hoch«, sage ich zu ihr, und meine Schritte sind schwer, als ich sie sitzen lasse und die Treppe nach oben in meine kleine Wohnung über der Garage nehme. Ich werde bleiben. Für Jamie.
In einer Stunde wird mein Sohn von der Schule nach Hause kommen. Noch ein paar Jahre wird er die Inselschule besuchen, danach würde ich ihn gern auf die Ashley High oder eine andere Privatschule in Charleston schicken. Wie ich das finanzieren soll, ist mir schleierhaft. Ich habe ja noch nicht einmal eine Aussicht auf eine bezahlbare Wohnung, geschweige denn einen Mietvertrag. Noch etwas weniger als sechs Wochen. Der Countdown schlägt unerbittlich wie das Pendel einer Wanduhr. Nur noch lächerliche sechs Wochen, dann werden Jamie und ich obdachlos sein.
In meiner Wohnung riecht es staubig und modrig. Die Klimaanlage funktioniert nicht mehr richtig, aber ich will meinen Eltern nicht jetzt noch eine Reparatur zumuten. Normalerweise würde ich die Deckenventilatoren anstellen. Heute nicht.
Über einem der vier Drahtgeflechtstühle am runden Esstisch hängt Jamies Sporttasche, auf einem anderen liegt ein Stapel Bücher. Ich schiebe einen freien Stuhl unter die beiden Ventilatoren und klettere darauf. Mit der Handfläche klopfe ich die Decke ab, die einzelnen Bretter, die äußerlich nichts von ihrem Geheimnis preisgeben. Eines der Paneele ist lose, und ich schiebe es zur Seite. Ich strecke mich und taste in den Hohlraum darüber. Wie immer bildet sich ein feiner Schweißfilm auf meiner Stirn. Wie immer verspüre ich die irrationale Angst, sie könnte weg sein. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen, der Stuhl kippelt, aber da ertaste ich sie. Fest und hart und unendlich beruhigend. Ich atme tief ein und schiebe das lose Brett wieder zurück.
Ich habe mich so oft gefragt, was passiert wäre, wenn ich damals Nein gesagt hätte. Wie anders mein Leben verlaufen wäre, wenn ich die Tasche nicht erst im Gartenbeet und später hier versteckt hätte. Die Existenz dieses Geheimnisses verändert nichts und zugleich doch alles. Es ist meine Lebensversicherung und mein Fluch. Auf dem Stuhl ausharrend, lasse ich den Blick über mein kleines Reich schweifen. Die Wohnung genügt mir und Jamie völlig. Die kleine Kochnische, in der sich unter dem Tresen die Wäsche auf der letzten Runde in der Maschine dreht, die dunkelgrünen Einbauschränke daneben, die so knapp eingebaut sind, dass sie direkt an der Haustür abschließen. Unser winziges Sofa, auf das wir zu zweit nur passen, wenn Jamie seine Beine über meine legt und der helle Boden, den Wilson bei unserem gemeinsamen Einzug damals glatt geschliffen hat und auf dem die Sonnenstrahlen jetzt unerbittlich zeigen, dass sich auch dort schon wieder Staub gesammelt hat. Insgesamt sind das hier vielleicht sechzig Quadratmeter, aber auf einer Insel wie Harbour Bridge sind sie inzwischen unbezahlbar geworden.
»Mama, bist du da?«, ruft es vom Flur her. Jamies helle, aber kräftige Stimme. »Schule war früher aus.«
Ich steige hastig vom Stuhl und stelle ihn wieder zurück an den Tisch. Wische mir übers Gesicht, als könnte ich dadurch nicht nur den Schweiß, sondern auch meine Sorgen wegwischen. Dabei ist das nicht nötig. Jamie hat es schon immer geschafft, mich zum Lächeln zu bringen.
Mein Sohn ruft noch einmal. Das italienisch klingende Mama, kein amerikanisches Mom.
Jamie reißt die Tür auf und steht vor mir.
»Mama! Stell dir vor, was wir heute in der Schule gemacht haben. Wir haben Briefe geschrieben. Mit der Hand. Dann haben wir Marken draufgeklebt, mit Spucke.« Er schüttelt sich gespielt. »Und dann sind wir zu einem Briefkasten gelaufen, haben sie da reingeworfen und sie abgeschickt! Das Ding sah aus wie ein Mülleimer. Jason Hadley wollte seinen nicht reinwerfen, weil er dachte, Mrs. Bold verarscht uns.«
»Wow«, erwidere ich und muss tatsächlich grinsen. »Briefe schreiben, das ist ja sehr retro.«
Jamie nickt eifrig. »Voll altmodisch, oder? Aber cool. Was meinst du, wie lange ein Brief dauert, bis er auf Sizilien ankommt?«
»Keine Ahnung, zwei Wochen vielleicht.«
Jamie wiegt ungläubig den Kopf. Er hat dichtes, dunkles, gelocktes Haar. Wie Wilson. Wie ich, korrigiere ich. Jamie ist groß für sein Alter, aber schlaksig. Ich kann nicht auf seine Hände blicken, ohne zugleich auch die von Wilson zu sehen. Wenn ich Jamie früher die Fingernägel geschnitten habe, hatte ich immer das seltsame Gefühl, eine Miniversion von Wilson in der Hand zu halten.
Und doch liegt so ein riesiger Unterschied zwischen diesen Händen. Jamies sind zärtlich. Wilsons sind auf die beängstigendste Art stark.
»Zwei Wochen? So lang. Und wie schnell kann man hinfliegen?«
»In etwa vierzehn Stunden.«
»Dann fliegen wir besser immer zu Nonna und Nonno, statt Briefe zu schreiben.«
»Ja«, sage ich gedehnt und muss wegsehen. Ich kann mir noch nicht einmal einen Flug nach Kalifornien leisten. Wie soll ich je mit Jamie zu seinen Großeltern fliegen können? Wenn Josie … Ich verbiete mir den Gedanken und schaue mich in unserer kleinen Wohnung um. Nichts hier ist wirklich von Wert. Ich könnte die Handtasche verkaufen, das überteuerte Ding von Michael Kors, das Weihnachtsgeschenk des Hotels zu Weihnachten letztes Jahr. Aber auch das würde nicht one-way nach Los Angeles reichen. Geschweige denn nach Europa. Jamie merkt, dass ich in Gedanken versinke. Er sagt nichts, er mustert mich nur. Manchmal sehe ich Wilson auch in seinem Blick. Dann habe ich Angst. Nicht vor Jamie, sondern davor, dass er so wird wie sein Vater. Und jedes Mal schäme ich mich dann und sage mir, dass es absolut keinen Grund zur Sorge gibt. Jamie ist ein herzensgutes, empathisches Kind, das keinerlei narzisstische Züge aufweist.
»Komm mal her«, bitte ich und drücke seinen Kopf gegen meine Brust, hauche Küsse in sein Haar. Für dich, alles nur für dich, flüstere ich nicht hörbar in seine Locken.
»Mama«, gluckst Jamie. »Du drückst zu fest.«
Ich lasse ihn los und betrachte ihn. Das schöne, feine Jungengesicht, von dem ich hoffe, dass ein paar Züge davon bleiben werden, wenn Jamie zum Mann wird.
»Möchtest du mit zu Avery kommen und mit uns zu Abend essen?«
Jamie legt den Kopf zur Seite. »Ist Avery noch eine Weile hier?«
»Ja, sie wird noch eine ganze Weile hier sein.«
»Länger als Nonna und Nonno?«
»Ja.«
Er nickt bedächtig. »Dann bleibe ich hier.«
Ich bringe Jamie am Abend runter zu meinen Eltern. Dabei vermeide ich es dringend, mich zu genau umzusehen. Denn meine halbe Kindheit ist bereits aus diesen Räumen verschwunden. Der Ohrensessel und diverse andere alte Erbstücke werden bald die zweite Atlantiküberquerung ihres Möbellebens antreten und sind schon in Polsterfolie verpackt. In ein paar Tagen wird mein Bruder kommen und beim Umzug helfen. Dann wird das, was für mich noch wie ein vorübergehender Zustand wirkt, dauerhafte Realität werden. Die Bilder an den Wänden werden bald nur noch schattige Abdrücke auf der Tapete sein. Alles verblasst, was einst Farbe hatte. Und ich würde am liebsten in einem Anfall kindischen Trotzes die ersten Umzugskisten wieder auspacken und die Bücher und Aufstellrahmen mit alten Familienfotos zurück ins Regal stellen.
Ich muss hier raus.
Erst als ich auf dem Roller die Center Street entlangfahre, löst sich der Druck auf meiner Brust. Im Park hinter Red’s Market sitzen noch ein paar Jugendliche mit in braunen Papiertüten verpackten Bierdosen und winken mir zu. Ich erwidere den Gruß, und als ich die Waterfront Avenue erreiche, fühlt es sich fast schon wieder normal an, mein Leben.
2
Ich parke meinen Roller neben Averys verbeultem Mietwagen und dem protzigen Chevy Bandit, der Jake gehört. Isabellas SL steht auf der anderen Straßenseite, und dann ist da noch ein Wagen, den ich noch nie in der Waterfront Avenue gesehen habe. Ein von oben bis unten verstaubter und sandverkratzter roter Toyota Tacoma mit einem Nummernschild aus Minnesota. Auf der Heckklappe klebt ein weißer, kreisrunder Aufkleber mit dem Logo von Harbour Bridge, das die Gemeindeverwaltung zu Harbour Gras vor zehn Jahren entwerfen hat lassen. Ich streiche mit dem Finger über die Wellen und den Halbmond, der sich auch in der Flagge von South Carolina wiederfindet. Ich gehe um den Wagen herum, lege beide Hände an die getönten Scheiben und spähe in den Innenraum. Sauber, aber chaotisch. Der Rücksitz ist voll mit irgendwelchem Tech-Kram. Kabel, Laptops, Kameras. Auf der Ladefläche des wuchtigen Pick-ups liegt ein Surfboard, das mir bekannt vorkommt.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich Avery besuche, seit sie zurück auf der Insel ist, aber noch immer überwältigt mich ein freudiges Kribbeln, wenn ich wieder die Treppe zur vorderen Veranda hochsteige. Das Anwesen von Averys Eltern war früher so etwas wie mein zweites Zuhause. Nachdem ich bald kein erstes mehr haben werde, ist es schön zu wissen, dass es das Strandhaus noch gibt. Die Tür ist nur angelehnt, es klingt, als wären alle draußen auf der Terrasse versammelt, auf der wir so viele Sommer gemeinsam verbracht haben. Jemand lacht schallend. Zunächst kann ich es niemandem zuordnen, doch dann vertieft sich das warme Gefühl in meinem Innern. Es ist Isa, die so befreit lacht. Eine männliche Stimme, die ich nicht erkenne, mischt sich darunter.
Ich stelle die große Glasschale mit der Pannacotta, die ich zu Hause noch schnell zubereitet habe, auf den Tresen in der Küche und gehe raus zu den anderen.
»Odina!«, ruft Avery erfreut und kommt auf mich zu. Jake lässt sich in eben diesem Moment auf ein Sitzkissen fallen, springt aber hastig wieder auf, als er mich sieht.
»Bleib sitzen«, rufe ich. »Meinetwegen brauchst du nicht aufzustehen.«
»Ich hol dir was zu trinken, abartige Hitze«, sagt Jake und umarmt mich trotzdem kurz. Und dann stehe ich einem Mann gegenüber, den ich noch nie gesehen habe. Er hat raspelkurzes braunes Haar und einen Zug um den Mund, der schelmisch und gleichzeitig skeptisch wirkt, so als wollte er etwas sagen, doch stattdessen zieht er seine dichten Augenbrauen zusammen und sieht kurz weg.
»Hi«, sage ich. Verdammt, bist du heiß, denke ich.
Er verschränkt die Arme vor der Brust, braun gebrannte Arme in einem lockeren, ausgeblichenen Shirt. Dann grinst er schief. Ich kenne ihn von irgendwoher. Wie alt mag er sein? Bestimmt einige Jahre jünger als ich. Er ist deutlich größer als Jake, die Beine in seinen Shorts sind lang und muskulös. Er ist barfuß.
»Hi«, antwortet er. »Schön, dich zu sehen.«
Ich denke immer noch: Verdammt, bist du heiß. Ich sollte aufhören, ihn so anzustarren.
Der ist doch noch ein Welpe, versuche ich mir einzureden. Aber ich kann nicht aufhören. Er offensichtlich auch nicht. Dabei biete ich heute Abend keinen spektakulären Anblick. Ich trage ein altes hellgelbes Kleid mit Spaghettiträgern, das mir ein bisschen an der Brust spannt, aber herrlich um die Beine flattert, sodass es für einen Tag wie heute perfekt ist. Einen Teil meiner Haare habe ich zu einem Half Bun nach oben gebunden, der Rest lockt sich ungehindert um meine Schultern.
»Hast du mich nicht gehört, Odina?«, höre ich Avery fragen.
»Was?«
»Jake will wissen, was du trinken möchtest.«
»Wasser«, sage ich und verspüre den irrsinnigen Drang, mich sofort wieder dem Fremden zuzuwenden. Als könnte ich etwas verpassen.
»Hast du ein Gespenst gesehen?«, fragt Avery.
»Äh, nein«, erwidere ich. Oder doch. Vielleicht schon. Ist der Kerl echt? Muss so sein, denn für ein Gespenst wäre er auf verschwenderische Weise attraktiv.
Ich reiße mich zusammen und nicke dem Unbekannten zu. »Möchtest du uns nicht vorstellen, Ave? Ist das ein neues Bandmitglied?«
Eigentlich unspektakuläre Züge, aber ein spektakulärer Body, so viel ist klar. Und ein auffallend irritierendes Grinsen unter den Stoppeln am Kinn, die die Bezeichnung Bart nicht verdient haben.
»Äh …«, stottert Avery, und einen verrückten Moment lang glaube ich, dass sie auch Probleme hat, in der Gegenwart dieses viel zu schönen Kerls zu sprechen. Aber Avery hat nie Probleme zu sprechen, außerdem hat sie nur Augen für Jake. Augen … Ich schaue in Averys Gesicht, in dem das gleiche wachsame Paar Augen sitzt und die Stirn sich darüber exakt im gleichen geometrischen Muster runzelt wie die des vermeintlich Unbekannten. Und dann weiß ich, warum mir das Brett draußen bekannt vorkam. Und wer da vor mir steht wie ein frisch dem Meer entstiegener Halbgott.
»Noah!«, platzt es aus mir heraus, zusammen mit einem dümmlichen Lachen. »Himmel, haben sie dir Wachstumshormone verabreicht?«
Ausgerechnet Noah. Averys kleiner – nicht mehr so kleiner – nervtötender, aber unschuldiger – gar nicht mehr so unschuldiger – Bruder.
Noah lächelt unmerklich. »War nicht nötig, O.«, sagt er und stößt sich vom Geländer ab.
O. Ich hatte vergessen, dass er für alles und jeden immer einen Spitznamen parat hat. Dieser einzige Buchstabe aus seinem Mund macht meine Beine weich und butterig.
Er geht langsam auf mich zu. Ich halte die Hände abwehrend vor meinen Körper, der seltsam auf Noah (Averys kleinen Bruder!) reagiert. Mein Mund ist plötzlich so trocken, dass ich es unmöglich allein auf die Hitze schieben kann.
»Wie alt bist du?«, frage ich unvermittelt.
»Dreiundzwanzig«, sagt er und bleibt stehen. Zum Glück.
»Das kann nicht sein, gestern hast du uns noch mit Algen beworfen, unsere Erdnüsse geklaut und warst im Stimmbruch und …« Die Fähigkeit, einen Satz zu Ende zu sprechen, kommt mir plötzlich abhanden. Ich schiebe als Lückenfüller ein Lachen hinterher und klopfe dem angeblichen Noah mit einer kumpelhaften Geste auf die Schulter. Das geht gewaltig daneben. Ich habe den Effekt des Körperkontakts völlig unterschätzt. Totaler Systemoverkill. Das trockene Gefühl in meiner Kehle breitet sich aus, ich fühle mich, als würde ich verdursten. Das ist definitiv nicht normal und muss daran liegen, dass ich viel zu lange keinen Sex hatte. Noah als Objekt meiner Begierde käme einer Art Inzest gleich. Oder nicht?
Sein Gesichtsausdruck passt so wenig zu meiner vermeintlich geschwisterlichen Geste wie meine Gedanken.
Avery lacht schallend. »Ihr zwei seid ja komisch. Odi, willst du mir etwa erzählen, dass du Noah nicht erkannt hast? Er hat sich doch null verändert. Noah, sei doch nicht so abweisend, die Zeiten, in denen Odina dir Plastikspinnen aufs Bett gesetzt hat, sind vorbei.«
Noah und abweisend? Ich finde ihn überpräsent. Ein Östrogenmagnet.
»Du tust so, als wäre ich zwanzig Jahre jünger als ihr«, sagt Noah. Aber er schaut nicht seine Halbschwester an, sondern mich.
»Fast«, sagt Avery lachend, stellt sich zwischen Noah und mich, legt einen Arm um mich und einen um ihren hünenhaften, langbeinigen, testosteronverseuchten, heißen … stopp, stopp, stopp. Sie legt einen Arm um mich und ihren Bruder. Punkt.
Jake kommt mit einem Glas Wasser zurück auf die Terrasse, seine Augenbraue zuckt kurz. Kann er mir nicht einfach das Wasser über den Kopf schütten? Oder am besten zwischen die Beine?
Kurz darauf werden Stühle gerückt, und Isabella und Preston bestehen darauf, sich zu zweit auf die enge Bank am Geländer zu quetschen. Sie befinden sich noch in dieser Phase ihrer Beziehung, in der man pausenlosen Körperkontakt braucht und vermutlich dreimal am Tag Sex hat. Mindestens. Es ist schön, Isa so gelöst zu sehen.
Noah und ich stehen so lange untätig herum, ich jeden weiteren Blick zu ihm vermeidend, bis alle Plätze besetzt sind und nur noch zwei sehr nah nebeneinanderstehende Stühle an der Stirnseite der Tafel frei sind. So eng, dass sich zwangsläufig irgendwelche Körperteile berühren würden. Sein Bein an meinem, seine nackten Füße an meiner Wade. STOPP!
Das ist Noah. Ich werde doch wohl in der Lage sein, neben Averys kleinem Bruder zu sitzen, ohne mich wie eine ausgehungerte Sirene auf ihn zu stürzen. Was stimmt denn nicht mit mir?
Ich räuspere mich, murmele etwas von Pannacotta und eile nach drinnen. Dort stürze ich auf die Glasschale zu, als wäre sie meine verdammte Rettungsboje. Was jetzt? Es ist zu warm, um das Dessert jetzt schon auf den Tisch zu stellen. Ich schiebe die Schale in den Kühlschrank und hoffe, dass niemand merkt, in was für einen Ausnahmezustand mich die bloße Vorstellung, Noah so nah zu sein, katapultiert hat.
Ich halte den Blick gesenkt, als ich wieder nach draußen gehe. Merke aber gleich, dass sich die Sitzordnung verändert hat. Jake sitzt neben Noah, sodass der Platz bei Avery frei ist. Dort laufe ich nicht Gefahr, Noah zu berühren. Ich lasse mich auf den Stuhl fallen, innerlich zerrissen zwischen Erleichterung und einem seltsamen Anfall von Bedauern.
Jake zwinkert kaum merklich, und Noah starrt mich in Grund und Boden. Ohne dass aus seinen Augen so etwas wie Schüchternheit spricht. Sofern ich das in der Millisekunde, in der ich mir Blickkontakt zu ihm erlaube, überhaupt adäquat beurteilen kann. Ich schaffe es, das ganze Essen hindurch nichts zu schmecken, weil ich die ganze Zeit an Noah denke, aber mir verbiete, ihn anzusehen.
»Wie wollt ihr das eigentlich machen? Wenn ihr in Kalifornien seid? Ich meine, ihr habt ein Datum und die Adresse einer Polizeistation, mehr nicht. Nach was wollt ihr dort suchen?«, lenkt Jake das Gespräch auf die Anzeige.
»Wir haben einige Verbindungen der Band genutzt«, erklärt Avery. Es klingt ein wenig ausweichend.
Jake murmelt: »Der James-Bond-Effekt also.«
Avery wirft Isabella einen Blick zu, der so vertraut ist, dass es in meiner Magengrube zu grummeln beginnt. Dabei habe ich überhaupt kein Recht, auf kleine Geheimnisse zwischen den beiden eifersüchtig zu sein.
Aber Isa sucht sofort Augenkontakt zu mir. »Ich habe ein Foto vom Bildschirm gemacht, als die Polizistin kurz draußen war, während ich meine Anzeige erstattet habe. Und ich dachte, da ist nichts, aber als ich mir das Foto noch mal angesehen habe …«
»Was?«, frage ich begierig nach.
»Eine Adresse. Eigentlich nur ein Teil einer Adresse. Aber es muss die der Person sein, die die Anzeige erstattet hat.« Sie schaut mich an und lächelt.
»Die Adresse, aber nicht der Name«, erklärt Preston.
Isa nickt.
»Aber das bedeutet ja …« Ich räuspere mich. »Das bedeutet ja, wir … ihr könnt da hinfahren und klingeln und … und vielleicht macht Josie euch die Tür auf?« Meine Stimme schraubt sich Oktave für Oktave nach oben.
»Ja«, sagt Isa mit einem Blitzen in den Augen. »Ja, das könnte wirklich sein. Schwer vorstellbar, aber ja.«
Ich wünschte, dass ich mitfahren könnte. So sehr, dass es wehtut. Aber es ist völlig unmöglich. Noch sechs Wochen, und dann bin ich obdachlos. Flüge nach Kalifornien sind das Letzte, was ich mir leisten kann.
Danach reden wir noch eine ganze Weile über Josie, diskutieren, wie Isabella und Avery in Thousand Oaks vorgehen können. Aber ich habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Es ist erstaunlich, was für einen Effekt Noahs Präsenz auf mich hat. Als wäre ich plötzlich wieder ein unerfahrener Teenager, der sich nicht traut, einen Jungen direkt anzuschauen.
Erst als Preston und Isabella unter dem Protest der anderen den Tisch abgeräumt haben, erlaube ich mir, zu ihm zu sehen. Noahs Blick ist immer noch – oder wieder – auf mich gerichtet. Ich halte ihm nicht stand, weil da dieses Gefühl durch meine Venen schießt, das in einen Pornofilm gehört, aber nicht zu einem gemütlichen Barbecue-Abend mit Freunden. Und in Anbetracht der aktuellen Umstände erscheint es mir auch völlig abwegig, noch etwas anderes zu fühlen als Anspannung und hoffnungsvolle Erwartung. Absurd, an etwas anderes zu denken als an Josie und meine eigene prekäre Situation.
»Was willst du eigentlich nach dem Studium machen?«, wendet sich Preston schließlich an Noah, als alles zu Josies möglicher Existenz in Kalifornien gesagt ist.
»Das nächste Studium anfangen«, sagt Avery und gluckst, bevor Noah etwas erwidern kann. »Mein Bruder hat den Hörsaal noch nicht gefunden, aber er weiß, wo die besten Partys steigen.«
»Für mich wäre das mehr wert als ein Diplom«, meint Sammy, der Bassist von Averys Band Force of Habit, und lacht.
Avery kickt ihrem Bruder unter dem Tisch gegen das Bein. »Wenn, dann bekommt Noah ohnehin nur ein Diplom fürs Abschleppen schöner Frauen.« Sie zwinkert mir zu. Als ob ich darüber auch nur nachdenken wollte. Über Noah, der flirtet, über Noah, der Frauen abschleppt, über Noah, nackt.
Jetzt johlt Sammy: »Sag das doch gleich, Kleiner.« Der Ausdruck ist ziemlich lächerlich, denn Noah überragt Sammy um mindestens anderthalb Köpfe. »Du studierst schöne Frauen. Kann mir keinen besseren Studiengang vorstellen.«
Avery zieht eine Grimasse, grinst dann aber wieder ihren Bruder an. Ich kann nicht anders, ich sehe auch zu Noah. Er runzelt die Stirn und schüttelt kaum merklich den Kopf. Und er sieht so aus, als würde er nur deshalb nicht protestieren, weil es ohnehin keinen Sinn hat. Avery merkt gar nicht, was sie bei ihm auslöst. Aber sie hat gute Laune und stichelt ein wenig gegen ihren Bruder, wie sie es früher auch getan hat. Nichts daran meint sie böse, das weiß ich.
»Noah, komm schon. Diese Schwedin im Auslandssemester, wie hieß sie gleich? Sanna? Das war eine Schönheit! Und die Blondine, mit der du angeblich auf diesem ›Programmierkurs‹ in Daytona warst.«
»Programmierkurs in Daytona, ha, Spring Break, was?«, grölt Sammy. »Noah, du hast es drauf!«
»Das Programm kenne ich, nennt sich Sexcode«, witzelt Rodriguez, der Drummer, und wischt sich die Lachtränen aus den Augenwinkeln.
»Ihr habt doch alle keine Ahnung«, versucht Noah es lahm. Aber er ist das Küken hier, und die anderen gackern zu laut, als dass er dagegen ankommen könnte. Er wirft mir einen Blick zu. Keinen stechenden wie vorher, sondern einen nachdenklichen.
»Was ist ein radikaler Student? Einer, der alles bestreitet, nur nicht seinen Lebensunterhalt.«
Rodriguez klopft sich auf den Oberschenkel und holt den nächsten Flachwitz aus der Schublade. »Student sagt: ›Ich hab morgen ein wichtiges Meeting mit Investoren.‹ Professor: ›Wieso, triffst du dich mit deinen Eltern?‹«
Noah stöhnt gequält. Der Rest des Tisches lacht. Bis auf Jake. O Mann, ich weiß jetzt, warum Avery ihn liebt. Ich fange an, ihn auch zu lieben. Dafür, dass er mir seinen Platz überlassen hat, und weil er beim Noah-Bashing nicht mitmacht.
Und ehe ich weiß, was ich tue, stehe ich auf und stütze meine Hände auf die Tischplatte und will lauthals verkünden, dass sie alle aufhören sollen, auf Noah herumzuhacken. Allerdings wäre das so was von unangebracht, dass ich gerade noch rechtzeitig die Kurve kriege.
»Ich hole den Nachtisch«, presse ich stattdessen hervor und verschwinde zum zweiten Mal an diesem Abend übereilt in die Küche. Doch jetzt folgt mir jemand. Das spüre ich an der Luft, die sich elektrisch auflädt und vor Spannung sirrt. Hinter mir ist Noah.
Ich gebe vor, ihn nicht zu bemerken. Ich bin mir seiner Präsenz so bewusst, dass ich die Pannacotta im Kühlschrank nicht gleich entdecke, obwohl ich sie selbst hineingestellt habe. Plötzlich ist da Noahs Arm, der die Kühlschranktür aufhält und mir dabei so nahe kommt, dass sich alle Härchen an meinem Körper aufstellen. Alarmiert oder erregt. Vielleicht beides.
Ich drehe mich mit der Schüssel um, aber er steht trotzdem noch so eng bei mir, dass wir uns fast berühren.
»Odina Bianchi«, sagt er leise und legt den Kopf schief. So wie Avery es auch manchmal macht. Und es ist gut, dass mir die Ähnlichkeit auffällt. Sie hält mich davon ab, einen Mann in ihm zu sehen. Meinen Körper hindert es allerdings nicht daran, völlig unangemessen auf ihn zu reagieren.
»Wirklich schön, dich wiederzusehen«, sagt er, als müsste das unbedingt erneut betont werden.
»Ja, nicht wahr, ich meine, was für ein Zufall. Ausgerechnet hier«, plappere ich und breche ab, als ich merke, was für ein Unsinn das ist. Mein Hirn läuft anscheinend auf Sparflamme. Kein Wunder bei der Energie, die mein Körper benötigt, um sich von einer sexuellen Attacke auf Noah zurückzuhalten.
»Im Haus meiner Eltern«, sagt Noah und lacht, »wirklich ein Riesenzufall.«
»Aber du warst lange nicht hier, oder?«
Er sieht kurz zur Seite. »Nein, ist schon ein paar Jahre her.«
»Warum eigentlich?«
Er zuckt mit den Achseln. »Hat sich nicht ergeben.«
Ich spüre sofort, dass da mehr dahintersteckt, aber ich hake nicht nach.
Dann lächelt Noah zaghaft. »Wie geht es dir, O.? Was macht Jamie? Ave hat mir ein paar Fotos gezeigt. Er sieht dir so ähnlich. Ist bestimmt ein toller Junge. Ich wette, du bist wahnsinnig stolz auf ihn.«
Es sind Phrasen, aber sein Blick ist offen, interessiert.
Jamie. Er weiß von Jamie.
»Ja, das bin ich. Stolz auf ihn. Jamie, meinen Sohn«, stottere ich. Dann straffe ich die Schultern. »Danke. Es geht mir gut. Ich, ich meine, meistens. Ist nicht so, dass alle von uns ihre Träume verwirklicht haben wie deine Schwester. Aber es ist okay, ich bin zufrieden.«
»Medizin, oder?«, fragt er. »Das war dein Traum.«
»Ja.«
»Und dann kam Jamie?«
»Genau, dann kam Jamie«, sage ich. »Und alles war anders.«
»Läuft es nicht meistens anders als gedacht? Heißt nicht, dass es schlechter ist.«
»Nein, auf keinen Fall. Als alleinerziehende Mutter hab ich mich nie gesehen, aber ich bin glücklich, so wie es gekommen ist.« Alles ist besser, als mit Wilson zusammenleben zu müssen. Auch wenn ich das nicht direkt sage.
Noah nickt, sein Lächeln wird ein wenig wärmer. Dann greift er nach etwas unten im Kühlschrank und berührt dabei beiläufig meine Hand. Nur mit der Fingerspitze. Wahrscheinlich hat er es nicht gemerkt. Ich schicke einen stummen Dank an Jake, dass er mit mir den Platz getauscht hat. Nicht auszudenken, was es mit mir anstellen würde, wenn Noah und ich uns für länger als den Bruchteil einer Sekunde berühren würden.
»Du surfst noch?«, frage ich, weil ich durch das Küchenfenster seinen Truck mit dem Brett sehe. Und mich unbedingt ablenken muss.
»Klar«, strahlt er, »immer noch mit Hannibal.«
Einen Moment lang weiß ich mit diesem Namen nichts anzufangen, dann fällt mir Noahs alte Gewohnheit wieder ein.
»Dein Brett? Hannibal ist dein Surfbrett?«
»Jap. Sag bloß, deine Vespa hat keinen Namen?«
»Nein, tatsächlich nicht. Die Zeiten, in denen ich Dingen Namen gegeben habe, sind vorbei.«
Der Roller heißt Betty, aber das werde ich ihm nicht sagen. Es ist viel wichtiger zu betonen, dass es kindisch ist, Dingen Namen zu geben. Auch wenn ich es eigentlich rührend finde.
Noah reibt sich über seinen Bartschatten. »Lust, mal mit mir rauszupaddeln? Hast du Colette noch?«
»Du weißt noch, wie mein Brett heißt?«
»Hieß.« Er kostet das Wort aus. »Du bist ja zu erwachsen, um den Dingen in deinem Leben Namen zu geben.«
Und mit diesen Worten lässt er mich stehen.
3
Vierzehn Jahre zuvor
Fast alles, was ich als Kind gelernt habe, hat mir mein Bruder beigebracht. Wie man Roller fährt, wie man ihn zu mehr PS tunt und am besten in der Kurve liegt. Wie man Kirschkerne spuckt, und was das mit dem Dressieren von Katzen zu tun hat. Wie man aus Fenstern springt, ohne sich die Knochen zu brechen, und wie der Druckausgleich beim Tauchen funktioniert. Andrea war es auch, der mir eingeschärft hat, niemals ein Versprechen zu brechen. Komme, was wolle. Weil ein Versprechen unter Freunden heiliger ist als das Amen in der Kirche.
Andrea, der mir vier Lebensjahre voraus war, war auch in allen anderen Belangen immer mein Vorbild. Ob ich wollte oder nicht. Mein Roller war sein alter, mein neuer Schulrucksack sein abgelegter. So wie ich die Hosen auftragen musste, die ihm nicht mehr passten. Bis irgendwann meine Hüften zu breit dafür wurden und meine Mutter zwangen, doch neue zu kaufen. Ich erbte die alten Kassetten meines Bruders, seine zerfledderten Comics und die Vorliebe für sehr starken schwarzen Kaffee und Pfefferminzkaugummi.
Wären wir in Italien geblieben und nicht hierhergezogen, als ein entfernter Cousin meinem Vater das Haus und die heruntergewirtschaftete Pizzeria angeboten hat, dann hätten Andrea und ich sicher noch viel mehr Geschwister. So aber hat schlicht das Geld nicht gereicht für weitere Kinder. Und nicht einmal Mama hatte genug Arme, um all die Arbeit zu bewältigen, die allein auf ihr lastete.
Von meinem Bruder wusste ich auch, dass man ein Chamäleon sein musste, wenn man irgendwo neu war. Am besten färbte man sich in die Umgebung ein und verschwand in der Masse. Und genau hier unterschieden wir uns. Ich hatte keine Lust, mich anzupassen. Denn das hatte ich versucht und war gescheitert. Ich war schon immer groß und kräftig für mein Alter gewesen und hatte bereits mit zwölf einen Busen bekommen. Ich passte nicht zu den zarten Südstaatlerinnen. Es brachte auch nichts, mich wie sie anzuziehen. Warum also so tun?
Auf der Inselschule fiel das noch nicht groß auf, weil wir alle mehr oder weniger wilde Kinder waren, die in einer liebevollen, winzigen Grundschule in Klassengemeinschaften lernten. Die meiste Zeit in Gummistiefeln und am Strand. Jeden Freitag wurde gemeinsam Gingerbread gebacken, und man trug alte Kleidung, die nur dem Zweck diente, praktisch zu sein. Auch Isabella war da keine Ausnahme. Erst danach wurde es anders. Während Andrea an der Ashley High schnell Anschluss finden konnte, blieb ich allein. Eine gute Schülerin am Rande der Klasse, kaum beachtet, aber eben nicht Chamäleon genug, um unter dem Radar zu fliegen. Denn der Radar waren die LOLAs und Isabella White. Und da tat es zum ersten Mal richtig weh, nicht dazuzugehören. Weil Isabella nicht irgendeine Tochter aus gutem Charlestoner Haus war, sondern das Mädchen aus Harbour Bridge, mit dem ich zu Halloween Kürbisschnitzwettbewerbe ausgetragen und in der Projektwoche Schulter an Schulter den weißen Zaun der Grundschule gestrichen hatte.
Und jetzt gehörte sie zu denen, zu denen ich auf keinen Fall gehörte. Und auch gar nicht gehören wollte. Isabella lachte über meine Klamotten, und ich tat alles, um mich abzugrenzen. Ich aß die fettigen Burger in der Cafeteria, nicht weil sie mir schmeckten, sondern weil ich mich damit von Isabella und ihrem Clan abhob. Browniegate war ein Fehler, denn ich hatte absolut kein Interesse an Mason Summers. All das tat nicht weh, nicht ein einziger Kommentar der dummen Zicken. Es schmerzte nicht, mit Spaghetti beworfen zu werden. Die anderen dachten, ich wäre stolz, aber es war Gleichmut. Ich schwor mir – albern, wie man eben als Teenager war –, dass ich Isa, selbst wenn wir beste Freundinnen werden würden –, niemals auf meinem Roller mitnehmen würde. Versprechen waren heilig, so heilig wie meine Vespa, der ich sogar einen Namen gegeben hatte. Fast so heilig wie das Surfcamp, das ich diesen Sommer besuchen würde. Ich wollte surfen lernen, seit wir auf die Insel gezogen waren, aber erst mithilfe meines Bruders war es mir gelungen, meine Eltern von dem Camp zu überzeugen. Denn wenn es einen Grund gab, mir eine Freizeitaktivität zu erlauben, die außerhalb der elterlichen Pizzeria stattfand und nichts mit dem Kneten von Teigen, dem Anrühren von Tomatensoßen oder dem Ausfahren von Kartons zu tun hatte, dann musste es mit der Schule zusammenhängen. Deshalb spielte Andrea Baseball und Softball, war in einer Schachmannschaft und bei den Rettungsschwimmern. Die Idee, das Surfcamp als wichtigen Meilenstein für ein Sportstipendium am College zu verkaufen, war so genial wie einfach. Typisch Andrea eben.
»Topolina, pass gut auf dich auf! Diese Wellen!« Meine Mutter hob theatralisch die Hände, bevor sie erneut die Arme um meine Mitte schlang, mich viel zu fest an ihren vollen Busen drückte.
»Odina, non capisco, warum musst du surfen, kannst du nicht einfach Fußball spielen?«, rief mein Vater mit rotweinschwerer Zunge aus dem Wohnzimmer heraus. Der ebenso dunkle wie träge Akzent gehörte zu ihm wie das tägliche Glas Nerello in der Mittagspause. Kistenweise ließ er den sizilianischen Wein importieren und hing an jedem Tropfen wie ein Baby an der Muttermilch. »Attenzione, amore, brich dir nicht den Arm oder das Brett«, schob er zwinkernd hinterher, als ich mich von ihm verabschiedete.
Mama sah mir nach, wie immer, die Hände in die Taille gestemmt, während ich mit meiner Vespa knatternd davonbrauste. Sie sah mir immer nach, als wäre es das letzte Mal. Wenn ich in die Schule fuhr, wenn ich Pizzakartons auf dem Sitz hinter mir balancierend auslieferte und auch nun, nachdem ich endlich ein Stück Freiheit für mich erkämpft hatte. Ein langer Sommer lag verführerisch vor mir, und es machte mich völlig fertig, dass sie diesen sorgenvollen Blick nicht lassen konnte. So würde ich niemals werden, wenn ich selbst Mutter war.
Ich fuhr schneller als sonst, fast so, als würde ich verfolgt von etwas, das ich nicht abschütteln konnte. Mehr als einmal rutschte mir der Roller in der Kurve weg, und ich konnte ihn nur wieder einfangen, weil ich von Andrea gelernt hatte, wie man gegensteuert, wenn der Hinterreifen schlingerte. Irgendwie verspürte ich dennoch den Drang, nicht zu bremsen, sondern Vollgas in meine Zukunft zu fahren. Wenn mir auf dem Roller der Wind um die Ohren wehte und die Seebrise meine Haare verknotete, fühlte ich mich nicht nur frei, ich konnte auch träumen. Davon, tatsächlich ein Sportstipendium zu ergattern und Medizin an einer renommierten Uni zu studieren. Wie Andrea, der im nächsten Jahr seinen Highschool-Abschluss machen würde und dem bei seinen hervorragenden Noten die Studienförderung schon so gut wie sicher war. Ich träumte davon, irgendwann wieder in Italien zu leben und dort jemand Besonderes zu sein, weil ich in den Staaten studiert hatte. Ich war auf dem Weg in eine große Zukunft, warum bremsen? Es konnte doch gar nicht schnell genug gehen.
Ich war dementsprechend früh am Strand, aber nicht die Erste. Andy, den Surflehrer, kannte ich schon von der Anmeldung. Er war nett, sah aber mit seinen langen, leicht ergrauten Locken nicht gerade aus wie ein Durchschnittskatholik, sondern eher wie ein verwegener Buddhist. Auch wenn Mama und Papa jedem Beruf mit dem Zusatz »Lehrer« das Prädikat »vertrauensvoll« zusprachen, hatte ich beschlossen, dass meine Eltern ihn und seine heruntergekommene Hütte am Strand nie zu Gesicht bekommen würden. Neben Andy stand Lee Baker und verzog das Gesicht, wie nur Lee Baker das Gesicht verziehen konnte. Lees Mom hatte einen Sommer lang Pizza für uns ausgefahren, aber als ich alt genug war, um nach italienischen Maßstäben ein Fahrzeug zu bedienen, hatte ich den Job übernommen. Und damit fingen die unangenehmen Vorfälle an. Hundescheiße im Briefkasten, die Sache mit den verschwundenen Mülltonnen und möglicherweise das Rattengift im Katzenfutter, dem Ocho beinahe zum Opfer gefallen wäre. Und trotzdem. Lees Anwesenheit versprach, dass es spannend werden würde. Sie strahlte Unangepasstheit aus, und genau das gefiel mir. Sie war die lebende Antithese zu Andreas Chamäleonideologie. Ihre fransigen Haare, der knappe Bikini und die Art, wie sie den Kopf hob und laut sprach, weil es ihr gar nicht in den Sinn kam, sich unterzuordnen, waren so beeindruckend, dass ich ihr augenblicklich alles verzieh, was ich ihr vor Sekunden noch insgeheim vorgeworfen hatte. Sie diskutierte Andy in Grund und Boden, und ich war mir sicher, dass es ihr gelingen würde, sich ihre Teilnahme am Surfkurs zu erstreiten.
Ein Grinsen zog sich breit über meine Wangen und verschwand fast genau im selben Augenblick wieder.
»Du!«
Es war Isabella. Ausgerechnet. Isabella White. Fehlte nur noch, dass die restlichen LOLAs anmarschierten und mir den Sommer vollends verdarben.
»Du?«, antwortete ich im gleichen ungläubigen Ton.
Isabella schien ähnlich zu denken, als ich überhörte, was sie zu Andy sagte. Sie besaß tatsächlich die Frechheit, Andy zu fragen, ob sie den Kurs wechseln konnte. Zweifelsohne wegen Lee und mir. Wir waren der feinen Dame wohl nicht gut genug.
»Sie kann mit mir tauschen. Also, ich bleibe, sie geht«, schlug Lee schließlich vor und zuckte gelangweilt mit den Achseln.
»Der Kurs bleibt, wie er ist, und ich habe auch keinen Platz in anderen Kursen«, schimpfte Andy.
»Vielleicht kann ich Einzelstunden nehmen«, versuchte Isabella es weiter. Sie wollte nicht aufgeben. Natürlich nicht. Ein Nein war sie nicht gewohnt. Sie bekam immer ihren Willen, das Fräulein Hotelerbin.
Andys Gesichtsausdruck sagte mir, dass er gar nicht daran dachte, Isabella den Anmeldeschein aus der Hand zu nehmen. Stattdessen winkte er Lee in den Schuppen.
Da standen wir also. Isabella und ich. Wie sie mich anstarrte! Als wäre ich Plankton und sie der Schwertwal, der mich schlucken würde. Mein alter Neoprenanzug, den ich bei Exchange Factor in Charleston aus zweiter Hand gekauft hatte, sah gegen ihren nigelnagelneuen modischen Einteiler lächerlich aus. Ich musste Isabella nur anschauen, um zu spüren, wo meine Haut sich wölbte und rollte. Wenn man sie nicht kannte, hätte man ihren abschätzigen Blick vielleicht für Interesse halten können, ich aber sah sie, die unverhohlene Verachtung. Wir sprachen kein Wort, aber es fühlte sich an, als wäre diese Stille laut und schreiend. Bis ein weiteres Mädchen auftauchte. Zart wie Isabella, brünett mit einem lustigen Mund, den ich mir gut lachend vorstellen konnte. Was sie dann auch tat. Ich hatte sie noch nie gesehen und vermutete daher, sie war eine Touristin. Andy und Lee kamen aus der Hütte wieder heraus und schrien sich an. »Aber ich bin nicht Lee, mein Name ist Elisabeth Warren, ich wohne im Seasons, ich bin Touristin! Behandelst du so zahlende Gäste? Eine Frechheit ist das. Ich habe einen Gutschein.«
Natürlich war Lee kein Gast im Seasons. Das wusste Andy so gut wie Isabella, die aussah, als würde sie gleich kleine boshafte Wölkchen aus ihren Nasenflügeln schnaufen.
»Die Warrens haben vorgestern ausgecheckt«, behauptete Isabella.
»Umso besser, dann nehme ich der ›anderen‹ Elisabeth Warren ja nichts weg.«
Ich beobachtete den Schlagabtausch mit diebischer Freude.
Lee wandte sich an den Surflehrer. »Was ist jetzt, Andy, lässt du mich mittrainieren? Ich kann diesen Bitches hier noch einiges beibringen.«
Die Neue sah schweigend zu.
Lee erklärte: »Ich bin Lee. Du darfst aber auch Elisabeth zu mir sagen.«
»Avery«, antwortete die Fremde. Nur dieses eine Wort, aber ich horchte auf. Etwas daran hörte sich nicht so amerikanisch an wie ihr Name.
»Isabella White.«
Isabella klang, als hätte sie gerne noch hinzugefügt: »Das Seasons gehört mir.« Ich verdrehte innerlich die Augen.
»Möchtest du dich nicht auch vorstellen, Odina? Wenn wir schon mal hier sind.«
Ich spürte, wie meine Wangen zu brennen begannen, und ärgerte mich. Dabei hatte ich Isabella White doch mal gemocht.
»Eine fehlt noch«, erklärte Andy. »Sue Fisher.«
Es dauerte keine zwei Minuten, in denen Isabella weiterhin ihr überlegenstes Gesicht aufsetzte, bis besagte Sue Fisher auftauchte. Fast verschluckt von einem riesenhaften Seesack in Signalfarben. Sie war zierlich, aber ihre Schritte waren selbstbewusst.
»Heilige Scheiße«, rief Lee unvermittelt. »Heilige Scheiße, heilige Scheiße, heilige Scheiße.«
Ich grinste in mich hinein. Weil es mir gefiel, wie direkt sie war. Und weil Isabella kaum merklich zusammenzuckte. Beide, Lee und Isabella, schienen das Mädchen zu erkennen. Ich tauschte einen Blick mit Avery, die mit den Achseln zuckte.
Lee geriet völlig aus dem Häuschen und hüpfte auf und ab. »Das ist bestimmt nicht Sue Fisher!«
Inzwischen konnte die zierliche Blondine uns längst hören.
»Wenn sie sagt, sie heißt Sue Fisher, dann heißt sie Sue Fisher«, kommentierte Andy trocken.
»Wenn die Sue Fisher ist, bin ich Elisabeth Warren, und du schmeißt mich nicht raus.«
Ich hatte ihr augenblicklich die Hundescheiße im Briefkasten verziehen. Sie stellte schließlich fest: »Du bist Witty aus UrbanOath!«
Die vermeintliche Sue Fisher ließ den Seesack sinken und streckte Andy ihre Hand entgegen. Lee war noch nicht fertig. »Verdammte Scheiße. Du bist Josie Blythe und spielst Witty in Urban Oath. Du bist ein fucking Star!« Lees Augen schienen ihr aus dem Kopf zu fallen. »Bekomme ich ein Autogramm auf mein Board?«
»Das Board gehört dir nicht«, fuhr Andy dazwischen.
»Aber sie hat recht, oder? Du bist Josie Blythe, geboren in Pasadena. Erste Hauptrolle in Killing Tyler. Deine Patentante ist Meryl Streep, und du hast den Mickey Mouse Club moderiert.« Natürlich, Isabella war bestens informiert.