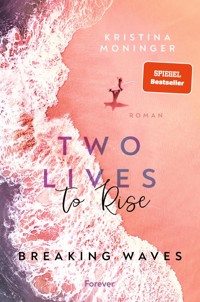4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Breaking Waves
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Fünf Freundinnen. Vier Liebesgeschichten. Eine große Schuld. Avery, Isabella, Odina, Lee und Josie sind jung, wild und die besten Freundinnen, seit sie sich im Surfcamp auf der kleinen Insel vor der Küste South Carolinas kennenlernten. Es ist der Sommer ihres Lebens – bis Josie plötzlich spurlos verschwindet. Erst zehn Jahre später gibt es eine Spur ... Avery kehrt als gefeierter, aber ausgebrannter Rockstar auf die Insel zurück, um über ihren Bandkollegen Jake hinwegzukommen. Niemand ist ihr vertrauter als er – und niemand hat sie je so verletzt. Doch neue Hinweise zu Josies Verschwinden lassen Avery keine Ruhe. Sie weiß, dass nur ihre einstigen Freundinnen weiterhelfen können, obwohl ihre Freundschaft zerbrochen ist. Und dann ist da noch Jake. Warum beginnt er ausgerechnet jetzt, wo alles verloren ist, um sie zu kämpfen? Averys Geschichte: Eine Second Chance Rockstar Romance Band 1: Breaking Waves - One Second to Love Band 2: Breaking Waves - Two Lives to Rise Band 3: Breaking Waves - Three Tides to Stay Band 4: Breaking Waves - Four Secrets to Share
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Ähnliche
One Second to Love
Die Autorin
KRISTINA MONINGER hat bereits mehrere gefühlvolle und ebenso charmante wie tiefgründige Romane veröffentlicht. Sie ist bestens vernetzt mit diversen New-Adult-Autorinnen und hat bereits eine große Fangemeinde. Kristina wurde 1985 in Würzburg geboren und hat ihre Kindheit in einem kleinen Dorf auf dem Land verbracht, in dem sie auch heute noch mit ihrem Mann und ihren Zwillingen lebt. Findet man sie nicht am Schreibtisch, dann sehr wahrscheinlich hinter einem Buch oder mit Familie und Hund in der Natur.
Band 1: Breaking Waves - One Second to LoveBand 2: Breaking Waves - Two Lives to RiseBand 3: Breaking Waves - Three Tides to StayBand 4: Breaking Waves - Four Secrets to Share
Kristina Moninger
One Second to Love
Breaking Waves
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei Forever Forever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH Berlin
1. Auflage September 2023© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2023Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung: Favoritbuero GbR - Bettina ArltTitelabbildung: © Wonderful Nature / ShutterstockAutorinnenfoto: © Wundertoll FotografieE-Book powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-95818-790-0
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Dank
Leseprobe
Isabella
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Für Teresa und Ben
Motto
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in
Leonard Cohen
Prolog
Zehn Jahre zuvor
Der Boden unter meinen Füßen war weich, und ich grub die Zehen so tief in den Sand, dass sie sich kühl anfühlten. Ein angenehmer Kontrast zu der Sommerhitze, die den Festivalplatz wie einen Kessel zum Glühen brachte und die Körper um mich herum noch weiter aufheizte. Obwohl die Sonne sich dem Ozean zugeneigt hatte und der Abend wie ein Versprechen auf Erleichterung lauerte, war es noch immer unerträglich heiß. Die Luft trug eine Mischung aus Meeresbrise, Schweiß und dem süßlichen Geruch von Haschisch in sich, eine dicke Parfümwolke, der man nicht entgehen konnte. Die salzig-sandig verklebten Haarsträhnen an meiner Stirn ziepten. Neben mir tanzte Isa, das lange blonde Haar wehte ihr um die Schultern, die Augen geschlossen. Um ihren Hals schwang die Blumenkette, die es zur Eintrittskarte dazugegeben hatte. Sie drehte sich zu mir, und ich lächelte zaghaft. Sie erwiderte mein Lächeln mit einem leichten Zucken ihrer Mundwinkel. Odina legte Isa von hinten die Arme um die Schultern. Es sah seltsam aus, weil sie um einiges kleiner und runder war. Odinas Teint hob sich tief gebräunt von Isas durchscheinender Haut ab. Obwohl alles um uns herum lärmte und kreischte, drang Odinas dunkle, schwere Stimme bis zu mir. Sie sang schief, aber der Charme ihres italienischen Akzents machte ihr fehlendes musikalisches Talent wett. Die Band oben auf der Bühne unter dem weißen Zeltdach, das zumindest für die Musiker für Schatten sorgte, war nicht übel, aber der Gitarrist taugte nichts. Ich schrie den Mädels zu: »Die Riffs sind schwach, die Slides auf den beiden oberen Saiten sind nicht akkurat und nicht aggressiv genug.«
»Oh, Ave, halt die Klappe«, lachte Lee und schubste mich unsanft. Gröber, als ich es von ihr gewohnt war. Lee trug wie immer kurze abgeschnittene Jeans und eines der zwei T-Shirts, die sie besaß. Ihre Haare waren auf einer Seite raspelkurz rasiert und hingen ihr dafür an der anderen umso länger und strähniger über die Schulter. Sie war die Einzige von uns fünf ohne Blumenkette, weil sie keine Eintrittskarte für Harbour Gras besaß. Und die Einzige, die wusste, wie man auch ohne Karte überall hinkam, wo man hinwollte. In ihrer rechten Hand hielt sie ein Bier, die linke warf sie im Rhythmus der Musik nach oben. »Irgendwann steht Avery auf der Bühne, und wir jubeln ihr zu«, behauptete sie und nahm einen tiefen Schluck aus dem Becher. »Avery Winter for Rockstar«, lachte sie. »Die Frage ist nur, ob mit oder ohne Jake«, fügte sie hinzu, und ihr Lachen verklang zeitgleich mit dem Song.
»So ein Unsinn«, sagte ich zu laut in die plötzliche Stille hinein. Instinktiv reckte ich den Hals und schaute zu der Strandbar mit der blauen Verbretterung. Als ob Jake dort stehen würde. Dabei hatte er die Insel sicher längst verlassen. Kein Jake in Sicht, nirgendwo, nur das Flirren der Hitze, das die Luft verzerrte, als sähe man in einen milchigen Spiegel. Ich zupfte an den klebrigen Haaren an meiner Stirn und wischte sie mir von der Haut. Ich wünschte mir, mich auch so von den Gedanken an Jake lösen zu können. Ihn einfach wegwischen. Aber er klebte viel zu fest in meinem Herzen.
»Das ist unser letzter gemeinsamer Sommer hier, Mädels«, rief Isa, als die Band ankündigte, eine Pause einzulegen. Das Gewicht dieser Worte kam ihr mühelos über die Lippen. »Ich werde studieren, Odina wird sich vom katholischen Regiment freimachen, und Josie kann mich mal. Wenn Avery ihre Musikerkarriere nicht vorantreibt, dann müssen ihre Eltern vielleicht das Ferienhaus verkaufen, und Lee, na ja, Lee, dich sehe ich auch nicht auf Harbour Bridge versauern. Die Welt steht uns offen.«
Für mich klang es nicht nach Freiheit. Es klang, als bedeutete eine offene Welt zu viel Verantwortung. Ich wollte nicht die Welt, ich wollte nur diesen Flecken Erde. Harbour Bridge. Den Sommer. Isabella, Lee, Odina – Jake. Und Josie. Verdammt, Josie.
Ich wollte so tun, als wäre ich ewig jung und unbeschwert. Ich konnte nicht ahnen, wie bald diese Unbeschwertheit enden würde, und dass ich die Erste und Einzige von uns sein würde, der die Welt ein Zuhause gab, nicht Harbour Bridge.
»Wir sollten morgen früh zum Wash-Out und noch ein letztes Mal surfen, bevor wir fahren«, sagte ich und dachte wehmütig an die Wochen, die unwiederbringlich hinter uns lagen. An den endlosen Strand, an Isa neben mir auf dem Brett. Daran, wie wir uns nach dem Surfen aus dem Wetsuit schälten und dabei sowohl Erleichterung als auch ein Gefühl des Verlusts spürten. Das gleiche Gefühl, das ich immer empfand, wenn ich die Insel und das Meer hinter mir ließ. Mir fehlten jetzt schon Odinas Spaghetti am Spieß, der starke Geruch von Lees selbst gedrehten Zigaretten. Den Gedanken an Josie verkniff ich mir, ich wollte nicht fühlen, was unter der Wut waberte.
»Irgendwann ist alles vorbei«, erklärte Isa und lächelte seltsam. »Irgendwann kennen wir uns nicht mehr.« Auch Jahre später fragte ich mich oft, ob ich mir die Erleichterung in ihren Worten nur eingebildet hatte.
Ich wollte widersprechen, als eine kühle Brise meinen Nacken streifte und die feinen Härchen daran aufstellte. Noch einmal drehte ich mich um und schaute zur Bar, wo mir vor Kurzem noch Josies grüne Haarsträhnen wie unnatürliche Farbkleckse zwischen den Festivalbesuchern ins Auge gestochen waren. »Wo ist eigentlich Josie?«, fragte ich und wusste selbst nicht, warum ausgerechnet ich nach ihr fragte.
Keiner reagierte. Ich wiederholte die Frage: »Wo ist Josie?«
Isa zuckte mit den Schultern, und um ihren Mund spielte wieder dieser Zug, den sie nur schwer verbergen konnte, ihr Halblächeln, das genauso gut eine Drohgebärde sein konnte. Diesen Gesichtsausdruck hatte sie in diesem Sommer exklusiv für Josie reserviert. Und ich konnte ihn einfach nicht deuten.
»Drinks holen vielleicht?«, schlug Odina unbeeindruckt vor und wischte sich die schwitzigen Hände an ihrem dunklen Kleid ab. Sie hinterließen feuchte Flecken auf dem dünnen Stoff.
»Seltsam, dass du dich plötzlich nach Josies Gesellschaft sehnst«, bemerkte Lee und musterte mich aus ihren scharfen blauen Augen.
Ich zuckte zusammen und spürte, wie meine Wangen anfingen zu glühen. »Was willst du damit sagen?« Es gelang mir nicht, meine Stimme so ruhig klingen zu lassen, wie ich es beabsichtigt hatte. Wie lange hatte Lee uns vorhin zugehört? Mein Gesicht brannte, aber ich durfte nicht zulassen, mich für meine Worte zu schämen. Es war ohnehin schon schwer, den Schmerz zu ertragen. Jetzt Reue zu empfinden, war mir unmöglich. Der Mensch hat Grenzen, und meine waren weit überschritten.
»Sie taucht sicher gleich wieder auf. Unkraut vergeht nicht«, hörte ich Isa sagen, während ich wieder den Blick suchend durch die feiernde Menge schweifen ließ. Kein Jake. Keine Josie. Die kühle Brise, die noch vor wenigen Minuten angenehm gewesen war in der heißen, drückenden Schwüle des Sommertages, ließ mich jetzt frösteln.
Es gab Momente wie diese, in denen man instinktiv wusste, dass der Wind gedreht hatte. Und dass ihn nichts und niemand wieder wenden konnte. Dass nichts und niemand die Zeit zurückdrehen, Geschehenes ungeschehen machen und ein Unrecht geradebiegen konnte.
Als die ersten knallenden Salven des Abschlussfeuerwerks hochgingen, zuckten wir alle erschrocken zusammen. Ich hatte nicht einmal bemerkt, dass die Band die Bühne verlassen hatte. Lee war die Einzige, die aktiv auf die Suche nach Josie gegangen war. Wir anderen waren an Ort und Stelle erstarrt, hatten keinen Blick für die tanzende Pyrotechnik am Himmel übrig, wir sahen uns um, bewegten uns aber nicht. Der Lärm der leuchtenden Raketen betäubte für ein paar wohltuende Minuten meinen rasenden Herzschlag. Ein paar Augenblicke lang konnte ich noch so tun, als wäre alles in Ordnung.
Aber Josie tauchte nicht wieder auf. Nicht an diesem Nachmittag, nicht an diesem Abend. Gar nicht mehr. Die Insel hatte sie mit Haut und Haaren verschluckt. Und zurück blieben vier Freundinnen und eine große Schuld.
1
Harbour Bridge ist nur über eine Brücke mit den vorgelagerten kleineren Inseln und dem Festland verbunden. Fährt man darüber, kommt man unweigerlich direkt auf das Seasons zu. Das einzige Hotel der Insel thront wie eine altersschwache, aber stolze Königin am Ende der Center Street und bietet von seinen Zimmern einen spektakulären, unverbauten Blick aufs Meer. Dabei ist das Seasons auf eine sehr unspektakuläre Art elegant: Heller Sandstein und schlichte Architektur runden den eindrucksvollen Bau ab. Und doch wirkt es neben den wehenden Palmen wie das ultimative Zentrum des Ortes. Ob man will oder nicht.
Es fühlt sich falsch und gleichzeitig so richtig an, hier zu sein. Ich empfinde bereits auf den ersten Metern hinter der Brücke eine tiefe Verbundenheit, die ich in den vergangenen Monaten so vermisst habe. Vermutlich liegt es nur an der Reizüberflutung und dem Stress der letzten Zeit, aber einen Moment lang erlaube ich mir, dieses Gefühl einfach zu genießen. Ich fahre an einer Exxon-Tankstelle, der Subway-Filiale mit dem grünen Dach und einer kleinen, orange gestrichenen Kirche vorbei, bevor ich das Seasons rechts liegen lasse und in die East Atlantic Avenue abbiege. Am Parkplatz vor der Wäscherei steht ein Mädchen mit einem Gitarrenkoffer und streckt den rechten Daumen in Richtung Straße. Bei ihrem Anblick zucke ich heftig zusammen. Ich ärgere mich, dass ich sie im Rückspiegel nicht mehr ausmachen kann. Mein Herz donnert und beruhigt sich erst, als ich die Geschwindigkeit des Wagens drossele und mir selbst versichere, dass das einfach nur ein Mädchen war. Kein Geist aus der Vergangenheit.
Ich fahre jetzt nur noch knappe zehn Meilen die Stunde und zögere den Moment des Ankommens hinaus, den ich mir so magisch vorgestellt habe. Nur deswegen wollte ich allein ankommen. Ohne die anderen Bandmitglieder. Ohne … Jake. Nicht im Tourbus, der bestimmt schon am Festivalplatz ist. Ein paar Minuten gehören mir allein.
Vielleicht sind sie noch da, flüstert eine Stimme in mir. Vielleicht sind sie alle noch da. Isabella, Odina, Lee, Josie. Aber die Stimme lügt. Eine ist nicht mehr da. Eine ist verschwunden.
Ich schüttele mich und konzentriere mich wieder auf die Straße. Es sieht alles noch aus wie damals. Die langen Sommerwochen über viele Jahre hinweg haben jede Straße, jede Abzweigung der Insel in mein Gedächtnis gebrannt. Ich lasse den Blick ein wenig schweifen, sehe auf die vollen Mülltonnen, die am Straßenrand auf Abholung warten, betrachte die weitverzweigten Stromleitungen, auf denen Vögel sitzen, und sehe, wie sich der braune Rasen der Vorgärten mit dem sandigen Untergrund mischt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite fahren Kinder mit zu großen Rädern, und eine ältere Frau steht in ihrem Garten und nimmt die Wäsche von der Leine. Eilig, als würde es in wenigen Minuten zu regnen beginnen.
Und dann lässt es sich nicht mehr in die Länge ziehen, ich biege in die Beach Side Road und fahre auf den Parkplatz, auf dem die roten Absperrbänder im Wind flattern. Mit zitternden Knien steige ich aus und schlage die schwere Tür meines Mietwagens hinter mir zu. Es ist lange her, so lange. Ich nehme den Gitarrenkoffer von der Rücksitzbank und werfe mir die Reisetasche über die Schulter. Darunter bricht mein Herz gleich seinen eigenen Geschwindigkeitsrekord.
Wenn irgendetwas das verbergen kann, dann diese Jacke. Sie ist so etwas wie ein Schutzschild. Ein alter, gut geölter Panzer, den ich mit sechzehn zusammen mit einem verstaubten Batikhemd und speckigen Motorradstiefeln in einem Stoffkleiderschrank auf Dad und Marges Dachboden gefunden habe.
»Da wären wir also«, sage ich zu mir selbst und ziehe die Lederjacke enger. Der Wind ist frisch, aber die Luft ist warm. Die Haare wirbeln mir um den Kopf wie meine Gedanken. Meine Schritte sind nicht so fest, wie ich sie mir gewünscht hätte. Ich habe gewusst, dass dieser Ort etwas mit mir machen würde. Mir war nur nicht klar, was. Und wie viel.
Schon vorhin auf der Brücke, noch bevor das breite Schild mit dem leicht verblichenen Schriftzug die wenigen verbleibenden Meilen bis Harbour Bridge angekündigt hat, hatte ich das seltsame Gefühl, mit magischen Kräften auf die Insel gezogen zu werden.
»Harbour Bridge? Ist das eine gute Idee?«, höre ich meine Stiefmutter Marge sagen. Eine leise, versteckte Verzweiflung in ihrem Tonfall. Doch jetzt ist mir, als trüge der Wind ihre Worte davon, würde ihre Stimme mit jedem Wort leiser. Der Südstaatenwind bläst sie fort. Und fast vergesse ich, dass Harbour Bridge das Ende unserer Tour markiert. Dass ich Jake nicht mehr täglich sehen werde. Dass er bald irgendwo anders sein wird. Weil es mich trotz allem stört, wenn er ohne mich ist. Bei Emily, seiner Frau. Bei irgendeiner anderen. An einem Tresen in einer heruntergekommenen Bar mit zu viel Alkohol. Zu viele Orte, zu viel Geld und zu viele Möglichkeiten. Das Leben steht nie still für ihn. Und wenn, dann kann er nicht damit umgehen.
Ganz leise klingen die Stimmen nach. Die, die mich anschreien, die, die mich anschweigen. Dabei ist Jakes Schweigen wahrscheinlich lauter und brutaler als Mortimers Geplärr. »Es wird Zeit, dass ihr wieder etwas schreibt, Mädchen. Seit drei Jahren kein neuer Song!«
Der mitfühlende Blick meines Bruders.
Der enttäuschte Blick meines Vaters.
Jakes Blicke.
Josies Blicke, die ich nur noch von Fotos kenne und die mich trotzdem nach Harbour Bridge ziehen. Auch Josies Stimme hallt seit langer Zeit wieder durch meine Gedanken. Wie gut man eine Stimme verdrängen kann, wenn man nur laut genug dagegen anbrüllt. Vielleicht bin ich deswegen Musikerin geworden.
Vor mir liegt der Strand, der für das Konzert künstlich verbreitert und platt gewalzt wurde. Kurz fühlt es sich an, als hätten die Zeiger der Uhr sich gar nicht gedreht, als wären wir alle auf der Stelle getreten. Und als wäre nur Josie im Treibsand verschwunden.
Ich drehe mich zum kleinen Häuschen mit der Verbretterung. Das Holz an der Fassade des Hauses war einmal blau, nicht weiß. Vielleicht ist der Ton einer Wandfarbe nicht bedeutend. Aber ist es nicht wichtig, in welche Farbe man eine Geschichte taucht? Der falsche Farbton kommt mir für einen kurzen Augenblick wie ein Verrat an meinen Erinnerungen vor. Ich wende mich ab und schaue stattdessen auf die Wellen, die sich hinter dem Schutzdeich brechen. Ihr Rauschen ist eine Melodie für sich. Jeder Ort hat einen Klang. Eine ganz eigene Tonleiter, die in mir widerhallt. Harbour Bridge ist ein d-Moll-Akkord, unterlegt vom tiefen Bass des Meeres. Der Wind ist der Gesang dazu, der sanfte Ruf einer Sirene. Und auch wenn die Töne eine beruhigende Wirkung haben, fühle ich mich plötzlich, als würde ich erwachen.
Ich ziehe die Jacke enger und gehe auf die Bühne zu. Winke den vertrauten Gesichtern zu, die Getränkekisten tragen, Kabel von Trommeln rollen, Stahlgestänge aufbauen und Lautsprecher von der Ladefläche eines Pick-ups laden. Auf der Bühne entdecke ich Lindsay von der Technik. Sie kämpft gemeinsam mit dem glatzköpfigen Roadie, der uns seit Warschau begleitet, mit der Verkabelung und schimpft dabei lauthals auf die miserable Stromversorgung: »Beim ersten Solo, spätestens, fliegt uns das um die Ohren. Bumm und Lichter aus. Du wirst schon sehen!«
Ich lächle schwach. Ich weiß, dass uns die Lichter nicht ausgehen werden. Auf Lindsay ist Verlass. Zuerst lege ich meinen Gitarrenkoffer auf die Bühne, werfe meine Tasche hinterher, und dann stütze ich mich mit den Armen auf die Brüstung und ziehe mich hoch.
»Du musst zugeben, dass das der beste Ausblick ist, den wir jemals hatten«, sage ich und deute auf das Meer. Lindsay brummt etwas Unverständliches.
Ich sehe mich um und warte darauf, dass etwas passiert. Dass mich die Umgebung einsaugt und mich dort wieder ausspuckt, wo alles begonnen und alles aufgehört hat. Harbour Bridge ist meine ganz eigene Lebenslinie. Ein klarer Cut. Altes Leben, neues Leben und gar nicht so viel dazwischen.
»Wo ist Jake?«, frage ich in die Runde auf der Bühne.
Lindsay zuckt mit den Schultern. Sammy am Bass räuspert sich und schüttelt sein kurzes blondes Haar. Und Rodriguez, unser Drummer, brummt: »Er war nicht im Bus.«
»Wie, er war nicht im Bus?«
Sammy sieht Rodriguez an, als wolle er sagen: Weißt du nicht, was in Berlin passiert ist? Und ich, ich sage nichts, weil ich hoffe, dass vielleicht noch nicht alle in der Band wissen, was in Berlin wirklich los war.
»Er hat einen Abstecher nach Cannon Falls gemacht«, antwortet Rodriguez.
Wie immer bei der Erwähnung dieses Ortsnamens zieht sich alles in mir zusammen. Meine Finger zittern, aber ich versuche, es mir nicht anmerken zu lassen. Cannon Falls, Jake, Emily. Und stets ein Punkt dahinter, der mich nicht einschließt. Keine Chance auf ein Komma. Spätestens hinter Emily steht ein finales Satzzeichen. Offensichtlich auch noch nach Berlin.
Ich seufze. Dann nehme ich »die Blonde« aus dem Gitarrenkoffer. Da liegt sie, als wäre sie eine einfache, billige Schulgitarre und keine Fender Stratocaster mit allen Details und historischer Bedeutung. Ich liebe und hasse diese Gitarre. Jake hat sie mir vor drei Jahren zum Geburtstag geschenkt. Hätte er mir die Strato nicht freudestrahlend in dieser winzigen Umkleide in Wisconsin wie ein neugeborenes Baby in die Hände gelegt, würde ich wohl immer noch »die Blaue« spielen. Und ich würde sie gern spielen. Nun aber bin ich im Besitz eines Instruments, das laut Jake das Original von Mary Kaye ist. Einfach, weil er es konnte, hat er ein Vermögen für diese Gitarre ausgegeben, um sie mir zu schenken. Ich liebe und hasse Jake genauso wie die Strat. Deshalb ist sie das perfekte Sinnbild unserer komplizierten Beziehung.
»Legen wir los?«, fragt Lindsay und mustert mich nachdenklich.
Ich nicke. »Legen wir los. Jake wird schon noch auftauchen.«
»Linecheck schon durch«, brummt Sammy an seinem E-Bass.
Wie immer beim Soundcheck trage ich meine weiten Jeans mit dem abgenudelten Saum und dem ausgewaschenen hellen Blau. Die Glückshosen. Mein Bühnenoutfit liegt schon seit heute Morgen gewaschen und gebügelt im Tourbus. Ich weiß, ich hätte auch gestern anreisen und mich im Ferienhaus meiner Eltern breitmachen können. Stattdessen habe ich wie die anderen ein Hotelzimmer im Seasons. Eigentlich sollte ich die Tage hier mit Dad und Marge verbringen, wir haben ohnehin zu wenig Zeit miteinander und uns seit der Rückkehr aus Europa nur kurz gesehen. Aber so viele Dinge halten mich davon ab. Die Liebe meiner Stiefmutter, die manchmal erdrückend ist und der ich nur ein schlechtes Gewissen entgegenzusetzen habe, und eine endlose Sehnsucht nach den alten Zeiten, die zu schwer ist, um sie abzuschütteln, zu hartnäckig, um ihr nachzugeben. Ich weiß, dass meine immer wieder aufblitzende Schwermut ein Motor für die Musikerin in mir ist. Und trotzdem wünsche ich mir manchmal mehr Leichtigkeit.
»Avery, bist du bereit?«, ruft Sammy und spielt die Anfangsmelodie von »A Summer Gone By«. Rodriguez an den Drums bearbeitet die Snare. Ich seufze, strecke die Schultern und versuche, die Gedanken loszulassen und mich ganz auf die Musik zu konzentrieren. Ich schlüpfe aus der Lederjacke, lege sie vorsichtig auf einen der Lautsprecher. Lindsay schießt nach vorn, richtet mir das Mikro und zwinkert mir aufmunternd zu. »Schöne Frisur«, sagt sie und zieht an meinem langen blonden Flechtzopf, der mir über den Rücken hängt. In New York habe ich mir während der Wartezeit auf den Anschlussflug nach Charleston den Pony schneiden lassen, ganz kurz. Jake hat es noch nicht gesehen.
»Komisch, hier zu sein«, sage ich leise.
»Das sind der Jetlag und die Aufregung«, besänftigt mich Lindsay. Für sie ist das hier ja nur irgendein Festival. Nicht der Ferienort ihrer Kindheit. Nicht der Ort, an dem sich die Weichen für ein Erwachsenenleben endgültig gestellt haben. Das Fleckchen Erde, an dem Jake und ich das erste Mal miteinander geschlafen haben. Der Platz, an dem Odina und ich statt Notenblättern Flugblätter mit Josies schönem Gesicht drauf gedruckt haben. Flugblätter von der Art, wie sie irgendwann überall hingen. Hunderte von ihnen. Auf der ganzen Insel. Tausende. Überall im Land.
»Aufregung ist der Antrieb der Antriebslosen«, philosophiert Sammy. »Und Jetlag gibt es nur, wenn man vom Westen in den Osten fliegt, nicht umgekehrt.«
»Du weißt, wo Osten und Westen liegen?«, ruft Lindsay, und ich muss lachen.
»Ich weiß, wo im Osten und im Westen die schönsten Frauen auf mich warten. Das reicht mir«, kontert er und dreht am Synthesizer. Ich schwenke das Mikrofon und stelle mich so, dass ich dem noch leeren Publikumsbereich den Rücken zudrehe und stattdessen Sammy und Rodriguez anschaue. Fokussier dich, Ave, fokussier dich.
Ich zupfe an den Saiten und will gerade die erste Zeile unseres letzten Nummer-eins-Hits singen, als sich die Härchen an meinen Armen aufstellen.
»Ihr fangt ohne mich an?«, schreit jemand heiser. Es ist Jake, der über die Bühne stampft. Er ist angetrunken. Das höre ich an seiner Stimme, und das fühle ich an seinen Händen, die sich wenige Sekunden später schwer auf meine Schultern legen. Ich will ihn abschütteln, aber er drückt fester.
»Gab es Whiskey zum Familienfrühstück? Cannon Falls ist auch nicht mehr der friedvolle Hafen, der es mal war«, sage ich spöttisch. Rodriguez sieht aus, als wollte er seine Sticks nach uns werfen.
»Sie war nicht da«, sagt Jake, und auf einmal bin ich mir nicht mehr sicher, ob er wirklich etwas getrunken hat.
»Wer?«, frage ich unsinnigerweise und kämpfe gegen diese Mischung aus Erleichterung und schlechtem Gewissen an, die sich in mir breitmacht.
»Meine Frau«, brummt Jake. Es gelingt mir endlich, ihn abzuschütteln. Ich drehe mich um und starre ihn an. Auf eine andere Weise als vor Berlin. Ich versuche, all das zu sehen, was sich hinter seiner gerunzelten Stirn verbirgt. Hinter den zu langen Haaren, die in Europa mangels Sonne stark nachgedunkelt sind. Er sieht aus wie früher. Wie an dem Tag, an dem wir uns kennenlernten. Bis auf den Bart, der sein Kinn bedeckt. Seine dunklen Augen blitzen wütend. Aber ich sehe, was er verbirgt. Und ich versinke darin – in all dem, was Jake eigentlich ist. In dieser alten, guten Seele in seinem jungen, wilden Körper. Ich spüre, wie ich trotz meines Ärgers weich werde. Merke, wie ich wider meinen Willen von etwas überschwemmt werde, das ich schon so lange im Zaum zu halten versuche. Es lässt sich nicht bändigen, genauso wenig wie Jake.
»Wo ist Emily?«, will Sammy wissen.
»Bei ihrer Mutter.«
»In Miami?«, rufe ich überrascht. Obwohl ich eigentlich gar nichts sagen wollte. So, wie ich schon lange nichts mehr zu Jake und Emily sage.
»Ja, in Miami«, brummt er und summt »Welcome to Miami«, fügt dann gut gelaunt hinzu: »I don’t need an Emily.«
Dabei weiß ich, dass das nicht stimmt. Er braucht sie. In Cannon Falls ist er immer nüchtern. Das Gute – oder vielleicht eher das Schlimme – ist, dass er selbst betrunken noch gut ist. Nicht so perfekt wie nüchtern. Aber anders als ich ist er durchaus in der Lage, seine Musikerqualitäten auch sturzbesoffen unter Beweis zu stellen. Wir mussten noch kein einziges Konzert deswegen canceln. Und deshalb sagt selten jemand etwas. Nicht der Manager, nicht Lindsay, nicht der Fahrer, der im Tourbus seinen nächtlichen Redefluss aushalten muss, nicht Sammy, nicht Rodriguez. Wir nehmen hin, dass Jake ein Problem hat. Und alle, sogar ich, hoffen auf Cannon Falls. Er muss nur einmal wieder nach Hause, sich ausnüchtern und sich von Emily die Leviten lesen lassen. Dann bleibt alles halbwegs unter Kontrolle. Oder haben wir die Kontrolle längst verloren? Seit Berlin kann ich es nicht mehr sagen.
Jake schnappt sich seinen Bass, hängt den breiten Lederriemen über die Schultern und zupft ein paar garstige tiefe Töne. »Who needs an Emily, who needs Miami, I got you«, improvisiert er und sieht mich dabei an. Ich sehe weg.
»Hör auf mit dem Mist und lass uns weitermachen. In zwei Stunden geht es los.«
Wortlos stellt sich Jake neben mich und fragt gelassen: »A Summer Gone By?«
Obwohl ich das Lied mitgeschrieben habe, ist mir der Bezug zu Harbour Bridge bis heute nicht aufgefallen. Dabei stimmt es, ein Sommer, der vergangen ist. Und den wir nicht wiederholen können. Wir alle nicht.
2
»Aber Mrs. Hobbs, ich bitte Sie! Natürlich haben Sie ganz vorne im VIP-Bereich Platz.« Mortimer, unser Manager, strahlt Marge an, als wäre sie die First Lady des Landes und nicht meine leicht untersetzte, grau gesträhnte und blasse Stiefmutter, die vor Stolz platzt und sich dennoch auf meinen Konzerten nie ganz wohlfühlt. Ich weiß, dass sie unsere Musik nicht mag. Sie geht am Wochenende zum Line-Dance, sie liebt George Strait und Willie Nelson. Nie würde sie zugeben, dass ihr Force of Habit zu laut ist, dass sie meine Texte zu direkt findet und Jake misstraut, seit er vor zwei Jahren in New Mexico wegen Trunkenheit am Steuer vier Tage in Untersuchungshaft saß. Ich habe ihr nie gesagt, wie hoch die Kaution wirklich war.
»Ich sitze aber gern hinten, Mortimer. Ich habe ja die Hunde dabei. Nicht, dass das zum Problem wird. Und bitte, nennen Sie mich doch endlich Marge«, widerspricht sie, lächelt und winkt mir liebevoll zu.
Es hat erstaunlich gutgetan, meinen Vater und sie vorhin fest zu umarmen. Mein Vater trägt wie immer seine Baseballkappe mit dem blau-roten Logo der Minnesota Twins. Sein Kopf mag kahl sein, aber sein Herz ist voll und schlägt für unsere Musik. Ich lächle beiden zu und gehe zurück hinter die Bühne. Dort finde ich Jake, der auf den Boden starrt, als hätte er Zeit und Raum vergessen. Er denkt an Emily, begreife ich. Ich fummele an der Strat herum und wechsele ein paar Sätze mit Sammy und Rodriguez, die ich sofort wieder vergesse. Ich versuche, mich auf das zu freuen, was jetzt kommt, aber entweder haben mich Europa und Asien stärker geschlaucht als gedacht, oder ich habe so eine Art Heimatblues. Das Gegenteil von Heimweh.
Ich trage enge schwarze Hosen, ein rotes Oberteil mit V-Ausschnitt, Stiefel. Ich habe eine Schicht Make-up auf dem Gesicht, und trotzdem fühle ich mich so nackt wie nie zuvor. Ich beginne auf meiner Unterlippe zu kauen und konzentriere mich darauf, mir selbst einzureden, dass das hier nicht anders ist als all die Konzerte der letzten Monate.
»Du musst keine Angst haben, Ave«, flüstert Jake mir ins Ohr.
Ich antworte nicht.
»Es tut mir leid«, sagt er noch leiser.
»Was genau?«, wispere ich zurück.
»Dass ich es offenbar nie schaffe, etwas für dich richtig zu machen.«
Ich antworte nicht.
»Ich bin ein Arschloch«, versucht er es erneut.
Ich reiße den Kopf herum und schaue ihm in die Augen. »Nein, Jake, du bist kein Arschloch. Du wärst nur manchmal gerne eins, weil das einfacher ist, als sich seine Probleme einzugestehen.« Ich hole Luft, und dann sage ich: »Nach der Tour bin ich erst mal raus.«
Der letzte Satz fällt einfach so, direkt aus meinem Unterbewusstsein, und klatscht Jake vor die Füße. Ich weiß nicht, wer darüber mehr erschrickt. Er oder ich. Ich weiß nicht einmal, was genau ich damit sagen will.
»Was meinst du damit?«, sagt er. Sein Atem klingt rasselnd, heiser, erhitzt. Ein Zustand, der stets exzessiven Trinkgelagen folgt und seiner Singstimme paradoxerweise guttut.
»Ich meine es, wie ich es gesagt habe.« Und plötzlich weiß ich, dass das stimmt. Das alles hier. Die Band, der Stress, Jake … macht mich kaputt.
»Ich brauche dringend eine Entgiftung«, murmele ich.
»Du meinst, ich … ich muss zur Entgiftung«, entgegnet er, kommt noch einen Schritt näher, traut sich aber nicht, mich anzufassen.
Ich lache kurz laut auf. »Ja, du auch.«
»Seid ihr so weit?«, Mortimer lugt durch den Vorhang, schüttelt kurz den Kopf, als er die improvisierte Verkabelung sieht, und murmelt dann: »Wenn uns das nicht nach fünf Minuten um die Ohren fliegt …«
»Wird schon«, sagen Jake und ich gleichzeitig. Aber keiner lächelt. Nicht mal Mortimer.
Als wir nach draußen treten, ist es wie ein Vorhang, der sich lüftet. Ein Steinbrocken, der sich von mir hebt. Jedes Mal, wenn ich die Bühne betrete. Ich bin süchtig nach diesem Gefühl, nach der Anerkennung der Menge. Und nach Jakes. Meistens spüre ich es bereits nach den ersten zwei Songs – ob er zufrieden ist oder nicht. Ich weiß es spätestens nach dem ersten Solo. Ich sehe es in seinem Blick. Das Lampenfieber, das ich vor jedem Auftritt empfinde, brennt diesmal noch heißer. Diese Köpfe da unten sind nicht nur Fremde. Hinter einigen Augenpaaren steckt jemand, den ich aus meiner Jugend kenne. Es gelingt mir erstaunlich gut, auszublenden, dass da unten Isas ehemaliger Schwarm steht und gut und gerne sechzig Pfund mehr auf den Hüften hat als früher. Ich sehe an Allister Waters vorbei und kann verdrängen, dass er mir im einzigen Supermarkt der Insel einmal seine glitschigen Hände wider meinen Willen auf den Hintern gelegt hat. Auch Wendy Myers ist da, deren Familie gegenüber von Marge und meinem Vater ein Ferienhaus besitzt, und ich überlege, ob sie wirklich Paul Lechtenberg geheiratet hat.
Nichts fliegt uns um die Ohren. Dad und Marge stehen tatsächlich im abgezäunten VIP-Bereich. Ich muss an Lee denken, die sich da sicher auch irgendwie reingeschmuggelt hätte. Früher.
Wie Maschinen spulen wir unser Programm ab, und niemand merkt, dass wir unter unseren Möglichkeiten bleiben. Rodriguez begeistert mit einem Solo, obwohl ich es schon hundertmal besser gehört habe, Sammy schlampt ein paarmal bei den Übergängen, nur Jakes Stimme klingt, wie der Rolling Stone vor einem halben Jahr geschrieben hat: »Eine Symbiose aus Sex, brachialer Urgewalt und Honigtropfen auf einem Baconsandwich.« Und diesmal kommt meine Stimme aus dem Kopf und nicht aus dem Herzen. Ich höre es, und Jake hört es. Auch wenn es sonst niemandem auffällt, weil keiner mich so gut kennt wie er. Und einen winzigen Moment blitzt eine Erinnerung auf. Ich sehe Josie, die mich vor so vielen Jahren sanft an die Schultern gefasst und mir erklärt hat, dass es gegen Lampenfieber helfen kann, zu Beginn mit dem Rücken zum Publikum zu singen. Ich schließe kurz die Augen und versuche diese beiden Frauen miteinander in Einklang zu bringen. Die Avery, die jetzt auf der Bühne steht, und die Avery, die glaubte, sterben zu müssen, wenn sie vor einer großen Menschenmenge singen sollte. Danke, Josie, hauche ich in Gedanken und zwinge mich dann, wieder ganz in der Gegenwart zu verharren.
Kurz vor dem letzten Song lasse ich den Blick noch einmal schweifen und bleibe atemlos an einer Person hängen. Alles in mir stockt. Meine Hände sind nicht in der Lage, weiterzuspielen, und meine Stimme wird leiser, leiser, bis sie ganz abbricht. Eine Sekunde lang starren wir uns an. Ich bin mir sicher, dass sie mich direkt ansieht. Ich hätte sie unter Tausenden wiedererkannt. Ganz am Rand, neben jenem Strandhüttchen, dessen weiße Farbe mir so falsch vorkommt, steht Odina.
Meine Odina. Die Haare wehen ihr ums Gesicht. Dicht und dunkel. Sie trägt ein grünes Kleid, und selbst aus der Ferne kann ich sehen, dass sie immer noch schön ist. Vielleicht sogar schöner als in meiner Erinnerung.
Ich spüre Jake in meinem Rücken, ohne dass ich den Blick von Odina abwende. Höre, wie er für mich übernimmt. Ich zwinge mich, weiterzumachen, dabei will ich von der Bühne springen und auf sie zulaufen. Sie umarmen und sagen: Es tut mir leid. Wir alle hätten so nie auseinandergehen dürfen. Das hätte nie passieren dürfen. Aber es ist zu spät. Ich bin hier oben, sie dort unten. Zwischen uns liegen Jahre, die sich wie eine Mauer aufgebaut haben.
Sie hat mir so sehr gefehlt.
Dann kommt der letzte Song vor der Zugabe. Ich zwinge mich, den Blick von Odina abzuwenden. Ausgerechnet dieser Song. Mit Odina hier, an diesem so schicksalsträchtigen Ort. Ein Song, der mich schon so oft zum Weinen gebracht hat. Ich würde ihn am liebsten nie wieder singen. Aber dazu ist er zu erfolgreich. Das Publikum fordert ihn. Und als ich mich in Paris geweigert habe, hat es uns Buhrufe, verärgerte Kommentare auf unseren Social-Media-Kanälen und einen empörten Artikel in einer bekannten französischen Tageszeitung eingebracht. Wie so oft bei Rock- oder Metalbands ist unser kommerziell erfolgreichster Song eine Ballade. Eine, die ich bitterlich bereue geschrieben zu haben, obwohl sie das Beste ist, was ich je hervorgebracht habe. »A Girl Named Josie« hat den perfekten Anfang, die perfekte erste Sekunde. Ich sehe mich um, bevor ich den Ton anstimme. Suche noch einmal Odinas Blick. Aber sie ist weg.
Ich blinzele.
Neben dem weißen Häuschen steht niemand mehr. Odina ist verschwunden, als wäre sie nie da gewesen. Als hätte ich sie mir nur eingebildet. Und doch, während der erste Ton von »A Girl Named Josie« erklingt, weiß ich, dass sich etwas verändert hat. Ich sehe zu Jake, eine Sekunde lang, zwischen C und D, und weiß, dass ich dringend Abstand zwischen uns brauche. Als hätte Odina mir zugeflüstert, dass ich meine Vergangenheit bewältigen muss, um mir eine Zukunft zu ermöglichen. Zum ersten Mal, seit wir uns kennen, möchte ich an einem Ort sein, der mir allein gehört. Ohne Jake. Jake war in Amerika meine Rettung, jetzt wird er, wenn ich nicht aufpasse, mein Untergang sein.
Es ist dunkel, aber der Vollmond taucht das Meer in ein mystisches Blau. Zwei Stunden nach dem Konzert sitze ich am verlassenen Strand von Harbour Bridge und habe zwei Dosen Bier neben mir im Sand eingegraben, um sie kühl zu halten. Ich muss lächeln, weil mir Lee dabei in den Sinn kommt. So intensiv, als würde sie wirklich neben mir sitzen und versuchen, sich an der falschen Seite ihres Kopfes die Haare hinter die Ohren zu stecken. Es ist seit langer Zeit das erste Mal, dass mir etwas Banales in Bezug auf Lee wieder einfällt. Das muss am Ort liegen. Oder an der Tatsache, dass Lees Familie nie einen Kühlschrank besessen hat. Was sie wohl heute macht? Und Josie? Ob es ihr gut geht? Was sie alle machen? Ich denke an Odinas lange Haare, wie sie neben der Strandhütte stand. Ich habe nach dem Konzert ein paar Roadies mit einer Beschreibung von ihr ausgeschickt, auch wenn ich am liebsten selbst auf die Suche gegangen wäre. Doch in der Menge wäre kein Durchkommen gewesen. Aber auch so war sie offenbar nicht aufzufinden. Verschwunden, wie Josie. Nach dem Festival. Die Parallelen sind so erschreckend, dass ich eine Gänsehaut bekomme. Wie ich sie vermisse. Sie alle. Odinas lebhafte Stimme und ihre fast schon mütterliche Besorgtheit um uns, Isas bleiche Eleganz und ihren scharfen Verstand, Lees blitzblaue Augen und ihre Unerschrockenheit, Josies hohe Wangenknochen und ihre unberechenbare Abenteuerlust. Das ist es, was ich hier wollte. Ich will das zurück, was wir einst hatten.
Erst als ich durch das Meeresrauschen nahende Schritte höre, hebe ich den Kopf und verliere mich direkt in Jakes Blick. Seine Augen leuchten unnatürlich hell.
»Hey«, sagt er.
»Hey«, antworte ich.
Er lässt sich neben mich fallen, so nah, dass ich seinen warmen Körper spüre.
»Du warst gut heute.«
»Lügner«, sage ich.
»Du warst gut, du warst aber auch schon mal besser«, ergänzt er. Ich muss lächeln.
»Wie geht es dir?«, fragt er vorsichtig.
Ich seufze. »Keine Ahnung. Sag du es mir.« Ich sehe ihn kurz an, sehe dann wieder weg, greife nach einer Bierdose und öffne sie zischend. Ich bedeute ihm, sich die andere zu nehmen, aber er schüttelt den Kopf. Ich verkneife mir einen bissigen Kommentar.
»Nach dem Konzert ist vor dem Konzert. So war es immer in den letzten zweieinhalb Jahren. Und jetzt …«
»Jetzt hat diese Freiheit etwas Beängstigendes«, beendet er meinen Satz.
»Ja, genau.« Es überrascht mich nicht, dass er es versteht. »Jetzt müssen wir ohne den Applaus überleben. Ohne den Kick. Ohne vor Menschenmassen zu stehen und zu wissen, dass man sie für ein paar Stunden völlig im Griff hat.«
»Ja, weißt du, manchmal denke ich, wir sind so etwas wie Dompteure«, stimmt er zu.
»Oder Dirigenten«, werfe ich ein. »Wir führen ihre Emotionen, bestimmen ihren Takt, ihren Puls, ihre Sinne. Es ist ein Gefühl von Macht, nach dem man süchtig werden kann.«
Er nickt, und dann herrscht eine Weile Schweigen, bis Jake die Stille irgendwann doch durchbricht.
»Was hast du jetzt vor, Ave?«
»In unserem Urlaub?«, frage ich nach und ärgere mich sofort über das »unserem«. Warum habe ich nicht einfach »meinem Urlaub« gesagt?
»Ja, was machst du?«
Ich zucke mit den Achseln und schaue aufs Meer. »Vielleicht surfe ich. Ich war so lange nicht surfen. Ich hätte mal wieder Lust dazu. Vielleicht auf Hawaii, in Portugal, oder …«, und dann spreche ich aus, was sich, seit ich Odina in der Menge entdeckt habe, als fixer Gedanke in meinen Kopf eingenistet hat. Harbour Bridge ist nicht unsere Insel. »Oder ich bleibe einfach hier.«
»Hier?«, stößt er überrascht aus und streicht sich die Haare aus der Stirn.
»Warum nicht? Marge und Dad haben das Strandhaus noch, und sie fahren morgen nach Jamesville zurück.«
»Ich will nicht, dass du hier allein bist. Ich …« Er zögert kurz, »mache mir Sorgen … Du bist hier nicht sicher, ganz allein.«
»Warum nicht?«
»Du hättest sagen können: Dann bleib zusammen mit mir hier.«
»Warum sollte ich das sagen?«
»Warum nicht?«, antwortet er und grinst so frech, dass ich wegsehen muss, damit dieses Lächeln mich nicht ansteckt.
»Was passiert danach, Ave? Nach dem Urlaub?«
Ich ziehe mit den Zeigefingern gerade Linien in den Sand, als könnte ich damit auch meine Gedanken ordnen.
»Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht.«
»Du hast mir Angst gemacht vorhin«, meint er, und ich weiß, dass er damit auf meine Aussage auf der Bühne anspielt.
Ich antworte nicht.
»Wir sollten endlich wieder etwas schreiben«, fügt er hinzu.
»Wie soll das gehen?« Ich sehe ihn wieder an.
Die Wahrheit ist: Solange man auf Tour ist, wird nicht von einem erwartet, dass man neue Songs herausbringt. Eine unplugged Platte vielleicht, ein Live-Mitschnitt, ein paar Sonderauskopplungen. Aber nichts Neues. Und eines ist mir seit Berlin klar: Wir können es nicht mehr. Jake nicht und ich auch nicht. Unsere ohnehin schon wackelige Konstruktion hat dauerhafte Schieflage bekommen, und ich weiß nicht, wie man es wieder geraderückt. Bestimmt nicht, indem wir miteinander schlafen.
»Wir waren in Berlin, Ave«, sagt er. Seine Hand rutscht im Sand ein wenig in meine Richtung. »Wir können alles schaffen.«
»Ja, wir waren in Berlin.«
»Und du willst nicht darüber reden.«
Ich schüttele den Kopf. »Nein, will ich nicht.«
»Ich möchte, dass du weißt …«, fängt er an. Aber bevor er weitersprechen kann, lege ich ihm meine Finger auf die Lippen. Ein fataler Fehler, wenn man bedenkt, was diese simple Berührung mit mir macht. Verdammt, das sind nur meine Finger auf seinem Mund. Nichts. Und doch alles.
»Ich möchte nicht, dass du mir etwas sagst, was du schon viel zu oft zu viel zu vielen Frauen gesagt und noch nie gemeint hast«, erwidere ich.
Er seufzt. Aber Jake wäre nicht Jake, wenn er sich davon abbringen lassen würde.
»Kommst du mit mir ins Seasons, zum Essen?«, will er wissen.
»Hast du keine andere Begleitung für heute Abend?«, sage ich garstig. »Die kann man sogar kaufen, wenn man nicht charmant genug ist, dass jemand freiwillig mitgeht.«
Er lacht laut, und ich hoffe, dass er nicht sagt, dass ich in Berlin alles sehr freiwillig gemacht habe – doch stattdessen verzieht er den Mund und erklärt: »Na dann, soll ich den Escortservice für dich anrufen? Es gibt bestimmt auch Herren in der Auswahl. Du könntest Marge mit einem Johnny-Cash-Verschnitt beeindrucken …«
»Der hat ein Alkoholproblem«, sage ich und sehe ihm fest in die Augen.
»Hatte«, kontert er und wird für eine Sekunde ernst. »Oder ein Quarterback für deinen Vater? Ah, nein, besser nicht, dein letzter Freund hatte ja ein gewisses Gewaltproblem …«
»Offenbar haben alle meine Freunde irgendein Problem«, gifte ich zurück und zucke innerlich bei der Erinnerung zusammen. Lance, mein letzter Freund, Profifootballer und Quarterback der San Francisco 49ers, hat meinem Bruder Noah während eines Familienessens beinahe die Nase gebrochen. Ein Streit, der begann, weil mein kleiner Bruder ganz unverblümt zugegeben hatte, Fan der Eagles zu sein.
»Scheint so«, erwidert Jake ungerührt.
»Zumindest wechsele ich meine Problemfreunde nicht so häufig wie du deine Bettwanzen, vor Emily.«
»Meine Bettwanzen?«, jetzt lacht er schallend.
»Ja, deine Bettwanzen. Dünne Körper, die sich an dich kleben. Klassische Parasiten, Insecta Groupia eben.«
»Gott, Ave, ich liebe deinen Humor«.
»Ich würde gerne eine Bierdose nach dir werfen«, sage ich und koste den Moment ein wenig aus. »Aber ich schätze, auf alkoholfrei stehst du nicht.«
»Du weißt genau, worauf ich stehe«, erwidert er, und seine Stimme klingt heiser. »Lass uns über Berlin reden.«
»Du kannst mit Emily über Berlin reden. Wenn sie aus Miami zurück ist.«
»Aber ich …«
»Lass es einfach«, unterbreche ich ihn.
»Ave …«
»Jake …«, äffe ich ihn nach. Er versucht, nach meiner Hand zu greifen, aber ich ziehe sie rechtzeitig weg.
»Wir sehen uns im Seasons. Wenn du nicht kommst, erzähle ich deinen Eltern vielleicht von Berlin«, sagt er so unschuldig wie möglich.
»Das wagst du nicht!«
»Dann komm und verhindere es«, stichelt er, steht auf, klopft sich den Sand von der Hose und kniet sich dann dicht vor mich. »Bleib nicht mehr so lange, es braut sich was zusammen.« Schwungvoll springt er auf die Beine und wendet sich zum Gehen.
»Ja, mit Gebrautem kennst du dich aus!«, knurre ich.
Sein lautes Lachen hallt ihm weit nach, und ich erwische mich dabei, wie sich mein verräterischer Mund verzieht. Nicht witzig, rede ich mir selbst zu, nicht witzig. Eine Weile sitze ich noch im Sand und lasse Jakes Worte durch meinen Kopf hallen, als bräuchte es ein Echo, um sie richtig zu verstehen.
Was hat er gesagt? Freiheit hat etwas Beängstigendes … Wie recht er damit hat. Ich bin ihm schon einmal auf den Leim gegangen, diesem trügerischen Gefühl eines Neuanfangs, dem verlockenden Versprechen von Unabhängigkeit.
3
Vierzehn Jahre zuvor
Ich besuchte meinen Vater zwar zum dritten Mal in den Staaten, aber dieser Sommer würde sich für immer als der erste auf Harbour Bridge in mein Gedächtnis einbrennen. Jene Wochen, auf die ich das ganze Jahr hinfieberte, waren endlich angebrochen. Mein amerikanischer Vater war mit meiner deutschen Mutter, die er an der Universität Karlsruhe kennengelernt hatte, wo sie beide als wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt waren, gerade lange genug liiert gewesen, um mich zu zeugen. Bis auf ihre Leidenschaft für Physik teilten Edgar Hobbs und Cornelia Winter keine Gemeinsamkeiten. Sodass, nüchtern betrachtet, meine Existenz auch an ein physikalisches Wunder grenzt. Kurz nach meiner Geburt lief der Vertrag meines Vaters aus, und er kehrte in die USA zurück. Meiner Mutter war das recht, denn er zahlte mehr Unterhalt, als er verpflichtet gewesen wäre, und sie hatte ihre Ruhe. Sie gestand ihm zu, mich nach seiner früh verstorbenen Mutter zu benennen, und er beharrte darauf, jeden Sommer seinen gesamten Jahresurlaub mit mir in Baden-Baden zu verbringen. Es waren immer die schönsten Wochen im Jahr gewesen. Als ich schließlich alt genug war, um allein zu fliegen, fing ich an, ihn zu besuchen. Beneidet von den Kathrins, Lisas und Miriams meiner Jahrgangsstufe, flog also das Mädchen mit dem komischen Namen jedes Jahr von Frankfurt nach Minneapolis.
In diesem Jahr machten wir gemeinsam mit seiner Frau Marge und meinem Halbbruder Noah auf Harbour Bridge Urlaub. Kurz vor den Sommerferien hatte Dad endlich den jahrelangen Gerichtsprozess gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber gewonnen. Er bekam eine lächerlich hohe Schadensersatzsumme zugesprochen, weil er wegen eines Sicherheitsmangels an einer Maschine den kleinen Finger der linken Hand verloren hatte. Von dem Geld kaufte er sich ein Ferienhaus auf der kleinen Insel in South Carolina und mir eine Akustikgitarre, damit ich meine nicht von zu Hause mitschleppen musste. Ich sagte ihm nicht, dass ich lieber eine elektrische gehabt hätte.
Stets bemüht, mir einen aufregenden Sommer zu bieten, hatte Dad mich auf der Insel für ein Surfcamp angemeldet. Ich wollte aber nicht surfen, ich wollte einfach nur Gitarre spielen. Und ich wollte mir überlegen, wie ich sowohl Dad als auch meine Mutter davon überzeugen konnte, mich endgültig in die USA ziehen zu lassen. Die vier Wochen, die ich hier verbringen würde, erschienen mir viel zu kurz. Ich wollte nicht wieder zu meiner vielbeschäftigten Mutter und meiner Stiefschwester Annabelle zurück. Ich wollte bei Dad sein – und bei Marge, die mich »Honeybunch« nannte, die besten Pancakes der Welt machte und über einen unerschöpflichen Vorrat an Geduld und Liebenswürdigkeit verfügte. Eine Frau, die zwar keine promovierte Physikerin war, aber ihre Liebe zu mir deutlicher zeigte als meine eigentliche Mutter.
Leicht nervös sah ich aus dem Fenster, an dem die Strandpromenade im östlichen Teil der Insel an uns vorbeizog, und ignorierte meinen vor Aufregung zappelnden Bruder, der seinen Neoprenanzug am liebsten schon die Nacht zuvor getragen hätte.
»Jetzt steig schon aus«, sagte Marge mit sanftem Druck, als wir auf dem Parkplatz vor der Surfschule standen. »Es geht in fünf Minuten los. Du schaffst das, Honeybunch. Sie werden dich lieben.«
Noah hatte den Wagen längst verlassen und war in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Er hatte sich entschieden geweigert, den gleichen Surfkurs zu besuchen wie ich.
Und ich hatte zum ersten Mal Angst. Es war doch etwas anderes, mit Dad und Marge Englisch zu sprechen, als mit den vier Amerikanerinnen, die mit mir den Kurs besuchen würden. Mein Akzent würde sofort auffallen. Ich wollte nicht das deutsche Ersatzrad sein. Langsam und mit zitterigen Beinen kletterte ich aus dem Wagen und sah mich um. Es herrschte Ebbe, der Strand war breit, das Meer rauschte leise, und die Luft war so salzig, dass ich das Gefühl hatte, auf meiner Zunge die raue Konsistenz der Kristalle zu spüren. Ich kam mir komisch vor in dem Wetsuit, wie ein Mensch, den man in eine Entenhaut gesteckt hatte, ohne ihm zu verraten, wie man sich damit bewegte. Es war ein unangenehmes Gefühl, genauso wie das, auf die Gruppe Mädchen zuzugehen, die an der Strandbude mit den Surfbrettern herumstand.
Die Hütte wirkte wie einem Prospekt für Surfkurse entsprungen. Das Holz der Bude war leicht verwittert und angegraut. Im vorderen Bereich ragte der Bug eines alten Fischerbootes hervor, als wäre es nicht kunstvoll in die Wand eingebaut, sondern direkt hier an Ort und Stelle gestrandet. Über dem Eingang waren der Schriftzug »Point Break Surfing« und ein dunkel lackiertes Stück Holz in Form einer Welle angebracht. Scheinbar wahllos, in zahlreichen Farben und Längen, lehnten Surfbretter an der Hütte.
Ich würde also die Neue sein, die zu den vertraut beisammenstehenden Mädchen am Point Break dazustoßen würde. Die Versuchung, einfach umzudrehen, zurück zu Marge ins Auto zu steigen und auf Privatstunden zu bestehen, war groß. Dann aber dachte ich an meine Freundinnen zu Hause, die mit offenen Mündern an meinen Lippen hängen würden, wenn ich ihnen vom Surfen in den USA erzählen würde. Von braun gebrannten Ami-Jungs, von Lagerfeuern am Strand, Countrysongs auf der Gitarre und der Brandung im Ohr. Ich blieb mit ein paar Metern Abstand stehen und wagte einen erneuten Blick auf die Mädchen, die mich noch nicht bemerkt zu haben schienen. Zuerst fiel mir die Dunkelhaarige auf – eine Welle brauner Haare kringelte und krauste sich um ihren Kopf und verschmolz an ihrem halb nackten Rücken mit der gebräunten Haut unter dem Neoprenanzug, der aussah, als hätte er bessere Zeiten längst hinter sich gelassen. Sie wirkte etwas älter als ich, vielleicht fünfzehn oder sechzehn. Erst als ich zögerlich näher kam, bemerkte ich, dass die Blondine mit den langen Beinen und der schmalen Taille zu weit weg von der Gruppe stand, um mit den anderen vertraut zu sein. Ihr Neo sah teuer aus. Es war schwarz mit pinken Streifen. Aus dem breiten Tor der Strandhütte trat ein Mann, über dreißig, vielleicht auch schon vierzig, der sich ein heftiges Wortgefecht mit dem dritten Mädchen lieferte, das nur einen Bikini trug und wild gestikulierend auf den Mann einredete. Sie sprach mit einem so starken Slang, dass ich nur Fetzen verstand, dem Gespräch aber immerhin so weit folgen konnte, dass ich wusste, worum es grob ging. Er wollte sie nicht zum Kurs zulassen, sie hatte aber eine Art Gutschein und beharrte darauf, eine gewisse Elisabeth Warren zu sein, was er ihr wiederum nicht abnahm.
»Die Warrens haben vorgestern ausgecheckt«, sagte die Blondine kühl und musterte das Mädchen im Bikini. Diese warf ihr einen bitterbösen Blick zu und verkündete dann selbstbewusst: »Umso besser, dann nehme ich«, sie malte Gänsefüßchen in die Luft, »der ›anderen‹ Elisabeth Warren ja nichts weg. Was ist jetzt, Andy, lässt du mich mittrainieren? Ich kann diesen Bitches hier noch einiges beibringen.« Sie hob das Kinn, das wie alles an ihrem Gesicht etwas spitz war. Ich musterte sie interessiert. Ihr glattes dunkelblondes Haar war kinnlang und sah aus, als hätte sie es selbst geschnitten. Ihr flacher, durchtrainierter Bauch bestätigte den Eindruck eines dünnen, aber athletischen Mädchens. Zögerlich ging ich ein paar Schritte näher und schloss mich der Gruppe an.
Sie drehte sich zu mir um. »Und den Touris auch.« Sie grinste entschuldigend. »Ich bin Lee«, erklärte sie und streckte mir ihre Hand entgegen. »Du darfst aber auch Elisabeth zu mir sagen.« Sie zwinkerte mir mit ihren eisblauen Augen zu.
»Avery«, stellte ich mich vor.
»Isabella White«, erwiderte die Blondine gestelzt und sagte fast schon gereizt an das dunkelhaarige Mädchen gewandt: »Möchtest du dich nicht auch vorstellen, Odina? Wenn wir schon mal hier sind.«
Die hübsche Brünette senkte den Blick, und ich spürte das Bedürfnis, etwas zu ihrer Verteidigung zu sagen, aber ich wusste nicht, was und wie.
»Lässt sich da denn nichts machen?«, wandte sich Isabella an den Surflehrer, der gut gelaunt mit den Schultern zuckte.
»Hab ich dir vorhin schon gesagt. Entweder du bleibst in diesem Kurs, oder du lässt es.«
Isabella schüttelte resigniert ihren blonden Kopf.
»Jetzt warten wir nur noch auf …« Andy, der Surflehrer, drehte sich zur Bude um und sah auf einen vergilbten Zettel, der mit Reißzwecken an die Hütte gepinnt war, » … Sue Fisher.«
Instinktiv sah ich an den bunten Boards vorbei zurück zum Parkplatz. Von dort kam ein Mädchen auf uns zu. Von Weitem wirkte es, als wäre sie viel jünger als wir. Sie war klein und trug keinen Wetsuit, sondern Jeansshorts und ein blaues Tanktop. Über ihrer Schulter baumelte eine Art Seesack, so ein rot-gelbes wasserdichtes Ding, dessen Ende man zusammenrollen und mit einem Klickverschluss befestigen konnte.
»Das wird sie sein«, erklärte Andy zufrieden und machte sich an den dicken Seilen zu schaffen, die die Boards aneinanderbanden.
»Heilige Scheiße«, hörte ich Lee flüstern, und Isabella zog scharf die Luft ein. Sie musterten besagte Sue Fisher, als wäre sie Britney Spears persönlich. Nur Odina und ich sahen uns fragend an. Dass keine von uns beiden wusste, wer diese Sue Fisher wirklich war, sollte sich als unser Eisbrecher herausstellen. Wir schenkten einander ein zaghaftes Lächeln, und mit einem Mal fühlte ich mich nicht mehr so allein.
»Das ist nicht Sue Fisher«, sagte Lee laut und wiederholte »Heilige Scheiße« noch genau drei Mal.
Andy strich sich seine leicht ergrauten Locken aus der braunen Surferstirn, räusperte sich und erklärte mit fester Stimme: »Wenn sie sagt, sie heißt Sue Fisher, dann heißt sie Sue Fisher.«
»Aber dann bin ich auch Elizabeth Warren, und du schmeißt mich nicht raus«, konterte Lee.
Er seufzte und nickte kaum merklich, bevor er etwas murmelte, das wie »Kleines Biest« klang.
»Du bist Witty aus Urban Oath«, polterte Lee und zeigte mit dem Finger auf das zierliche, dunkelblonde Mädchen, das den Seesack vor ihre Füße stellte und uns aus blaugrauen Augen anschaute. Ich hatte weder eine Ahnung, wer Witty war, noch, was Urban Oath sein sollte.
»Sue Fisher«, sagte sie kühl und reichte Andy die Hand, während sie Lees dreisten Fingerzeig ignorierte.
»Verdammte Scheiße«, fluchte Lee. »Du bist Josie Blythe und spielst Witty in Urban Oath. Du bist ein fucking Star.«
Bei ihren letzten Worten ließ sie die Hand sinken, offenbar bemerkte sie selbst, wie unverschämt sie geklungen hatten. »Krieg ich ’n Autogramm auf das Board?«, fragte sie deutlich leiser und fing an, nervös ihren Unterarm zu kratzen.
»Das Board gehört dir nicht«, brummte Andy.
»Aber sie hat recht, oder? Du bist Josie Blythe, geboren in Pasadena. Erste Hauptrolle in Killing Tyler. Deine Patentante ist Meryl Streep, und du hast den Mickey Mouse Club moderiert«, mischte sich Isabella ein. Es kam mir vor, als wollte sie gleichmütig klingen, doch ich konnte die unterdrückte Aufregung in ihrer Stimme hören.
»Vor zwei Jahren«, erwiderte Josie Blythe gelassen und süffisant lächelnd.
Und ich bekam eine Ahnung davon, warum Lee und Isabella sie so überrascht angestarrt hatten. Sie war hier so etwas wie Britney Spears.
»Hast du die US Weekly gefrühstückt, oder was?«, kicherte Lee und stupste Isabella mit der Faust leicht an. Isabella wandte sich mit zusammengepressten Lippen ab.
Odina und ich standen da, als kämen wir von einem anderen Stern.
Sie flüsterte mir zu: »Ich schaue nie fern. Du?«
»Ich komme aus Deutschland«, erwiderte ich leise. »Und ich hasse Horrorfilme, aber Killing Tyler sagt mir schon was.«
»Wenn ihr nicht Killing Andy spielen wollt, würde ich vorschlagen, wir fangen endlich an«, brummte unser Surflehrer und fing an, uns Surfbretter zuzuteilen.
Bis auf Lee hatte keine von uns fünf Mädchen Vorkenntnisse im Surfen. Aber bereits in den ersten Tagen wurde klar, dass die Art, wie wir den Sport angingen, sehr genau zeigte, wer wir waren.
Isabella war verbissen, als hätte sie einen Wettkampf zu gewinnen. Bei den Trockenübungen an Land, bei denen wir lernten, wie man sich im Stütz auf das Brett positionierte, wie man auf die Beine sprang und richtig auf der gedanklichen Linie auf dem Brett stand, wiederholte sie die Bewegungsabläufe so lange, bis nicht nur Andy, sondern auch sie selbst zufrieden war. Wenn wir alle schon erschöpft und mit schmerzenden Armen am Strand saßen und Cola tranken, paddelte Isa noch einmal nach draußen, um ihre Technik zu verbessern. Beim Mittagessen las sie in den zahllosen Surfbüchern und ‑heftchen, die Andy in seinem Schuppen liegen hatte, und ich hätte wetten können, dass sie nachts im Bett noch die richtige Beinstellung übte. Sie war ihr eigener größter Kritiker und gleichzeitig ihr stärkster Motor.
Lee dagegen war überheblich und so leichtsinnig, dass sie mehrmals Glück hatte, sich nicht ernsthaft zu verletzen. Sie rutschte häufig in ihrem Übereifer vom Brett und landete mit dem Gesicht im Sand. Am dritten Tag verstauchte sie sich das Genick, als sie einen Kopfstand auf dem Board versuchte, und schlug sich beim missglückten Versuch eines Duck Dive (das Brett war viel zu lang und schwer, um es unter der Welle hindurchzudrücken) die Knie blau. Sie bekam die Finne auf den Kopf, glaubte, Sonnencreme sei überbewertet, und verbrannte sich die Nase so stark, dass sich ihre Haut wie eine Kartoffel schälte. Und sie brachte es fertig, Andy, der im Wasser stehend Anweisungen gab, mit ihrem Board zu rammen. Aber sie war auch der Spaßvogel der Truppe, der jedes ihrer aus dem Übereifer geborenen Missgeschicke mit schlagfertigen Sprüchen kommentierte und die anderen zu Höchstleistungen anspornte. Wir konnten ihr nie böse sein.
Während Surfen bei Lee von Anfang an eine Herzensangelegenheit war, ging Odina viel zu kopflastig an die Sache heran. Sie war unglaublich vorsichtig, beobachtete die Wellen endlos lange, bevor sie sich für eine entschied, und wurde deshalb unzählige Male ordentlich gewaschen. Was ihr an Mut fehlte, machte sie jedoch mit Körperbeherrschung wett. Wenn sie einmal auf dem Brett stand, stand sie. Ihre kompakte Figur, die mir zunächst wie ein Hindernis erschienen war, erwies sich als Segen. Sie hatte die Stärke, die uns anderen fehlte. Paddelte am kräftigsten, klebte mit den Beinen förmlich am Brett und hatte die Weitsicht und Geduld, auf die richtige Welle zu warten.
Josie war in ihrem Verhalten undurchsichtig. Sie hatte sichtlich Spaß am Training und offensichtlich das Talent, sich eine neue Sportart ohne Schwierigkeiten zu eigen zu machen. Und doch war sie unzuverlässig, unpünktlich und in ihren Launen so schwankend, dass man nie wusste, welche Josie morgens erscheinen würde oder ob sie überhaupt auftauchen würde. Wir sahen sie nie aus einem Auto steigen, nie in Begleitung eines anderen Menschen, und es muss an unserem jungen Alter gelegen haben, dass wir in diesem ersten Sommer nicht auf die Idee kamen, nachzufragen. Wir hatten uns wie selbstverständlich angewöhnt, sie beim Surfen mit »Sue« anzusprechen. Ihre beiden Namen waren ein Sinnbild ihres Charakters: Mal aufgekratzt und voller launiger Geschichten über das Showbiz, und schon am darauffolgenden Tag konnte sie einsilbig und in sich gekehrt sein. Auf dem Board war sie alles – von unkonzentriert zu völlig fokussiert, von wendig und athletisch zu stocksteif und ängstlich.
Ich glaube, ich war von uns allen die Ungeduldigste. Mit dem Surfen erging es mir wie anfänglich auch beim Gitarrespielen. Ich wollte alles können. Jetzt. Sofort. Und anders als bei der Musik, die ich überall spielen konnte, saß mir hier die Zeit im Nacken. Ich lebte nicht am Meer, wie die anderen Mädchen, ich hockte in Baden-Baden fest. In einer Stadt, die Hunderte von Kilometern vom Meer entfernt lag. Und noch viel weiter von einem Strand, an dem man auch wirklich surfen konnte. Es konnte mir nicht schnell genug gehen. Ich wollte Wellen reiten, nicht sitzen. Aber Andy bestand auf den Basics, quälte uns mit den Techniken, das Board zu tragen, mit scheinbar endlosen Reden über das Lesen der Wellen, die richtigen Winkel, Gezeiten, Strömungen und Fachbegriffen, die ich meist sofort wieder vergaß.
Unversehens lernten wir einander durch das Surfen schneller und besser kennen, als es uns anders je gelungen wäre. Mittags unterbrachen wir das Training und saßen zusammen bei der Hütte an einem alten, zum Esstisch umfunktionierten Longboard, reckten die Gesichter in die Sonne und lobten Andy für seine Kochkünste. Zumindest, bis sich das Menü zum zweiten Mal wiederholte und wir feststellten, dass Mac & Cheese, Chicken Sandwiches und die Reispfanne das Einzige waren, was er kochen konnte. Isas seltsame Feindseligkeit Odina gegenüber sowie Odinas zurückhaltendes Verhalten Isa gegenüber legten sich etwas, schwanden aber nicht ganz. Josie und Isabella rückten näher zusammen. Odina, die als Kind mit ihren Eltern aus Italien nach Harbour Bridge gekommen war, und ich stellten fest, wie viele Gemeinsamkeiten es gab, wenn man aus Europa stammte, und Lee … war eben Lee. Manchmal das fünfte Rad, für das ich mich ursprünglich gehalten hatte, manchmal das Bindeglied, das die bunt gemischte Truppe zusammenhielt.